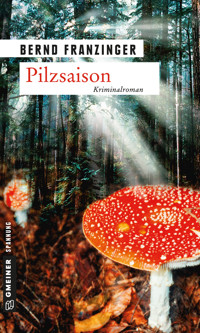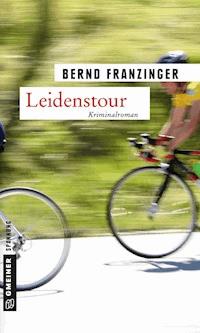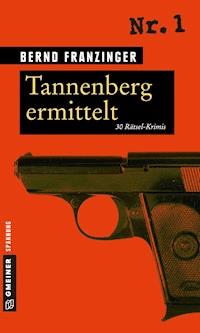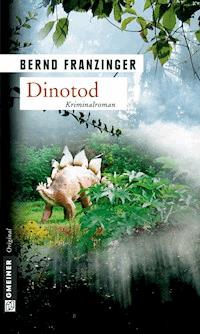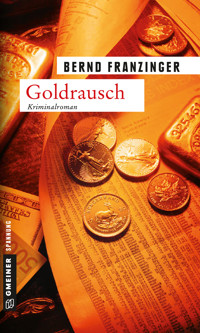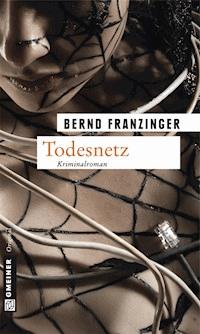Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Wolfram Tannenberg
- Sprache: Deutsch
Von einem Eisenbahntunnel herunter wird ein betäubter Mann auf die Gleise geworfen und kurz danach von einem Intercity überrollt. Exakt 48 Stunden später wiederholt sich dieses makabere Szenario. Aber das ist nicht das Einzige, was die Toten miteinander verbindet: Beide waren nackt, ihre Hinterteile zierte die gleiche auffällige Tätowierung. Da die Mordopfer ansonsten keinerlei Identifikationsmerkmale aufweisen, gestaltet sich die Ermittlungsarbeit für den Kaiserslauterer Hauptkommissar Wolfram Tannenberg äußerst schwierig …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Franzinger
Ohnmacht
Tannenbergs dritter Fall
Zum Buch
ALbTRAUM ORGANHANDEL Von einem Eisenbahntunnel bei Kaiserslautern wird ein betäubter Mann auf die Gleise geworfen und kurz darauf von einem Intercity überrollt. Schrill aufkreischende Bremsen, danach beklemmende Stille. Exakt 48 Stunden später wiederholt sich dieses makabere Szenario. Aber das ist nicht das Einzige, was die Toten miteinander verbindet: Beide waren nackt, ihre Hinterteile zierte die gleiche auffällige Tätowierung. Da die Mordopfer ansonsten keinerlei Identifikationsmerkmale aufweisen, gestaltet sich die Ermittlungsarbeit zunächst äußerst schwierig für Hauptkommissar Wolfram Tannenberg und sein Team. Erst als der berühmte Kommissar Zufall unverhofft in den Diensträumen des K1 auftaucht, kommt ein wenig Licht in das Dunkel. In Tannenbergs privatem Umfeld ereignen sich derweil erfreuliche Dinge: Nichte Marieke hat ihren Traummann gefunden. Umso größer ist der Schock, als sie erfährt, dass ihr Freund nach einem Motorradunfall in eine Privatklinik eingeliefert werden musste …
Bernd Franzinger lebt bei Kaiserslautern. Mit seinen überaus erfolgreichen Tannenberg-Krimis gehört er zu den bekanntesten Autoren der deutschen Krimiszene.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2004 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: © U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
ISBN 978-3-8392-3152-4
Widmung
Ich kann mir keinen Zustand denken,
der mir unerträglicher wäre,
als bei lebendiger und schmerzerfüllter Seele
der Fähigkeit beraubt zu sein,
ihr Ausdruck zu verleihen.
Michel de Montaigne (1533 – 1592)
1
Freitag, 18. April
Der ICE ›Rheingold‹ verließ fahrplanmäßig um 1 Uhr 53 den Kaiserslauterer Hauptbahnhof.
Mit hohem Tempo raste er durch die tiefschwarze Frühlingsnacht.
Lautes Pfeifen zerschnitt die friedliche Stille, gefolgt vom wütenden Protest aufgeschreckter Waldvögel.
Leuchtstarke Scheinwerfer brannten kegelförmige Löcher in die mondlose Finsternis.
Nach einer lang gezogenen Linkskurve tauchte der Heiligenberg auf.
Kurz vor dem mit verwittertem Bruchsandstein umrahmten Tunneleingang geschah das Unfassbare.
Reflexartig betätigte der Zugführer das Schnellbremsventil.
Schrill aufkreischende Bremsen, die in der engen Röhre ohrenbetäubenden Lärm erzeugten.
Hysterische Menschenschreie.
Die beiden Zugbegleiter eilten in den Führerstand, fragten nach dem Grund der Notbremsung.
Aber sie erhielten keine Antwort.
Er stand unter Schock.
Regungslos starrte er auf die hell erleuchtete Gleisanlage.
Sein Gesicht war aschfahl.
Dicke Tränen quollen aus seinen geröteten Augen.
Als Hauptkommissar Tannenberg etwa eine halbe Stunde später das triste Bahnhofsgebäude in Hochspeyer betrat, stürmte sofort ein hünenhafter jüngerer Mann auf ihn zu, baute sich drohend vor ihm auf und begann, gestenreich auf ihn einzureden.
»Haben Sie das angeordnet?«
»Was?«
»Die Vollsperrung! Sie können doch hier keine Vollsperrung veranlassen! Das ist doch ein enormer wirtschaftlicher Schaden, den Sie uns verursachen. Sie sind wohl wahnsinnig geworden!«
Vielleicht hing es an dem ausgeprägten Dämmerzustand, mit der sich sein rebellischer Biorhythmus gegen den brutalen Eingriff in den tradierten tannenbergschen Schlafzyklus zur Wehr setzte. Vielleicht waren es aber auch die Spätfolgen des bis kurz vor Mitternacht gemeinsam mit Bruder Heiner und Dr. Schönthaler zelebrierten feuchtfröhlichen Skatabends. Jedenfalls reagierte der Kriminalbeamte entgegen sonstiger Gewohnheit völlig ruhig und gelassen auf die aggressiven Anfeindungen des Bundesbahn-Mitarbeiters – zumindest äußerlich.
»Herr Kollege, kommen Sie mal her«, rief er in Richtung eines Streifenbeamten, der gerade mit der Befragung mehrerer Zugpassagiere beschäftigt war. Aber darauf nahm Tannenberg keinerlei Rücksicht. »Sorgen Sie mal dafür, dass dieser überaus sympathische Zeitgenosse hier nicht weiter die kriminalpolizeilichen Ermittlungen stört.«
»Und wie soll ich das machen?«, gab der Uniformierte übellaunig zurück.
»Na, dann lassen Sie sich doch einfach mal etwas einfallen«, antwortete der Leiter der Kaiserslauterer Mordkommission gähnend, wandte sich zu seinem Mitarbeiter Adalbert, genannt ›Albert‹, Fouquet um und forderte diesen dazu auf, ihm nach draußen ins Freie zu folgen.
Die kalte Nachtluft, die ihn vor der Bahnhofstür erwartete, wirkte belebend. Mit einem tiefen Zug sog er die frische Kühle ein, blähte dabei seinen Brustkorb auf und reckte die eingerosteten Glieder seines verschlafenen Körpers. Dann entließ er mit einem kräftigen Stoß die eingesperrte Atemluft wieder in die Freiheit.
»So, Albert, und jetzt sagst du mir zuerst einmal, warum du mich überhaupt um diese unchristliche Zeit aus dem Bett geholt hast. Ich kann nur hoffen, dass du dafür gute Gründe vorzubringen hast. Schließlich gibt’s für solche Fälle den Bereitschaftsdienst. Und der ist ja meines Wissens heute Nacht von deiner Wenigkeit zu gewährleisten. Oder lieg ich da etwa grundlegend falsch?«
»Nein … Aber …«
»Aber was?«, fiel Tannenberg seinem jungen Mitarbeiter ziemlich unsanft ins Wort. »Die Sache ist doch wohl sonnenklar. Das haben sogar die Kollegen von der Streife erkannt, die mich zu Hause abgeholt haben. Da hat wohl irgend so ein armer Irrer nichts Besseres zu tun gehabt, als sich mitten in der Nacht vor einen Zug zu werfen. Das ist doch nichts Besonderes, nur ein ganz normaler Selbstmord! Das kannst du doch wohl alleine machen, oder? Mensch, Albert!«
»Aber, aber Wolf, der Zugführer hat doch was von zwei Männern erzählt.«
»Zwei Männer? Was hat er gefaselt? Den kannst du doch nicht für voll nehmen, der steht doch unter Schock!«
»Ich hab halt gedacht, dass du ihn vielleicht mal befragen könntest. Weil ich außer diesen beiden Wörtern nichts aus ihm rausgekriegt hab. Vielleicht ist ja auch was Wahres dran an der Geschichte.«
»Also, gut. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich dir ja auch gleich mal zeigen, wie man aus einem Menschen, der unter Schock steht, trotzdem Informationen rausholen kann«, verkündete der Leiter des K1 inoberlehrerhaftem Ton und begab sich anschließend mit Kommissar Fouquet zu dem Lokführer, der sich in Begleitung eines Sanitäters in einem Nebenraum des Bahnhofsgebäudes aufhielt.
»Mein Name ist Tannenberg, ich bin Kriminalbeamter und möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zum Ablauf des Unglücks stellen. – Haben Sie verstanden, was ich eben gerade gesagt habe?«
Keine Reaktion.
Aber der berufserfahrene Ermittler ließ sich von dieser demonstrativ zur Schau getragenen Ignoranz nicht im Geringsten beeindrucken. »Sie wollten gerade mit Ihrem Zug in den Heiligenbergtunnel einfahren. Und da ist etwas passiert. Ist das richtig?«
Der kräftige, bärtige Mann schwieg und blickte weiter starr geradeaus in Richtung eines etwa drei Meter von ihm entfernt stehenden Schreibtischs. Sein glasiger Blick schien allerdings nichts Konkretes zu fixieren. In Zeitlupentempo schoben sich die Lider über die mit roten Äderchen durchsetzten Augäpfel, trafen sich für einen kurzen Moment in der Mitte, um sich gleich danach wieder langsam voneinander zu entfernen.
»Haben Sie ihm etwa ein Beruhigungsmittel gegeben?«, herrschte Wolfram Tannenberg plötzlich den jungen Sanitäter an, der zusammengesunken auf einem Stuhl neben dem einzigen Fenster des äußerst spartanisch eingerichteten Büroraums saß.
»Nein, ich nicht … Und der … Doktor auch nicht«, gab dieser stockend zurück.
Tannenberg kniete sich direkt vor den Zugführer, legte seine Hände auf dessen Knie und betrachtete ihn mit einem fordernden, stechenden Blick.
»Sie wollten also gerade in den Tunnel einfahren. Konzentrieren Sie sich! Was ist genau in diesem Moment passiert?«
Der Mann machte den Eindruck, als ob er etwas sagen wollte, denn seine Lippen öffneten sich, gefroren dann aber gleich wieder zu völliger Regungslosigkeit.
»Was ist passiert? Warum haben Sie die Notbremse gezogen?«
Die Augenbrauen zuckten ein wenig, sonst blieb der Zugführer des Intercitys ungerührt.
»Sind Sie eigentlich verrückt geworden? Sie haben mit ihrem blödsinnigen Verhalten das Leben Ihrer Fahrgäste gefährdet!«, schrie Tannenberg plötzlich los, erhob sich mit schnellen Bewegungen aus seiner knienden Sitzposition, packte den Zugführer an dessen Schultern und rüttelte ihn ein paar Mal richtig durch.
Noch bevor Kommissar Fouquet und der Sanitäter die völlig überraschende Veränderung der Situation erfasst hatten, war in die mumienhafte Mimik des Beschimpften das Leben zurückgekehrt.
»Aber ich musste doch bremsen«, sagte er mit tränenerstickter Stimme.
»Wieso mussten Sie bremsen?«, setzte Tannenberg sofort nach.
»Weil …« Er schlug die Hände vor die Stirn. »So etwas Schreckliches hab ich noch nie erlebt!«
»Das ist wirklich etwas Furchtbares! Aber Sie müssen einfach daran denken, dass Sie absolut keine Schuld trifft. Es ist nun leider mal so: Wenn ein verrückter Selbstmörder sich umbringen will, kann man gar nichts dagegen machen. Wie schnell sind Sie denn eigentlich gewesen?«
»Hundertsechzig …«
»Hundertsechzig! Wie sollten Sie denn da noch rechtzeitig bremsen? Das ist ja völlig unmöglich!«
»Ja: völlig unmöglich … Aber es war kein Selbstmord.« Er schüttelte zur Unterstützung seiner Behauptung mit Vehemenz den Kopf.
»Warum nicht?«, setzte Tannenberg direkt nach.
»Weil diese beiden Männer …«, der Zugführer schluckte, presste die Lippen fest aufeinander, »die Person auf mein Gleis geworfen haben … Die hätten ja auch das andere nehmen können. Dann wär wenigstens ich nicht drübergefahren!«
»Sind Sie wirklich sicher, dass es zwei Männer waren?«, mischte sich nun auch Adalbert Fouquet ein. »Vielleicht haben Sie sich ja getäuscht und es waren nur Schatten von Bäumen oder Sträuchern.«
»Im ersten Augenblick hab ich ja gedacht, dass es Wildschweine oder Rehe sind. Die seh ich nachts nämlich oft. Aber als die beiden Männer aufgestanden sind und den Körper an den Beinen hochgehoben haben …« Er brach ab, rang deutlich erkennbar um Fassung.
»Konnten Sie die Gesichter der Männer sehen?«, platzte es unkoordiniert aus dem altgedienten Kriminalbeamten heraus.
»Weiß nicht … Hab keine Gesichter gesehen … Hatten Masken oder Mützen auf … Ging ja auch alles so schnell!«, stotterte der Mann, der zu zittern und hörbar mit den Zähnen zu klappern begann.
Dieses markante Geräusch war anscheinend das Startsignal für einen intensiven Betreuungseinsatz des Rot-Kreuz-Sanitäters, der die ganze Zeit über recht teilnahmslos in der Ecke gesessen hatte. Nun aber wurde er von einem regelrechten Energieschub erfasst, der ihn sogleich dazu veranlasste, sich von seinem Stuhl zu erheben, zu dem völlig verstörten Zugführer zu gehen, ihm eine grau-rot-karierte Decke umzulegen und ihm als Sahnehäubchen seines beeindruckenden sozialen Engagements aus einer Thermoskanne einen heißen Tee zu servieren.
Tannenberg ließ sich von diesem plötzlichen Samariter-Aktionismus allerdings nicht aus dem Konzept bringen.
»Klar ging das alles sehr schnell über die Bühne«, bemerkte er verständnisvoll. »Also noch mal: Diese beiden Gestalten haben den Menschen an den Beinen hochgehoben. Und dann?«
Keine Antwort.
»Und dann!«, wiederholte Tannenberg.
»Dann haben sie ihn direkt … vor meinen Augen … losgelassen …«
»Haben Sie das Gesicht der Person erkennen können?«, fragte Fouquet leise.
»Nein … Ich hab nur den … Hinterkopf gesehen.«
»War es eine Frau oder ein Mann?«
»Weiß nicht …« Unschlüssig wiegte der Zugführer seinen Kopf. »Vielleicht eher ein Mann … Aber das ging ja alles so verdammt schnell … Mann oder Frau? … Eigentlich müsste ich das ja wissen … Dieser Mensch war ja schließlich nackt.«
»Was? Nackt war der?«, fragte Kommissar Fouquet verblüfft.
»Ja, ganz nackt … Aber …, aber ich hab ihn ja nur von hinten gesehen. Und das auch nur ganz kurz.«
»Und wie war der Körper?«, warf Tannenberg ein und ergänzte, nachdem er das Stirnrunzeln des Zugführers registriert hatte: »Ich meine: Hatte der Körper Spannung? So wie jemand, der mit einem Kopfsprung in ein Schwimmbecken springt?«
»Nein, der war ganz schlaff … Erst hab ich ja für einen kurzen Augenblick gedacht, dass das nur so ’ne aufgeblasene Plastikpuppe oder so was ist.« Plötzlich riss der Mann seinen Kopf zu Tannenberg um. »War es vielleicht nur ’ne Puppe?«
»Leider nicht«, brach Kommissar Fouquet den Strohhalm ab, an dem sich der Zugführer gerade hochgehangelt hatte. »Aber wenn es stimmt, was Sie sagen, dann war dieser Mensch garantiert schon tot, als man ihn auf die Gleise hat fallen lassen.«
»Glauben Sie wirklich?«
Wieder traf ein flehender Blick den Leiter des K1.
»Ja. Sie haben mit ihrem Zug bestimmt nur einen Toten überfahren«, düngte Tannenberg das zart aufkeimende Hoffnungspflänzchen. Dann wandte er sich an seinen Kollegen: »Albert, ich denke, es wird Zeit, dass wir uns jetzt an den Ort des Geschehens begeben.«
»Kannst du das nicht alleine machen? Ich fühl mich nämlich nicht so gut!«, jammerte der junge Kriminalbeamte, während er den Zündschlüssel aus seiner Hosentasche kramte.
»Nein, tut mir Leid. Das gehört eben auch zu unserem Job. Da musst du jetzt wohl durch. Aber ich verrate dir nachher einen Trick, mit dem du solche unangenehmen Ereignisse wenigstens einigermaßen erträglich gestalten kannst.«
Kurz vor dem kleinen Waldparkplatz in unmittelbarer Nähe des Heiligenbergtunnels nötigte Tannenberg Kommissar Fouquet zu einem Zwischenstopp.
Sein angekündigter ›Trick‹ bestand in einer äußerst fragwürdigen dienstlichen Anordnung, mit der er seinen jungen Mitarbeiter konfrontierte, nachdem dieser den silbernen Mercedes zum Stillstand gebracht hatte.
»Dieses Zaubermittel hier hilft immer, wenn man in eine Schlacht zieht! Das haben schon die alten Germanen gewusst«, sagte Tannenberg und setzte einen chromfarbenen Flachmann, den er aus der Innentasche seines olivgrünen Parkas hervorgezaubert hatte, an die geöffneten Lippen. Anschließend wischte er dessen Trinköffnung mit dem Jackenärmel ab und überreichte ihn seinem angewidert dreinblickenden Kollegen.
»Oh nein, Wolf, das kann ich jetzt wirklich nicht! Nicht um diese Zeit! Und dann auch noch auf nüchternen Magen!«
»Los, Mann, mach schon! Stell dich nicht so an. Das Ding machst du jetzt leer! Und zwar ganz! Du wirst mir nachher dankbar sein!«
Widerwillig befolgte der junge Kriminalbeamte die Anweisung seines Vorgesetzten. Aber sein gesamter Körper schien sich mit Vehemenz gegen diese alkoholische Zwangsbeglückung zur Wehr zu setzen: Die Mundschleimhäute zogen sich zusammen, der Magen krampfte, kalte Schauerwellen liefen über seinen Körper.
»Ist das Zeug scharf! Das brennt ja wie Feuer!«, beschwerte sich Fouquet, wilde Grimassen schneidend.
»Dilettant! Du hast doch überhaupt keine Ahnung! Das ist ein wunderbar weicher Mirabellenbrand. Gut und gerne zehn Jahre alt. Die Früchte hab ich eigenhändig gepflückt und auf dem Frönerhof selbst gebrannt.«
»Entschuldige, ich hab ja nicht gewusst, dass ich solch eine Delikatesse gerade achtlos hinuntergekippt habe.«
»Fahr jetzt besser weiter. Sonst vergesse ich mich noch, du kulturloser Banause!«
Als Tannenberg vor dem von grellem Halogenscheinwerferlicht hell erleuchteten Tunneleingang stand, war er sehr verwundert darüber, dass er zwar einige Mitarbeiter der Spurensicherung auf der Gleisanlage sah, aber keinen Intercity.
»Hallo Eisbären, wo ist denn der Zug?«, fragte er die, wie immer in putzige weiße Kunststoffoveralls gehüllten Kriminaltechniker.
»Der steht hinten im Tunnel nach der Kurve«, rief einer der Männer zurück. »So ein Intercity hat schließlich einen Bremsweg von mehreren hundert Metern.«
»Danke Kollege, für die Auskunft! Wo ist denn euer Chef?«
»Wolf, ich bin hier unten!«, antwortete plötzlich eine dunkle Stimme von der anderen Seite des Bahndamms her. »Warte, ich komme hoch und zeig dir mal, was wir bisher gefunden haben.«
»Ach, Karl, so genau will ich das alles gar nicht wissen«, wehrte Tannenberg ab.
Der Leiter der kriminaltechnischen Abteilung kletterte schnaubend die Böschung hinauf. Mit seiner rechten Hand hielt er einen länglichen Gegenstand in die Höhe. »Weißt du, was das hier ist?«
»Wie soll ich denn das auf die Entfernung hin sehen? Ich bin doch kein Adler! Eigentlich will ich mir dieses Zeug auch gar nicht näher anschauen!«
»Es ist aber höchst interessant, was ich hier habe!«
»Dann sag mir’s halt einfach. Aber bleib ja dort, wo du gerade bist!«, erwiderteTannenberg und ging zur Sicherheit ein Paar Schritte zurück.
Karl Mertel deutete mit dem Zeigefinger seiner linken Hand auf das wurstähnliche Ding, das er in einem kleinen durchsichtigen Plastiktütchen verstaut hatte. »Das hier ist der eindeutige Beweis dafür, dass es sich bei dem zerfetzten Toten definitiv um einen Vertreter des männlichen Geschlechts gehandelt hat!«
Die aus Richtung Fouquets an Tannenbergs Ohr dringenden Würgegeräusche waren so laut, dass er seine Antwort einen Augenblick hinauszögern musste.
»Bleib mir bloß vom Leib mit diesem ekligen Kram!« Er schaute sich suchend um. »Wo ist denn eigentlich mein alter Freund, der liebe Herr Kollege Rechtsmediziner?«
»Der liegt bestimmt seelenruhig zu Hause in seinem warmen Bettchen. Das ist auch besser so. Der würde uns sowieso bloß wieder tollpatschig zwischen den Füßen rumlaufen. – Dass der arme Kerl hier, zu dem diese vielen Einzelteile gehören, mausetot ist, sieht ja wohl auch ein Blinder mit einem Krückstock. Und wie er zu Tode gekommen ist, ja wohl auch.«
»Hast eigentlich Recht, Karl. Dieser alte Chaot würde uns hier sowieso nur alles durcheinanderbringen.«
»Seh ich auch so, Wolf. Wir sammeln ihm die Brocken auf, kratzen die Fetzen vom Zug und von den Tunnelwänden, fotografieren sie, versehen sie jeweils mit einem nummerierten Schildchen, legen sie in die große Alukiste und schieben sie ihm nachher in der Pathologie in eines seiner geliebten Kühlfächer. Dann kann er später in aller Ruhe sein Leichenpuzzle zusammensetzen. – Fouquet, hörst du was?«
»Was soll ich hören?«, antwortete der Angesprochene gedehnt mit gepresster Stimme.
»Na, diese lauten, spitzen Schreie der Raubvögel, die vom Aasgeruch angelockt worden sind?«
Der junge Kriminalbeamte antwortete nicht, sondern entledigte sich geräuschvoll der letzten Reste seines Mageninhalts.
Am späten Nachmittag desselben, ungewöhnlich kalten Apriltages saß Wolfram Tannenberg alleine in seinem Dienstzimmer und wartete ungeduldig auf den angekündigten Besuch Dr. Schönthalers. Dieses Entgegenkommen war dem Gerichtsmediziner allerdings nur schwer abzuringen gewesen, bestand er doch fast das gesamte Telefongespräch über hartnäckig darauf, dass ihn der Leiter der Kaiserslauterer Mordkommission wie üblich in der Pathologie des Universitätsklinikums aufsuchen sollte. Aber angesichts des ihn dort erwartenden makaberen Szenarios hatte Tannenberg schon lange vor dem Telefonat entschieden, sich diesmal unter keinen Umständen an den sterilen, weißgekachelten Arbeitsplatz des Rechtsmediziners zu begeben.
Tannenberg langweilte sich.
Und er verspürte nicht die geringste Lust, sich mit einem mysteriösen Mordfall zu beschäftigen.
Na ja, vielleicht handelt es sich ja wirklich nur um einen Selbstmord, versuchte er sich selbst Hoffnung zu machen. Aber dann müsste es doch eine Vermisstenanzeige geben! Bis jetzt ist aber noch keine eingegangen. Und dann war der Mann ja auch noch nackt! Wer begeht denn nackt einen Selbstmord? Das hab ich noch nie gehört! Blödsinn!
Er schüttelte den Kopf, warf die linke Hand an seine Lippen, öffnete den Mund und begann nervös an seinem Zeigefinger herumzuknabbern. Eine lästige Angewohnheit, die ihn seit seiner frühesten Kindheit durch das Leben begleitete und die ihm an dieser Stelle seiner Hand im Laufe der Jahre eine hartnäckige Hornhautschicht beschert hatte. Und gerade deshalb musste man diese dicke, raue Haut ja auch mit den Schneidezähnen des Unterkiefers häufig abschaben – fand Tannenberg jedenfalls.
Lange Zeit hatte er diese merkwürdige Zwangshandlung überhaupt nicht bemerkt, denn niemand hatte ihn darauf hingewiesen. Bis er Lea kennen gelernt hatte, mit deren Hilfe er sich diese ungewöhnliche Marotte schließlich irgendwann einmal abgewöhnte, zumindest in der Öffentlichkeit.
Sein gedankenverlorener Blick schwebte ruhelos durch den Raum. Er seufzte tief auf. Er griff in seine Hosentasche, zog einen Schlüsselbund hervor, öffnete mit einem kleinen silbernen Schlüsselchen eine Schublade seines Schreibtischs und entnahm ihr einen Stapel Fotos, in die sich seine Augen sofort vergruben.
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen.
»Hallo, alter Knochen!«, rief Dr. Schönthaler frohgelaunt in Richtung seines sichtlich verdutzten alten Freundes. »Wieso kriegst du denn so eine rote Birne?« Er wechselte in eine höhere Tonlage. »Hab ich dich etwa in flagranti ertappt? Sind das vielleicht Pornobilder, die Sie sich da anschauen, Herr Kriminalhauptkommissar?«
»Was? … Pornobilder? …« Mehr war der geschockte Leiter des K1 nicht zu sagen in der Lage.
Schon stand der Pathologe vor seinem Schreibtisch.
»Zeig mal her!«, forderte er, während er gleichzeitig eine Hand ausstreckte.
Tannenberg reagierte nicht.
Dr. Schönthaler ging um den Schreibtisch herum und stellte sich rechts neben den Ermittler. »Ach so: Die Fotos von der Beerdigung«, sagte er verständnisvoll mit sich absenkender, leiserer Stimme. »Die Bilder mit der Frau, die Lea so verdammt ähnlich sieht. Wolf, wie hieß die noch mal?«
»Die hieß nicht nur so, die Frau heißt immer noch so: Ellen Herdecke.«
»Genau! Das war die Mitarbeiterin dieser Softwarefirma bei deinem letzten Fall. Stimmt’s?«
»Ja, stimmt«, knurrte Tannenberg.
»Sag mal, alter Junge, müssten die Bilder eigentlich nicht in der Asservatenkammer oder im Archiv liegen?«
»Reg dich ab! Ich hab sie mir ja nur mal kurz ausgeborgt.«
»Aha, ausgeborgt nennt man das. Und warum, wenn ich fragen darf? – Weil du verknallt in die Frau bist, alter Knabe! Und das in deinem fortgeschrittenen Alter. Die geht dir einfach nicht mehr aus dem Kopf, gell?«
»Quatsch!«
»Kein Quatsch, lieber Wolfram! Das ist doch super!« Der Gerichtsmediziner gab Tannenberg von hinten einen kräftigen Klaps auf die Schulter. »Mensch Wolf, das wäre ja glatt ein Indiz dafür, dass du wieder lebst – emotional meine ich. Es würde ja wirklich auch mal Zeit dafür, alter Junge. Schließlich ist Lea nun schon seit acht Jahren tot! Und sie hätte garantiert nicht gewollt, dass du im selbst auferlegten Zölibat lebst! Hast du mal mit dieser Ellen Kontakt aufgenommen?«
»Nein. Die ist doch verheiratet und hat zwei Kinder.« Tannenberg seufzte, machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ist ja auch egal.«
»Ich sag dir eins: Wenn du nicht den Hintern hochkriegst, geh ich für dich auf Partnersuche! Dann werd ich nämlich mal ’ne Anzeige in der ›Menschlichen Brücke‹ aufgeben.«
»Du spinnst ja! Lass mich doch ein für alle Mal in Ruhe mit diesem bescheuerten Thema! Wir haben uns schließlich mit wichtigeren Sachen zu beschäftigen, zum Beispiel mit einem total beknackten Mordfall. Denn das war ja wohl kein Selbstmord, oder?«
Dr. Schönthaler antwortete nicht, sondern zuckte nur leicht mit den Schultern.
»Los, sag schon, was hast du alter Leichenschinder denn Interessantes für mich rausgefunden?«
»Gemach, gemach, Herr Kommissar! Zuerst machen wir mal einen Test!«
»Wieso? Was für einen Test machen wir?«
»Frag nicht lang herum, leg einfach mal dein rechtes Bein hier auf die Schreibtischplatte!«
Tannenberg lachte. »Warum sollte ich denn so was Verrücktes machen?«
»Frag nicht. Mach’s einfach!«
»Na gut, von mir aus.« Grinsend und gleichzeitig kopfschüttelnd kam er der merkwürdigen Aufforderung nach. »So, und jetzt?«
»Jetzt ziehst du den Socken nach unten und das Hosenbein nach oben, und zwar so weit wie’s geht!«
Tannenberg tat, wie ihm geheißen.
»So, und jetzt hebst du vorsichtig das Bein an und stellst es wieder auf die Erde!«
Nachdem der Kriminalbeamte widerspruchslos die Anweisung befolgt hatte, schob Dr. Rainer Schönthaler seinen alten Freund ein wenig zur Seite, fuhr mit einer vorsichtigen Bewegung mit dem Handballen über die Stelle, auf der das Bein abgelegt gewesen war und hielt anschließend Tannenberg die geöffnete Hand unter die Nase. »Was ist das, was du hier siehst?«
»Nichts seh ich! Komm, jetzt hör auf zu nerven! Setz dich hin und sag mir endlich, was du bei deinem Leichenpuzzle so alles gefunden hast!«
»Typisch für fortgeschrittene Alterungsprozesse: selektive Wahrnehmung!«
»Was? Du sprichst einfach in Rätseln!«
»Rätsel? Nein, es ist eigentlich ganz banal, Wolf: Du siehst nur, was du sehen willst! Du willst nämlich nicht sehen, was ich hier habe!«
»Mann, Rainer, ich seh einfach nichts!«
Triumphierend drückte der Rechtsmediziner Tannenberg die Hand noch ein wenig näher vor dessen Nase. »Dann schau dir eben mal die Sachen genauer an! Diese netten kleinen Dinger hier sind nämlich Hautschuppen, richtig schöne weiße Hautschuppen. Und die sind von deinem Bein gerieselt.«
»Von meinem Bein gerieselt? Du spinnst doch!«
»Nein überhaupt nicht! Du willst dich nur nicht der Realität stellen!«
»Welcher Realität denn?«
»Der schmerzlichen Realität des kontinuierlichen Verfalls deines Körpers!«
»Rainer, du nervst wirklich! Was soll der Quatsch?«
»Das ist kein Quatsch! In deinem Alter fängt das nämlich an: Das Problem mit der trockenen Haut. Ich wollte einfach nur mal überprüfen, ob die biologische Uhr, die deinen körperlichen Verfall steuert, auch richtig tickt. Aber ich sehe schon: alles bestens. Ich hab da übrigens einen heißen Tipp für dich: Cremebäder – am besten täglich!«
»Cremebäder? Jetzt hör doch mal auf mit diesem Schwachsinn! Sag mir jetzt endlich, was du für mich hast!«
Der Rechtsmediziner besetzte den Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtischs, öffnete in Zeitlupentempo seine braune Ledertasche und entnahm ihr einen Ordner mit den von Mertel am Heiligenbergtunnel aufgenommenen Fotos, die er gleich anschließend zu Tannenberg hinüberschob. »Gut, dann schau dir mal die Bilder hier an!«
»Nee, nee, lass mal. Darauf verzichte ich gern! Du sagst mir jetzt einfach, was Sache ist. Das reicht mir voll und ganz.«
»Also gut, altes Weichei: Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, etwa 30 Jahre alt.« Dr. Schönthaler deutete mit dem Zeigefinger seiner linken Hand auf eine der farbigen Abbildungen. »Wie du diesem Foto entnehmen könntest, wenn du nicht so eine verdammte Memme wärst. – Übrigens war der Mann beschnitten.«
»Beschnitten?« Tannenberg krauste die Stirn. Dann schob er, ohne auch nur einen Blick auf die vor ihm liegende Spurenakte zu werfen, die Hand des Rechtsmediziners zur Seite und klappte den Ordner zu. »Und was schließt du daraus?«
»Na ja, zum Beispiel weiß ich, dass so etwas in unserem Kulturkreis nur recht selten praktiziert wird. Bei Juden und Moslems dagegen sehr häufig.«
»Ist ja nicht uninteressant. Mach mal weiter!«
»Also: Der Mann war mittelgroß, ca. 175 cm. Er war ein dunkler Typ: schwarze Haare, starker Bartwuchs usw. Und er scheint einen regelrechten Pflegetick gehabt zu haben …«
»Inwiefern?«, unterbrach Tannenberg verständnislos.
»Weil er ein vorbildlich gepflegtes Gebiss hatte: keine einzige Füllung in den Zähnen! Das gibt’s in seinem Alter wirklich nicht so oft.«
Tannenbergs Interesse steigerte sich. »Dann hast du also seinen Kopf und sein Gesicht.«
»Nein, leider nicht. Das war alles nur noch Matschpampe. Und das mit den Zähnen war eine richtige Tüftelarbeit. Zuerst hab ich sie …«
»Schade, das wär schließlich eine Möglichkeit gewesen, mit der wir ihn vielleicht hätten identifizieren könnten«, würgte der Kriminalbeamte den Beitrag seines Freundes brutal ab. Schließlich wusste er nur allzu gut, wie sehr der Gerichtsmediziner zu weit ausschweifenden Fachvorträgen neigte.
Dr. Schönthaler akzeptierte kommentarlos Tannenbergs Intervention. »Ja, habt ihr immer noch nicht seine Identität geklärt?«
»Nein, wie denn auch? Er war ja splitterfasernackt. Nirgendwo Papiere oder wenigstens seine Kleider oder Schuhe. Nix. Nicht der geringste Anhaltspunkt. Eine Vermisstenmeldung gibt’s bis jetzt auch keine. Und der Abgleich seiner Fingerabdrücke mit unseren Datenbanken, die der Mertel durchgeführt hat, brachte auch kein Ergebnis. – Sonst hast du nichts für mich? Keine anderen Besonderheiten?«
»Doch.« Der Rechtsmediziner nahm die Mappe mit den Fotos in die Hände und öffnete sie. Nachdem er gefunden hatte, was er suchte, schob er den aufgeschlagenen Ordner wieder zurück zu Tannenberg. »Nun schau halt mal hin. Es ist kein schlimmer Anblick. Das Stück Fleisch, das du sehen wirst, ist nur sein rechtes Hinterteil. Sieht nicht viel anders aus als ein roher Schweineschinken.«
Äußerst unwillig befahl der Kriminalbeamte seinen Augen einen vorsichtigen Spähangriff auf das ihnen dargebotene Bildmaterial. Dr. Schönthaler hatte Recht gehabt: Es waren zwei Fotos, auf denen jeweils aus einer anderen Perspektive in Großaufnahme eine auffällige Tätowierung abgelichtet war. Kein Blut oder sonstige unappetitlichen Dinge.
»Und was ist das, Rainer? Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte?«
»Sieht irgendwie nach einem Wappen aus – find ich jedenfalls.«
»Vielleicht. Hast du sonst noch was?«
»Ja, kann man wohl sagen.«
»Und was?«
Wie bei einem spontanen Stoßgebet schlug der Gerichtsmediziner seine Hände mit einem leisen Knallgeräusch vor den Kopf, berührte kurz mit einigen Fingerknöcheln die Lippen, trennte anschließend die beiden Hände wieder voneinander und ließ sie langsam auf die Schreibtischplatte niedersinken. »Also: Der Tote war gar nicht tot, als er von dem Zug überrollt wurde.«
»Wieso denn das?«
»Na, weil der Stickstoffanteil …«
»Komm, verschon mich mit unnötigen Details!«
»Unnötig? … Na ja, jedenfalls wurde der Mann mit einem Medikament betäubt, das man sonst eigentlich nur in der Tiermedizin verwendet. Und zwar als Narkotikum vor der Letaldosis.«
»Bitte allgemeinverständlich, lieber Herr Doktor!«
»Also, gut: Nehmen wir einmal an, du wolltest diesen kleinen fetten Dackel, der dich zu Hause immer tyrannisiert, von einem Tierarzt einschläfern lassen …«
»Welch eine traumhafte Vorstellung«, schoss es aus Tannenberg spontan heraus.
»Dann bekäme dieses Vieh zuerst ein Narkosemittel.«
»Okay kapiert. Und so was hat der Tote vom Heiligenberg intus gehabt.«
»Ja. Und zwar eine ziemlich hohe Dosis.«
»Das erklärt auch, weshalb der Zugführer angegeben hat, dass der Körper so merkwürdig schlaff gewesen sei, so völlig ohne Spannung.«
»Genau! Denn wenn er bei Bewusstsein gewesen wäre, hätte er in einem willentlich nicht beeinflussbaren Reflex die Arme gestreckt und die Finger auseinandergespreizt. Richtig, Wolf.«
»Ein Lob aus deinem Munde. Es geschehen tatsächlich noch Wunder!«
Dr. Schönthaler ignorierte den ironischen Einwurf seines alten Freundes, zu sehr hatte er sich bereits von der Außenwelt abgekoppelt und war tief in seine Fachwissenschaft eingetaucht.
»Und dann hätte sein Schädel auch nicht diese eindeutigen Verletzungen aufgewiesen.« Der Rechtsmediziner zauberte mit einem schnellen Handgriff ein braunes Hühnerei aus seiner Tasche hervor, das er direkt vor Tannenbergs Augen in bewährter Kolumbusmanier mit dem spitzeren Ende auf die Tischplatte schlug, um es gleich anschließend in die Höhe zu halten und dem völlig verblüfften Kriminalbeamten die am unteren Ende zertrümmerte Eischale vor die Nase zu halten. »So ähnlich muss die Schädeldecke direkt nach dem Aufprall ausgesehen haben.«
Tannenberg war vor Schreck reflexartig ein Stück zurückgewichen. »Aber warum hat man ihn denn dann nicht getötet, bevor man ihn auf die Gleise geworfen hat? Warum ist der Mann nur betäubt worden?«
Dr. Schönthaler zog die Schultern nach oben, schob die Unter- über die Oberlippe. »Keine Ahnung. Vielleicht ist man irgendeinem Ritual gefolgt. – Ach, was weiß denn ich!«
»Vielleicht haben die ja auch gemeint, dass er bereits tot ist.«
»Ja, vielleicht. Vielleicht wollte man ihn auf diese Weise auch symbolisch für irgendetwas bestrafen. Nachdem man ihn gefoltert hatte.«
»Was? Man hat den armen Mann auch noch gefoltert?«
»Ja, ich hab an mehreren Stellen seines zerstückelten Körpers punktförmige Verbrennungen gefunden.« Er blickte kurz in Richtung der Zimmerdecke. »Könnten von Elektroschocks herrühren.«
»Oh Gott!«
»Muss ich aber erst noch genauer untersuchen. – Komm, wir gehen nun mal zum angenehmeren Teil unserer Zusammenkunft über. Ich bin nämlich auf meinem Weg hierher zufällig bei Antonio vorbeigekommen.« Der Gerichtsmediziner griff erneut in seine geräumige Arzttasche. »Zwei Flaschen Barbera d’Alba, etwas Käse und ein Ciabatta. Wie hat einmal ein weiser alter griechischer Philosoph gemeint: Wein ist die Muttermilch für alte Männer.«
»Aha, der Herr Hauptkommissar, wie immer: Intensiv in die Ermittlungsarbeit vertieft«, sagte plötzlich Dr. Hollerbach mit lauter Stimme von der Bürotür aus. »Ich war gerade im Hause und dachte, ich frag mal nach, ob es irgendwelche neuen Erkenntnisse in der Sache ›Heiligenberg‹ gibt.«
»Nein, gibt es nicht«, gab der Leiter des K1 kurz angebunden zurück. »Übrigens hab ich jetzt Dienstschluss. Schließlich war ich im Gegensatz zu Ihnen heute Nacht einige Stunden auf den Beinen.«
»Ach, der Herr Oberstaatsanwalt. Einen wunderschönen guten Abend«, säuselte Rainer Schönthaler, der sich inzwischen zu dem ungebetenen Gast umgedreht hatte. »Setzen Sie sich doch zu uns. Wollen Sie nicht ein Glas mit uns trinken? Es ist allerdings nur noch Tannenbergs Zahnputzbecher frei.«
»Nein, danke. Ich habe Theaterkarten für heute Abend. Und muss jetzt gleich weg!«, antwortete der ranghöchste Vertreter der Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft und machte flugs auf dem Absatz kehrt.
»Schade, wirklich schade«, drückten die beiden alten Freunde im Chor ihr zutiefst empfundenes Bedauern aus.
»Was hätten wir denn eigentlich gemacht, wenn er deiner blödsinnigen Aufforderung gefolgt wäre?«, fragte Tannenberg, während er aus seinem Schreibtisch ein hölzernes Schachspiel hervorholte.
»Ganz einfach: Wir hätten ihn abgefüllt, bis er nicht mehr hätte stehen können und ihn dann am Heiligenbergtunnel vor einen Zug geworfen!«
2
Samstag, 19. April
Marieke Tannenberg hatte ein Geheimnis.
Das Geheimnis war männlichen Geschlechts, ein Meter neunundachtzig groß, 86 Kilogramm schwer, 24 Jahre alt, von athletischer Gestalt und hieß Maximilian Heidenreich.
Seit fast vier Wochen waren sie nun ein Paar.
Der Beginn dieser Lovestory hätte in jeden schnulzigen Hollywoodfilm gepasst: Max hatte an diesem bedeutungsvollen Abend lediglich seinem jüngeren Bruder, der die gleiche Jahrgangsstufe wie Tannenbergs Nichte besuchte, von den Eltern etwas ausrichten sollen. Deshalb unternahm er auf seinem Weg in die Altstadt einen kurzen Abstecher zur Oberstufenparty seiner alten Schule, in der er vor knapp fünf Jahren das Abitur erworben hatte.
Nachdem er die Eingangstür der Aula des Rittersberg-Gymnasiums aufgedrückt hatte, beschlug plötzlich seine Brille. Er zog sie ab, um sie sauber zu putzen. Wie ein blinder Maulwurf stand er inmitten des belebten Vorraums und kramte in seiner schwarzen Lederjacke nach einem Taschentuch, fand aber keins.
Marieke, die gemeinsam mit anderen Schülern Eintrittskarten verkaufte, hatte ihn sofort bemerkt, schließlich kannte sie ihn noch aus einer Zeit, in der sie sich mit ihren Pubertätsproblemen beschäftigte, während er zu einem für sie unerreichbaren Mädchenschwarm avancierte.
Nach seinem Abitur hatte sie ihn vollständig aus den Augen verloren. Von seinem Bruder wusste sie allerdings, dass Max seit der Beendigung des Zivildienstes in Freiburg Betriebswirtschaft und Philosophie studierte.
Geistesgegenwärtig zog sie aus ihrer Jacke ein Papiertaschentuch hervor und überreichte es ihm. Er bedankte sich freundlich, wischte schnell über die milchig-trüben Gläser, schob die silberne Brille auf die Nase – und gaffte. Ja, man konnte dieses markante Mienenspiel wirklich nicht anders beschreiben: Er stand vor ihr und stierte sie mit offenem Mund an, so als sei sie ein Wesen von einem anderen Stern. Sein starrer Blick bohrte sich in ihre lebhaften blauen Augen, tastete ihr bildhübsches Gesicht ab.
»Oh, Mann! Was für Augen – was für ein Lächeln! Genauso sieht meine Traumfrau aus!«
Marieke blieb gelassen.
»Spinner!«, war alles, was sie lachend zu dieser verrückten Anmache bemerkte, bevor sie sich wieder dem Kartenverkauf zuwandte.
Maximilian blieb noch einen Augenblick kopfschüttelnd in der Eingangshalle stehen. Dann erinnerte er sich an den eigentlichen Grund seines Erscheinens und machte sich auf die Suche nach seinem Bruder.
Er verschwand zwar an diesem Abend aus der Aula genauso plötzlich, wie er aufgetaucht war, aber er verschwand nicht aus Mariekes Leben. Denn schon am nächsten Morgen in aller Frühe erreichte sie eine SMS, in der ihr Max mitteilte, dass er die ganze Nacht über nicht geschlafen habe und sie unbedingt treffen müsse. ›Schau in den Briefkasten‹, lautete der Schlusssatz.
Im Schlafanzug flitzte Marieke an die unten eingeschlitzte Haustür, wo auch tatsächlich ein blütenweißes Couvert lag. Schnell verschwand sie wieder in ihrem Zimmer und öffnete mit zittrigen Händen den Briefumschlag. Sie fand darin ein wunderschönes, romantisches Gedicht, von dem Max in einem kurzen Ergänzungssatz sogar behauptete, es selbst geschrieben zu haben.
Auch Marieke hatte in dieser Nacht nur wenig Schlaf gefunden. Ruhelos hatte sie sich in ihrem Bett herumgewälzt und immer und immer wieder mit offenen Augen von ihrem Märchenprinzen geträumt, einer imaginären Projektionsfigur für ihre spätpubertären Wünsche und Sehnsüchte, die seit gestern Abend wie durch Zauberhand plötzlich Gestalt angenommen hatte.
Zwar hatte Liebesgott Amor diese nebulöse Person anfänglich sowohl hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes als auch bezüglich der Persönlichkeitsmerkmale nur recht unscharf konturiert. Aber im Laufe der beiden letzten Jahre hatten sich die zentralen Komponenten dieses männlichen Fabelwesens immer deutlicher herauskristallisiert: Mariekes Mann fürs Leben sollte groß, dunkelhaarig, sportlich, sensibel, zärtlich, romantisch, ehrlich und treu sein – mithin alles Kriterien, die Max möglicherweise in einer Person vereinigte.
Trotz aller emotionalen Befangenheit versuchte sie krampfhaft, Abstand zu bewahren. Sie wollte sich nicht verlieren, sich ihm nicht bedingungslos ausliefern. Ihr Kopf hämmerte ihr stetig ein, dass sie in Bezug auf die vermeintliche Ehrlichkeit und Treue des jungen Mannes äußerst skeptisch sein müsse, schließlich eilte dem Objekt ihrer Begierden der Ruf eines unverbesserlichen Casanovas voraus.
Aber ihr Bauch setzte sich mit Vehemenz gegen diese rationalistischen Bevormundungsversuche zur Wehr. Infolgedessen gelang es ihr trotz all der ernsthaften Distanzierungsbemühungen nicht, sich seiner magischen Anziehungskraft zu entziehen. Obwohl sie von ihrem, aus neugierigen, mitfühlenden, aber auch neidischen Freundinnen bestehenden Beraterinnenstab auf das Eindringlichste vor einer Liaison mit ihm gewarnt wurde, merkte sie, dass sie, je öfter sie ihn traf, immer mehr vom Boden abhob und hinauf in den siebten Himmel schwebte.
Aber es war eigentlich auch kein Wunder, dass Marieke auf Maximilian Heidenreich derart heftig reagierte, schließlich hob er sich extrem positiv von ihren männlichen Altersgenossen ab, die entweder affig gekünstelt oder betont cool, aufgesetzt freakig oder pseudo-souverän alle Facetten ihrer zukünftigen Männerrolle ausprobierten.
Max dagegen hatte diese schwankungsanfällige Orientierungsphase bereits weit hinter sich gelassen und war inzwischen auch äußerlich zu einem richtigen Mann gereift: Markante Gesichtszüge, starker Bartwuchs, wunderbar herbwürziger Rasierwasserduft, muskulöser, sehniger Körper – und gleichzeitig war er in allen Belangen unglaublich zärtlich und rücksichtsvoll.
Je länger die beiden miteinander liiert waren, umso häufiger malte sich Marieke ihre gemeinsame Zukunft aus. So beschäftigte sie sich zum Beispiel ausgiebig mit der Frage, ob sie mit ihrem Mann und den Kindern lieber in der Stadt oder auf dem Lande leben wollte. Ja, sie ließ sich sogar von Maximilian ein Babyphoto aushändigen, legte es neben ein eigenes und versuchte daraus das wahrscheinliche Aussehen des bereits fest eingeplanten mehrköpfigen Nachwuchses abzuleiten.
Es war wieder einmal Samstag.
Und somit der Tag in der Woche, an dem Wolfram Tannenbergs soziales Engagement für seine Familie, mit der er auf engstem Raum in den beiden durch den gemeinsamen Hof verbundenen Häuser im Musikerviertel der Stadt zusammenlebte, zumindest am Vormittag zentral im Vordergrund stand.
Zwar hätte er sich selbst nicht unbedingt als aufopferungsbereiten, sich durch ausgeprägtes soziales Handeln verwirklichenden Menschen bezeichnet, denn dazu war er viel zu faul und egoistisch. Aber dieser samstägliche Wochenmarktbesuch war für ihn doch so etwas wie ein symbolischer Akt, mit dessen Hilfe er sein schlechtes Gewissen besonders gegenüber den Eltern, die ihn schließlich mietfrei im Obergeschoss ihres Hauses wohnen ließen, beruhigen konnte.
Nach getaner Einkaufsarbeit schleppte er sich auch an diesem Morgen, schwer beladen wie ein andalusischer Packesel, zu seinem Lieblingscafé, wo er sich trotz der niedrigen Außentemperaturen auf einem Plastikstuhl im Freien niederließ. Es war zwar recht kalt und auch etwas windig; aber das störte ihn nicht, schließlich hatte er fast zwei Jahrzehnte lang bei jedem Wetter und jeder Temperatur im Fritz-Walter-Stadion auf der zugigen Nordtribüne gesessen.
In dem kleinen Zeitschriftenladen an der Stiftskirche hatte er sich die FAZ gekauft und breitete sie nun vor sich auf dem kleinen Bistrotischchen aus. Aber als er zu lesen beginnen wollte, stellte er fest, dass er die zu dieser Mittagsstunde herrschenden Lichtverhältnisse wohl falsch eingeschätzt hatte. Denn da die winterkahlen Platanen noch keinen Schatten spenden konnten, wurde die Zeitung so stark von grellem Sonnenschein bestrahlt, dass an eine genüssliche Lektüre nicht zu denken war.
Seine blinzelnden Augen erhoben sich von der Zeitung. Er blickte in Richtung der verwitterten Sandsteinsockel des mittelalterlichen Kirchengemäuers. Er gewann den Eindruck, dass an diesem kühlen Apriltag irgendetwas anders war als sonst.
Nur was?, dachte er.
Er grübelte, ließ den Blick in Richtung des Schillerplatzes schweifen, kehrte wieder zurück. – Klar! Es war das andere Garagentor! Der Apotheker hatte das mausgraue Metallteil durch ein braunes Kunststofftor ersetzen lassen.
Das war es also! Tannenberg schmunzelte.
Plötzlich bemerkte er einen großflächigen Schatten zu seiner linken Seite, der sich wie ein schwarzer Mantel auf den Tisch und die Zeitung geworfen hatte. Sofort drehte er sich um, blickte neugierig empor.
»Hallo, Onkel Wolf!«, begrüßte ihn Marieke mit einem strahlenden Lächeln. »Darf ich dir meinen Freund vorstellen: Maximilian Heidenreich.«
Tannenberg sprang auf. Die Zeitung rutschte an der Tischplatte hinunter und blieb zwischen Stuhl und Tisch senkrecht stehen.
»Angenehm … Tannenberg … Ich bin Mariekes Onkel. Setzt euch doch zu mir!«, stotterte er verlegen wie ein schüchterner Pennäler, der sich an seinem ersten Schultag den Klassenkameraden vorstellen musste.
»Danke, Herr Tannenberg. Schön Sie einmal kennen zu lernen. Marieke hat mir schon viel von Ihnen erzählt.«
»Na, hoffentlich nicht allzu schreckliche Dinge.«
Max lachte. »Nein, nein. Ganz im Gegenteil!«
Tannenberg war sichtlich erleichtert und forderte die beiden erneut auf, an seinem Tisch Platz zu nehmen.
»Geht leider nicht, Herr Tannenberg«, wehrte Maximilian freundlich, aber bestimmt ab. »Wir haben noch ein wichtiges Date.«
»Schade.«
»Aber ein anderes Mal sehr gerne!«, sagte der sympathische junge Mann, während er lässig einen roten Motorradhelm neben seinem Körper baumeln ließ.
»Tschüss, Onkel Wolf!«
Marieke hakte Max unter, drückte sich zärtlich an seine schwarze Lederjacke und schob ihn von der Seite her an. Lachend verließen die beiden Turteltauben den Außenbereich des Stadtcafés.
Zurück blieb ein übertölpelter Kriminalbeamter, der immer noch nicht so recht verstand, was ihm da gerade passiert war.
Marieke hat einen Freund! Und was für einen! Kein kleiner Milchbubi, sondern ein richtig deftiger Kerl!, stellte Tannenberg amüsiert fest. Da wird sich mein liebes Bruderherz aber freuen, dieser eifersüchtige Gockel!
Schlagartig war ihm alles klar. Das also war die Erklärung für das seltsame Verhalten seiner Nichte, das ihren Vater in den letzten Wochen so sehr beunruhigt hatte, dass er doch allen Ernstes zu der Meinung gelangt war, seine Tochter habe garantiert ein Drogenproblem. Marieke war verliebt! Deshalb war sie so aufgedreht, hatte ihr Wesen derart stark verändert, dass Heiner vermutete, sie würde Amphetamine oder Ecstasy schlucken.
Die gute, alte Liebe!, sagte er grinsend zu sich selbst.
Erleichterung breitete sich in ihm aus, denn ganz so spurlos waren die Erklärungsversuche seines Bruders doch nicht an ihm vorübergegangen. Zwar hatte er sich nicht ernsthaft vorstellen können, dass seine Nichte tatsächlich drogengefährdet sei, aber nun zeigte er sich doch sehr erfreut darüber, dass Mariekes Verhaltens-auffälligkeiten auf eine Ursache zurückzuführen war, die genauso alt war wie die Menschheit – und zudem völlig harmlos.
Aber warum sind denn ihre eigenen Eltern nicht selbst auf diese ebenso nahe liegende wie natürliche Erklärung gekommen? Verlieben ist doch bei einem siebzehnjährigen Mädchen gar nicht so ungewöhnlich, oder?, fragte er sich lächelnd.
Sein gedankenversunkener Blick schwenkte in die Gasse, in der vor ein paar Minuten die beiden Turteltauben verschwunden waren.
Nur wer von den beiden Superpädagogen sollte denn auch auf solch eine Idee kommen? Diese in Gestalt meiner Schwägerin fleischgewordene menschliche Heckenschere etwa? Die ist doch total verklemmt!, stellte er ketzerisch fest. Ist ja auch kein Wunder, schließlich hat sich außer Heiner niemals einer an sie rangewagt.
Und Heiner? Der ist doch völlig blind vor Eifersucht! Na ja, gut, auf der anderen Seite ist es heutzutage natürlich für Eltern auch nicht mehr ganz so einfach wie früher, solche Dinge mitzubekommen. In meiner Jugend liefen diese Kontakte ja mehr oder weniger öffentlich ab: Über das fest installierte Telefon im Flur oder Wohnzimmer. Und heute? Heute läuft doch fast alles nur noch schnurlos über Handys. Kein Wunder, dass Eltern viel weniger als früher erfahren, welche Freunde ihre Kinder haben.
Wolfram Tannenberg belieferte mit den auf dem Wochenmarkt erworbenen Frischwaren zuerst seine Eltern im so genannten Nordhaus, das an die Beethovenstraße angrenzte. Dann begab er sich mit den restlichen Tüten über den gemeinsam genutzten Innenhof in das an der Parkstraße gelegene Südhaus der tannenbergschen Wohnanlage, hinter deren dicken Bruchsteinmauern seine über alles geliebte Schwägerin in Matriarchatsmanier das Zepter schwang.
»So, werte Elsbeth«, begann er, nachdem er die Wohnküche betreten hatte. Dieser Raum sah immer noch genauso aus, wie man sich das leicht chaotische Lebenszentrum einer studentischen Wohngemeinschaft vorstellte. »Melde gehorsamst: Habe alle deine Wünsche erfüllt: Vollbiologisches Vollkornbrot, glückliche Eier von glücklichen Hühnern und der garantiert ungespritzte, garantiert von Schnecken angefressene, dafür aber doppelt so teure Öko-Bio-Natur-Salat.«
Grinsend hatte Tannenberg die genannten Lebensmittel auf den mit Leinöl behandelten Buchenholztisch gestellt, auf dem, wie es sich für ein kultur- und politikinteressiertes Lehrerehepaar schließlich auch gehörte, DIEZEIT stets ihr einwöchiges, ebenso demonstratives wie häufig unberührtes Dasein fristete, bevor sie wie üblich am nächsten Donnerstag durch das aktuelle Exemplar ersetzt wurde und dann zwar durchgeblättert, nicht selten aber auch völlig unangetastet auf Nimmerwiedersehen in der Altpapierbox im Hof verschwand.
»Ach Gott, bist du wieder originell!«, entgegnete die mit einem wallenden, bordeauxfarbenen Gewand bekleidete Englischlehrerin, die deshalb darauf bestand, Betty genannt zu werden, weil ihr eigentlicher Vorname für sie ein rotes Tuch war.
»Heiner«, schrie Tannenberg plötzlich mitten in der Küche los, »komm mal runter, ich hab wichtige Informationen über eure Tochter!«
Aus den kurz danach einsetzenden lauten Poltergeräuschen aus Richtung des Treppenhauses schloss er spontan, dass sein Bruder, der sich aus mehr als nachvollziehbaren Beweggründen sehr oft in sein Arbeitszimmer im ausgebauten Dachgeschoss flüchtete, die Aufforderung vernommen hatte.
»Und: Hast du was rausgekriegt?«, fragte er direkt nachdem er in der Küche erschienen war, ohne ein Wort der Begrüßung. »Haben deine Kollegen von der Drogenfahndung irgendwas über diese verfluchten Dealer gesagt, die in der Altstadt ihr Unwesen treiben?« Heiner musste verschnaufen. »Mensch, Wolf, sag endlich, was Sache ist.«
»Ganz ruhig, setzt euch doch erst mal hin.«
»Hinsetzen? Ist es denn etwa so schlimm?«, stöhnte Betty laut auf, warf die Hände vor den Kopf, kämpfte mit den Tränen. »Meine arme Marieke! Um Himmels willen.«
»Na, ist ja auch kein Wunder, dass es mit ihr so weit gekommen ist. Wie sagt man so schön: ›Lehrers Kinder und Pfarrers Vieh, gedeihen selten oder nie‹.«
Aus Heiners Gesicht hatte sich das Blut in Richtung entfernterer Körperregionen verabschiedet. »Über so was macht man keine Scherze, Wolf! Überleg dir lieber mal, wie wir ihr helfen können, damit sie aus diesem verdammten Drogensumpf wieder heil herauskommt. Schließlich ist sie ja auch deine Nichte. Oh Gott, meine Tochter – die Christiane F. von Kaiserslautern!«
»Marieke, drogenabhängig! Was für eine Schande! Ausgerechnet meine Tochter. Wo ich mir doch bei ihrer Erziehung solche Mühe gegeben habe. Ich bin völlig fertig!«, stimmte der gelockte Rotschopf in das Klagelied ihres Ehemannes ein.