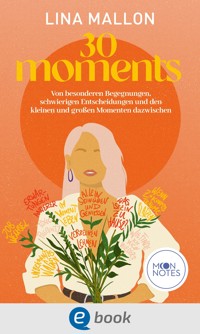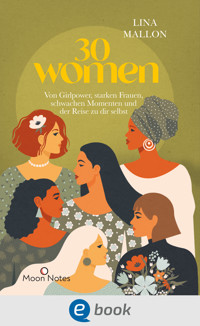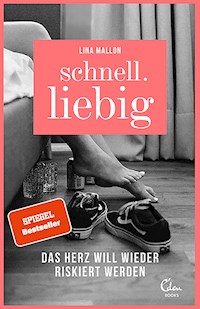13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Als Lina Mallon ein kleines Stück Land in Südafrika kauft und mit dem Bau einer Cabin beginnt, weiß sie, dass wir nie wissen, wo wir landen, wenn wir uns für einen neuen Weg entscheiden – und genau das der schönste Teil eines Abenteuers sein kann. Sie begibt sich auf unbekanntes Terrain, erlebt kleine und große Baupannen, Begegnungen mit Pavianen und breitschultrigen Männern in Khaki-Shorts. Sie zweifelt an sich, verläuft sich in ihrem eigenen Traum und kehrt Schritt für Schritt zu sich selbst zurück. Das Buch erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich überall auf der Welt zu Hause und doch nie angekommen fühlte. Eine Geschichte über das Reisen mit uns selbst, über die Frage danach, wo und wie man seinen Platz in der Weltfindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Tag eins
Der Funken
Bain’s Kloof
Besichtigt
Aber warum Südafrika?
Mit beiden Beinen
Ein Anfang
Entwürfe
Architekt*in
Toni the »Tub Guy«
Speeddating
Stormwater Ditch
Momentaufnahmen
Grundbruch
Trust the process
Oomblik
Ratschläge
Bad Birdwatcher
Gerede
Braaibroodjies
Egos
Baustopp
Schmerz
Zurück zum Moment
Zwei Schritte
Epilog
Danksagung
This book is for every single soul who is out there – trying.
Dieses Buch basiert auf meinen Erlebnissen und Erfahrungen während der letzten drei Jahre. Einige der Geschehnisse wurden gekürzt, umstrukturiert oder zusammenfassend erzählt und finden manchmal auch an neuen Schauplätzen statt. Ich habe mich bemüht, meine eigene Geschichte so offen, so authentisch und so ehrlich wie möglich aufzuschreiben. Daher sind Ortsnennungen real und engste Freunde, die in Oomblik vorkommen, erscheinen weitestgehend unter ihren Klarnamen. Mit Rücksicht auf die Privatsphäre aller anderen Personen in diesem Buch habe ich deren Namen und Charakterzüge verändert. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind demnach rein zufällig und unbeabsichtigt.
Prolog
»Weißt du denn, worauf du dich da einlässt?«
Manchmal ja, manchmal noch nicht, habe ich oft geantwortet.
Während ich dieses Buch schrieb, habe ich mir viele Gedanken über unseren Umgang mit dem Unbekannten, dem Ungewollten, dem Ungeplanten gemacht. Wie oft wir es ersehnen, wie oft wir es ablehnen, wie sehr wir das, was wir nicht kennen können, kontrollieren wollen. Wir wollen uns treiben lassen, aber dennoch nicht abdriften, wollen uns mitreißen lassen, aber am besten vorher wissen, wo wir ankommen, ob es uns genug gefallen wird, ob es sich überhaupt lohnt.
Die Sache ist nur die – du weißt nie, wohin dich deine nächsten Entscheidungen wirklich bringen werden, aber in dem Moment, in dem du sie triffst, gibst du dir eine Richtung.
Als ich beschloss, eine Cabin in Südafrika zu bauen, ahnte ich, was auf mich zukommen könnte, sammelte Perspektiven, saugte Erfahrungen auf, hatte schon fünf Jahre in diesem Land verbracht, bevor ich beschloss, diesen Schritt zu gehen – und hätte am Ende dennoch niemals voraussehen können, was ich dann wirklich erlebte, was mich herausfordern, wo ich am Ende landen würde.
Ich habe in den letzten zwei Jahren, in diesem Buch, auf meiner Reise, begonnen zu lernen, dass man die Schönheit eines Moments, einen Augenblick im eigenen Frieden, manchmal auch im Unbequemen, im Unfertigen finden kann. Dass er ein Teil von uns ist, den wir, ganz egal wohin wir gehen – immer in uns selbst tragen.
Selbstbewusst zu entscheiden heißt nicht, dass du dir zutrauen musst, für all das, was vielleicht kommt oder was andere dir vorhersagen, bereit zu sein. Es gibt so viele Dinge, für die du niemals wirklich bereit sein wirst. Dich überhaupt zu entscheiden heißt, dass du dir vertraust. Dass du weißt, wer du bist, welche Stärken du hast, welche Schwächen du in dir trägst, und dass du über dich hinauswachsen kannst, wenn es so weit ist. Dich im richtigen Moment zu entscheiden heißt nicht, dass du niemals scheitern wirst, heißt nicht, dass es nicht manchmal hart wird. Es heißt nicht, dass es keine schlechten oder einsamen Tage gibt. Aber – diese Gefühle machen unsere Entscheidung nicht falsch, machen deinen Traum nicht faul oder deinen Versuch wertlos. Sie machen dich zu einem menschlichen Wesen.
Tag eins
Ich ziehe die schwere Eisentür hinter mir zu, die schief in den Scharnieren hängt, und vergewissere mich, dass das alte Schloss sich einhakt. Hinter mir, zwischen den vielen Fieberbäumen und Akazien, die sich entlang der roten Sandpiste ziehen, über die wir gerade hergekommen sind, wird in einer halben Stunde die Sonne untergehen. Schon jetzt weicht ihre Wärme dem kühleren Wind, der mit jedem Tag ein bisschen früher ankündigt, dass der Herbst kommt. Ich stehe barfuß in meinen Latschen, das leichte Blumenkleid umspielt meine Knöchel. Den Reißverschluss meiner großen Strickjacke habe ich zugezogen, die Wolle der Ärmel bedeckt meine Fingerspitzen, nicht weil mir kalt wäre, sondern weil ich mich wohlfühle, wenn meine Hände sich in dem dichten Stoff vergraben können, während meine Füße nackt und frei sind.
Der Himmel färbt sich heute schnell in warmen Tönen, er bleibt nicht so lange klar wie sonst. Die tief hängende Wolkendecke ist in ein weiches Pink getaucht, sie wird immer dunkler und verschwindet fast darin – reißt dann aber doch noch einmal auf und lässt einen letzten Blick auf die Sonne zu, die sich hinter der Wetterfront verbirgt. Ihr Licht lässt sich nicht festhalten, es kehrt aber immer wieder zurück.
Es ist mein letzter Abend hier in Mpumalanga, im Norden Südafrikas. Wir sind extra noch einmal zu Fuß über die lange Wiese hinter dem Farmhaus spaziert, um den Blick auf den Abendhimmel zu genießen. Neben uns grasen ein paar Schafe, die erst aufschrecken, als sie den Hund bemerken, der zwischen uns läuft. Ich hocke mich ins hohe Gras, warte noch einen Moment ab, bis der Himmel seine letzte, schönste Szene zeigt. Dann beginne ich zu fotografieren. Man weiß nie, welches Foto das letzte ist, das man von einem Ort schießt, ob man jemals hierher zurückkehren wird – oder ihn von nun an nur noch in seiner Erinnerung besucht.
***
»When you lose touch with inner stillness, you lose touch with yourself.«
– Eckhart Tolle
Matotoland ist noch heute der inoffizielle Name, den einst die Siswati dem Gebiet um die Seenlandschaft des Highvelds gaben, auf das ich gerade schaue. Froschland heißt das übersetzt. Mehr als zweihundertfünfzig Seen gibt es hier, mehr als fünfhundert verschiedene Vogelarten brüten während des Frühlings in der Nähe, kommen und gehen, bleiben für einen Moment, bevor sie weiterziehen, oder verlassen diesen Ort nie wieder, weil sie hier ihren Platz gefunden haben. Die Frösche sind immer da.
Seit zwei Wochen wecken sie mich jeden Morgen, meist kurz vor Morgengrauen, wenn die Luft noch feucht an den Fenstern hängt und sich als Tau über die weite Graslandschaft legt. Während ich langsam aus dem Bett aufstehe, quietschen die Dielen unter meinen Füßen leise, sie ächzen unter dem Gewicht meiner sanften Schritte wie müde Glieder. Mit einem Streichholz zünde ich den alten Gasherd an, lasse das Wasser in den Kessel laufen. Als ich den Deckel der kleinen Kaffeedose abziehe, schaue ich direkt auf ihren blechernen Boden. Ein paar feine schwarze Reste hängen noch in den Ecken, zusammengekratzt würden sie nicht einmal einen kleinen Löffel Kaffee ergeben. Ich öffne ein paar der Schränke, mit denen ich noch nicht vertraut bin, schiebe Vorräte zur Seite und finde tatsächlich noch ein paar dunkel geröstete Bohnen. Genauso schnell stelle ich allerdings fest, dass ich keine Möglichkeit habe, sie zu mahlen. Strom haben wir hier nicht, und nach einer mechanischen Kaffeemühle suche ich vergeblich. Als der Kessel pfeift, nehme ich ihn von der Flamme. Statt das heiße Wasser in die French Press zu füllen, gieße ich vier Beutel Rooibostee damit auf, Ceylon Blend.
Ich mag den leicht herben, malzigen Geschmack des Ceylons – und die leise Konstante, die er in meinen Tag bringt. In beinahe jedem südafrikanischen Haushalt, selbst in Hotelzimmern oder Apartments, findet sich in irgendeiner Ecke dieses charismatische rote Päckchen mit den kleinen Beuteln voll schwarzem Tee. Er ist ergiebig, unempfindlich gegen lange Lagerzeiten, gegen warme Temperaturen und selbst gegen hartes Wasser. Mit ein bisschen Milch wird er milder. Und während er bei den meisten Südafrikanern wie selbstverständlich im Schrank lagert, bleibt er für mich etwas Besonderes. Auch heute noch erinnert er mich mit jedem Schluck immer noch an meine erste Reise nach Südafrika, an die frühen Game Drives durch den Busch und die Sonnenaufgänge im Madikwe Reserve, an die frische Morgenluft in De Hoop erst letzten September oder an die Regenwettertage in Kapstadt, als ich gerade erst auf die Long Street gezogen war, im Fenster saß und trotz all des Graus überglücklich war, mich nicht sattsehen konnte an diesem Ort. Das ist heute noch immer so.
Im Sessel neben mir liegt ein altes, abgegriffenes Taschenbuch mit dem Titel How to Be a Bad Birdwatcher. Ich hebe es auf, ziehe mir die Wolldecke über die Knie und schlage wahllos ein Kapitel auf. Im Grunde beschreibt der Autor Simon Barnes darin, dass Vögel zu beobachten kein Hobby für alte, weiße Männer in beigefarbenen Westen sein sollte, die das Geld ihrer Pensionszahlungen in Teleobjektive investiert haben, sondern dass eine Begegnung mit so etwas Vergänglichem wie einem fliegenden Vogel dann am bedeutsamsten ist, wenn man sowieso gerade mal wieder ein bisschen Zeit damit verbringen wollte, einfach still in den Himmel zu schauen, herumzuspazieren und die Welt wieder etwas bewusster wahrzunehmen. Nicht nur ihre Geschwindigkeit, ihre Lautstärke, sondern die leisen Momente, die einem sonst leicht entwischen würden.
Ich ziehe den Sessel auf die Veranda, lege mir ein Kissen in den Nacken und aale mein Gesicht in den Sonnenstrahlen. Ich höre, wie die Spanielhündin Phoebe die Holztreppen der Cabin hinunterläuft, blinzle kurz auf und sehe gerade noch, wie sie im hohen Gras verschwindet. Ich weiß, dass sie in zehn Minuten zurückkommen, sich neben mich legen und sich mit mir sonnen wird, ohne sich dabei der Zeit bewusst zu sein oder irgendeinen Drang zu verspüren.
Über mir zieht ein Flock Kraniche über den See, ändert seine Richtung mehrfach, einige der Tiere landen auf der sich spiegelnden Wasseroberfläche, rasten dort, bevor auch sie sich wieder in einer Formation in den Himmel schwingen. Ich schaue den Vögeln am Himmel so lange zu, bis ich die einzelnen Arten voneinander unterscheiden kann. Bis sie nicht mehr nur Flügel und ein kurzer Moment sind, sondern verschiedene Farben und Formen annehmen, sich durch verschiedene Geräusche auszeichnen, von denen ich manche wiedererkenne, manche sogar beim Namen nennen kann.
Ich bin es gewohnt, dass mein Interesse nicht langsam einsetzt, sondern sich schlagartig zeigt. Interesse braucht in meiner Welt, in meinem Alltag nur Sekunden. Ich investiere meine Zeit nur selten in Dinge, von denen ich nicht sofort weiß, dass sie mich begeistern können. Ich suche nach Funken, die auf mich überspringen und mich entzünden. Ich koste die Begeisterung aus, lasse mich von ihr in Euphorie versetzen, aber ich pausiere nicht für das kleine Interesse.
Aber hier, hier habe ich Zeit, die ich den kleinen Dingen widmen kann, ohne sie dabei zu verlieren. Zeit hat hier und jetzt, in diesem Lockdown, in dieser Umgebung, keinen – und damit vielleicht einen unschätzbar großen – Wert. Ich habe, vielleicht zum ersten Mal seit Jahren, einfach unglaublich viel davon. Ohne den Druck, dass ich sie besser nutzen müsste, dass ich mehr Bücher lesen, diese eine Dokumentation, die schon ewig auf meiner Liste steht, noch schauen oder endlich mal meinen Schrank sortieren sollte. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Sonntagen in der Vergangenheit ich eigentlich so viel Zeit für so vieles hatte, dass ich sie am Ende für gar nichts nutzte – und das nicht einmal genoss. Aber in einer Welt, in der ich gerade überhaupt nichts tun kann, in einer Umgebung, in der es keinen Strom, kein Netflix, kein Wi-Fi und nur drei Bücher (Simon Barnes, Eckhart Tolle und irgendein namenloser Historienroman), ein Backgammon-Spiel und mein Tagebuch gibt, ist Nichtstun gerade sehr leicht. Und während ich gar nichts tue, ergibt sich der Rest. Während ich gar nichts tue, nur ab und zu einen Schluck Tee trinke und die Tasse dann wieder abstelle, kommt so viel Vergessenes zurück. Wie leises Interesse, wie Vogelnamen, die ich vor zwanzig Jahren mal von meinem Opa gelernt habe.
»All artists, whether they know it or not, create from a place of inner stillness, a place of no mind«, schreibt Eckhart Tolle. Vor ein paar Tagen heftete ich dieses Zitat an den Rand meines Tagebuchs, das ich hier im Lockdown wieder zu schreiben begonnen habe. Ich fühlte diese Worte, fühlte, wie die Stille hier, die Stille in mir, mich wieder schreiben, mich überhaupt wieder denken ließ, mir den Raum für die Kreativität gab, die sich in mir erst wieder finden müsste. Seit Tagen skizzierte ich den Inhalt eines zweiten, sogar eines dritten Buches, ohne viel darüber nachzudenken. Ich fotografierte intuitiv, bildete ab, was ich sah und nicht, was ich einfangen wollte.
Ich konnte wieder fühlen, wirklich spüren, was ich da tat. Es hatte erst leise um mich herum und dann schließlich leise in mir selbst werden müssen, damit meine kreative Stimme, die sich in letzter Zeit so heiser angehört hatte, wieder zurück zu ihrer vollen Lautstärke fand.
Während die Welt dort draußen tobte, sich ängstigte, nervös zuckte, stand sie gleichzeitig still. Wir konnten nicht bestimmen, wann sie sich weiterdrehen würde, aber wir hatten zumindest die Chance zu bestimmen, ob wir selbst mit ihr toben und zucken wollten – oder ob wir uns erlaubten, uns wieder mit der Stille anzufreunden, sie in uns aufnahmen, statt sie zu fürchten.
Chris’ Stimme reißt mich aus meinen Träumen, ich bin wohl eingenickt. Mein linker Arm, der unter meinem Kopf liegt, fühlt sich taub an. Neben mir hat sich Phoebe eingerollt.
»Guten Morgen«, sagt er und umarmt mich. Er fühlt sich warm an und riecht nach NIVEA-Creme, nach Rosmarin und Orange. Seine Haare hat er zusammengebunden, steht sonst aber noch barfuß und in Pyjamahose vor mir.
»Ich muss noch einmal eingeschlafen sein.«
Er reicht mir mein Handy, das ich seit zwei Wochen kaum benutzt habe. Das Bootshaus liegt in einem Funkloch. Wenn ich kurz ein paar Nachrichten lesen oder mit meinen Freunden telefonieren möchte, muss ich gut vierhundert Meter weit laufen. Meistens verbinde ich den Weg mit einem längeren Spaziergang, setze mich dann auf den hellen Sandstein am Rande des Sees und schalte die Funkverbindung ein. Statt geistesabwesend über den Bildschirm zu scrollen und in banalen Daten zu versinken, an die ich mich später kaum erinnern würde, ist es für mich zu einem Ritual geworden, am Nachmittag kurz mit meinen engsten Freunden zu sprechen, ihnen Bilder zu schicken und ein bisschen Liebe und Wärme mit ihnen auszutauschen. Dafür liebe ich die Möglichkeit, mich von überall auf der Welt mit ein paar Klicks mit meinen Liebsten verbinden zu können. Für alles andere ist sie in den letzten Tagen belanglos geworden.
Ich tippe auf das Umschlagsymbol auf meinem Handybildschirm, öffne die E-Mail, die paar Kilobyte, die es trotz Funkloch irgendwie hier auf die Terrasse geschafft haben. Dann ziehe ich meinen Pullover aus, hole mir ein Handtuch aus dem Badezimmer, binde es um meinen Kopf und komme zurück auf die Terrasse. Chris grinst und schenkt mir eine Tasse Kaffee ein.
»Alles okay?«
»Ich hab eine Mail vom Konsulat bekommen. Ich bin auf einer Liste.«
»Für die Rückholflüge? Wann denn?«
»In zwei Tagen …«
Der Funken
Zwei Wochen habe ich im Bootshaus von Chris’ Familie im südafrikanischen Lockdown verbracht, bevor mich ein Flug von Johannesburg zurück nach München und das Auto meiner Freundin schließlich bis zu meiner Wohnung in Hamburg bringt. Chris – das ist der Mann, in den ich mich in diesem Moment vielleicht verlieben könnte, den ich nicht date, den ich aber auch nicht nicht date. Und den ich nicht vergessen kann, auch wenn ich ihn auf unbestimmte Zeit nicht wiedersehen werde.
Ich erlebe die gesamte Rückreise – den Abschied, die vielen Unterschriften auf noch mehr Formularen, die Kontrollen, die Listen mit meinem Namen darauf, den Check-in, die Menschen, das Umladen des Gepäcks, das Warten, die Ungewissheit, noch mehr Papiere, noch mehr Stempel, die Unterbrechungen, schließlich die Landung – wie in Zeitlupe, wie eine Aneinanderreihung von Abschnitten, durch die ich beinahe automatisch geschoben werde. Der stille Flughafen fühlt sich surreal und befremdlich an, wie eine abgekapselte Zwischenstation, in der es gerade weder ein Datum noch einen Tagesablauf gibt. Als mich die Bundespolizei in die Ankunftshalle entlässt und ich auf einem menschenleeren Parkplatz auf Sabine warte, mit der ich mir für sieben Stunden die Strecke bis nach Hamburg teilen werde, fällt es mir schwer zu begreifen, dass ich zurück in Deutschland bin.
Noch nicht einmal als die Tür meiner Wohnung hinter mir ins Schloss fällt, komme ich wirklich an. Ich lasse den Koffer im Flur stehen, ziehe meine Schuhe aus und löse den Knoten, zu dem ich meine Haare vor mehr als 18 Stunden gebunden habe. Ich beziehe mein Bett neu, schalte meinen Geyser wieder an, dusche und lege mich mit nassen Haaren auf die Kissen, die sich in der Abendsonne, die durch meine Balkontür scheint, aufgewärmt haben. Es ist kurz nach sieben Uhr abends und noch hell, und obwohl es zwischen Südafrika und Deutschland gerade keine Zeitverschiebung gibt, fühle ich mich, als würde ich festgehalten von dem Gefühl, das wir Jetlag nennen. Außerhalb von Zeit und Raum, ziellos, erschöpft, aber nicht müde, abgenabelt von der Welt, bis wir nach ein paar Nächten wieder synchron mit ihr schienen.
Und auf einmal kommt mir ein Gedanke: Was, wenn dieser Jetlag der eigentliche Lockdown war?
***
»To feel inner stability, hold on to your routines and if that is not possible – find new ones.«Diesen Rat hat der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa seinen fellow South Africans in einer seiner wöchentlichen Ansprachen mit auf den Weg gegeben. Aber auf einer Farm, auf der wir uns frei bewegen durften, auf dem Sonnendeck, auf dem wir die Tage einfach verstreichen lassen und uns von allem, das sich um uns herum ständig änderte, aber wir nicht ändern konnten, abkapseln konnten, hatten wir keine Routine gebraucht. Chris und ich lernten uns gerade erst kennen, und ein Tag, den wir bei einem Herbstgewitter im Bett verbrachten, war genauso schön wie einer, an dem ich las und mich in Erinnerungen und Worte vertiefte, während er am Tisch neben mir zeichnete. Ohne Strom, ohne Lärm, ohne ständige Verbindung nach außen war es uns leichtgefallen, den weltweiten Lockdown, all seine Informationen und seine Nervosität auszublenden. Für mich fühlte sich die Welt nicht auf einmal viel zu klein auf diesen 52 Quadratmetern an – sondern genau richtig.
Zurück in Hamburg, nach 48 Stunden, die ich mit einem achtlos im Hintergrund laufenden Netflix-Bildschirm und bestelltem Essen im Bett verbracht habe, fühlt sich die gleiche Quadratmeterzahl auf einmal nicht mehr warm und geborgen, sondern beengend und gleichzeitig auch irgendwie leer an.
Auf der Farm habe ich die Stille der Natur genossen, aber hier in Eimsbüttel fehlt mir die Sammlung an menschlichen Geräuschen, die mir normalerweise das Gefühl gaben, ein Teil der Stadt zu sein. Das Klappern der Cappuccino-Tassen auf der Osterstraße, die Schritte der Spaziergänger, die Gespräche unten vor dem Obstladen, der Verkehr, der an der Ampel abebbt und nach einer kurzen Unterbrechung wieder anfährt, die U-Bahn, die sich surrend unter unserem Haus durch den Tunnel arbeitet – ohne all das fühlt sich meine Stadt wie fader Beton an, dem seine Seele fehlt.
Auf meinem ersten Spaziergang, zu dem mich meine Freundin Nori abholt, fühle ich mich wie ein Fremdkörper, der hier draußen zwar erlaubt, aber kaum geduldet ist. Und als ich mir schließlich einen Kaffee mache, die Bohnen automatisch von der Maschine mahlen lasse, Milch aufschäume und mich dann mit einer großen Tasse in der Hand wieder zurück in meine Kissen und die endlose Menge an Instagram Stories sinken lasse, die mich entweder ernüchtern, überfordern oder einfach nur abschalten lassen, beginne ich zu verstehen, dass die stetige Verbindung zur Welt – zu Unterhaltung, Zerstreuung, zu unzähligen Formen der Kommunikation, zu sozialen Netzwerken, zu jeglichem Komfort – nicht die war, die mir fehlte, überhaupt nicht die war, die ich brauche, um mich in diesem Lockdown zurechtzufinden, um zu mir selbst zu finden.
Das Gefühl von Glück entsteht selten einfach aus einer bestimmten Situation heraus – sondern wurzelt in unseren Gefühlen, die wir aus ihr ziehen. Gleiches gilt für das negative Gefühl, irgendwie verloren zu sein – es wurzelt niemals einfach nur in unseren Umständen, sondern in unseren Gedanken über diese.
In den letzten zwei Wochen, so viele Kilometer von meinem gewohnten Umfeld entfernt, in einem fremden Bett, an einem unbekannten Ort, den ich mir unter normalen Umständen niemals ausgesucht hätte, in der Stille des Highvelds, hatte ich mich nicht einen einzigen Moment lang einsam gefühlt, sondern das zeitlose Alleinsein genossen.
Zurück in meiner eigenen Wohnung, in der Nähe von all den Dingen, die ich liebe, die ich schätze, die mein Zuhause füllen – lähmt mich das Herunterticken der Stunden. Ich habe hier jede Ressource zur Hand, um meine Gedanken zu füttern, aber finde trotzdem keinen Appetit. Ganz egal wie viele Bücher ich mir bestelle, die zu lesen ich mich dann aber irgendwie doch nicht aufraffe, wie oft ich Brot backe, um es dann nicht einmal zu essen, wie viel Mühe ich in meine Pflegeroutine investiere, um im Spiegel dann doch in ein müdes Gesicht zu schauen – meine gezwungenen Routinen schaffen es nicht, die emotionale Leere auszugleichen, von der ich nicht einmal weiß, woher sie auf einmal kam oder was sie auslöste. (Nein, hier geht es nicht darum, dass mir dieser eine Typ fehlte, den ich gerade erst kennengelernt hatte, hier geht es um mich.)
Nicht der Lockdown ist mein Problem, ich selbst bin es.
In Mpumalanga habe ich Inspiration gefühlt, in unscheinbaren Momenten kleine Funken gefunden, mich selbst gehört und gespürt. Ich bin neugierig geworden auf ein Leben unplugged. Ich war verliebt – nicht in einen Mann, sondern in ein Land und seine vielen Facetten, in seine Weite und seine Wärme, die ich, egal welchen Teil Südafrikas ich besuche, immer wieder finde. Und genau das ist es, was ich jetzt vermisse, was ich auf Amazon nicht bestellen, in meinem Alltag im Lockdown nicht durch irgendeine Routine erzwingen kann.
Ich hatte in den zwei Wochen eine Sehnsucht in mir wiederentdeckt, die ich vor einigen Jahren aus den Augen verloren hatte, die zwischen meinen Reisen, meinem Job als Bloggerin und Fotografin, den vielen Möglichkeiten, die ich beruflich ausschöpfte, aber auch dem Tempo meines eigenen Lebens, meiner Dates, Kurztrips, Kolumnen, Briefings, Partys, Festivals, meiner Neugierde auf immer neue Erfahrungen – einfach verloren gegangen war.
Ich hocke mich vor mein Bücherregal und brauche einen Moment, bis ich den dunklen Einband wiederfinde, den ein dichter Wald und tiefes Grün ziert. Cabin Porn steht auf dem weißen Umschlag des Hardcovers, das ich vor einigen Jahren in den englischen Cotswolds gekauft habe. Ich erinnere mich noch genau an die Reise, die ich im Oktober 2015 unternommen habe. Für eine Woche war ich mit dem Zug erst nach Oxford und schließlich nach Chipping Campden gereist, wo ich im Bed and Breakfast The Seagrave Arms für ein paar Tage übernachtete. Ich schrieb dort am ersten Entwurf meines ersten Buches, spazierte jeden Tag mehr als 15 Kilometer durch die Landschaft, kehrte zum Lunch in ein Pub ein, wärmte mich am offenen Kamin bei einem Sandwich und einem Pint auf und stöberte auf dem Rückweg durch die kleinen Shops, die sich entlang der High Street reihten. In einem von ihnen stieß ich schließlich auf jenes Buch, das ich jetzt in den Händen halte.
Es ist ein Bildband über unzählige Hütten und Cabins, die meisten davon straightoff the grid. »Are you yearning for a simpler existence? Find the rural escape of your dreams in this beautiful book from the creators of the wildly popular tumblr Cabin Porn«, beginnt die Sammlung, die Zach Klein und Steven Leckart gemeinsam kuratiert haben. Die Idee begann mit einer Gruppe von Freunden, die 55 Hektar Wald in Upstate New York verwalteten und gemeinsam erst auf Tumblr, später auf Instagram Inspirationen für ihre Bauprojekte sammelten und vorstellten. Mit immer mehr Häusern, die das Kollektiv besuchte, fotografierte und vorstellte, zog die Page eine immer größere Fangemeinde an und wurde zu einem internationalen Phänomen.
So viele Menschen sind fasziniert von dem, was eine kleine Hütte irgendwo im Nichts, abgeschnitten von der Zivilisation, repräsentiert. Ich war einer von ihnen, schon damals sofort angezogen vom leisen Kick des Alleinseins – und ich bin es jetzt wieder.
Ich lasse mich auf den Fußboden sinken und blättere durch die über dreihundert Seiten, kann mich nicht sattsehen an den verschiedenen Designs und Umsetzungen, an den kleinen timber cabins, verschluckt von kanadischen Wäldern, an den minimalistischen Tiny Houses, die in den nordamerikanischen Nationalparks verstreut sind, den container pods, die auf Klippen über norwegischen Fjorden sitzen, und schließlich den spiegelnden Glasfronten der isländischen eco cabins, die mitten hinein in eine karge, aber nicht weniger imposante Felslandschaft gebaut wurden.
Als ich das Buch wieder zuklappe, ziehe ich mein Handy aus der Hosentasche und suche auf Social Media nach dem Kollektiv. Ich bleibe an einem der letzten Posts hängen – zwischen grauen, sich auftürmenden Gesteinsformationen, umsäumt von unberührter Vegetation und in ein schimmerndes Licht getaucht, das mir so bekannt vorkommt, das viele einzigartig auf dieser Welt nennen, thront eine kleine cabin. Ich folge dem Geotag, dann sende ich den Post an Chris und frage: »Ist das hier wirklich Südafrika?« Meine Finger gleiten über die vielen Bilder, über noch mehr Eindrücke und Aufnahmen, meine Gedanken träumen ihnen weit voraus, und es gefällt mir, sie rennen zu lassen, sie nicht zu stoppen. Oftmals brachten sie mich an Orte, die ich sonst nie gefunden hätte.
»Ja, das ist Bain’s Kloof, das ist ungefähr neunzig Kilometer von Kapstadt entfernt«, antwortet er ein paar Minuten später.
Da ist er, der Funken.
Bain’s Kloof
Rückblende: Es ist April 2019, wir sitzen in der Abendsonne Kapstadts, machen uns gerade das zweite Bier auf. Jorge hört mir zu, während ich mir den Frust des Tages von der Seele rede.
Vor einigen Wochen habe ich meine Bewerbungsmappe als Gastlektorin für fotografisches Storytelling und Markenmanagement bei verschiedenen Akademien hier in Kapstadt eingereicht. Drei haben mir geantwortet und mich zu Gesprächen eingeladen, zwei davon habe ich besucht, beide waren begeistert von meinen Lektionsentwürfen, beide haben mir die Leitung eines Kurses angeboten.
»Wir lieben dein Konzept, wir lieben dein Portfolio und können dir ab sofort einen Raum für deinen Kurs geben und ihn mit in den Stundenplan aufnehmen. Wenn er im ersten Team gut besucht ist, könnte er im zweiten sogar mandatory werden. Ab dann können wir dich auch mit zweitausend Südafrikanischen Rand pro Einheit bezahlen und dir eine Einheit pro Woche anbieten.«
Übersetzt hieß das: Wenn ich drei Monate umsonst für die Akademie arbeitete und genug Student*innen in meine Kurse lotste, bestand danach die Chance, dass ich ungefähr 450 Euro im Monat verdienen würde. Damit würde ich nach Abzug der Steuern nicht einmal die Miete meines kleinen Apartments bezahlen können.
Die Akademie für Fotografie in Stellenbosch hatte mir immerhin ein sofortiges Gehalt von siebentausend Südafrikanischen Rand angeboten. Obwohl auch das auf keinen Fall reichte, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, stellte sich im Gespräch mit der Teamleitung für mich noch ein ganz anderes Problem heraus: Keine der Akademien würde mir einen festen Vertrag geben können, der mich für eine Arbeitsgenehmigung qualifizieren könnte. Und die Sache war außerdem die: In den meisten Fällen benötigten die Bewerber*innen ein generelles work visa, um sich für einen Vertrag zu qualifizieren, allerdings konnte ich mich darauf nur bewerben, wenn ich entweder bereits einen Vertrag vorweisen konnte – oder aber mich für einen Job qualifizierte, der auf einer Art Mangelliste, den critical skills, verzeichnet war. Denn wer eine Profession oder einen Abschluss hatte, der in Südafrika dringend gebraucht wurde, konnte sich auch ohne festen Arbeitsvertrag für ein Arbeitsvisum bewerben.
Wer Südafrika mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten bereichern kann oder aber mit seinem Business sogar weitere Arbeitsplätze schafft, hat eine positive Ausgangslage auf dem Markt und bei den Behörden. Wer aber einen Job möchte, den genauso gut eine Person aus Südafrika ausüben kann, braucht dafür einen triftigen Grund. Bei einer Arbeitslosenquote von 35 Prozent im eigenen Land ergibt das Sinn und fühlte sich für mich nur allzu verständlich an.
Sosehr ich nach Südafrika ziehen wollte, so falsch fühlte es sich für mich dennoch an, dies auf dem Rücken der Menschen zu tun, die sich hier durch eine Ausbildung oder ein Studium hochgearbeitet hatten und nun genauso intensiv wie ich nach einem Einstieg suchten, um sich das Leben in dem Land, in dem sie aufgewachsen waren, auch weiterhin leisten zu können. Auszuwandern blieb eine persönliche und freie Entscheidung, vielleicht sogar ein Privileg.
(Ein Beispiel: Ich war als deutscher Gast jederzeit willkommen, ich konnte darum bitten, länger bleiben zu dürfen, ich konnte mir unter Umständen erarbeiten, ein Teil der südafrikanischen Gesellschaft zu werden, im Gegenzug durften Südafrikaner ohne Gehaltsnachweise oder persönliche Einladungen den Schengenraum nicht einmal bereisen.)
Ich wusste, dass ich das Problem nicht allein lösen konnte, dass ich als europäische Auswanderin, die nach Afrika kam, sogar ein Teil des Problems war: Wie findest du deinen Platz – ohne ihn dir einfach nur zu nehmen?
»Vielleicht darfst du nicht einfach nur danach suchen und irgendwann glücklich über ihn stolpern – du musst ihn selbst erschaffen«, sagt Jorge und nippt an seiner Bierflasche.
Ich nehme ebenfalls einen Schluck, nicke zustimmend, aber finde keine Antwort. Ich hatte so viele Gründe, ich hatte den Mut, aber trotzdem keinen Platz – und seit heute auch nicht mal mehr einen Anfang.
»Welchen Job hast du denn vor Augen, wenn du dich selbst in Südafrika siehst? Hier in Kapstadt?«
Jorge lehnt sich mit dem Rücken an die Balkonbrüstung und kreuzt seine Füße. Statt sofort zu antworten, versuche ich, all die Antworten zu sammeln, die sich in mir melden. In den letzten acht Jahren habe ich in Deutschland vor allem als freiberufliche Reisefotografin und Bloggerin gearbeitet. Ich liebte das Schreiben, ich liebte gute Geschichten, und mit der Fotografie hatte ich meine vielleicht größte Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. In den letzten Jahren hatte meine Branche sich zu wandeln begonnen. Aus Bloggerinnen wurden Influencerinnen, die Inhalte wurden schneller, bewegter, richteten sich auf snackable snippets aus, also auf eine Form von kurzen Videos, die du auch nebenbei konsumieren kannst. Ich wusste, dass Fotoreportagen über mehrere Seiten, große Bilder, Lesezeiten von zehn bis fünfzehn Minuten vor allem online eine immer kleinere Rolle spielen, zu einer Nische werden würden. Ich kämpfte nicht dagegen an. Ich wusste, dass ich mich verändern, dass ich mich anpassen und in die Richtung, in die der Nutzer steuerte, entwickeln musste, wenn ich mein Geld weiterhin auf Social Media verdienen wollte. Das war der ganz normale Zyklus, wenn du in einem Berufsfeld erfolgreich sein wolltest, das auf ständiger Veränderung und immer neuen Updates basierte. Während ich noch über Mode bloggte, Fashion Weeks besuchte und Hotels vor allem auf ihren Lifestyle testete, hatte es auf mich einen riesigen Reiz ausgeübt, Trends in den Fingerspitzen zu fühlen, sie umzusetzen, manche von ihnen nur anzuprobieren und dann wieder loszulassen. Es war eine schnelllebige Zeit in meinem Leben gewesen, die ein Teil von mir ausgekostet und abfotografiert hatte – während ein anderer sich trotzdem nie so ganz wohl in ihr fühlte, nach mehr Tiefe, nach mehr Verbundenheit suchte, Momente nicht einfach nur abdrücken, teilen, durchblättern, sondern festhalten wollte.
In letzter Zeit hatte ich genauer hingehört, hatte mich bewusst für Einladungen und Jobs entschieden, die mir ein Stück der Welt zeigten, von der wir uns so entfremdet hatten, die mir die Chance gaben, mich zurückzuverbinden, ein Gefühl für diesen Planeten und seine unendlichen Facetten zu entwickeln. Ich entschied mich für Reisen, auf denen ich Teil von lokalen Projekten und nachhaltigerem Tourismus sein konnte, statt neue happenings zu feiern oder money shots zu jagen. Ich entschied mich gegen Dubai, gegen Miami, gegen Abu Dhabi, am Ende sogar gegen L.A. – reiste stattdessen mit dem Auto über das griechische Festland, trieb Ziegen durch kretische Dörfer hinauf ins Bergland, lernte, wie man Feta über dem offenen Feuer herstellte, tauschte Bangkok gegen Trang, entdeckte die Ruhe auf Ko Kut, wanderte in den schottischen Highlands, füllte Whisky in Fässer, verlor mich für eine Nacht im Trubel der Tallinner Künstlerviertel, schlief mit mehr als vierzig Huskys auf einer verschneiten Insel auf dem Inarisee und landete am Ende schließlich immer wieder hier: in Südafrika. Zuerst in Johannesburg, dann in Madikwe, in Hoedspruit, in Manguzi, in Jozini, in Phinda, in Cederberg, in Wilderness, in Simon’s Town, in Oudtshoorn – und Kapstadt. Immer, immer wieder Kapstadt.
Ja, zugegeben, gar nicht so weit entfernt von dem Jetset-Lifestyle, den ich doch ein paar Zeilen weiter oben noch austauschen und wegschieben wollte, gar nicht so weit entfernt vom Hype um Locations, Partys, Status, Egos und Wegwerfkultur. Und dann doch. Zumindest für mich. Denn als ich hier in Kapstadt zum ersten Mal aus dem Taxi steige, mich umringt von der Weite des ungezähmten Atlantischen Ozeans und unter dem Schutz der thronenden Zwölf Apostel wiederfinde, die wie Ahnenväter über die Stadt wachen, spüre ich keinen Hype, keine Hast, sondern instinktive Verbundenheit. Ich fühle mich nicht fremd an diesem Ort, den ich zum ersten Mal in meinem Leben betrete, nicht wie jemand, der gerade erst ankommt – sondern endlich zurückfindet. Als wäre ich schon einmal hier gewesen, als hätte mich das Universum nur beinahe dreißig Runden um die Sonne geschickt, bis es mich wieder hierherbringen wollte.
Mein ganzes Leben lang hatte ich gewusst, immer wieder in jeder Faser gefühlt, dass ich reisen musste, dass ich immer wieder aufbrechen wollte, egal wohin, unterwegs sein, mich manchmal treiben lassen, manchmal gezielt entdecken, erleben, aufsaugen – und dann mitnehmen. Ich fühlte mich lebendig, wann immer ich unterwegs war, wann immer ich noch so viel mehr von der Welt sehen durfte.
Hier in Kapstadt dachte ich zum ersten Mal über das Bleiben nach. Zum ersten Mal nicht über das Bleiben-Müssen, sondern das Bleiben-Wollen.