
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Alle sagen Petula, dass sie keine Schuld am Tod ihrer kleinen Schwester hat. Aber so einfach ist das nicht. Petula ist nun überzeugt, dass das Schicksal hinter jeder Ecke mit einer bösen Überraschung auf sie lauert. Als sie Jacob kennenlernt, kann Petula ihre maßlosen Ängste Schritt für Schritt hinter sich lassen. Bis zu dem Tag, als sie erfährt, dass Jacob nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat. Susin Nielsen erzählt die Geschichte einer Handvoll Jugendlicher, die alle Schweres durchgemacht haben und sich, jeder auf seine Weise, schuldig fühlen. Wie schon in Adresse unbekannt gelingt es ihr auch hier, ein ernstes Thema mit großartigem Humor zu vereinen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klappentext
Nicht schon wieder der!, denkt Petula. Jetzt taucht Jacob, der Neue in ihrer Klasse, auch noch in ihrer Therapiegruppe auf!
Petula will sich nicht eingestehen, dass sie Jacob toll findet. Denn dann müsste sie ja vielleicht aus ihrem Schneckenhaus heraus. Ihre Angst vor dem Leben angehen. Sich auf jemand anderen einlassen. Niemals!
Doch Jacob bringt frischen Wind in die Therapiegruppe. Und plötzlich erkennt Petula, dass die anderen mit ganz ähnlichen Problemen kämpfen wie sie selbst. Schritt für Schritt kann sie die Mauer um sich herum niederreißen. Bis zu dem Tag, an dem sie erfährt, dass Jacob nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat …
Wie in ihrem Erfolgstitel Adresse unbekannt gelingt es Susin Nielsen auch in diesem Buch, ein tief berührendes Thema mit herrlichem Humor zu vereinen. Eine Geschichte von Freundschaft, einer ersten, zarten Liebe, von einem Mädchen, das seine Ängste zu überwinden lernt. Eine Geschichte voller Spannung, Warmherzigkeit – und Optimismus.
»Ein einfühlsames, zutiefst bewegendes Buch, witzig und mit köstlichen Dialogen erzählt.«
Publishers Weekly
Für alle Katzenfreaks da draußen. Ihr wisst schon, wen ich meine.
Ein Pessimist ist häufiger im Recht
als ein Optimist,
aber ein Optimist hat mehr Spaß …
Und weder der eine noch der andere
kann den Lauf der Dinge aufhalten.
Robert A. Heinlein
Als ich den Robotermann zum ersten Mal sah, war ich von oben bis unten mit Glitter übersät.
Es war ein typischer Freitagnachmittag bei der Gruppe Freies Gestalten und Kunsttherapie für Jugendliche, kurz FuKJu. Ich versuchte gerade, Ivan dem Schrecklichen bei unserem neuesten und schwachsinnigsten Projekt zu helfen. Wie üblich weigerte sich Ivan, sich zu konzentrieren. Stattdessen drückte er eine Tube Regenbogenglitter aus, über meine Katzenmütze und mich. Alonzo kicherte mitfühlend. Koula grunzte vor Lachen. Paradiesische Zustände, wie üblich.
Wir saßen im Gemeinschaftsraum der Beratungsstelle. Dort war es immer antarktisch kalt oder saudiarabisch heiß. Obwohl es Anfang Januar war, hatte ich mich bis auf mein Batiktop ausgezogen. Ivan knuffte meinen nackten Arm, mit denselben Fingern, die noch wenige Augenblicke zuvor in seiner Nase gesteckt hatten. Ich griff in meinen Stoffbeutel und suchte die Flasche mit Händedesinfektionsmittel, als plötzlich eine der Bürotüren aufging.
Ivan schaute auf. »Guck mal, Petula«, sagte er. »Ein Riese.«
Der Robotermann war kein Riese. Aber er war um einiges größer als einen Meter achtzig. Alles an ihm war überdimensioniert. Über dem rechten Arm trug er einen schrill orangenen Anorak, was definitiv zu viel des Guten für einen Winter in Vancouver war. Er war schätzungsweise so alt wie ich, hatte dichte braune Locken und große braune Augen, die vom Weinen gerötet waren.
Der Robotermann kam aus Carol Polachuks Büro. Ich hatte selber schon viele Stunden in diesem seelenlosen Raum zugebracht, in dem ich mich genötigt sah, mit der Meisterin der ›Los geht’s!‹-T-Shirts, der Glubschaugen und der herablassenden Attitüde zu reden. Carol konnte eines richtig gut, und zwar dafür sorgen, dass man sich noch beschissener fühlte. Es überraschte mich daher nicht, dass der Robotermann verwirrt wirkte. Und wütend. Und tieftraurig.
Ich kannte diesen Gesichtsausdruck. Der Robotermann war nicht da drin gewesen, um über seine beruflichen Karrierechancen zu reden. Wegen Kleinkram ging man nicht zu Carol Polachuk.
Er war einer von uns.
Eine Millisekunde lang sahen wir einander an.
Dann lief er zielstrebig zur Tür.
Augenblicklich verschwand er aus meinem Hirn und ich begann, mich mit Desinfektionsmittel einzureiben.
Ende der Geschichte.
Oder auch nicht.
Am Montagnachmittag sah ich ihn wieder. Ich stand vor meinem Geschichtskurs, in meinem Präsentationsoutfit: schlichtes, weißes T-Shirt, lila Häkelweste und lila Gummistiefel, die meine gestreiften Glücksbringerstrümpfe verbargen.
Die Hälfte des Referats hatte ich hinter mir. Die Aufgabe: Erläutere ein historisches Ereignis, das Auswirkungen bis in die Gegenwart hat.
Ich hatte mich für den 11. September 2001 entschieden. 9/11, der Tag, an dem Terroristen zwei Flugzeuge entführten und in die Türme des World Trade Centers in New York flogen. Ich wollte über die politischen Folgen sprechen und darüber, wie dieses Ereignis unsere Wahrnehmung von persönlicher Sicherheit verändert hatte.
Doch so weit sollte ich nie kommen.
Viele Menschen auf den Stockwerken unterhalb der Einschlagstelle konnten über die Treppen entkommen, bevor die Türme einstürzten. Aber den Menschen oberhalb davon muss bewusst gewesen sein, dass sie dem Tod geweiht waren, dass niemand sie retten würde, denn wie auch? Diese Türme ragten praktisch in den Himmel.
Ich dachte oft über diese Menschen nach. Darüber, wie normal ihr Tag begonnen hatte. Darüber, dass sie durchschnittliche menschliche Wesen waren, wie ich, wie Mom und Dad, wie wir alle.
Ich stellte mir einen Mann vor, der überlegte, ob es noch zu früh sei, sein Mittagessen auszupacken, weil er, obwohl es erst kurz nach neun war, schon Hunger hatte. Ich stellte mir eine Frau vor, die sich um ihren Sohn sorgte, weil er geweint hatte, als sie ihn morgens in den Kindergarten gebracht hatte.
Sie erwarteten einen Tag wie jeden anderen.
Diesen Teil meiner Präsentation wollte ich kurz halten, bloß die Fakten darlegen, um dann auf die Auswirkungen zu sprechen zu kommen.
Doch ich konnte den Gedanken an all die unschuldigen Opfer nicht abschütteln. Oder an die Menschen, die sie zurückgelassen hatten, die Kinder, Partner, Eltern und Freunde, deren Liebste nach der Arbeit nicht nach Hause kamen, weder an jenem noch einem anderen Tag. In diesem Augenblick änderte sich ihr Leben für immer.
Mein Herz fing an zu rasen. Mein Atem wurde hastig, kam in kurzen Schüben. Ich machte den Mund auf, aber es drang kein Wort heraus. Meine Klassenkameraden schauten beunruhigt.
Da sah ich ihn, an einem Tisch ganz hinten im Raum.
Mein letzter Gedanke war: O Gott, ich trage meine alte Oma-Unterwäsche, o Gott, bitte lass meinen Rock nicht hochrutschen –
Dann sackten meine ganzen einhundertachtzig Zentimeter gesammelt zu Boden.
Eine Stunde später saß ich Mr Watley gegenüber in meinem Lieblingssessel mit dem knubbeligen, bunten Stoffbezug. In den vergangenen zwei Jahren hatte ich so oft darin gesessen, dass die Sitzfläche sich perfekt an meinen Hintern angepasst hatte.
Mein Lieblingssessel war er deshalb, weil er am weitesten von den Bücherregalen entfernt stand, die nirgends befestigt waren. O ja, das hatte ich überprüft. Falls es also ein Erdbeben gab – und in Vancouver ist das eine Frage des Wann, nicht des Ob –, konnte ich von herabfallenden Büchern schwer verletzt werden. (Ich versuchte, nicht an das ganze Gebäude zu denken, welches im Falle eines Erdbebens mit einer Stärke von mehr als fünf auf der Richterskala wie ein Jenga-Turm in sich zusammenstürzen würde. Denn darüber nachzudenken hieße, die Schule zu verlassen, ebenso wie Vancouver, und irgendwo allein in einer Höhle zu leben, was meine Eltern fertigmachen würde. Obendrein wäre ich eine leichte Beute für jeden psychopathischen Serienmörder, der zufällig vorbeikäme. Und/oder ich würde mir wegen der feuchten Kälte eine Atemwegserkrankung zuziehen und einen langsamen, qualvollen Tod sterben. Der Tod durch ein Erdbeben trat zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach rascher ein.)
Trotz der Bücherregale mochte ich das Büro unseres Direktors. Es war überraschend warm und gemütlich, mit Stehlampen anstelle von Neondeckenleuchten. Außerdem hatte Mr Watley auf seinem Schreibtisch noch immer die Einmachglasschneekugel stehen, die ich in der neunten Klasse für ihn gemacht hatte. Ich nahm sie in die Hand und schüttelte sie kräftig, und die Schneeflocken rieselten auf ein kleines Legogebäude, auf dem Princess Margaret Secondary geschrieben stand.
Mit seinen großen, wässrigen Augen sah Mr Watley mich an. Er hatte ziemliche Ähnlichkeit mit einem Bernhardiner. »Geht’s dir besser, Petula?«
»Viel besser. Die Schulkrankenschwester hat mich komplett durchgecheckt. Für die Entlassung geeignet befunden.«
»Du hattest solche Fortschritte gemacht. Ich hatte gehofft, wir hätten diese Zwischenfälle hinter uns.«
»Ich auch.« Meine letzte krasse Panikattacke lag mindestens drei Monate zurück, im Biounterricht. Ansteckende Krankheiten waren das Thema gewesen. Ich hatte über den Ebolavirus gesprochen, der durch Körperflüssigkeiten übertragen wird und zu einem grausamen Tod führt. Als ich erwähnte, wie rasch dies zu einer weltweiten Epidemie führen könnte, war ich zusammengebrochen.
»Zumindest treten sie nun seltener auf und die Zeitabstände sind größer«, sagte Mr Watley. Er fuhr sich über den Kopf. Ich wünschte, seine Frau würde ihm sagen, dass er mit seinen paar über die Glatze gekämmten Haaren niemanden täuschen konnte. Doch ich hatte schon oft das Familienfoto angeschaut, das neben meiner Schneekugel stand. Es zeigte das grinsende Ehepaar Watley mit seinem Mops. Der Hund war bei Weitem das Attraktivste auf dem ganzen Bild. Vermutlich hatten sie eine Abmachung: Mrs Watley ignorierte die Haarsituation ihres Mannes, und er ignorierte das riesige Muttermal an ihrem Kinn. »Trotz allem, Petula, wir haben vereinbart, dass du dich von Themen fernhältst, die so etwas bei dir auslösen.«
»Ja.«
»Über die Opfer zu sprechen, wäre nicht nötig gewesen.«
Vor seinem Fenster goss es in Strömen. »Das war nur ein kleiner Teil. Darüber hinaus hatte ich gute sachliche Argumente.«
Er legte die Fingerspitzen aneinander und stützte sein Kinn darauf ab. »Zum Beispiel?«
»Zum Beispiel, dass 9/11 alles verändert hat. Dass wir jetzt in einer Welt leben, in der ein terroristischer Angriff eine ständige Bedrohung darstellt.«
»Ich dachte, wir vermeiden diese Art von negativem Denken.«
»Sir, das ist nicht negativ, sondern realistisch. Meine These war, dass 9/11 uns gelehrt hat, wachsamer zu sein. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.«
»Mir ist klar, dass die Welt nicht immer sicher wirkt. Aber wir leben in Vancouver. In Kanada. Es ist …«
»Sagen Sie’s nicht, Sir. Nirgendwo ist es sicher.«
»Nun gut, selbst wenn wir in diesem Punkt unterschiedlicher Meinung sind, so müssen wir doch weiter unser Leben leben, oder nicht? Wir können nicht andauernd in Angst leben. Wir können uns nicht bei jedem Flugzeug, das über uns hinwegfliegt, fragen, ob es entführt wurde. Wir können uns nicht bei jedem Menschen auf der Straße fragen, ob er oder sie eine schmutzige Bombe bei sich trägt.«
Ich kann das schon, dachte ich. Ich kann für euch arme Unwissende wachsam sein. »Nein, aber wir sollten auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Bildlich gesprochen natürlich. Wenn man den Kopf wirklich in den Sand steckt, erstickt man.«
Mr Watley dachte kurz nach. Dann deutete er auf die Tasse auf seinem Schreibtisch. »Sag mir, was du siehst.«
»Eine halb leere Tasse Kaffee.«
»Ich sehe eine halb volle Tasse Kaffee.« Er lächelte triumphierend, als habe er gerade etwas sehr Tiefsinniges gesagt.
»Und deshalb werden Sie vor mir sterben.«
Er blinzelte ein paarmal. »Nun, das hoffe ich doch. Ich bin immerhin zweiundfünfzig, und du erst fünfzehn …«
»Sechzehn, seit letzter Woche. Aber das Alter tut nichts zur Sache; Studien haben erwiesen, dass Optimisten zehn Jahre früher sterben als Pessimisten.«
»Das halte ich für wenig glaubhaft.«
»Natürlich tun Sie das, Sie sind Optimist. Sie gehen von der irrigen Annahme aus, dass sich alles in Ihrem Sinne fügen wird. Sie erkennen Gefahren nicht, bis es zu spät ist. Pessimisten sind realistischer. Sie treffen eher Vorsichtsmaßnahmen.«
»Das scheint mir ein recht trauriges Leben zu sein.«
»Es ist ein sicheres Leben.«
Mr Watley seufzte. Er rieb sich die wässrigen Augen.
»Das ist eine todsichere Methode, um sich eine Bindehautentzündung einzufangen.«
Er ließ die Hand sinken und betrachtete mich mitfühlend, was ich einerseits verabscheute, andererseits aber auch mochte. »Wie läuft’s bei FuKJu?«
»Sie wissen, was ich davon halte.«
»Ja, und ich hoffe immer noch, dass du deine Einstellung änderst.« Er warf einen Blick auf die Uhr. »Na gut. Ab in den Unterricht mit dir.«
Da es nur noch zehn Minuten bis zum Ende der Stunde waren, verspürte ich keinerlei Bedürfnis, in die Klasse zurückzugehen. »Klar.« Ich stand auf und machte eine kleine Verbeugung, anstatt ihm die Hand zum Zweck des Keimaustauschs zu reichen.
Ich verließ Mr Watleys Büro, bog nach links –
Und stieß mit dem Robotermann zusammen.
Unser beider Schulbücher flogen in hohem Bogen durch die Luft. Wir bückten uns, um unsere Sachen wieder aufzusammeln, und unsere Köpfe krachten – PLONK – aneinander.
Ich stand auf und rieb mir die Schläfe. »Au! Blödmann!«
»Äh, dir ist schon klar, dass du mich umgerannt hast, oder?«
Ich schaute hoch.
Betonung auf ›hoch‹.
Es ist so: Dass eine junge Frau von amazonenhaften Ausmaßen zu jemandem hochschaut, geschieht doch eher selten. Aber der Robotermann überragte mich locker um zehn Zentimeter.
Ich starrte ihn ein bisschen zu lange an. Seine Gesichtszüge wirkten, als seien sie minimal verrutscht. Würde man seine Nase und seine Augen hier und da einen Millimeter verschieben, könnte er vielleicht fast attraktiv sein. Stattdessen sah er aus wie ein Picasso-Gemälde vor Pablos komplett abstrakter Phase.
»Wie fühlst du dich?«, fragte er.
Ich wusste nicht, was er meinte, unsere Schädelkollision oder meine Ohnmacht in Geschichte, und es war mir auch egal. Ich schlüpfte an ihm vorbei und ging zu meinem Schließfach. Im Leben n.M. (nach Maxine) hatte ich Schwierigkeiten mit Smalltalk. Außerdem blieben mir nur noch fünf Minuten, um zu verschwinden, bevor der Flur sich mit Schülern füllte. Letztes Jahr, als es mir schlechter ging, hatte ich ernsthaft in Erwägung gezogen, eine Maske zu tragen wie die Leute in China, wenn die Luftverschmutzung zunimmt. Jetzt beschränkte ich mich auf die wesentlichen vernünftigen Maßnahmen: keine Leute oder Oberflächen anfassen und das Händewaschen auf zwei Durchgänge von Happy Birthday ausdehnen. Und nicht in dieser Keimbrutstätte verweilen.
Der Robotermann lief mir nach und stand daneben, als ich mein Spindschloss erst nach links und dann nach rechts drehte. »Du solltest keine Leute verfolgen«, sagte ich. »Besonders keine Mädchen. Das ist gruselig.« Sein nicht mehr ganz weißer Pulli miefte nach Mottenkugeln.
»Im Ernst. Geht’s dir gut? Du bist umgefallen wie ein Sack Kartoffeln.«
Als müsste man mich daran erinnern. Nachdem ich wieder zu mir gekommen war, hatte Ms Cassans Strickjacke unter meinem Kopf gelegen und das Mädchen, das früher mal meine beste Freundin gewesen war, hatte besorgt auf mich herabgeschaut. »Hat jemand meine Unterwäsche gesehen?«, platzte ich heraus.
»Nein.«
Ich riss die Tür zu meinem Schließfach auf und schnappte meine Seemannsjacke; die Freiheit war so nah, ich konnte sie beinahe schmecken. Doch als ich am Robotermann vorbei wollte, streckte der die rechte Hand aus. »Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Jacob Cohen.«
Ich konnte nicht anders. Ich gaffte ihn an.
Seine Hand war nicht echt. Sie war schmal, schwarz und ganz sicher maschinell hergestellt.
Er bemerkte meinen Blick. »Ziemlich cool, was? Wie aus Ich, der Robot.«
»Oder Der Gigant aus dem All.«
»Ha! Ja. Großartiger Film.«
»Das Buch ist besser.« Als Kind hatte ich es geliebt.
»Das gibt es als Buch?«
Ich ließ ihm das durchgehen. Seine Roboterhand schwebte noch immer vor mir.
»Na los, gib mir die Hand«, sagte er. »Sie hat zwölf verschiedene Greifeinstellungen.«
Ich saß in der Klemme. Wenn ich ihm die Wahrheit sagte – dass ich nie jemandem die Hand gab –, würde er denken, dass mich seine Robotergliedmaßen abschreckten. Was auch stimmte. Doch obwohl meine Sozialkompetenz derzeit ›suboptimal‹ war, wie ich ein paar Mädchen aus meinem Sportkurs hatte sagen hören, war ich nicht grausam.
Also gab ich ihm die Hand. Ich hörte ein mechanisches Surren und die Finger seiner schwarz glänzenden künstlichen Hand umschlossen meine. Nach einer gefühlten Ewigkeit surrte es erneut und meine Hand war frei.
Es klingelte. Ein Gefühl der Beklemmung schnürte mir die Kehle zu.
»Jetzt muss ich aber wirklich gehen.« Ich stopfte meine Schulsachen in den Stoffbeutel.
»Ich habe das Gefühl, dass ich dich schon mal irgendwo gesehen habe. Also, vor heute. Aber ich bin erst vor einer Woche hergezogen.«
Ich verriegelte meinen Spind und ließ ihn stehen. Ich würde ihm nicht sagen, wo er mich gesehen hatte, zu seinem Wohl und auch zu meinem. Was in der Beratungsstelle ablief, blieb in der Beratungsstelle.
Mit den Ellbogen drückte ich die Eingangstür auf und ging nach draußen. Ich atmete ein und genoss einen kurzen Moment der Erleichterung. Wieder einmal hatte ich einen Schultag überlebt.
Nun galt es, den Heimweg zu überstehen.
Der Weg nach Hause dauerte eine Viertelstunde. Das waren ganze acht Minuten mehr als üblich, denn zwischen der Schule und unserer Wohnung war im Dezember ein Gebäude abgerissen worden, und nun befand sich dort eine Baustelle, die fast den gesamten Block einnahm. Also musste ich einen Umweg gehen, um sie zu meiden.
Ein Stück die Straße runter sah ich das Mädchen, das früher mal meine beste Freundin gewesen war, und ihre Clique an der Baustelle vorbeilaufen. Beinahe hätte ich gerufen, um sie zu warnen. Aber ich wusste, sie würde mich bloß genervt und mitleidig anschauen, also ließ ich es bleiben. Anstatt geradeaus zu gehen, bog ich nach links ab und ging im Kopf meine Checkliste durch.
Nur an dafür vorgesehenen Überwegen und Kreuzungen die Straße überqueren: o.k.
Erst dann auf die Straße laufen, wenn sämtlicher Verkehr vollständig zum Halten gekommen ist: o.k.
Den Gehweg auf verdächtige Objekte, Taschen oder Pakete überprüfen: o.k.
Unverantwortliche Hundehalter, die ihr besagtes Tier nicht angeleint haben, obwohl es das Gesetz verlangt, weiträumig umgehen: o.k.
Nicht zum Kauspielzeug für Tiere werden: o.k.
Gelegentlich nach hinten schauen, um sicherzugehen, dass man nicht verfolgt wird: o.k.
Alarmpfeife um den Hals tragen: o.k.
Schlüssel fest zwischen den Fingern halten: o.k.
Der Angstknoten löste sich, als ich unsere Straße erreichte, eine ruhige Einbahnstraße im West End von Vancouver.
Es ist eine schöne Straße. Kastanien zu beiden Seiten und die Häuser sind niedrig. Unseres steht in der Mitte des Blocks, vier Stockwerke, gelbe Backsteine, über der Eingangstür der Schriftzug Arcadia. Wir wohnen ganz oben oder, wie Dad gern witzelt, im Penthouse.
Unsere Straße und unser Haus waren nicht gefahrenfrei. Aber ich hatte meine Sicherheitszonen, und dies war eine davon. Zum einen hatte ich gebührende Sorgfalt walten lassen, als wir vor über einem Jahr eingezogen waren. Ich hatte anonym alle möglichen Bauaufsichtsbeauftragten angerufen. Dank mir sind die elektrischen Leitungen jetzt ordnungsgemäß und jede Wohnung verfügt über eine neue Sprinkleranlage. Man könnte meinen, der Hauseigentümer sei darüber erfreut gewesen, doch stattdessen schickte er einen Brief an sämtliche Mieter und drohte damit, »die Ratte auffliegen zu lassen«.
Hat er nicht.
Allerdings bekam er eine Antwort auf seinen Brief. Eine Postkarte ohne Absender mit einer kurzen Nachricht auf der Rückseite: Meinetwegen!
Als ich in die Wohnung kam, machte ich zuallererst die Geruchsprüfung. Auf einer Skala von eins bis zehn lagen wir heute bei drei. Das Auswechseln der Streu in den Boxen hatte Zeit bis morgen.
Moms rote Gummistiefel standen im Flur. Ich stellte meine lilafarbenen daneben und zog meine Jacke aus. Pippi Langstrumpf, Stuart Little, Mumin-Mama und Ferdinand umzingelten mich. »Ich bin zu Hause!«, rief ich.
»Hallo, Tula. Ich bin im Schlafzimmer.«
Die Katzen miauten und rieben sich an meinen Beinen. »Schon gut, schon gut, gebt mir eine Sekunde«, sagte ich so streng wie nur möglich, was aufgrund ihres alarmierend hohen Niedlichkeitsgrades nahezu unmöglich war. Ich konnte nicht einmal besonders wütend werden, als ich meine Stofftasche im Wohnzimmer ablegte und sah, dass eine von ihnen – ich wette, Pippi Langstrumpf – ein erschreckend großes Häufchen mitten auf dem Teppich hinterlassen hatte. Wie kann etwas so Winziges etwas so Großes aus sich herauspressen?, fragte ich mich, nicht zum ersten Mal.
Ich zog Gummihandschuhe an und putzte die Sauerei weg, hörte den Anrufbeantworter ab, hoffentlich vor Mom. Natürlich hatte die Schulkrankenschwester eine Nachricht hinterlassen. Ich löschte sie. Dann holte ich eine Tüte Leckerli aus der Küche und gab jeder Katze zwei. »Damit schafft ihr’s bis zum Abendessen.«
Mit unserer ältesten Katze Ferdinand auf dem Arm, wie ein pelziges, orangenes Kleinkind, ging ich zum Schlafzimmer meiner Eltern. Mom saß in Arbeitsklamotten am Computer und tippte eine E-Mail. Ihr welliges, kastanienbraunes Haar hatte sie zu einem Dutt aufgezwirbelt. Maxine hatte auch solche weichen Locken gehabt, und ich hatte sie immer ein bisschen darum beneidet. Meine Haare sind langweilig und glatt. Einen Monat zuvor hatte ich sie abgeschnitten, um wie Lena Dunham auszusehen. Stattdessen wurde Beaker von den Muppets draus. Tatsächlich ist meine Augenfarbe das einzige kompensierende äußerliche Merkmal, das ich von meiner Mutter habe, die viel schöner ist als ich. Wir haben beide haselnussbraune Augen, eher grün als braun.
»Hallo, Mom. Wie war dein Tag?«
»Ach, gut. Ich habe mehr Bücher als Kerzen verkauft, und das ist immerhin erfreulich.« Mom arbeitet in einer Buchhandelskette in einem Einkaufszentrum in Burnaby, und die Geschäftsführer lieben sie, weil sie, anders als andere Angestellte, tatsächlich liest.
Sie schickte ihre E-Mail ab und drehte sich um.
Mein Gesichtsausdruck entgleiste. »Du hast doch nicht …«
Auf ihrem Schoß eingerollt lagen zwei pechschwarze Katzen. »Hab ich wohl.«
»Du hast es versprochen.«
»Ich weiß, ich weiß, aber was hätte ich denn tun sollen? Angie rief mich an, weil sie Hilfe brauchte.« Angie leitet die städtische Katzennothilfe, bei der Mom sich ehrenamtlich engagiert. »Sie haben die beiden herrenlos und halb verhungert unter einer Veranda gefunden. In den anderen Tierheimen gibt es keinen freien Platz. Angie hat sie vor einer Stunde hergebracht. Es ist ja nur so lange, bis wir ein richtiges Zuhause für sie finden.«
»Das hast du auch bei Pippi Langstrumpf, Stuart Little und Mumin-Mama gesagt.«
»Es ist schwieriger, eine Bleibe für die älteren zu finden. Die beiden hier sind noch jung, also sollte es nicht so schlimm werden.« Mom hielt mir eine der schwarzen Katzen hin. Ferdinand fauchte. »Den hier nenne ich Stanley, nach Stanleys Party. Und das ist Alice, aus Alice im Wunderland.«
Ich liebe Katzengesichter. Ich kraulte Stanleys Ohren und er schnurrte in einer Tour, wirkte friedfertig und sanftmütig. Aber das änderte nichts an den kalten, harten Fakten, zum Beispiel, dass wir uns kaum die vier Katzen leisten konnten, die wir schon hatten. »Dad bringt dich um.«
»Ich regle das mit ihm«, sagte sie leichthin. Als sei es die einfachste Sache auf der Welt.
Zum Abendessen kochte Mom eine Tofupfanne. Ich machte einen Salat, entfernte die äußeren Blätter und warf sie weg, wusch die übrigen mit ein wenig Spülmittel. Mom war der felsenfesten Überzeugung, dass sie das rausschmecken konnte, aber ich erinnerte sie daran, dass ein bisschen Spülmittel besser war als eine Infektion mit Kolibakterien. Nachdem wir uns je eine Portion genommen hatten, machte ich einen Teller für Dad zurecht, in Form eines Smiley-Gesichts, und stellte ihn mit Plastikfolie abgedeckt in den Kühlschrank.
Beim Essen schauten wir ein Katzenvideo auf Moms Laptop an. Alle sechs Katzen lagen bei uns im Wohnzimmer. Ferdinand machte den Neulingen klar, wer der Herr im Haus war. Alice tippelte erst zögerlich auf meinem Rock hin und her, rollte sich dann auf meinem Schoß zusammen und schlief ein. Mom lächelte. »Du musst doch zugeben, es ist schon schön, ein paar neue Babys zu haben.«
Ja, meine Mutter nennt die Katzen ihre Babys. Und ja, es ist nicht schwer, darin einen tieferen Sinn zu entdecken. Die Katzen – besonders Ferdinand – halfen ihr, sich nach Maxines Tod aus ihrem schwarzen Loch der Verzweiflung herauszuziehen, was sonst niemandem – weder mir noch Dad noch ihrem Therapeuten – geglückt war.
Auf dem Bildschirm versuchte Maru, die japanische Katze, in immer noch kleinere Kisten zu kriechen. Ich kannte das Video schon, aber es brachte mich jedes Mal wieder zum Lachen.
»Weißt du noch, als Opa und Oma Maxine den Spielzeugherd geschickt haben?«, fragte Mom. »Und sie den Karton viel interessanter fand?«
»Ich hab ihr geholfen, ein Spielhaus daraus zu machen.«
»Sie liebte diesen Karton.« Mom fing immer wieder mit solchen Erinnerungen an meine kleine Schwester an. Manchmal machte es mir nichts aus; manchmal wünschte ich, sie würde einfach die Klappe halten.
Heute wünschte ich, sie würde einfach die Klappe halten.
Als ich den Geschirrspüler eingeräumt und die Arbeitsplatte mit antibakteriellem Reiniger geschrubbt hatte, duschte ich, nicht ohne vorher zu prüfen, ob die Gummimatte rutschfest war. Die Statistiken zu Verletzungen und Todesfällen aufgrund eines Sturzes in der Badewanne sind alarmierend.
Nach dem Duschen war ich froh über den beschlagenen Spiegel, denn so musste ich meinen langen, dürren Körper nicht nackt sehen. »Du hast die Größe eines Supermodels ohne das Aussehen eines Supermodels«, hatte ein Junge namens Carl mir in der sechsten Klasse sachlich erläutert, als ich den ersten von vielen Wachstumsschüben hatte und alle anderen Kinder überragte. »Na ja, bis auf deine Möpse. Das sind Supermodelmöpse. Winzig klein.« Ich war nicht traurig, als Carl und seine Familie nach Moose Jaw, Saskatchewan, zogen.
Ich flitzte nackt durch den Flur in mein Zimmer, schmiss meine getragenen Klamotten auf den Haufen auf dem Boden und zog meinen Hausanzug an, einen Pinguineinteiler. Rachel, das Mädchen, das mal meine beste Freundin gewesen war, hatte genauso einen; wir hatten sie zusammen genäht, damals, als wir unzertrennlich waren. Ich fragte mich oft, ob sie ihren wohl noch trug. Ein- oder zweimal hatte ich ihr fast eine Mail geschrieben, um sie zu fragen.
Fast.
Der Bücherturm neben meinem Bett war dank Katzeneinwirkung umgekippt. Ich stapelte ihn wieder auf und zog mein Bilderalbum aus dem Versteck unter meinem Bett hervor. Ich hatte nichts Neues hinzuzufügen, aber ich schaute es eine Weile an, weil es mich beruhigte.
Als ich fertig war, kroch ich ins Bett und zog mir den neuesten Roman von Ann-Marie MacDonald rein. Das ist einer der Vorteile von Moms Job: Sie kriegt oft Leseexemplare von Büchern, bevor sie veröffentlicht werden, und reicht sie an mich weiter, wenn sie durch ist.
Kurz nach elf hörte ich Dad nach Hause kommen. Ein paar Minuten später piepte die Mikrowelle. Ich hoffte, dass ihm der Smiley aufgefallen war. Ich hoffte, er hatte ihn zum Lächeln gebracht.
Ich hoffte, er würde Alice und Stanley erst am nächsten Morgen bemerken.
Einen Moment überlegte ich, ihm beim Essen Gesellschaft zu leisten. Ich stellte mir uns beide auf dem Sofa vor. Ich stellte mir vor, wie ich meine Füße auf seinen Schoß legte. Ich stellte mir vor, wie er Witze über den Geruch machte und mir dann eine seiner berühmten Fußmassagen verpasste.
Vor ein paar Jahren – als es Maxine noch gab und das Leben unendlich und voller Möglichkeiten erschien – war ich bei dem Mädchen, das mal meine beste Freundin gewesen war, zu Hause gewesen und wir hatten Windspiele aus Kronkorken gebastelt. Einer war unter die Fernsehkonsole gerollt. Sie hatte danach gesucht und nicht bloß den Kronkorken, sondern auch eine verstaubte, hüllenlose DVD mit dem Titel Das Geheimnis gefunden.
»Was denkst du, was das ist?«, fragte sie.
»Keine Ahnung.«
Irgendwie hatten wir beide Angst, es rauszufinden. Wenn ihre Eltern nun auf schräge Sexspiele standen? Dieses Wissen würden wir nie wieder aus unseren Hirnen löschen können. Doch die Neugier siegte. Wir legten die DVD ein.
Es hatte nichts mit Sex zu tun. Eher war es eine Art Selbsthilfevideo, eine Anleitung, wie man durch die Kraft seiner Gedanken glücklich wird. Wenn man zum Beispiel ein Foto von einem Auto, das man gern hätte, ausschneidet und dann die ganze Zeit das Foto anstarrt und sich vorstellt, man würde das Auto fahren – sofern man fest genug daran glaubt, dass man es verdient –, dann kriegt man es durch die bloße Kraft seiner Gedanken schließlich auch. Das zumindest schloss ich aus der ganzen Sache. Selbst mit zwölfeinhalb Jahren fanden wir, dass das ziemlicher Quatsch war, aber das hielt uns nicht davon ab, es eine Zeitlang auszuprobieren. Rachel schnitt ein Foto mit sämtlichen Bandmitgliedern von One Direction aus (weil, wie sie sagte, ihr »so ziemlich jeder davon recht wäre«) und versuchte sich vorzustellen, dass einer von ihnen ihr Freund sei. Ich probierte es mit etwas Realistischerem und wählte ein Foto von einer Klebepistole.
Zu Weihnachten bekam ich die Klebepistole. Rachel bekam keinen Freund von One Direction, aber sie ging eine Weile mit einem Jungen aus, der eine ähnliche Frisur wie Niall hatte.
Ich wünschte, auch der Gedanke, wie mein Vater und ich gemütlich schweigend auf dem Sofa lagen – vielleicht sogar Musik hörten –, würde Wirklichkeit werden.
Aber so funktionierte das Leben nicht. Also blieb ich, wo ich war.
Mumin-Mama hatte sich zu meinen Füßen eingerollt. Pippi Langstrumpf lag auf meiner Brust.
Maxine kam manchmal nachts in mein Zimmer und presste ihren kleinen Körper an mich. Morgens war ich komplett verschwitzt, aber es machte mir nie etwas aus, denn es war wundervoll, ihren winzigen, pummeligen Kleinkindbauch zu spüren, zu sehen, wie ihre Brust sich hob und senkte, und ihren heißen Atem an meiner Wange zu fühlen.
Bevor ich das Licht ausmachte, nahm ich das Foto meiner


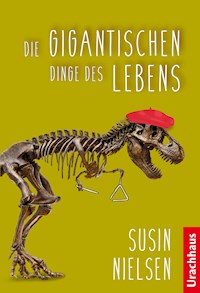













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












