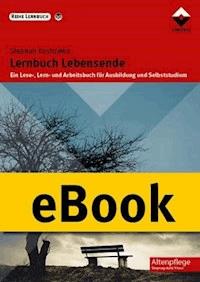29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Praxisorientiertes Handbuch zur palliativen Pflege, das einfühlsam das "Leben in einem permanenten Augenblick" von Menschen mit einer Demenz beschreibt und zeigt, wie Pflegende sterbende demenzkranke Menschen pflegen, unterstützen und begleiten können. Der erfahrene Autor und Dozent bietet Empfehlungen und handlungsorientierte Lösungen auf den Ebenen des Symptommanagements und des kommunikativen Handelns in der Sterbebegleitung integriert die nationalen Expertenstandards zum Schmerzmanagement und zur Beziehungsgestaltung mit Menschen mit Demenz zeigt typische Konfliktfelder auf, wie den Einsatz von Morphinpräparaten, Flüssigkeits- und Nahrungsverweigerung und herausforderndes Verhalten sensibilisiert für die veränderte Informationsverarbeitung und das Erleben von Menschen mit Demenz und deren -spirituelle Bedürfnisse beschreibt das Assessment und Symptommanagement von Aggression, Atemnot, Durst, Mundtrockenheit, Unruhe und Schmerzen erläutert Konzepte zur Begleitung von sterbenden Menschen mit Demenz von der Hospizidee, über die Basale Stimulation, Biografie- und Angehörigenarbeit, Fallarbeit, Namaste Care, Palliative Care und das therapeutische Gammeln, bis hin zur Validation vernetzt professionelle Dienstleister, Demenzbeauftragte und ehrenamtlich Helfende bietet Arbeitshilfen, wie Biografiebögen, Angehörigenbroschüren, Curricula und Schmerzassessments erleichtert den Praxistransfer durch Fallbeispiele, -Reflexionsfragen, Rollenspiele und Übungen. "Die Lektüre dieses Buches ist absolut empfehlenswert. Es ist abwechslungsreich, übersichtlich, lehrreich und gut strukturiert." Altenpflege
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stephan Kostrzewa
Palliative Pflege von Menschen mit Demenz
3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Palliative Pflege von Menschen mit Demenz
Stephan Kostrzewa
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
André Fringer, Winterthur; Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Angelika Zegelin, Dortmund
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Palliative Care:
Christoph Gerhard, Dinslaken; Markus Feuz, Zürich
Stephan Kostrzewa. Dr. rer. medic., Dipl. Sozialwissenschaftler, Altenpfleger, Organisationsberater und Projektbegleiter.
Wallstraße 4, DE-45468 Mühlheim an der Ruhr
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z.Hd. Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Martina Kasper, Caroline Suter
Bearbeitung: Martina Kasper
Herstellung: René Tschirren, Daniel Berger
Umschlagabbildung: Getty Images/Pornpak Khunatorn
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Illustration/Fotos (Innenteil): Jürgen Georg, Schüpfen
Satz: Matthias Lenke, Weimar
Format: EPUB
3. vollst. überarb. u. erw. Auflage 2023/24
© 2023/24 Hogrefe Verlag, Bern
© 2008/2010 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96264-1)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76264-7)
ISBN 978-3-456-86264-4
https://doi.org/10.1024/86264-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Alice – meine Inspiration, meine Muse und mein Leben
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort zur dritten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur ersten Auflage
Einleitung
1 Demenz
1.1 Demenz – medizinisch betrachtet
1.1.1 Einteilung der Demenz nach Schweregraden
1.1.2 Das klinische Erscheinungsbild
1.1.3 Symptome nach Stadieneinteilung
1.1.4 Diagnostik
1.1.5 Medikamentöse Therapie
1.1.6 Nicht-medikamentöse Therapie: Milieugestaltung
1.1.7 Nicht-medikamentöse Therapie: Trainingsprogramme
1.1.8 Nicht-medikamentöse Therapie: Therapeutisches Gammeln
1.1.9 Empfehlungen zu den Therapieansätzen
1.1.10 Mortalität
1.2 Demenz – phänomenologisch betrachtet
1.2.1 „Instant Aging“
1.2.2 Phänomen des gegenwärtigen Erlebens
1.3 Kommunikation
1.4 Exkurs in die „Totale Institution“ nach Goffman
1.5 Person-zentrierter Ansatz nach Kitwood
1.6 Der Nationale Expertenstandard „Demenz und Beziehungsgestaltung“
1.6.1 Die fünf Prozessebenen
1.6.2 Verstehenshypothesen: STI-Methode
1.6.3 Erfassen von Wohlbefinden und Lebensqualität
2 Sterben und Sterbebegleitung
2.1 Tod, Modernität und Gesellschaft
2.1.1 Der Tod in der vormodernen Gesellschaft
2.1.2 Der Mythos vom schönen Tod in der traditionellen Gesellschaft
2.1.3 Der Übergang zum Todesbild der modernen Gesellschaft
2.1.4 Der Tod in der modernen Gesellschaft
2.1.5 Zusammenfassung
2.2 Sterben und Sterbender sein
2.2.1 Wie erleben ältere Menschen den herannahenden Tod?
2.2.2 Organisationskultur des Sterbens
2.3 Kernbedürfnisse Sterbender
2.4 Sterben und Demenz, ein Problem für wen?
2.5 Grenzen gängiger Sterbebegleitungsempfehlungen bei Menschen mit Demenz
3 Probleme in der symptomorientierten Versorgung Demenzkranker im Sterbeprozess
3.1 Problem der Kommunizierbarkeit von Symptomen
3.1.1 Schmerz
3.1.2 Problem der Pseudodemenz
3.1.3 Durst und Mundtrockenheit
3.1.4 Unruhe und Aggression
4 Konzepte und Ansätze für eine Versorgung Demenzkranker im Sterbeprozess
4.1 Hospizidee – Palliative Care
4.2 Palliative Versorgung
4.3 Schmerztherapie und Alter
4.4 Hospizkonzept und Palliative Care bei Demenz?
4.5 Gemeinsames Verständnis für die Erlebenswelt sterbender Menschen mit Demenz
4.6 Mögliche palliative und schmerztherapeutische Interventionen
4.6.1 Bei Schmerz
4.6.2 Nicht-medikamentöse Interventionen zur Schmerzreduktion
4.6.3 Expertenstandards und Schmerzmanagement bei Menschen mit Demenz
4.6.4 Bei Mundtrockenheit
4.6.5 Mögliche Flüssigkeitszufuhr und ihre Grenzen
4.6.6 Unruhe
4.6.7 Luftnot und terminales Rasseln
4.7 Basale Stimulation und validierende Haltung
4.7.1 Basale Stimulation in der Sterbebegleitung Demenzkranker
4.7.2 Validation – alter Wein in neuen Schläuchen
4.8 Angehörige und Biografiearbeit
4.8.1 Angehörigenarbeit und deren Integration
4.8.2 Schulderleben und Filiale Reife
4.8.3 Verschiedene Formen der Angehörigenarbeit
4.9 Gestaltung der Sterbebegleitungssituation – Eine Zusammenfassung
4.9.1 Validierende Grundhaltung
4.9.2 Sicherheit durch vertraute Umgebung – Milieugestaltung
4.9.3 Soziales Bezugssystem
4.9.4 Vertraute Berührungen als nonverbale Kommunikation (Gewohnheiten)
4.9.5 Palliative Ausrichtung der Intervention
4.9.6 Entwerfen von Ritualen und festen Abläufen
4.10 Namaste Care
5 Typische Konflikte
5.1 Einsatz von Opiaten
5.2 Flüssigkeits- und Nahrungsverweigerung
5.3 Hilfe durch Ethikberatung
6 Ausbildung – Fortbildungen – Befähigungen
6.1 Demenz in bestehenden Curricula des Palliative Care
6.2 Entwurf eines Curriculums für Inhouse-Fortbildung
7 Vernetzung und Ehrenamt
7.1 Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und deren Befähigung
7.2 Überleitung biografischer Informationen
7.3 Demenzbeauftragte (mit palliativem Auftrag)
8 Schluss, Diskussion und Perspektive
9 Zusatzmaterial
Anlage 1 Biografiebogen für Bewohner*innen
Anlage 2 Informationsbroschüre für Angehörige
Anlage 3 Curriculum
Anlage 4 BESD
Literatur
Dementia Care im Verlag Hogrefe
Palliative Care im Verlag Hogrefe
Glossar
Autor
Sachwortverzeichnis
|11|Vorwort zur dritten Auflage
Der Themenkomplex „Palliativversorgung von Menschen mit Demenz“ ist aktueller denn je. Warum? Zum einen, da die Zahl der Erkrankten zunehmend steigt und damit auch die Familien, die hiervon ebenfalls betroffenen sind. Die Alzheimer Gesellschaft geht für Deutschland von einer geschätzten Zahl von 1,8 Millionen Menschen mit Demenz aus (Alzheimer Gesellschaft, 2022). Genaue Zahlen gibt es nicht, da es hierfür kein Melderegister gibt. Sprechen wir aber von eigentlich Betroffenen, dann muss der Demenzerkrankte plus seine Zugehörigen gerechnet werden, denn betroffen sind immer die gesamte Familie, Freunde, Nachbarn und die weiteren Bekannten. Hieraus lässt sich schließen, dass es kaum eine Familie in Deutschland gibt, die nicht durch die Demenz eines Familienmitglieds beeinflusst ist. Hieraus ergibt sich eine große Unsicherheit und ein wachsender Bedarf an Informationen zum Thema „Umgang mit Menschen mit Demenz“. Der Markt reagiert hierauf mit einer Fülle an lukrativen – mithin nicht immer effektiven – Maßnahmen, Medikamenten, Konzepten und Angeboten. Demenz ist lukrativ! Das wiederum führt aber nicht dazu, dass die Allgemeinbevölkerung sich vermehrt mit dem Thema befasst, denn Demenz bekommen immer nur die anderen – es ist somit eine „Unberührbare“ für den Normalverbraucher. Die entworfenen Konzepte und Angebote richten sich fast ausschließlich an die Profis.
Zum anderen ist das Thema aber auch aus dem Grund aktuell, wenn nun der Erkrankte an sein Lebensende kommt, denn jetzt kommt die zweite „Unberührbare“ hinzu, das Sterben. Dieser Themenkomplex schreckt die öffentliche Diskussion zwar nicht mehr, da ja nun entsprechende Profis, wie z. B. Hospiz und Palliative Care, zur Verfügung stehen. Die machen das Bisschen schon! Aber ist das so? Ist die Hospizbewegung und die Palliative Care auf Menschen mit Demenz vorbereitet? Sind diejenigen, die einen Menschen mit Demenz am Lebensende versorgen ausreichend hierauf vorbereitet? Nein, leider immer noch nicht!
|12|Eigentlich ist es schon ein Stück weit frustrierend, dass die vorliegende Publikation über all’ die Jahre nichts an ihrer Aktualität verloren hat. Auf der anderen Seite erlebe ich in meinem beruflichen Umfeld aber auch viele ermutigende Ansätze und Projekte, die das Themenfeld mit Kreativität und Engagement angehen. Möge daher auch die völlig überarbeitete und erweiterte 3. Auflage den Lesern Inspiration und Mut für ein lohnenswertes Unterfangen liefern.
Mülheim an der Ruhr, Herbst 2022
Stephan Kostrzewa
|13|Vorwort zur zweiten Auflage
Die Szene ist in Bewegung geraten! Endlich finden sterbende Menschen mit Demenz immer mehr Aufmerksamkeit durch die Fachwelt, aber auch durch den Laien.
In der Vorbereitung zur 1. Auflage gab es nur wenig deutschsprachige Literatur zum Thema. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, dass Menschen mit Demenz nicht oder nur heimlich sterben. Auch konnte man den Eindruck gewinnen, dass vor der Jahrtausendwende Menschen mit Demenz in Deutschland keine Schmerzen hatten, hingegen aber in Frankreich und Amerika, da es hier schon geeignete Verfahren zur Schmerzbeobachtung im Einsatz gab. Nun denn, seit ca. 2000 gibt es nun auch Schmerzen bei den an einer Demenz Erkrankten in Deutschland!
In Inhouse-Schulungen zum nationalen Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“ (den ich dann selber um den Bereich „Schmerzerfassung bei Demenz“ erweitere, da Menschen mit Demenz in diesem Standard kaum berücksichtigt werden) löst man mit der Vermittlung entsprechender Inhalte oftmals Erstaunen, Interesse, aber auch Betroffenheit aus, wenn man auf Selbstverständlichkeiten („Ja! Auch Menschen mit Demenz haben Schmerzen“) hinweist. Zudem äußert sich auch zögerlich Scham, denn „eigentlich hätte man da ja auch selber darauf kommen können“ (Antwort einer Teilnehmerin in der Inhouse-Schulung). Nach entsprechender Schulung in diversen palliativen Interventionen, vorneweg dem Erkennen von Schmerzzuständen, ergeben sich ermutigende Rückmeldungen aus der Praxis:
Die Atmosphäre im Wohnbereich wird ruhiger.
Es gibt weniger herausforderndes Verhalten der Bewohner mit Demenz.
Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten gestaltet sich professioneller.
|14|Mit zeitlicher Verzögerung reagiert ebenfalls der Bereich der Aus- und Fortbildung auf dieses Thema. Auch wenn immer noch nicht die führenden Curricula für Palliative Care und Palliativmedizin den Menschen mit Demenz entdeckt bzw. ihm seinen gebührenden Platz eingeräumt haben (oftmals wird er immer noch im Rahmen des Delirs und des Symptoms der Verwirrtheit, quasi imaginär oder am Rande mitvermittelt), setzen sich Bildungsträger immer häufiger über diesen Mangel in der curricularen Arbeit hinweg.
Die Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in folgt zögerlich, wohingehend die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in den Menschen mit Demenz kaum entdeckt, geschweige denn sein Sterben mit entsprechend auftretenden Symptomen zum Thema macht.
Mülheim an der Ruhr, Frühjahr 2009
|15|Vorwort zur ersten Auflage
Mitte der 1980er Jahre habe ich meine Altenpflegeausbildung bei der Diakonie in Duisburg absolviert. Zu dieser Zeit dauerte sie nur zwei Jahre, eins davon war das Anerkennungsjahr. Zum Thema „Sterben und Tod“ wurde eine Doppelstunde „Kübler-Ross“ angeboten und etwas „Religiöses“, quasi als Garnitur. Dieser fachliche Input sollte reichen für das weite Feld der Begleitung sterbender Menschen. Nun gut. Das wenige Rüstzeug konnte dem großen Bedarf aus der Praxis nicht gerecht werden. Mit meinen 21 Jahren stand ich total überfordert am Sterbebett der Bewohner/innen.
Innerhalb meines anschließenden Studiums der Sozialwissenschaften wurden im Rahmen der Psychologie die Erkenntnisse von Kübler-Ross (eingeflossen in ein 5-Phasen-Modell) teilweise entzaubert, da sie methodisch unsauber gearbeitet hatte (Howe, 1992). Aber schon vorher war ich durch meine Altenpflegepraxis irritiert, da keiner meiner sterbenden Bewohner bzw. Patienten sich an das Phasenmodell zu halten schien. Entweder wurde hier nicht „richtig“ gestorben, oder an dem Modell stimmte etwas nicht.
Wenn der/die Leser/in nun meint, hier kommt das Werk eines frustrierten Altenpflegers, muss ich ihm/ihr widersprechen. Enttäuschung ja, aber keine Frustration. Denn gerade die Arbeit mit alten und an Demenz erkrankten Menschen hat mir so manchen Blickwinkel ermöglicht, den mir die Ausbildung nicht hat bieten können. Ihre Sichtweise der Dinge, ihre Erlebenswelt und ihre radikale Gegenwärtigkeit faszinierten mich ungemein.
Meinen Professoren im Studium der Sozialwissenschaften bin ich im Nachhinein sehr dankbar, dass sie mich auf den wissenschaftlichen Weg der Sterbeforschung und Thanatologie gebracht haben. Auch wenn es kein ausgesprochener Schwerpunkt dieser Universität war, gab es die Möglichkeit, sich diesem Thema zu widmen. Über ein Lehrforschungsprojekt bin ich am Anfang der 1990er Jahre zu |16|der Hospizbewegung Duisburg-Hamborn gelangt. Erst ehrenamtlich und später hauptamtlich war ich im stationären und ambulanten Hospizbereich tätig. Diese Hospizarbeit hat mir deutlich gemacht, was alles möglich gemacht werden kann in der Arbeit mit Sterbenden und ihren Angehörigen. Sie wurde für mich quasi zur Messlatte einer gelingenden Versorgung sterbender Menschen, die überall dort zu praktizieren sein müsste, wo Menschen gepflegt und bis zuletzt begleitet wurden.
Mit viel Engagement haben wir Mitte der 1990er Jahre aus der Hospizarbeit (Hospizbewegung Duisburg-Hamborn) heraus Inhouse-Schulungen in Altenpflegeheimen durchgeführt. Bei dieser Übertragung von Interventionen und praktischen Erfahrungen aus dem Hospizbereich und der Palliativen Versorgung in z. B. Altenpflegeheime, mussten wir erkennen, dass unser Thema auch ein politisches Thema war. Wir rührten an Strukturen und mussten uns von manchem Träger und Heimleiter mehr als einmal anhören, dass man Tod und Sterben nicht verkaufen kann.
Mit der Einführung der zweiten Stufe der Pflegeversicherung standen die einzelnen Altenpflegeeinrichtungen vermehrt in Konkurrenz zueinander. Jetzt wurde für die jeweilige Einrichtung mit Hochglanzbroschüren geworben, in denen rüstige Senioren ballspielend im Residenzgarten abgebildet waren. Vitalität und Agilität, gespiegelt in einem Animationsprogramm des Sozialen Dienstes, verdrängten die Sicht auf ein Themenfeld, das sich trotz allen Etikettenschwindels immer mehr in den Vordergrund schob: Altenpflegeheime wurden zu Sterbehäusern! „Der Tod ist ständiger Gast im Pflegeheim. Man kann ihn einfach nicht ignorieren, weil er sich in so vielen Formen und Gesichtern ankündigt“ (Heimerl et al., 1999, S. 42).
Die Verweildauer in deutschen Pflegeheimen sank schon Mitte der 1980er Jahre auf unter zwei Jahre (Bickel & Jaeger, 1986, S. 30). Immer häufiger mussten Mitarbeiter/innen der Pflege und des Sozialen Dienstes Sterbebegleitung und Trauerarbeit leisten. Der Belegungsdruck führte dazu, dass Mitarbeiter/innen sich immer häufiger darüber beschwerten, dass sich neue Angehörige nachmittags ein Zimmer anschauten, in dem vormittags ein Bewohner verstorben war. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern blieb keine Zeit zur Verarbeitung der gemachten Erfahrungen.
Um die heile Welt im Pflege-Servicezentrum nicht zu erschüttern, ließen sich die Einrichtungen mitunter sehr perfide Formen der „Leichenentsorgung“ einfallen. Häufig wurde (und wird in vielen Einrichtungen leider immer noch) der Leichnam nachts über den Hinterhof vom Bestatter abgeholt. Dort, wo der Müll entsorgt wird, werden auch die Leichen der verstorbenen Bewohner entsorgt. Hier wird besonders deutlich, dass das alltägliche Treiben nicht in seinen Grundzügen erschüttert werden darf.
|17|Ein neuer Trend machte sich dann Mitte bis Ende der 1990er Jahre breit. Die neue Pflegeheimklientel, bereits an einer Demenz erkrankt, zog in die Einrichtung. In vielen Pflegeheimen Deutschlands leben etwa 50 bis 70 % (manchmal noch mehr) gerontopsychiatrisch erkrankte Bewohner/innen (Becker, 2005). Den größten Teil der Erkrankungsgruppen stellen dabei die Demenzen.
Wieder wurde das Bild der ballspielenden Senioren ad absurdum geführt, denn die neuen Bewohner ließen und lassen sich nicht in das klassische Animierprogramm einbinden. Für Bingo, Zeitungsrunde und Window-Colours waren diese neuen Bewohnergruppen nicht zugänglich.
Ein weiteres Problem entstand aus dem Sachverhalt, dass auch diese Bewohner über kurz oder lang sterben würden. Hatte uns Kübler-Ross mit ihren Arbeiten eine Richtschnur geflochten für eine angemessene Begleitung sterbender Menschen, konnten die Demenzkranken nicht in diese Erkenntnisse eingebunden werden. Auch litten viele Bewohner, deren Erkrankung schon fortgeschritten war, an einem Sprachzerfall und an schweren kognitiven Störungen, sodass die klassischen Handreichungen zur Kommunikation mit sterbenden Menschen hier nicht viel weiterhelfen konnten.
Waren die kustodial ausgerichteten Einrichtungen nicht in der Lage, Menschen mit Demenz adäquat zu versorgen, verschärfte sich die Lage zusätzlich dadurch, dass die Entwicklung einen palliativen Ansatz erforderte.
Folgende Fragen standen fortan im Raum:
Was erlebt ein Mensch mit Demenz im Sterben?
Was bedeutet ihm das Sterben?
Welche Bedürfnisse haben an einer Demenz leidende Menschen im Sterbeprozess?
Wie lassen sich die einzelnen Bedürfnisse erkennen?
Wie geht Sterbebegleitung bei einem Menschen mit Demenz?
Haben Menschen mit Demenz Schmerzen? Und wenn ja, wie zeigen sie diese?
Lassen sich gängige Konzepte der gerontopsychiatrischen Arbeit in die Sterbebegleitung integrieren?
Welche zusätzlichen Angebote brauchen Angehörige für die Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz?
Im Rahmen unserer Hospizarbeit im Duisburger St. Raphael Hospiz begegneten uns zuweilen auch Hospizgäste, die an einer Demenz erkrankt waren. Hier konnten wir wichtige Erfahrungen in der Anwendung der Basalen Stimulation sammeln. Wir merkten, dass Berührung auch Kommunikation bedeutet. Ja, dass gerade Berührung häufig der einzige Zugangsweg war, um den Erkrankten zu erreichen. Aus |18|diesen Erfahrungen entstand unser Buch: Was wir noch tun können! (Kostrzewa & Kutzner, 2022), quasi als Antwort auf die Fragestellung von Kübler-Ross: „Was können wir noch tun?“.
Im Folgenden widmet sich dieses Buch ausschließlich den an einer Demenz erkrankten sterbenden Menschen. Sie und ihr soziales Umfeld sollen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, um einen einheitlichen Ansatz zu ihrer Versorgung und Betreuung zu finden. Dabei richte ich den Fokus vermehrt auf den stationären Altenhilfebereich, eben weil Sterben gestaltbar ist und weil diese Einrichtungen zunehmend geprägt sein werden von einer Klientel, die an Demenz erkrankt ist und die stationäre Altenhilfe auf diese Entwicklung reagieren muss. Das vorliegende Buch versteht sich als kleiner Baustein in diesem neu zu konzipierenden Versorgungsangebot.
An dieser Stelle möchte ich den vielen Mitarbeitern (insbesondere den Pflegefachkräften) danken, die mir behilflich waren, so manches Brett vor meinem Kopf abzuschrauben, mal nicht zu kompliziert zu denken und zu akzeptieren, dass 2 + 2 auch mal 5 sein kann. Ohne diese vielen Rückmeldungen und Anregungen wäre die vorliegende Arbeit nicht möglich gewesen. In tiefer Verbundenheit: danke!
|19|Einleitung
Sterbebegleitung und die Versorgung sterbender Menschen werden in den letzten Jahren, und das ist gut so, breit und interdisziplinär thematisiert. Besonders die sozialen Grundwissenschaften Psychologie, Soziologie und Philosophie entdecken zunehmend, dass das Sterben gesellschaftlich bedingt und vor allem auch gestaltbar ist. Aus den grundlegenden Fragestellungen der eben genannten Disziplinen leiten nun im Weiteren die Pflegewissenschaften ihre Fragestellungen ab. Diese werden dann in Hospizkonzepte, Palliative Care, Konzepte der hospizlichen Altenpflege und entsprechenden Fortbildungsangeboten in die Praxis der Sterbebegleitung transferiert und implementiert.
Üblicherweise widmen sich diese Arbeiten dem ohne Demenz sterbenden Menschen. Er ist Forschungsmittelpunkt diverser Befragungen und Beobachtungen (Kübler-Ross, 1987; Kruse, 1994a; Heller et al., 1999). An und mit ihm lassen sich klar Bedürfnisfelder ergründen, nach denen dann individuell und biografisch orientiert die jeweilige Gestaltung der Sterbebegleitung und -versorgung vorgenommen werden kann.
Die demografische Entwicklung der westlichen Industrieländer weist eine erhebliche Zunahme an hochaltrigen Menschen auf. Die Lebenserwartung nimmt stetig zu. Kehrseite dieses angestrebten Ziels ist jedoch, dass sich mit der Zunahme der Hochaltrigkeit diverse Krankheiten vermehrt einstellen. Eine Gruppe dieser Krankheiten repräsentieren die Demenzen (lat.: der Geist ist weg). Zurzeit sind in Deutschland mehr als 1,7 Million Menschen erkrankt (Bundesministerium für Gesundheit 2007; Zugriff 09. 08. 2022). Ist die Demenz unter anderem dadurch repräsentiert, dass der Verstand, das Gedächtnis, die Kognition bzw. die Rationalität erheblich betroffen sind, muss die Frage erlaubt sein, ob und wie Demenzkranke ihr Sterben erleben. Und in einem zweiten Schritt muss überlegt werden, wie dieses „Erleben“ von außen zu erfahren ist. Stehen uns bei sterbenden Menschen |20|ohne Demenz verschiedene Formen der Befragung und Beobachtung zur Verfügung, wird ein sprachliches Erfassen der Bedürfnislage des Sterbenden mit zunehmender bzw. fortgeschrittener Demenz immer schwieriger. Können wir nicht auf das Symbolsystem „Sprache“ zurückgreifen, sind wir auf Interpretationen von Lautbildung, Mimik, Körperhaltung, Gestik, Intonation, Muskeltonus und einigen allgemeinen messbaren körperlichen Parametern angewiesen.
Das vorliegende Buch bedient sich unter anderem eines solchen Interpretationsversuches. Hier wird, nachdem das Krankheitsbild vom medizinischen Standpunkt her betrachtet wurde, über einen phänomenologischen Zugang versucht, die Lebens- und Erlebenswelt der Menschen mit Demenz zu erfassen. Dabei ist dem Autor bewusst, dass wir Orientierten nicht „dement“ denken können. Wir können vielleicht aus uns bekannten Alltagssituationen heraus Ähnlichkeiten finden, die im Erleben vermuten lassen, so könnte Demenz „sein“. Die Kontemplation über diese Alltagserlebnisse führt uns dann zu einer (auch affektiven) Erlebenswelt, die nicht Erleben auf dem Hintergrund einer Demenz „ist“, aber die eine zu vermutende Ähnlichkeit in sich trägt.
Diese vermutlich ähnlichen Erlebensweisen gilt es nun zu betrachten. Hier kann der orientierte Betrachter phänomenologisch einen Zugang finden in die besondere Lebenssituation eines Menschen mit Demenz. Oder anders ausgedrückt: „Der Phänomenologe ist demnach ein Wissenschaftler, der selbst an dieser Lebenswelt durch seine Alltagserfahrungen teilhat, und der diese Alltagserfahrungen für seine wissenschaftliche Arbeit auswertet“ (Seiffert, 1991, S. 41). Und weiter: „Der Phänomenologe macht erfahrbare Lebenssituationen zum Gegenstand seiner Beschreibungen“ (Seiffert, 1991, S. 57).
Sterbeprozess und Sterbebegleitung werden in den letzten Jahren immer häufiger zum Fokus wissenschaftlicher Forschungsarbeit. Dass man nicht mehr von einer Tabuisierung des Sterbens in der modernen Gesellschaft sprechen kann, belegt auch das zunehmende öffentliche Interesse, beispielsweise an der Hospizarbeit, obwohl es, das ist deutlich zu spüren, noch immer eine große Befangenheit gibt bezüglich der konkreten Situation der Sterbebegleitung.
Deshalb ist es sinnvoll, einen entsprechenden Exkurs zu wagen über einige Erkenntnisse der Sterbeforschung und der Thanatologie und ihre Entsprechungen in den zuständigen Organisationen. Da es kein entsprechendes Interesse für sterbende Menschen mit Demenz zu geben scheint, muss eine Ableitung der gefundenen Ergebnisse vorgenommen werden, um etwas Konkretes zur Sterbebegleitungssituation dieser Menschen aussagen zu können. Die so gewonnenen Erkenntnisse gilt es mit Erfahrungen aus der palliativen Intervention zu kombinieren.
|21|Zwar leben in Deutschland die meisten Menschen mit einer Demenz zu Hause, doch innerhalb der Altenpflegeheime stellen sie die größte Bewohnergruppe. Hier sind es dann ca. 70 % der Bewohnerinnen und Bewohner. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit immer wieder der stationäre Altenhilfebereich in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Schon im Vorwort wurde angesprochen, dass zurzeit ein radikaler Umbruch im stationären Altenhilfebereich stattfindet, durch die sich verändernde Klientel. Diese Klientel ist zunehmend gerontopsychiatrisch verändert, und sie stirbt immer schneller in den stationären Einrichtungen. Ein entsprechendes Konzept zur Betreuung und Versorgung sterbender Menschen muss diesen Umstand berücksichtigen.
Der palliative Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er sich im Rahmen der Sterbebegleitung radikal an den Bedürfnissen des Individuums und an den versorgenden Personen orientiert. Hier finden wir unter anderem auch einen gemeinsamen Nenner in der Hospizarbeit und in der Arbeit mit Menschen mit Demenz. Denn die angestrebten Pflege- und Versorgungsziele sind nur zu erreichen, wenn der Mensch mit Demenz sich in seiner Welt aufgehoben und sicher fühlt. Dabei sollen die einzelnen Verfahrensweisen nicht losgelöst vom Gesamtkontext, quasi rezeptartig, dargestellt werden, sondern eingebunden sein in ein übergreifendes Konzept zur Betreuung demenzkranker sterbender Menschen, das alle beteiligten Personengruppen wie Mitarbeiter und Angehörige, aber auch Hausärzte und weitere Professionen mit berücksichtigt.
Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die schmerztherapeutische Behandlung der Menschen mit Demenz gelegt. Zwar berücksichtigt der Nationale Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“ auch Menschen mit Demenz, doch es ist in der täglichen Praxis vor Ort in den Teams immer noch zu bemerken, dass diese sich mit der Thematik schwertun.
Da das vorliegende Buch den Anspruch hat, der Praxis Impulse zu vermitteln, ist es immer wieder bemüht, konkrete Arbeitsschritte im angezeigten Problemfeld planend mitzugestalten. Hierzu gibt es an entsprechenden Stellen Arbeitshilfen, die in dieser Form im stationären Altenpflegebereich und in geschlossenen gerontopsychiatrischen Einrichtungen erprobt und modifiziert wurden. Dabei sind eine mögliche Abänderung und Ergänzung dieser Arbeitshilfen mitgedacht und gewollt, denn andere Strukturen erfordern modifizierte Lösungen.
Für eine gelingende Sterbebegleitung bei Menschen mit einer Demenz ist es notwendig, nicht nur den Erkrankten ins Blickfeld zu nehmen, denn er lebt ja nicht im luftleeren Raum. Eine wichtige Unterstützung im Prozess der Begleitung sind die Angehörigen bzw. Zugehörigen. Sie bestätigen die „Plausibilitätsstrukturen“ |22|des betroffenen Menschen, zumindest zu Beginn der Krankheit, und sie (die Angehörigen) stellen eine wichtige Brücke zur Biografie des Demenzkranken dar.
Dass die Zusammenarbeit zwischen Professionellen und Angehörigen nicht immer reibungslos vonstattengeht, ist bekannt. Aber divergierende Ansichten mit vielleicht unterschiedlichen ethischen Haltungen können zu einer Synthese führen, die das Entstehen einer Sterbekultur möglich machen kann.
Aus der Hospizarbeit ist bekannt, dass sie nur funktionieren kann, wenn entsprechende ehrenamtliche Helfer sie unterstützen. Hier gilt es genau hinzuschauen, wer wann und mit welcher Befähigung in die Betreuung sterbender Demenzkranker einbezogen werden soll. Der Einsatz entsprechender Curricula stimmt hierbei ermutigend (DHPV e.V. und Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2012). Auch ist es wichtig, den regelmäßigen Austausch zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Betreuungspersonen zu strukturieren.
Damit nun bei allen Personengruppen, die in den Sterbebegleitungsprozess involviert sind, ein einheitliches Gesamtverständnis für die besondere Lebenssituation der Menschen mit Demenz im Sterbeprozess entsteht, schließt diese Arbeit mit einem Curriculumsentwurf für eine etwa 84-stündige Schulung zum Thema ab. Sie ist so oder in ähnlicher Form in verschiedenen stationären Bereichen der Altenarbeit durchgeführt, erprobt und evaluiert worden. Sie ist in Module gegliedert und spricht nicht allein die Pflegefachkräfte an. Verschiedene Inhouse-Schulungen haben mir deutlich gemacht, dass gerade die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und der Austausch darüber die oben erwähnte Synthese bewirken können. Diese verschmolzene Einheit gilt es dann, in einer gelebten Kultur in den entsprechenden Einrichtungen zu implementieren.
Das Buch erhebt nicht den Anspruch, den Königsweg in der palliativen Versorgung von Demenzkranken entworfen zu haben, sondern es ist das Extrakt aus vielen Inhouse-Schulungen, Fortbildungen und Praxisbegleitungen. Es ist quasi das Ergebnis einer mehrjährigen fruchtbaren Interaktion zwischen Theorie und sehr viel Praxis. Oder anders formuliert: Es soll zeigen, dass Intuition, Erfahrungswissen und Empirie sich nicht gegenseitig ausschließen müssen, sondern einander fruchtbar ergänzen können.
|23|1 Demenz
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Krankheitsbildern des Demenziellen Syndroms. Zuerst wird es aus einem medizinischen Blickwinkel betrachtet, um dann aus dem Blickwinkel des Betroffenen thematisiert zu werden. An bestimmten Stellen sind Übungen eingebaut, um Leser und Leserinnen zur Kontemplation und zur Identifikation anzuhalten. Denn Demenzerkrankungen lassen sich zum einen von außen, naturwissenschaftlich-reduktionistisch, also objektiv betrachten, aber auch von innen heraus, aus der Perspektive des Betroffenen.
Bei der ersten Betrachtungsweise stellt sich bei dem Leser bzw. der Leserin und beim anschließenden Betrachten eine selektive Wahrnehmung ein. An bestimmten |24|Stellen in der Begegnung mit Demenzkranken wird der Leser feststellen: „Aha, wie im Buch beschrieben, das Symptom erkenne ich wieder“. Leider führt das auch dazu, dass wir durch Differenzialdiagnostik einen Menschen auf sein Krankheitsbild reduzieren. Dieser naturwissenschaftlich-reduktionistische Blick blendet viele Bereiche des Person-Seins aus. „Durch diese Auffassung findet eine Standardisierung der Krankengeschichten zu Krankheitsgeschichten – zu Fällen – statt. Diese Standardisierung und die damit einhergehende Einengung der Variationsbreite tragen letztlich zur Ausschaltung derjenigen Störgrößen bei, welche eher im persönlich individuellen Bereich anzusiedeln wären“ (Voss, 1993, S. 107). Diesem Gedanken haben sich auch Kitwood (2000) sowie Kitwood und Brooker (2022) in engagierter Form verschrieben. Sein personenzentrierter Ansatz im Umgang mit Menschen mit Demenz lässt sich auch als Kritik an eben diesem selektiven Blickwinkel lesen. „Diese und ähnliche Beschreibungen werten die Person ab und machen ein einzigartiges und sensibles menschliches Wesen zu einem Fall in irgendeiner Kategorie, die aus Gründen der Bequemlichkeit oder zu Kontrollzwecken geschaffen wurden“ (Kitwood, 2000, S. 25). Eines der Hauptanliegen Kitwoods ist es, die Person im Erkrankten zu sehen, und nicht den Patienten. Oder anders formuliert: Wenn man alle Krankheitsbilder subtrahiert, bleibt ganz viel Mensch und Person übrig!
Vor dem Hintergrund unseres Fokus kann ich Kitwoods Bemühen nur zustimmen (Kitwood & Brooker, 2022). Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz erfordert eine radikale Personenzentrierung und -orientierung. Sie einzunehmen und dann in einem späteren Abschnitt für die Sterbebegleitungssituation zu organisieren, ist der rote Faden dieser Arbeit.
1.1 Demenz – medizinisch betrachtet
Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wenn hier in aller Ausführlichkeit die Krankheitsbilder der Demenz thematisiert werden sollten. Ich werde mich auf die Inhalte beschränken, die dem Anliegen meines Themas dienlich sind. Im Literaturverzeichnis am Ende des Buches sind weiterführende Werke aufgeführt, die eine differenzierte Darstellung verfolgen und ein vertiefendes Studium ermöglichen.
Nähern wir uns der Demenz auf dem schulmedizinischen Weg über Klärung von Begriffen.
So lässt sich Demenz übersetzen aus dem Lateinischen mit: „ohne Verstand“ oder „Der Geist ist weg.“ (Hafner & Meier, 1996, S. 35). Und weiter: „Gemeint ist |25|aber eine organisch bedingte, chronische, (bis jetzt) meistens nicht heilbare, allgemeine Hirnleistungsschwäche, verbunden mit Gedächtnis- und Orientierungsstörungen sowie Persönlichkeitsveränderungen“ (Hafner & Meier, 1996).
Weltweit waren Anfang der 2000er ca. 30 Millionen Menschen von diesen Krankheiten betroffen (Becker, 2005, S. 5). Da von einer wachsenden Zahl von Neuerkrankungen auszugehen ist, rechnet man mit stark ansteigenden Zahlen.
Epidemiologie der Demenz:
zirka 1,2 % der 65- bis 69-Jährigen
zirka 2,8 % der 70- bis 74-Jährigen
zirka 6,0 % der 75- bis 79-Jährigen
zirka 13,3 % der 80- bis 84-Jährigen
zirka 23,9 % der 85- bis 89-Jährigen
zirka 34,6 % der über 90-Jährigen
(Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz, 2004, S. 15)
In Deutschland sind zirka 1,7 Million Menschen von einer Form der Demenz betroffen. Von ihnen werden etwa zwei Drittel zu Hause versorgt und etwa ein Drittel in stationären Einrichtungen. (Diese Zahlen sind nüchtern und technokratisch, und sie verstellen den Blick auf das eigentliche Martyrium von vielen pflegenden Angehörigen, die sich mitunter über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte völlig aufopfern für den erkrankten Angehörigen). Häufig ziehen dann Menschen mit Demenz in einem späten Stadium der Erkrankung in ein Altenpflegeheim, da die Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleistet werden kann. Viele Altenpflegeheime können auf einen Anteil von 70 % und mehr bei den Bewohnenden verweisen, die an einer Demenz leiden. Sie stellen zurzeit die größte Herausforderung an die Institutionen. Leider werden die meisten Einrichtungen dieser Patientengruppe nur unzureichend gerecht. Schon Kostrzewa und Kutzner haben auf eine eigentümliche „Unberührbarkeit“ bei sterbenden Menschen mit Demenz verwiesen: „Hat der alte, demente und sterbende Mensch nun seine letzte Wohnstätte im Altenpflegeheim erreicht, unterliegt er häufig einer vierfachen Isolation:
Isolation aufgrund der Demenz, die den Dementen in seiner eigenen Welt leben lässt
Isolation, weil er Sterbender ist und viele Begleiter Berührungsängste mit dem Thema ,Tod und Sterben‘ haben
Isolation durch sein soziales/familiäres Umfeld, da dieses sich die Wesensveränderung durch Demenz nicht erklären kann und somit das Unverständliche meidet, indem es den sterbenden Dementen meidet
|26|Isolation durch die Einrichtung Altenpflegeheim, da dieses orientiert ist am Normalen und Funktionalen und die Eigenheiten des Dementen die Ablaufoptimierung durchkreuzt. Dies umso mehr, je größer die Einrichtung ist“ (Kostrzewa & Kutzner, 2022, S. 33).
Zusätzlich lässt sich in „gemischten“ Einrichtungen (integratives Modell) beobachten, dass orientierte Mitbewohner*innen sich von den Demenzkranken, mitunter sehr kategorisch, distanzieren. „Die Beobachtung psychischer Veränderungen ihrer Mitbewohner stellt für Heimbewohner die stärkste Belastung dar und wirkt sich weitaus mehr aus, als die Beobachtung schwerer organischer Funktionseinbußen. Auf Wesensveränderungen anderer Bewohner reagieren die meisten mit Betroffenheit und Unverständnis. Da sie ihren verwirrten Mitbewohnern nicht immer ausweichen können, müssen sie sich mit ihnen auseinandersetzen. Dies fällt besonders schwer, weil zu der Angst, vielleicht ähnlich krank zu werden, die Unsicherheit hinzukommt, wie man ihnen begegnen soll“ (Kruse, 1994b, S. 61). Erste Einrichtungen der Altenarbeit beginnen daher damit, die orientierten Mitbewohner*innen im Thema „Demenz“ zu schulen (Kostrzewa & Kretschmer, 2020). Hier zeigt sich dann nach erfolgten Schulungen, dass sich weniger Konflikte vor Ort in den Wohnbereich zwischen orientierten und demenziell veränderten Bewohner*innen ergeben.
Das Unverständnis bezüglich des Krankheitsbildes Demenz rührt aber auch daher, dass es die Demenz nicht gibt, sondern eine Fülle von verschiedenen Krankheitsbildern, die unter diesen Begriff subsummiert werden. Zudem wird das Störungsbild „Demenz“ von jedem betroffenen Menschen individuell „ausgestaltet“, sodass eine Typisierung schwierig ist.
„Die Krankheitsbilder der Demenz – ein Oberbegriff, unter dem die Medizin mehr als 50 Formen zusammenfasst, sind ausgesprochen vielfältig. Selbst innerhalb einer Form, etwa der Alzheimer-Demenz (AD), entwickelt und äußert sich die Krankheit von Person zu Person sehr unterschiedlich. Diese Streubreite ist einer der Gründe dafür, weshalb es so schwierig ist, eine Demenz im Frühstadium zu diagnostizieren, vor allem aber zu entscheiden, welche Form der Demenz vorliegt und mit welchem Verlauf man zu rechnen hat“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004, S. 24). Wenn ich also im Folgenden auf eine Systematisierung im Feld des „Demenziellen Syndroms“ näher eingehe, so soll dieses mehr als ein Lernschema für professionelle Begleiter*innen verstanden werden.
Eine grobe Einteilung findet dahingehend statt, dass man die primären von den sekundären Demenzen unterscheidet. Dabei repräsentieren die primären Demenzen (z. B. Alzheimer-Demenz und vaskuläre Demenz) die Krankheitsbilder, die |27|durch einen im Gehirn ursächlich entstandenen progredienten Krankheitsprozess verursacht werden. Hingegen liegen bei den sekundären Demenzen andere Krankheitsursachen zugrunde, die, wenn man sie behandelt, mitunter dann kein klinisches Bild einer Demenz mehr zeigen (z. B. schwere Formen der Herzinsuffizienz oder Schilddrüsenunterfunktion).
Zu den Ursachen einer Demenz soll hier nur kurz Stellung genommen werden, denn es gibt 70 bis 100 auslösende Erkrankungen (Becker, 2005, S. 7). „Letztendlich münden alle schädigenden Prozesse darin, dass Nervenzellen im Großhirn in ihrer Funktion beeinträchtigt werden oder gar absterben und somit für neurophysiologische Prozesse nicht mehr zur Verfügung stehen. Sind es Nervenzellen an einer Schaltzentrale, dann richtet ihre Schädigung mehr Störung in der Hirnfunktion an als bei Nervenzellen in einer nebensächlichen Verschaltung“ (Becker, 2005, S. 7).
1.1.1 Einteilung der Demenz nach Schweregraden
Eine brauchbare Einschätzung der einzelnen Schweregrade einer Demenz (z. B. die senile Demenz vom Alzheimer Typ, kurz: SDAT wie auch die Multiinfarktdemenz, kurz: MID) liefert das DSM-IV (Pipam, 2005, S. 172).
Leichte Demenz: Die Fähigkeit unabhängig zu leben, mit entsprechender persönlicher Hygiene und intaktem Urteilsvermögen, ist erhalten, Arbeit und soziale Aktivitäten sind deutlich beeinträchtigt (Mini-Mental-Status-Werte 21 – 24).
Mittelschwere Demenz: Die selbstständige Lebensführung ist nur mit Schwierigkeiten möglich, ein gewisses Maß an Betreuung/Aufsicht ist erforderlich (MMS-Werte 11 – 20).
Schwere Demenz: Die Patient*innen benötigen kontinuierliche Betreuung, eine Aufrechterhaltung auch nur minimaler persönlicher Hygiene ist nicht mehr möglich, Symptome wie Inkohärenz und Mutismus sind häufig (MMS-Werte 10 und weniger).
1.1.2 Das klinische Erscheinungsbild
Die meisten Demenzen beginnen für die erkrankten Menschen und ihre Angehörigen kaum merkbar. Die ersten Hinweise auf eine beginnende Störung bemerken zuerst die engsten Angehörigen und natürlich der betroffene Mensch selbst (Taylor, 2011). Den Angehörigen fällt z. B. auf, dass kognitive Störungen zunehmen, z. B. |28|eingeschränkte Merkfähigkeit und Wortfindungsstörungen sowie eine meist vorher nicht gekannte Reizbarkeit. Kleinste Fehlleistungen bzw. Verweise auf solche, führen zu impulsiven Reaktionen, zu depressiven Verstimmungen oder zu einem auftretenden sozialen Rückzug. Zu Beginn des krankhaften Prozesses versucht der betroffene Mensch mit viel Energie und Aufwand (Merkzettel, Tagebuch etc.), die Defizite zu kompensieren oder zu überspielen. Die gesellschaftlich gewünschte Kontenance in öffentlichen Räumen und Begegnungen funktioniert zu Beginn noch recht gut, wird aber mit zunehmendem Krankheitsprozess immer schwieriger.
Im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung findet sich häufig eine ausgeprägte Agitiertheit der erkrankten Menschen. Sie laufen viel umher, schauen sich suchend um, sind getrieben durch Rastlosigkeit. Andere klammern sich fast kindlich an ihre Bezugspersonen. „Demenzkranke sind Menschen, die in einer anderen Wirklichkeit leben. Sie brauchen zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse wie Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Bewegung und Schlaf die Unterstützung anderer und können schließlich nur in deren Nähe Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Das ist der Grund, warum sie diesen vertrauten Personen hinterherlaufen und immer wiederkehrende Fragen stellen. Gerade, wenn man nicht mehr weiß, wer man selbst ist, ist man darauf angewiesen, dass einem andere immer wieder bestätigen, wer man ist und war“ (Wilkening & Kunz, 2003, S. 56).
Einfachste Verrichtungen, wie das Ankleiden, das Rasieren, das Zähneputzen oder das Essen mit Messer und Gabel, werden immer schwieriger bis unmöglich. Besonders schlimm wird von Angehörigen empfunden, wenn der erkrankte Mensch sie nicht mehr erkennt (Agnosie), sie womöglich noch beschimpft, sie aus dem Zimmer weist oder gar Schutz bei den Pflegenden sucht. Diese Form der Kränkung kann nur aufgefangen werden, wenn den Angehörigen das Krankheitsbild ausführlich erläutert wird, und wenn sie die Möglichkeit haben, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Hier können wir aufseiten der Angehörigen klare Trauerreaktionen beobachten (hierzu weiter unten mehr). Ebenfalls problematisch für Angehörige ist es, wenn die Erkrankten eine ungewohnte Enthemmtheit in der Sprache, bezüglich der Privatsphäre, des Privateigentums und im Umgang mit Sexualität zeigen.
1.1.3 Symptome nach Stadieneinteilung
Wie bereits beschrieben gibt es sehr unterschiedliche Verläufe und Erscheinungsformen bei den Erkrankten. „Jeder Versuch, die einzelnen Demenzformen anhand der beobachtbaren Symptome voneinander abzugrenzen, beruht daher auf |29|Aussagen, dass diese bei einer bestimmten Demenzform ,eher selten‘, ,meist erst später‘ oder ,häufig als erste‘ im Krankheitsverlauf auftreten. Es handelt sich also um statistische Aussagen, die zwar ,in der Regel‘ – also für die Mehrzahl der Menschen mit einer bestimmten Demenz – zutreffen, nicht aber notwendigerweise für den einzelnen, konkreten Fall“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004, S. 24).
Vor dem Hintergrund, dass ein Teil der sekundären Symptome durch uns Begleitende, durch Angehörige, durch Mitbewohnende und durch die Gestaltung des Umfeldes wesentlich beeinflusst werden kann, ist eine Einteilung nach primären und sekundären Symptomen sinnvoll. Repräsentieren die primären Symptome (z. B. Störungen der Kognition, wie Merkfähigkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen, Orientierungsstörungen) die Auswirkung der Krankheit an sich, so lassen sich als sekundäre Symptome solche bezeichnen, die als Reaktion auf die Krankheit, aber auch auf uns Begleitende, entstehen können (z. B. aggressives Verhalten, depressive Verstimmungen, Weglauftendenz etc.). Vielleicht kann man sogar noch ein Stück weiter gehen, indem man die sekundären Symptome als diejenigen bezeichnet, die uns etwas „mitteilen“ wollen. Es gilt nun für die Begleitenden herauszufinden, was der erkrankte Mensch mit seinem Verhalten bewirken bzw. mitteilen möchte.
Das Max-Bürger-Institut für Altersforschung (1997, S. 12) unterscheidet die primären von den sekundären Symptomen gemäß einem Drei-Stadien-Modell (Tab. 1-1).
Bei allen Formen der Demenz lassen sich also drei Bereiche unterscheiden, die von den Symptomen betroffen sind (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004, S. 25):
kognitiver Bereich (Gedächtnis, Orientierung, Wahrnehmung)
affektiver Bereich (Gefühlslage und Verhalten)
motorischer Bereich (Bewegung und Muskelkontrolle).
Je nach Demenzform sind die genannten Bereiche unterschiedlich stark bzw. in unterschiedlichen Stadien betroffen. Haben die Betroffenen z. B. bei der Alzheimer-Demenz zu Beginn Störungen im Kurzzeitgedächtnis, zeigen sich bei der Lewy-Body-Demenz eher Probleme durch optische Halluzinationen und starke Schwankungen in orientierten und desorientierten Phasen. Bei der Frontallappen-Demenz wiederum liegt eine Persönlichkeitsveränderung vor, wenn die erkrankte Person z. B. sich sehr enthemmt, bzw. ungezügelt verhält, was in der Öffentlichkeit zu peinlichen Situationen für die Angehörigen führen kann. Im Fortschreiten der jeweiligen Demenzen verschwimmen dann diese Unterscheidungen zunehmend.
|30|Tabelle 1-1: Primäre und sekundäre Symptome einer Demenz (Eigendarstellung)
Frühes Stadium der Demenz
Primärsymptome
Sekundärsymptome
Gedächtnisstörung:
Merkfähigkeitsschwäche
(Kurzzeitgedächtnis)
Konzentrationsstörungen
(Vergesslichkeit)
Orientierungsstörungen vor allem zeitlich
Urteilsschwäche:
Fehlentscheidungen
Störungen des abstrakten Denkens:
Fehlplanungen
Antriebsstörungen (Produktivität, Motivation)
Persönlichkeitsveränderungen:
Reizbarkeit, Desinteresse
Depressive Verstimmungszustände:
Traurigkeit, Unlust, Apathie, Freudlosigkeit, sozialer RückzugWahnideen:
Beeinträchtigungs-, Verfolgungs- und Bestehlungsideen, Verarmungs- und Eifersuchtsideen
Fortgeschrittenes Stadium der Demenz
Primärsymptome
Sekundärsymptome
kognitive Defizitsymptome:
Desorientierung (zeitlich/örtlich) mit Weglaufgefahr, Sprachstörungen (vor allem Sprachverständnis gestört)
Wahrnehmungsstörungen
Handfertigkeitsstörungen (Ankleiden, Haushalt)
Urteils- und Handlungsfähigkeit („Versagen“)
Depression und Angst
Wahnvorstellungen
Agitation, psychomotorische Unruhe
Perseveration: immer wieder dasselbe tun oder fragen
Tag-Nacht-Umkehr
Aggression
Spätes Stadium der Demenz
Primärsymptome
Sekundärsymptome
Gedächtnisverfall (auch Langzeitgedächtnis betroffen)
schwere Verhaltensstörungen
Sprachzerfall (Kommunikation unmöglich)
psychotische Explosivreaktion
Agnosie (Patient erkennt Angehörige nicht mehr)Persönlichkeitsverfall (Endstadium: „leere Hülle“)
körperliche Störung (Gangstörung, Stürze)
Inkontinenz, Infekte
|31|1.1.4 Diagnostik
Für den stationären Altenpflegebereich muss leider immer noch konstatiert werden, dass die Demenzen bei vielen erkrankten Bewohner*innen nicht (ausreichend) diagnostiziert sind. Häufig erstellt der Hausarzt über das klinische Erscheinungsbild eine Diagnose, die dann in der eigentlichen Altenpflegeeinrichtung, aber auch im häuslichen Umfeld ein „Eigenleben“ entwickeln kann (Kap. 3.1.1: Schmerz und Demenz). Der vermeintlich erkrankte Angehörige oder Bewohner*in wird durch seine Außenwelt als Mensch mit Demenz behandelt, und er muss sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen, die diese Diagnose in ihm auslösen.
Aus der Praxis
In einer Oberhausener Altenpflegeeinrichtung (Rheinland) ist mir folgende Umgangspraxis mit dem MMSE (Mini-Mental-State-Examination) geschildert worden:
Hier erheben die Mitarbeiter der sozialtherapeutischen Betreuung mithilfe des MMSE den kognitiven Stand des neuen Bewohners, kurz nach Heimeinzug. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen werden dort die Daten erhoben und die erzielten Ergebnisse in den Computer eingegeben. Dieser rechnet dann „den Schweregrad der Demenz“ aus. Auf Nachfrage wird dieses Verfahren gerechtfertigt mit den Erfordernissen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen. Umso niedriger die MMSE-Werte, desto höher die zu ermittelnden Minutenwerte, die für die Einstufung in eine Pflegestufe notwendig sind.
Dass damit gleichzeitig defizitorientierte Erwartungshaltungen aufseiten der Mitarbeitenden unterstützt werden, wird von den Mitarbeitenden nicht als problematisch angesehen. Auch werden die fraglich gestellten Diagnosen „Altersdemenz“, „Senile Demenz“ oder „Hirnorganisches Psychosyndrom“ nicht hinterfragt, sondern als gegeben übernommen.
Da die Mitarbeitenden meine kritische Haltung nicht nachvollziehen konnten, habe ich einen Teil der teilnehmenden Kollegen und Kolleginnen mit dem MMSE testen lassen. Selbstverständlich unter Stress/Zeitdruck (auch die getesteten Bewohner und Bewohnerinnen standen nach dem Heimeinzug unter starkem Stress), sodass ein Teil der getesteten Probanden*innen Punktwerte erreichten, die eigentlich auf eine leichte Demenz schließen lassen müssten. Etwas irritiert wurde im Anschluss die Testpraxis der Pflegeeinrichtung erneut diskutiert. Jetzt etwas kritischer.
|32|Da der Begriff Demenz mittlerweile in der breiten Öffentlichkeit etabliert ist und sich zunehmend auch populärwissenschaftliche Abhandlungen (z. B. in Apothekerzeitschriften etc.) dieser Thematik annehmen, erleben immer mehr Menschen dieses Wissen als Bedrohung.
Mittlerweile stehen verschiedene, mitunter sehr differenzierte Diagnoseverfahren zur Verfügung. Einen besonders ausführlichen diagnostischen Prozess finden wir in den Memory-Kliniken, die zuerst somatisch – also körperlich – testen, um dann, wenn dort keine Befunde vorliegen, die das klinische Bild ausreichend begründen können, psychische und psychomotorische Tests durchzuführen.
Schon sehr einfache Testverfahren, wie der Uhrentest oder der Mini-Mental-Status-Test (MMST), können bei einem Anfangsverdacht dienlich sein. Es wird jedoch davor gewarnt, diese Tests mit ihren Ergebnissen als alleinigen Befund stehen zulassen und aufgrund ihrer Aussage eine Demenz als verifiziert anzuerkennen. Es muss bedacht werden: Demenzdiagnostik ist ein sehr differenziertes Verfahren.
Beispiel aus dem Unterricht
Im Rahmen des Unterrichts an unserem Fachseminar testen sich die Schüler*innen untereinander mit dem Mini-Mental-Status-Test. Dabei kommt es immer wieder vor, dass zwei bis drei Teilnehmer mit Punktwerten abschließen, die eine leichte Demenz vermuten lassen. Meist nehmen diese Teilnehmenden die Ergebnisse humorig auf, genau wissend, dass sie nicht an einer Demenz leiden, jedoch bleibt ein leichtes Unbehagen zurück. Das Ergebnis entwickelt ein Eigenleben, es macht Unbehagen.
In einem zweiten Schritt verändern wir dann bei anderen Probanden*innen die Testbedingungen. Es werden mehr Störquellen während des Tests eingebaut und der Versuchsleiter drängt die Teilnehmenden zu einer schnelleren Beantwortung der gestellten Aufgaben. Resultat ist, dass die Testergebnisse sprunghaft nach unten gehen und somit eher die Diagnose „Demenz“ im Raum steht.
Die Übung soll zeigen, wie äußere Faktoren das Testergebnis wesentlich beeinflussen können. Zusätzlich war an den Reaktionen der Teilnehmenden zu erkennen, dass die Diagnose „leichte Demenz“ nicht spurlos an ihnen vorbeiging.
Ein Lernziel dieser Übung bestand darin, zu erkennen, dass nicht ein Diagnoseverfahren allein herangezogen werden darf, sondern eine Vielzahl verschiedener Tests.
|33|1.1.5 Medikamentöse Therapie
In den nächsten Kapiteln sollen verschiedene Therapieansätze vorgestellt und unterschieden werden. Es lassen sich grob die medikamentösen Therapien – dargestellt in diesem Kapitel – und die nicht-medikamentösen Therapien (Kap. 1.1.6) voneinander unterscheiden. Als Nichtmediziner möchte ich mich nicht aufs Glatteis begeben, die Wirksamkeit einzelner Präparate oder Wirkstoffgruppen infrage zu stellen. Den Streit überlasse ich der Pharmaindustrie und den unabhängigen pharmazeutischen Gutachter*innen, die doch häufig eine unterschiedliche Einschätzung der Wirksamkeit einzelner Antidementiva zu haben scheinen. In Kapitel 1.1.6 wird dann eine Auswahl aus dem breiten Spektrum der psychosozialen Interventionsansätze für Menschen mit Demenz vorgestellt.
Zurzeit kann mit Sicherheit gesagt werden, dass es keine Medikation gibt, die eine Demenz heilen bzw. ursächlich behandeln kann. Die Hoffnung der aktuellen medikamentösen Therapie liegt eher in dem Bereich, die Symptome zu lindern oder den Verlauf der Erkrankung zu verzögern. Dies umso erfolgreicher, je früher die Erkrankung diagnostiziert wird.
Als kleine Auswahl sollen hier einige Gruppen an Medikamenten unterschieden werden:
Gruppe 1: Nootropika. Ihnen wird eine leistungsfördernde Wirkung zugesprochen, obwohl ihre Wirkweise nicht genau bekannt ist, auch wenn sie schon seit den 1970er-Jahren auf dem Markt sind. Zu dieser Wirkstoffgruppe liegen nach heutigen methodischen Anforderungen nur unzureichende klinische Studien vor.
Gruppe 2: Acetylcholinesterase-Hemmer und das Memantin. Die Medikamente dieser Gruppe sollen helfen, die chemische Signalübertragung zwischen den Nervenzellen zu verbessern. Besonders das Memantin hat sich in einigen klinischen Studien als „Bremser“ im Verlauf der Erkrankung erwiesen. „Bei Demenzpatienten, die über sechs bis 28 Wochen mit dieser Substanz behandelt wurden, verschlechterten sich die kognitive Leistungsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Bewältigung von Alltagsaktivitäten und das Antriebsverhalten deutlich langsamer als bei vergleichbaren Patienten, die lediglich wirkstofffreie Placebo-Tabletten erhielten“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004, S. 52). Den „Zeitgewinn“ durch entsprechende Medikation bewerten Experten zwischen sechs Monaten und bis zu zwei Jahren (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004, S. 53).
|34|Gruppe 3: Vitaminpräparate. Gerade in der Diskussion um die Prävention einer Demenz werden immer wieder Vitamine ins Spiel gebracht. Besonders den Vitaminen C, E und Beta-Karotin wird nachgesagt, dass sie die freien Radikalen fangen. Verschiedene Studien (wahrscheinlich je nach Interessenlage) bewerten den Einsatz von Vitaminen im Zusammenhang mit Demenz sehr unterschiedlich, wenn nicht gar widersprüchlich (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2004, S. 48).
Selbst wenn die Wirksamkeit eines Präparates klinisch nachgewiesen wurde, muss sie für den einzelnen demenzkranken Menschen sehr sensibel ausgetestet werden.
Auf einen, meiner Meinung nach, nicht unerheblichen Einwand macht Synofzik aufmerksam, wenn es ihm darum geht, dass beim Einsatz von Antidementiva (aber auch bei anderen Interventionsformen) nicht einzelne Parameter der erkrankten Person im Vordergrund stehen sollten. „An welchen Behandlungszielen sollte sich eine Alzheimer-Behandlung aber orientieren, damit sie für den Patienten nutzbringend wird? Gerade für die Verordnung von Antidementiva ist diese Frage immer noch ungeklärt: Obwohl es mittlerweile viele randomisierte Studien gibt, die eine Wirksamkeit von CEIs (Acetylcholinesterasehemmer) nahelegen, bleibt es umstritten, ob und inwiefern die betroffenen Patienten von einer Behandlung mit CEIs profitieren“ (Synofzik, 2006, S. 302). Synofzik gibt dabei zu bedenken, dass eine nachweisliche Veränderung z. B. der Kognition, im Sinne einer Besserung, nicht unbedingt mit einer Steigerung der Lebensqualität verbunden sein muss, sodass die „statistische Wirksamkeit und das Erreichen eines klinischen Behandlungsziels […] hierfür allenfalls instrumentellen Wert [haben]“ (Synofzik, 2006, S. 303). Exemplarisch verdeutlicht Synofzik seine Überlegungen an Beispielen von Patient*innen und ihren Angehörigen, die sich im progredienten Verlauf der Erkrankung mit dem aktuellen Status abgefunden haben, und nun, nach „erfolgreicher“ Therapie mit bestimmten Antidementiva diese Stadien abermals durchlaufen müssen. „Ein Patient, der bereits die Einsicht in seine Situation und seine Zukunft verloren hat, könnte diese Einsicht wieder gewinnen, und wäre gezwungen, die Beeinträchtigung seiner kognitiven Fähigkeiten und die Aussichtslosigkeit der Zukunft erneut wahrzunehmen. […] Der entscheidende Punkt, an dem ein Patient ,vergisst, dass er vergisst‘, könnte zu einem sich lang dahinziehenden, quälenden Zeitraum werden“ (Synofzik, 2006, S. 304).
Die Praxis zeigt, dass es noch zwei weitere Medikamentengruppen gibt, die häufig bei Demenz Anwendung finden. Zum einen sind es Sedativa, die den Erregungszustand und die Unruhe der Menschen mit Demenz dämpfen sollen. Leider dämp|35|fen sie auch deren Antrieb und die Vigilanz. Bei der Gabe von Sedativa sollten vorher folgende Fragen beantwortet werden:
Leidet der betroffene Mensch oder sein soziales Umfeld unter der Unruhe und der Erregung?
Sind zuvor andere Interventionsformen (nicht-medikamentöse Therapieansätze) getestet worden?
Welche psychosozialen oder körperlichen Ursachen könnten die Unruhe und Erregung verursacht haben?
Gibt es Informationen im Biografiebogen, in welchen Situationen die demenzkranke Person früher, vor Beginn der Erkrankung, ein ähnliches Verhalten gezeigt hat?
Lassen sich bestimmte Situationen beschreiben, in denen dieses Verhalten besonders häufig oder deutlich gezeigt wird?
Gibt es Angebote (Zuwendung, Trost, Nähe etc.), bei denen das Verhalten nachlässt?
Sedativa sind schnell verordnet. Manchmal finden wir diese Medikamentengruppe schon in der Bedarfsmedikation. Nur muss hier gefragt werden, wer den Bedarf formuliert? Wer wird durch die Unruhe oder Erregung gestört, sodass dieses Verhalten gedämpft werden muss? Wojnar beantwortet diese Frage wie folgt: „Eine medikamentöse Therapie des Wahns und der Halluzinationen, der psychotischen Ängste, der Aggressivität oder einer ausgeprägten psychomotorischen Unruhe ist immer dann sinnvoll (und notwendig), wenn bei der Abklärung ihrer Ursachen festgestellt wird, dass sie tatsächlich durch krankheitsbedingte Veränderungen der Hirnfunktionen entstanden sind und der Patient unter ihnen sichtbar leidet oder ihretwegen nicht mehr adäquat betreut werden kann“ (Wojnar, 2001b, S. 45) Und weiter: „Die Behandlung mit Psychopharmaka ,aus organisatorischen Gründen‘ (z. B. Personalmangel) ist genauso unzulässig, wie eine Sedierung des Kranken ,damit er andere nicht stört‘. Nach einer kurzfristigen Entlastung des Personals und der Umgebung führen die Nebenwirkungen solcher ,Therapien‘ mittelfristig eher zu einer zusätzlichen Belastung aller Beteiligten, z. B. durch häufige Stürze, Bettlägerigkeit, dysphorische Verstimmung, Störungen bei der Nahrungsaufnahme u. ä.“ (Wojnar, 2001b, S. 53).
Bevor nun der Neurologe bzw. der Gerontopsychiater kontaktiert wird und möglicherweise Psychopharmaka zum Einsatz kommen, sollte eine Fallbesprechung zum sogenannten „herausfordernden Verhalten“ organisiert werden. Hierbei sollten unbedingt die in Tabelle 1-2 aufgeführten Fragen bearbeitet werden.
|36|Tabelle 1-2: Fragenkatalog für eine Fallbesprechung zu „herausfordernden Verhaltensweisen“ (Eigendarstellung)
Fragen
Seit wann zeigt die Person mit Demenz die herausfordernden Verhaltensweisen?
Was ging diesem Zeitraum voraus, z. B. Ortveränderung, Sturzereignis?
Haben Sie den Eindruck, dass die Person mit Demenz hierüber ein Leiden ausdrückt? Wenn ja, woran machen Sie das fest?
Könnten sich Nebenerkrankungen verschlechtert haben, wenn ja, welche?
Ist für die betroffene Person ein Schmerzassessment angelegt worden, wenn ja, wie sind hier die Punktwerte?
Ist versuchsweise ein Schmerzmedikament, z. B. die Bedarfsmedikation, ausgetestet worden? Wie hat die betroffene Person hierauf reagiert?
Sind die Schmerzmedikamente kurzfristig erhöht worden und wie hat die betroffene Person hierauf reagiert?
Wie interpretieren die Angehörigen das veränderte Verhalten?
Können nicht-medikamentöse Maßnahmen, z. B. Handmassagen oder Aromapflege das Verhalten beeinflussen?
Geht das herausfordernde Verhalten mit Angst und Unsicherheit einher? Wenn ja, woran machen Sie das fest?
Können Maßnahmen der Basalen Stimulation das herausfordernde Verhalten beeinflussen? Wenn ja, welche?
In welchen Situationen hat die zu pflegende Person früher dieses Verhalten gezeigt?
Was versprechen sich die mitbeteiligten Personen, z. B. Angehörige, vom Einsatz der Psychopharmaka?
Ist den mitbeteiligten Personen bekannt, welche Risiken mit dem Einsatz der Psychopharmaka verbunden sind?
Ursachen können vielfältig sein
Die eine Ursache für sogenanntes „herausforderndes Verhalten“ gibt es nicht. Gerade dann, wenn den erkrankten Menschen die verbale Sprache nicht mehr möglich ist, kommunizieren sie ihr Unwohlsein bzw. ihr Leiden auch über diese „herausfordernden Verhaltensweisen“. Hier ist es nun Sache des Teams, der Angehörigen und des Hausarztes oder der Hausärztin herauszufinden, was den zu pflegenden Menschen quält.
|37|Erst wenn alle möglichen therapierbaren Ursachen ausgeschlossen werden können, kann auch der Einsatz der Psychopharmaka sinnvoll sein. Erst recht, wenn zu bemerken ist, dass der erkrankte Mensch unter seiner Unruhe leidet und anders nicht zu einer inneren Ruhe findet. Mitunter können Unruhezustände den Demenzkranken bis zur völligen Erschöpfung treiben, sodass der Einsatz dieser Medikamentengruppe kurzfristig nützlich ist. Bedacht werden sollte aber, dass die nicht-medikamentösen Interventionen immer den medikamentösen vorgezogen werden sollten.
Psychopharmaka und ihre Wirkmechanismen
Sicherlich haben Pflegefachkräfte im Berufsfeld häufig mit Psychopharmaka zu tun. Hierbei handelt es sich um einen Sammelbegriff von Medikamenten, die einen Einfluss haben auf die Psyche, also die Seele und auf die Gesamtheit der geistigen Vorgänge.
Mittlerweile sind mehrere tausend psychotrop wirkende Substanzen bekannt und zum Teil werden diese angewendet, um verschiedene psychische und psychiatrische Erkrankungen positiv zu beeinflussen. Hierbei wird allerdings nicht einseitig nur auf den Einsatz dieser Substanzen gesetzt, denn parallel hierzu gibt es eine Vielzahl von psychotherapeutischen Ansätzen, die den Krankheitsverlauf ebenfalls positiv beeinflussen können.
Gruppierung der Krankheitsbilder
Die verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbilder werden in Gruppen zusammengefasst:
Exogene bzw. somatogene Psychose: Hierbei handelt es sich um körperlich begründete Psychosen, da ihnen eine körperliche Störung zugrunde liegt, z. B. Intoxikationen oder auch Hirntumore. Es werden bei diesen Krankheitsbildern Hirnstoffwechselstörungen gemutmaßt.
Endogene Psychosen: Diese werden nicht auf abnorme äußere Erlebnisse oder Konflikte zurückgeführt. Im Grunde liegen ihre Ursachen im Dunkeln. Mögliche Krankheitsbilder sind z. B.: Schizophrenie oder auch manisch-depressive Psychose.
Psychogene Störungen: Ihnen liegen keine körperlichen Störungen zugrunde, denn sie sind erlebnisbedingte, abnorme seelische Reaktionen. Bei ihnen liegen innere Konflikte vor. Beispielhaft können hier genannt werden, z. B.: Zwangsneurosen oder Angststörungen.
|38|Psychopathien: Hierbei handelt es sich um seelische Störungen, denen eine außerhalb des Normbereichs liegende Charakteranlage zugrunde liegt, z. B. abnorme Geltungssucht oder abnorme Erregbarkeit.
Die Wirkung bestimmt die Medikamentengruppe
Die Psychopharmaka sind eine Vielzahl verschiedener psychotrop wirkender Substanzen. In Tabelle 1-3 werden sie gemäß ihrem Wirkprinzip zu Medikamentengruppen zusammengefasst.
Tabelle 1-3: Gängige Psychopharmaka und ihre Wirkprinzipien (Eigendarstellung)
Neuroleptika
Diese Psychopharmaka werden bei Psychosen und anderen psychischen Störungen eingesetzt. Sie reduzieren den vitalen Antrieb, dämpfen Erregung und Aggressivität, ohne dass sie zur Eintrübung des Bewusstseins oder zur Störung der Kritikfähigkeit führen.
Als Nebenwirkungen zeigen sich oftmals Verstopfung, Schweißausbrüche, Blutdruckabfall, Störungen des Bewegungsablaufes und Abweichungen im Muskeltonus.
Atypische Neuroleptika
Sie wirken antipsychotisch, psychomotorisch dämpfend, sedierend und schlafanstoßend. Hier werden die einzelnen Wirkstoffgruppen noch nach ihrer neuroleptischen Potenz eingestuft, z. B.: Melperon ist eher schwach potent, hingegen Chlorpromazin mittelstark potent ist.
Oftmals werden diese Medikamente auch wegen ihrer Nebenwirkungen eingesetzt, denn z. B. ist das Atosil, als schwach potentes Neuroleptikum ebenfalls: antiallergisch, antiemetisch – es nimmt den Brechreiz – und spasmolytisch – es wirkt also entkrampfend.
Bei Verwirrtheitszuständen, Unruhe, Erregtheit und Aggressivität bei älteren psychiatrischen Patienten wird oftmals Ciatyl, eine Substanz mit mittlerer neuroleptischer Potenz, eingesetzt.
Tranquillantia
Sie kommen zum Einsatz bei Angst- und Spannungszuständen und bei innerer Unruhe. Zudem werden diesen Medikamenten auch eine umweltabschirmende Wirkung zugesprochen.
Ihre Wirkung entfalten sie vor allem im Limbischen System, aber auch im gesamten Zentralnervensystem, in dem sie dämpfend wirken. Oftmals werden sie auch wegen ihrer muskelentspannenden Wirkung eingesetzt, z. B. Tetrazepam und Diazepam.
Diese Gruppe der Benzodiazipine können die zentraldämpfende Wirkung anderer Substanzen, wie z. B. Alkohol oder auch Analgetika, verstärken. Zudem haben sie ein hohes Suchtpotenzial, sodass diese Substanzen nur über einen kurzen Zeitraum eingenommen werden sollten.
|39|Antidepressiva
Sie zählen zu den Psychopharmaka im engeren Sinne. Ihre Wirkung liegt im Bereich der Stimmungsaufhellung und der Minimierung von Depressionen. Hierbei müssen jedoch verschiedene Medikamentengruppen wieder unterschieden werden, da sie unterschiedlich wirken:
Stimmungsaufhellende Komponente
Psychomotorisch dämpfende Komponente
Antriebsteigernde Komponente
Die Substanzen mit stimmungsaufhellender Komponente werden auch tricyclische Antidepressiva genannt. Sie werden gerne auch als sogenannte Koanalgetika im Rahmen der Schmerztherapie eingesetzt.
Achtung: Als pflanzliches Antidepressivum bei leichten depressiven Verstimmungen und leichten depressiven Zuständen hat sich das Johanniskraut bewährt. Allerdings kann das Johanniskraut andere Medikamente in ihrer Wirkung herabsetzen, z. B. die herzstützenden Digitalis Präparate und das blutverdünnende Marcumar.
Lithiumsalze
Sie werden zur Behandlung und Prophylaxe manisch-depressiver Psychosen eingesetzt. Ihre Wirkung tritt eher verzögert ein, sodass der Patient mehrere Tage warten muss, bis er eine Wirkung spürt.
Vorsicht: