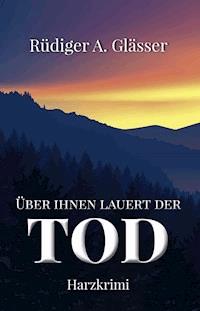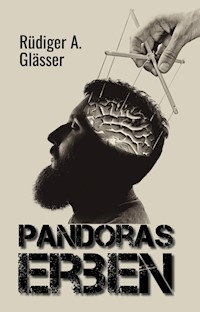
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Bulgarien verschwindet Dimitri Plantanow spurlos. Sein Bruder Georgi, ein Ex-Polizist, begibt sich auf die Suche. Er erfährt, dass Dimitri zuletzt in Begleitung eines international agierenden Gangsterbosses gesehen worden ist. Weitere Spuren führen Georgi nach Serbien, Ungarn, Österreich und schließlich in den Harz. Als Pierre Rexilius kurz vor seinem Urlaub in einem neuen Fall ermittelt, gerät er selbst unter Mordverdacht. Das LKA unter Leitung seines Erzfeindes Dunker übernimmt die Ermittlungen und eröffnet die Jagd auf ihn. Pierre entgeht seiner Verhaftung nur knapp und taucht unter. Um seine Unschuld zu beweisen, recherchiert der Hauptkommissar fieberhaft auf eigene Faust weiter. Irgendjemand scheint die sprichwörtliche »Büchse der Pandora« geöffnet zu haben. Die Zusammenhänge, die er zwischen dem Mordfall und der antiken Sage aufdeckt, offenbaren etwas Grauenvolles, das ihm den Verstand zu rauben droht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rüdiger A. Glässer
Sowohl die Handlung als auch die in diesem Roman vorkommenden Charaktere entspringen der Fantasie des Autors. Ähnlichkeiten mit verstorbenen oder lebenden Personen wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Impressum
Pandoras Erben
ISBN 978-3-947167-49-4
ePub-Version
V1.0 (03/2020)
© 2020 by Rüdiger A. Glässer
Abbildungsnachweise:
Umschlagmotiv © SvetaZi
# 142874715 | depositphotos.com
Porträt des Autors © Ania Schulz
as-fotografie.com
Lektorat:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163 · 37104 Duderstadt · Deutschland
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
E-Mail: [email protected] · Web: harzkrimis.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Titelseite
Hinweis
Impressum
Prolog
Vier Monate später
Osterode, Inspektion
Südharz
Bulgarien, Varna
Bulgarien, Schwarzmeerküste
Herzberg / Osterode
Bad Sachsa
Bulgarien, Karlovo
Bulgarien, Karlovo
Südharz
Osterode, Inspektion
Osterode, Inspektion
Bulgarien, Karlovo
Osterode, Inspektion
Osterode, Inspektion
Bad Sachsa, Seniorenheim
Bulgarien, Karlovo/Sofia
Bulgarien, Sofia
Bad Sachsa
Serbien, Belgrad
Bad Sachsa / Braunschweig
Serbien, Belgrad / Ungarn
Braunschweig / Hannover
Österreich, Wien
Südharz, Bad Sachsa
Österreich / Deutschland
Südharz
Blankenburg
Bad Sachsa
Südharz
Osterode, Inspektion
Bad Lauterberg, Waldstück auf dem Heikenberg
Göttingen-Dransfeld
Rübeland
Osterode, Inspektion
Osterode, Inspektion
Osterode, Inspektion
Braunschweig
Rübeland
Wieda
Rübeland
Osterode, Inspektion
Osterhagen
Rübeland
Südharz, Osterhagen
Rübeland
Hannover
Rübeland
Rübeland
Bad Lauterberg, Dr. Heine Sanatorium
In Steinbergs Suite
Papens Dienstzimmer
Rübeland
Bad Lauterberg, Dr. Heine Sanatorium
Eckertal, Steinbergs Anwesen
Bad Lauterberg, Dr. Heine Sanatorium
Rübeland
Epilog
Bad Sachsa, Bierstübl
Herzberg
Über den Autor
Mehr von Rüdiger A. Glässer
Prolog
Mein Name ist Alois Schrader. Heute ist der 11. Januar 2018. Werde ich das Datum als meine zweite Geburt ansehen können?
Ich befinde mich im Operationssaal, Neurologen und Neurochirurgen wollen mich von meiner Krankheit befreien. Sie haben meine Haare geschoren. Sie passen meinen Kopf an den Navigationsrahmen an, einen Metallbogen mit eingravierter Messskala, der sich wie das Modell einer Satellitenbahn über meine Nase und Wangen wölbt. Sie schrauben ihn direkt an meinem Schädelknochen fest. Ich fühle mich wie in einem Gefängnis, aus dem ich nicht mehr entrinnen kann.
Sie fixieren meinen Oberkörper, nur meine Arme und Beine bleiben frei. Das ist notwendig, weil sie meine Bewegungsfähigkeit während der Operation testen müssen. Aber nicht nur das: Ich erhalte nur eine örtliche Betäubung und werde die Operation bei vollem Bewusstsein miterleben. Nur mit meiner Mitarbeit kann sie gelingen. Was für eine Option!
Sie werden zwei Metallstäbe tief in mein Gehirn einführen. Ich höre den schrillen Ton des Bohrers. Ich höre die Geräusche des Wegstemmens und Herausbrechens kleinster verbliebener Knochenreste. Ich schreie. Ein zweites Mal setzt der Bohrer an. Wieder brechen Knochenteile. Ich schreie. Ich kann es nicht verhindern. Nur so kann ich den psychischen Druck besser aushalten und die Schallwellen ableiten. Das Schreien hilft, es befreit ein wenig. Ich schreie immer noch, obwohl der Bohrer längst ausgeschaltet ist. Ich höre meine Herztöne so laut wie Kirchenglocken. Sie rasen. Eine Krankenschwester erscheint, hält meine Hand, streichelt sie, redet beruhigend auf mich ein. Die Glockentöne werden leiser, verschwinden endlich.
In meinem Kopf sind zwei Löcher so groß wie Zweicentstücke. Die Vorstellung, dass gleich Nadeln tief in mein Gehirn eingeführt werden, bringt mich fast um den Verstand. Die Krankenschwester spricht immer noch mit mir. Sie hat eine angenehme, ruhige Stimme. Ich komme zur Ruhe. Ich muss mithelfen.
Ich weiß, was jetzt kommen wird. Die Operateure haben es mir mehrmals erklärt. Über eine am Navigationsring fixierte Halterung führen sie zuerst eine rund anderthalb Millimeter breite und knapp acht Zentimeter lange Führungshülse ins Gehirn ein. Durch sie schieben sie fünf Testelektroden einzeln in Richtung des Zielpunkts. Ich spüre keinen Schmerz. Gehirnzellen spüren keinen Schmerz.
Ich muss mithelfen, sonst gelingt die Operation nicht. Sie arbeiten sich zum subthalamischen Kern vor. Durch ihn laufen die wichtigen Schaltkreise zur Kontrolle von Impulsen und Bewegungen: Einige steuern Arme und Beine, andere die Sprache, wieder andere beeinflussen die Regelung verschiedener Körperfunktionen wie Blutdruck und Verdauung. Hier konzentrieren sich die bei meiner Krankheit so chaotisch feuernden Nervenzellen.
»Zielgebiet minus zehn Millimeter«, ertönt eine laute Stimme.
Sie sind nicht mehr weit entfernt vom Kern.
»Minus 9,5.«
Es dauert unerträglich lange.
»Minus sechs.«
Jetzt beginnen die Fragen und Tests.
»Sagen Sie bitte Bescheid, wenn es in ihrem Bein oder Arm kribbelt.«
Die Stimme ist neutral, fast schon formal. Wie eine seelenlose Computerstimme. Als ob das, was mit mir gemacht wird, eine Formsache ist. Sie sind mit einer Nadel tief in meinem Gehirn! Ich verneine. Wann kommen sie endlich an?, frage ich mich.
»Sprechen Sie mir nach: Liebe Lilli Lustig liebt launige Literatur.«
Ich schaffe es fehlerfrei.
»Minus drei.«
»Berühren Sie mit dem rechten Zeigefinger die Nasenspitze!«
Es gelingt mir zügig.
»Minus zwei.«
»Zählen Sie in Siebenerschritten von hundert rückwärts!«
Auch das schaffe ich.
»Minus eins.«
»Plus 0,5. Sprechen Sie mir nach: Fischers Fritze fischt frische Fische!«
»FrifrifriFisFis.« Jetzt ist es passiert. Meine Zunge rastet ein. Ich schaffe den Satz nicht mehr. Haben Sie mein Sprachzentrum zerstört? Ich werde hektisch. Mein Herz beginnt zu rasen. Ich höre das Pochen wie laute Hammerschläge gegen eine Wand.
»Null.«
Meine Zunge löst sich wieder. Die lauten Töne verstummen. »Fischers Fritze fischt frische Fische.« Danach zähle ich fehlerfrei in Fünferschritten von vierzig an rückwärts.
Ich höre die Stimmen der Operateure wie über Lautsprecher: »Wir sind am Ziel. Wir haben richtig gerechnet.«
Wie tröstlich. Was wäre, wenn sie sich verrechnet hätten? Ich sehe es nicht, aber ich weiß, was jetzt folgt. Sie entfernen die nicht so gut platzierten vier Sonden aus meinem Gehirn. Es dauert eine halbe Ewigkeit, bis die Neurologin endlich etwas sagt.
»Wir haben uns entschieden.«
Jetzt geht alles sehr schnell. Ich bekomme einen Bleimantel, der mich weitgehend umhüllt. Dann wird die Lage der Testsonde über Röntgenkontrolle festgehalten. Sie wird herausgenommen und durch eine dauerhaft verbleibende ersetzt.
»Röntgen … röntgen … röntgen … röntgen … röntgen … sitzt«, höre ich eine Stimme über mir, während der Operateur den endgültig im Gehirn verbleibenden Metallstab platziert. Dann ist es geschafft. Die erste der beiden Elektroden ist eingesetzt. Damit bin ich aber nicht erlöst. Gleich beginnt die gleiche Prozedur in der anderen Gehirnhälfte …
Vier Monate später
Ich bin am Verzweifeln. Die Operation hat meine Beschwerden kaum gelindert. Ich muss zahlreiche Medikamente einnehmen, fast so viele wie davor. Etwas Negatives hat die Behandlung zur Folge gehabt. Mein Sehvermögen hat sich stark verschlechtert. Ohne Brille kann ich nicht mehr lesen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich einer der drei von 100.000 Patienten bin, bei denen der Eingriff eine Verschlechterung gebracht hat. Als ob das ein Trost ist!
Ich gehe wieder regelmäßig zur Selbsthilfegruppe. Sie hat eine neue Leiterin. Sie erzählte mir beim heutigen Treffen, dass sie vollständig geheilt worden ist. Was ist das für eine Therapeutin, die einem ihre eigene Heilung vorhält, während ich unsäglich leide? Ich werde wütend. Aber schnell erfahre ich den Grund für ihr Verhalten. Auch sie war vor einigen Jahren mit der gleichen Methode wie ich operiert worden. Auch bei ihr hatte es kaum Verbesserungen gegeben. Aber vor ein paar Monaten hat sie zufällig einen Neurologen kennengelernt, der eine neue Operationsmethode entwickelt hat. Keine lange und nervenaufreibende Operation. Keine Nadeln. Nur eine Operation unter Vollnarkose. Der Neurologe hatte ihr einen Termin angeboten. Schon zwei Wochen später wurde der Eingriff durchgeführt. Zuerst wurde ihr Gehirn gescannt, dann wurde ihr ein Implantat unter der Kopfhaut eingepflanzt, das nicht größer als ein Zweieurostück ist. Die ganze Prozedur hatte nicht länger als drei Stunden gedauert. Die in der ersten Operation eingesetzten Sonden hatte man entfernt. Alle Symptome der Krankheit sind nachhaltig verschwunden. Kein Zittern der Hände mehr, keine Schlaflosigkeit, keine Darmprobleme. Ein stabiler Kreislauf. Sie fühlt sich wie neugeboren.
Ich frage hoffnungsvoll nach der Adresse des Neurologen, der diese Operation durchgeführt hat. Sie teilt sie mir mit und bietet ihre Hilfe bei der Vermittlung eines Termins an.
Drei Wochen später ist es soweit. Ich werde in den OP-Raum einer kleinen Klinik in Bad Lauterberg geschoben, von der ich noch nie etwas gehört habe. Aber ich habe keine andere Wahl.
Osterode, Inspektion
13. Juli 2018, vormittags
Pierre Rexilius saß gerade in seinem Büro, als das Krokodil über Lautsprecher die Belegschaft der Inspektion zu einer außerordentlichen Versammlung im großen Sitzungssaal bat. Rexilius klopfte seine Pfeife im Aschenbecher aus und machte sich auf den Weg.
Als er den Saal betrat, wunderte er sich, dass bereits über dreißig Kollegen auf ihren Stühlen saßen. Vorn stand Polizeidirektor Fischer am Pult und machte ein freudiges Gesicht. Hinter vorgehaltener Hand allerdings wurde er das Krokodil genannt. Diesen Spitznamen hatte man dem passionierten Modelleisenbahner (mit eigener Anlage im Dienstzimmer) vor einigen Jahren gegeben, als er ein rares Modell einer Schweizer Elektrolokomotive ersteigerte. Die Kollegen in der Inspektion mutmaßten, dass Fischer Schuhe mit der Größe fünfzig trug. Bei einer Körpergröße von einem Meter achtundneunzig war das auch nicht verwunderlich. Seine Dienstanzüge mussten gesondert gefertigt werden, da seine Konfektionsgröße in keiner Kleiderkammer vorrätig war. Die ohnehin schon imposante Erscheinung seines Vorgesetzten wurde durch den Umstand komplettiert, dass Fischer bereits im Alter von fünfundzwanzig Jahren sämtliche Kopfhaare verloren hatte.
Nachdem Pierre sich auf den letzten freien Stuhl gesetzt hatte, räusperte sich der Inspektionsleiter. Das Geraune im Saal verstummte.
»Liebe Kollegen, Sie wundern sich sicherlich, dass ich Sie zusammengerufen habe, aber ich kann Ihnen eine freudige Nachricht überbringen«, sagte er und legte eine kurze Pause ein. Die Polizisten schauten ihren Chef gespannt an. »Unsere Inspektion war im Jahr 2016 die erfolgreichste Dienststelle in Niedersachsen. Nicht nur das, auch im Bundesgebiet sind wir führend gewesen.«
Die Zuhörer klatschten und johlten fast eine Minute lang. Das Krokodil hob die Hand, langsam verstummten die Jubelbezeugungen.
»Mein Dank gilt allen Mitarbeitern unserer Inspektion. Besonders gewürdigt hat die Kommission, dass wir … nein besser, dass unsere Mordkommission nicht nur einen raffinierten Serienmörder überführen, sondern auch einen Überfall auf einen Geldtransporter aufklären konnte, der vier Jahre zurücklag und bei dem jede Spur von den Tätern gefehlt hatte. Auch ein großer Teil der Beute konnte sichergestellt werden. Hier muss ich vor allem den Leiter der Mordkommission, Hauptkommissar Rexilius, hervorheben, der mit seinem genialen kriminalistischen Spürsinn den Hauptanteil daran hatte.«
Die Polizisten erhoben sich, klatschten und schauten Rexilius anerkennend an. Die Beifallskundgebungen hielten ein paar Minuten an. Das Krokodil ging auf Pierre zu und gratulierte ihm.
»Danke«, sagte Pierre, »aber ich habe nur meine Arbeit gemacht, so wie alle Kollegen in unserer Inspektion.«
Das Klatschen wurde lauter und schwoll zu einem Stakkato an. Nachdem Fischer zum Pult zurückgekehrt war, verstummten die Beifallskundgebungen wieder.
»Die Kommission hat uns mit einer besonderen Auszeichnung bedacht. Eine Abordnung von fünf Kollegen ist eingeladen worden, für drei Wochen in die USA zu reisen, um deutsche Polizeiarbeit vorzustellen. Das FBI und andere überregionale Polizeibehörden werden uns empfangen und mit uns einen Meinungsaustausch durchführen. Damit haben wir das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter ausgestochen.«
Tosender Beifall folgte.
Das Krokodil hob die Arme. »Wir müssen die Delegation noch zusammenstellen, die in die USA reist, aber es ist klar, dass Hauptkommissar Rexilius auf jeden Fall dabei ist. Der Flieger startet schon in zwei Tagen. So, und jetzt wieder an die Arbeit.«
Der Saal lehrte sich. Als nur noch Pierre und das Krokodil im Raum waren, sagte Rexilius: »Ich kann nicht mitfahren. Zum einen habe ich in drei Tagen einen Gerichtstermin, den ich nicht platzen lassen kann, vor allem aber haben wir seit langem mit Freunden einen Urlaub auf Amrum geplant. Den kann ich unmöglich absagen.«
Der Inspektionsleiter sah Pierre bedauernd an. »Ich kann doch nicht ohne die Hauptperson in die USA reisen! Aber natürlich verstehe ich Ihre Gründe.«
»Sie sind ein würdiger Vertreter meiner Person«, sagte der Hauptkommissar.
Als Rexilius wieder in seinem Büro saß, bekam er Besuch von Frank Imse, seinem Kollegen aus der Mordkommission.
»Das ist ja mal ne tolle Auszeichnung für deine Arbeit«, sagte Imse.
»Sag besser für ›unsere Arbeit‹. Du hast auch erfolgreich mitgearbeitet. Und die anderen Kollegen der MoKo. Was hältst du davon, wenn du an meiner Stelle mitfährst?«
»Ich hasse solche Veranstaltungen, das weißt du doch. Außerdem habe ich eine Fußballmannschaft als Trainer übernommen. Wir sind mitten in der Saisonvorbereitung, da kann ich meine Truppe nicht alleine lassen. Außerdem hast du, wenn es in der Zwischenzeit einen Mord gibt, dann keinen Computerfachmann.«
»Da hast du natürlich recht«, sagte Pierre und schmunzelte. Er wusste von der Abneigung seines Kollegen gegen solche Veranstaltungen.
»Ich glaube, es reicht, wenn das Krokodil unsere Arbeit repräsentiert«, sagte Imse. »Hast du übrigens mitbekommen, dass Rauert und sein Assi Bienlein nicht bei der Versammlung waren?«
»Ja, ich hab es bemerkt. Wie ich gehört habe, hat unser Oberrat für heute Urlaub genommen. Wahrscheinlich hat er von der Auszeichnung schon gestern gehört und wollte sich die Schmach ersparen, dass unsere Arbeit besonders hervorgehoben wird«, sagte Pierre. »Apropos Urlaub. Rainer Wetzel und seine Frau Jacqueline kommen morgen. Am Wochenende wird gepackt, und am Montag fahren Sandra, Henriette und die beiden Wetzels schon mal nach Amrum vor. Am Donnerstag muss ich noch bei einem Prozess aussagen. Danach werde ich den Harz sofort in Richtung Nordsee verlassen. Endlich können wir mal einen gemeinsamen Urlaub machen. Der letzte war vor vier Jahren. So, ich fahr jetzt nach Herzberg. Wir sehen uns dann am Montag.«
»Dann grüß mal die Wetzels und Sandra und mein zukünftiges Patenkind Henriette von mir«, sagte Imse.
Südharz
14.-15. Juli 2018
Die Vorfreude auf den kommenden Urlaub war groß. Die Wetzels, sehr gute Freunde von Pierre und Sandra, waren am Samstagmittag aus Freiburg gekommen, um mit ihnen gemeinsame Ferien zu verbringen. Ihre Reiseutensilien, drei große Koffer, ließen sie bis zur Abfahrt nach Amrum im Auto. Jacqueline Wetzel half Sandra bei ihren Reisevorbereitungen, während Pierre mit Rainer und Henriette nach Bad Sachsa fuhr. Ziel war der Ravensberg.
Henriette war inzwischen zwanzig Monate alt und hatte sich prächtig entwickelt. Natürlich bildete sie den Mittelpunkt der kleinen Familie. Sie hatte zu sprechen angefangen und beherrschte ausgerechnet schon das schwierige Wort ›Polizei‹.
Sandra hatte ihr Psychologiestudium abgeschlossen und würde nach der Babypause, die in vier Monaten zu Ende ging, wieder in den Polizeidienst zurückkehren. Allerdings würde sie nur am Vormittag arbeiten, wenn Henriette im Kindergarten war. Geplant war, dass sie sich zur Profilerin ausbilden lassen würde. Sie würde Pierre bei seinen Mordermittlungen in Zukunft von dieser Seite aus unterstützen können.
Der Wetterdienst hatte angekündigt, dass es wieder sehr heiß werden und die Sonne den ganzen Tag lang ungehemmt scheinen würde. Als sie auf dem Ravensberg vor den Grundmauern des 1962 abgebrannten Hotels standen, waren es schon fast dreißig Grad. Kein Lüftchen wehte. Henriette schien die Hitze nichts auszumachen, offensichtlich hatte sie die Hitzeunempfindlichkeit ihres Vaters geerbt. Rainer Wetzel mochte den normalen mitteleuropäischen Sommer mit Abkühlungen und gelegentlichem Regen lieber. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Pierre erzählte seinem ehemaligen Kollegen über den Brand von 1962. Immer wieder hatte es Planungen gegeben, auf dem Bad Sachsaer Hausberg ein neues Hotel zu bauen. Auf die Beine gestellt hatte man allerdings nur eine Art Baude, in der Wanderer von Mittag bis zum frühen Abend einkehren konnten. In den letzten Jahren hatte man geplant, ein Feriendorf auf dem Berg zu errichten. Das hatte sich zerschlagen. Dann sollte es einen zusammenhängenden Hotelkomplex geben. Allerdings war man auch hier nicht weitergekommen, weil die Stadtväter für den Bau der Versorgungsleitungen, der mehrere Millionen verschlingen würde, keinen Investor finden konnten. So wie Pierre es im Gedächtnis hatte, war das Projekt erst einmal auf Eis gelegt worden.
Nachdem sie mehrere Aussichtspunkte aufgesucht hatten, die einen fantastischen Überblick über den Harz boten, fuhren sie zum Märchengrund. Dieser hatte ein neues Betreiberehepaar, Bärbel und Hermann Hinrichs, das die Anlage modernisiert und eine neue Konzeption entwickelt hatte, die den Besucherstrom stark hatte ansteigen lassen. Henriette jedenfalls kommentierte die Attraktionen des Märchenparks mit leuchtenden Augen in ihrer Kleinkindersprache. Erst nach fast zwei Stunden schafften es Rainer und Pierre, sie zum Abschied zu bewegen.
Als sie wieder in Herzberg ankamen, hatten die beiden Frauen die Urlaubsvorbereitungen abgeschlossen.
Am folgenden Sonntag erhielten sie Besuch von Frank Imse und seiner Frau Nathalie, die die Wetzels schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatten. Nach einem ausgiebigen Essen und Kaffeetrinken verabschiedeten sich die beiden am Abend von den ›Urlaubern‹.
Bulgarien, Varna
14. Juli 2018
Georgi Plantanow saß an seinem Wohnzimmertisch und musterte Sofia Dimitrowa. Er hatte sie lange nicht mehr gesehen. Obwohl sie inzwischen fast fünfzig war, sah sie gut zehn Jahre jünger aus, auch als Fünfunddreißigjährige konnte sie durchgehen. Sie war eine attraktive Frau. Nun ja, Dimitri, sein Bruder, hatte schon immer einen guten Geschmack gehabt, wenn es um Frauen ging. Vor fünfzehn Jahren hatte er Sofia geheiratet, aber lange hielt er es nie mit einer Frau aus. Drei Monate nach der Hochzeit hatte er Sofia verlassen und sich einer Engländerin zugewandt, die an der Schwarzmeerküste für einen britischen Reiseveranstalter tätig war. Seit dieser Zeit hatte er von Dimitri nichts mehr gehört. So wie er seinen Bruder einschätzte, war die Liaison mit der Britin längst beendet und zahlreiche weitere Frauen waren inzwischen von ihm ›beglückt‹ worden.
Sofia rutschte auf dem Sofa hin und her, kritische Blicke wanderten wieder und wieder durch das Zimmer. Georgi hatte für einen kurzen Moment ein Naserümpfen beobachten können. Diese abgewrackte Wohnung war nichts für sie, die nach der Scheidung von Dimitri einen reichen Österreicher geheiratet und die Errungenschaften des westlichen Kapitalismus schätzen gelernt hatte. Sie wohnte in seinem Haus am Schwarzen Meer. Ihr billiges Parfüm, das ihn fast einnebelte, irritierte ihn ein wenig. Hatten die Österreicher keine besseren Duftmittel?
»Was führt dich in mein bescheidenes sozialistisches Domizil?«, fragte er sein Gegenüber mit einem leicht spöttischem Unterton.
Sie schaute ihn nicht mehr herablassend an, eher um Hilfe bittend. War etwas passiert? Hatte der Österreicher die Nase voll von ihr und sie abgestoßen? Das billige Parfüm sprach dafür.
»Es geht um Dimitri.«
»Dimitri?«, fragte Georgi und verzog ungläubig das Gesicht.
»Ja, Dimitri. Wir haben uns wieder neu verliebt.«
Er schaute Sofia zweifelnd an. Dimitri und verlieben? Das wäre etwas ganz Neues. Sein Bruder sah Frauen stets als Sexobjekte an, und wenn er die Nase voll von einer hatte, dann fing er etwas mit der Nächsten an. Dimitri und Liebe?! Welchen Floh hatte er ihr denn ins Ohr gesetzt?
»Ja, wir hatten uns wiedergefunden. Vor drei Monaten. Und jetzt ist er verschwunden.«
Eine Träne löste sich aus ihrem Auge und rollte langsam die Wange herab. Georgi fragte sich, ob weitere Tränen folgen würden. Das war allerdings nicht der Fall.
»Du warst doch einmal ein exzellenter Polizist. Du bist der Einzige, der mir helfen kann«, sagte sie.
Georgi zog die Stirn kraus. »Mach dir nichts vor, Sofia. Wir beide kennen Dimitri doch ganz genau. Er hat dich verlassen und macht jetzt bestimmt mit einer anderen herum. So war er doch immer.«
»Nein, nein.« Ihr Ton wurde bittend, ja fast schon flehend. »Diesmal ist es nicht so. Er hat sich grundlegend geändert. Ich weiß nicht, warum, aber er ist so einfühlsam geworden. Wenn wir etwas unternommen haben, hat er mich immer gefragt, ob ich das auch will. Und er hat sogar im Haushalt mitgeholfen. Was mich am meisten gewundert hat, war, dass er regelmäßig gekocht hat. Es ist sogar zu einem Hobby geworden.«
Georgi musterte Sofia kritisch. Der Mann, den sie soeben beschrieben hatte, konnte unmöglich Dimitri sein. »Kann es sein, dass du meinen Bruder mit jemandem verwechselst?«
Sie schaute frustriert auf den Boden und holte tief Luft.
»Georgi, ich war zuerst auch sehr erstaunt. Dimitri hatte mich schon ein Vierteljahr, nachdem wir geheiratet hatten, das erste Mal betrogen. Wenig später kam er zurück zu mir und bat um Verzeihung, hat mir das Blaue vom Himmel versprochen. Dimitri konnte einen immer gut um den Finger wickeln. Nun, ich bin schwach geworden und hab ihm noch einmal eine Chance gegeben. Er ist wieder bei mir eingezogen.«
Wahrscheinlich hatte ihn die vorherige Frau aus ihrer Wohnung geworfen und Dimitri hat eine billige Bleibe gesucht. Dabei war ihm Sofia eingefallen, dachte Georgi.
Sie senkte den Kopf. »Seine Versprechen haben nicht lange gehalten. Zwei Monate später ist er mit einer Balletttänzerin abgehauen.« Einen kurzen Moment zog sie ein grimmiges Gesicht, das sich wenig später in ein lächelndes wandelte. »Aber dieses Mal war er anders.«
Georgi schüttelte den Kopf. »Mach dir nichts vor, Sofia, Menschen wie Dimitri können sich nicht ändern. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll, ich bin kein Therapeut.«
Sie schaute ihn kurz an, dann fasste sie in ihre Handtasche, holte ein Bild heraus und reichte es ihm. Es zeigte Dimitri in der Küche. Er rührte in einem Topf und war mit einer Kochschürze bekleidet. Georgi sah sich den Mann noch einmal genauer an. Ja, es handelte sich tatsächlich um Dimitri. War das eine neue Masche, um an Frauen heranzukommen, oder hatte er sich tatsächlich geändert? Nichts war für seinen Bruder schlimmer gewesen, als sich jemals an einen Kochtopf zu stellen. Georgi schaute Sofia verblüfft an.
»Genauso überrascht war ich, als er das erste Mal gekocht hat. Aber das war nicht die einzige Veränderung an ihm. Früher hat er oft illegales Glücksspiel betrieben. Davon hat er sich völlig losgesagt. Nicht ein einziges Mal hat er mehr Karten gespielt. Er hatte eine feste Arbeit. Sein Arbeitgeber kann sein plötzliches Verschwinden auch nicht erklären, er kannte Dimitri nur als zuverlässigen Mitarbeiter.«
»Was hat er denn zuletzt gearbeitet?«, fragte Georgi.
»Er war Verkaufsfahrer und hat Hotels an der Goldküste beliefert«, sagte sie und holte ein weiteres Foto aus ihrer Handtasche. Es zeigte Dimitri stolz vor einem LKW stehen.
»Er war auch bei seinen Kollegen sehr beliebt, wie ich gehört habe. Wenn sie krank waren und er frei hatte, hat er ihre Touren zusätzlich übernommen«, sagte Sofia.
Georgi schaute seine ehemalige Schwägerin nachdenklich an. Tatsächlich sprach einiges dafür, dass sich sein Bruder geändert zu haben schien.
»Hast du sein Verschwinden der Polizei gemeldet?«
»Ja, natürlich. Aber die Polizisten haben gesagt, dass sie nicht viel tun können. Heutzutage verschwinden viele spurlos. Die meisten von ihnen gehen nach Mitteleuropa, um dort eine Arbeit zu suchen. In Deutschland erhalten sie teilweise das Fünffache von dem, was sie hier in Bulgarien verdienen. Irgendwann tauchen sie wieder hier auf oder bleiben ganz in Mitteleuropa. Genauso wird es mit Dimitri sein. Das glaube ich aber nicht. Niemals.«
Georgi dachte an seine Zeit als Polizist. Das Gesellschaftssystem hatte sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zwar geändert, aber die Leute, die damals das Sagen hatten, waren immer noch in führenden Positionen. Das Gehalt war schlecht, deshalb hatten viele den Dienst aufgegeben. Georgi wusste von einem Bekannten, dass ein Polizist in Deutschland das Zehnfache verdiente. Straftaten wurden vertuscht, wenn der Delinquent genug Schmiergelder zahlte. Georgi war mehrmals von Ermittlungen beurlaubt worden, bevor er die Straftäter hatte überführen können. Die Anzeigen wurden fallen gelassen, obwohl sie schuldig gewesen waren. Nein, das war nicht mehr seine Polizei gewesen.
Er war vor über zehn Jahren aus dem Dienst ausgeschieden und hatte, um überleben zu können, mehrere Jobs annehmen müssen. Tagsüber arbeitete er in einer Werkstatt, die Zweiräder und Autos reparierte. Am Abend und in der Nacht fuhr er Taxi. Oft hatte er Touristen zu chauffieren, die sich mit dem billigen bulgarischen Wein und Schnaps betrunken hatten. Wenn die Hauptsaison vorüber war, übernahm er gelegentlich Bergtouren durch die Rhodopen, aus denen er auch stammte. Reich konnte er durch seine Jobs nicht werden, aber es reichte halbwegs zum Überleben. Zum Glück hatte er vor ein paar Jahren eine billige Zweizimmerwohnung von einem Bekannten, der ausgewandert war, übernehmen können. Sie war zwar durch das starke Rauchen seines Vorgängers vergilbt, aber er rauchte auch nicht gerade wenig. Die Einrichtung stammte aus der sozialistischen Zeit. Geld für neues Mobiliar hatte er nicht.
Er steckte sich eine Zigarette an und blickte auf Sofia, die ein Husten zu unterdrücken schien. »Selbst wenn ich es wollte, ich kann nichts für dich tun. Um mich über Wasser zu halten, muss ich zwei Jobs machen. Die kann ich nicht aufgeben«, sagte er.
Sofia lächelte. »Das dürfte kein Problem sein. Ich war mit einem reichen Österreicher verheiratet. Er hat mich nach der Scheidung ausgezahlt. Und er war großzügig.«
Georgi runzelte die Stirn. War Dimitri deshalb zu Sofia zurückgekehrt und hatte ihr Konto schon geplündert?
»Wusste Dimitri davon?«, fragte er. »Hast du deine Konten mal überprüft?«
»Dimitri wusste nichts darüber. Ich arbeite weiterhin als Reiseleiterin. Zugang zu meinen Konten hatte er nicht. Er hat auch nie danach gefragt.«
»Hm. Das hört sich fast an, als hätte jemand an Dimitri eine Gehirnwäsche vorgenommen.«
Sie ging nicht darauf ein. »Ich biete dir fünftausend Euro, wenn du den Auftrag übernimmst. Sollte es länger als einen Monat dauern, dann bekommst du ein Festgehalt. Ich hab an tausend Euro pro Monat gedacht. Alle Kosten, die dir entstehen, übernehme ich. Ich rede mit deinem Arbeitgeber und besorge eine Vertretung für die Zeit deiner Nachforschungen.«
Offensichtlich nahm Sofia das Verschwinden seines Bruders sehr ernst. Was machte sie nicht alles, um ihn für die Suche nach Dimitri zu gewinnen.
»Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?«, fragte Georgi.
»Du übernimmst die Suche nach ihm?«, fragte Sofia.
»Ja.«
»Danke«, sagte sie und lächelte. »Vor einer Woche ist er verschwunden. Er ist zur Arbeit gefahren, hat dort seinen LKW übernommen und alle Kunden beliefert. Danach ist er auf eine Raststätte gefahren, hat den LKW abgestellt und alle Papiere an der Kasse abgegeben. Und dort verliert sich seine Spur.«
»Hm. Ich brauche jetzt die Namen von allen Leuten, mit denen er Kontakt hatte.«
Sie nickte und erzählte Georgi alles, was sie wusste. Als sie fertig war, sagte sie: »Hast du wieder eine Frau?«
Er schüttelte den Kopf und dachte an Charlotte. Sie war bei einer Bergtour in den Rhodopen abgestürzt und ums Leben gekommen. Er gab sich die Schuld an ihrem Tod. Erst zwei Tage später wurde ihre völlig zerschmetterte Leiche in einer Schlucht gefunden. Georgi hatte es nicht fertiggebracht, sich den Knochenhaufen, der von ihr übriggeblieben war, noch einmal anzuschauen. Er wollte sie unversehrt in Erinnerung behalten. Bis heute hatte er ihren Tod nicht überwunden.
»Nein.« Mehr brachte er nicht heraus.
Sofia schaute ihn nachdenklich an, hakte aber nicht weiter nach.
»Ach«, sagte sie und griff in ihre Handtasche, »hier habe ich ein Smartphone für dich. Es läuft noch auf meinen alten österreichischen Nachnamen, den ich inzwischen wieder abgelegt habe. Mit dem Gerät hast du Internetzugang.« Sie reichte es ihm und nannte ihm die PIN-Nummer.
Bulgarien, Schwarzmeerküste
15. Juli 2018, vormittags
Sofia hatte Wort gehalten. Sie hatte mit dem Eigentümer der Werkstatt gesprochen und eine Vertretung für ihn besorgt. Fünftausend Euro hatte sie Georgi übergeben, ebenso tausend Euro für Spesen. Selbst ein Auto wollte sie ihm zur Verfügung stellen, er hatte aber abgelehnt. Für notwendige Fahrten würde er sein altes Motorrad mit Beiwagen benutzen, das immer noch sehr zuverlässig war. Fielen tatsächlich einmal Reparaturarbeiten an, dann konnte er sie selbst durchführen. Notwendige Ersatzteile führte er immer in seinem Sozius mit.
Georgi würde mit seinen Ermittlungen bei Dimitris Arbeitgeber beginnen. Er knatterte mit seiner Maschine auf das Firmengelände. Zwei Fahrzeuge standen auf dem Gelände. Es handelte sich um ältere Mercedesmodelle. Wenig später saß er im Büro von Dimitris Chef, Piotre Vladimov. Dieser rauchte eine Zigarre. Er hatte eine Vollglatze und brachte gut hundert Kilo auf die Waage. Georgi stellte sich vor und erzählte ihm, weshalb er gekommen war.
»Ich kann mir sein Verschwinden nicht erklären, ihm muss etwas zugestoßen sein«, sagte Vladimov. »Dimitri war sehr zuverlässig und ist sogar für Kollegen am Wochenende eingesprungen, wenn die mal mit ihrer Familie etwas Privates unternahmen. Er arbeitet jetzt seit einem halben Jahr bei mir und hat nicht ein einziges Mal gefehlt.«
Sofia schien mit ihrer Einschätzung tatsächlich richtig zu liegen. Dimitri hatte es in einem Job nie lange ausgehalten. Hier war er genauso sprunghaft wie bei seinen Frauengeschichten gewesen. Er musste eine radikale Persönlichkeitsänderung durchgemacht haben. Was aber hatte diese Änderung herbeigeführt? Es musste etwas geschehen sein, von dem er keine Ahnung hatte.
»War Dimitri an dem Morgen anders als sonst?«, fragte Georgi.
Vladimov schüttelte den Kopf. »Er war wie immer gut gelaunt. Ich hab ihm seine Tour gegeben und dann ist er losgefahren.«
»Was hatte er denn für eine Tour?«
»Er hat Obst und Gemüse bei einer Genossenschaft abgeholt und damit die Hotels beliefert. Dort sind alle Waren angekommen. Danach ist er zu einer Raststätte bei Kavarna, etwa vierzig Kilometer von Varna entfernt, gefahren, in der viele Brummifahrer einkehren. Und dort verliert sich seine Spur. Das Fahrzeug stand an der Raststätte. Papiere und Schlüssel hat er dort an der Kasse hinterlegt«, sagte der Spediteur und zog die Schultern hoch. »Ich kann mir das nicht erklären.«
»Haben Sie mit den Mitarbeitern der Raststätte gesprochen, ob denen etwas an Dimitri aufgefallen ist? Ist er vielleicht dazu gezwungen worden? Waren irgendwelche Personen in seiner Nähe, die sich außergewöhnlich verhalten haben?«
»Als ich den Lastwagen abgeholt habe, das war am Abend, hatte ein Schichtwechsel des Personals der Raststätte stattgefunden. Keiner konnte mir etwas darüber sagen, sie haben mir nur die Papiere und den Schlüssel übergeben«, antwortete Vladimov.
»Haben Sie später noch einmal mit jemandem aus der Frühschicht gesprochen?«
»Nein. Ich glaube, dass er von irgendjemandem ein Jobangebot erhalten hat, der mehr bezahlen kann als ich. Dass er die Papiere und Schlüssel abgegeben hat, spricht dafür. In unserem Land kommt das häufig vor. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen«, sagte Vladimov. »Das wissen Sie genauso gut wie ich. Der Systemwechsel und der Beitritt in die EU hat für uns keine großen Vorteile gebracht. Viele verlassen von heute auf morgen das Land und gehen nach Deutschland oder Österreich, wo sie erheblich mehr verdienen. Einige fallen dort auch wegen krimineller Machenschaften auf.«
Georgi nickte. »Hat er einen Spind?«
»Ja. Am besten gehen wir in den Mannschaftsraum, dort befinden sich die Spinde. Sie können seine Sachen ja gleich mitnehmen«, sagte Vladimov und stand von seinem Stuhl auf.
Dimitris Schrank hatte keinen Schlüssel. Der Spediteur öffnete ihn. »Da ist nichts drin«, sagte er.
Georgi runzelte die Stirn. »Hat Dimitri an dem Morgen, an dem er verschwand, möglicherweise seinen Spind geleert?«
Vladimov zog die Schultern hoch. »Das weiß ich nicht. Ich hab auch keine Ahnung, ob er ihn überhaupt genutzt hat.«
»OK, um welche Raststätte handelt es sich, die Dimitri aufgesucht hat?«
Vladimov nannte ihm die Adresse.
Eine Stunde später stellte Georgi sein Motorrad an der Raststätte ab. Auf den Parkplätzen standen fast zwanzig LKWs. Sie war ein beliebter Treffpunkt vieler Brummifahrer. Sein Magen knurrte, er würde erst mal etwas essen. Im Gastraum herrschte starker Andrang, fast alle Plätze waren besetzt. Er ging zum Buffet und holte sich einen Kaffee und drei belegte Brötchen. Nachdem er einen freien Platz gefunden hatte, aß er hastig. Danach steckte er eine Zigarette an und nippte an seinem Kaffee.
Optimistisch war er nicht gerade, hier irgendetwas über Dimitri erfahren zu können. Wie sollte sich bei solchen Menschenmassen jemand an ihn erinnern? Er drückte seinen Zigarettenstummel im Aschenbecher aus und ging zur Kasse, an der zwei Frauen standen. Er zeigte ihnen ein Foto seines Bruders.
»Haben Sie den Mann vor einer Woche hier gesehen? Etwa um die Mittagszeit.«
Nachdem die beiden Frauen sich das Bild angeschaut hatten, schüttelten sie den Kopf. »Aber vielleicht kann ihnen Radka weiterhelfen, sie macht gerade eine Zigarettenpause. Am besten gehen Sie nach draußen, sie steht direkt an der Eingangstür. Blonde Haare, nicht zu übersehen.«
Georgi ging nach draußen. Dort stand eine blonde Frau. Die Haare waren gefärbt, das war unübersehbar. Etwas zu stark geschminkt, aber dennoch attraktiv. Sie nahm einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette und tippte etwas in ihr Handy ein.
»Sind Sie Radka?«
Sie schaute ihn mürrisch an. »Ja, und wer will das wissen?«
»Mein Name ist Georgi Plantanow. Ich suche meinen Bruder Dimitri, er ist vor einer Woche spurlos verschwunden. Wie ich gehört habe, hat er seinen LKW auf der Raststätte abgestellt, Schlüssel und Fahrzeugpapiere an der Kasse abgegeben. Wo er danach abgeblieben ist, weiß ich nicht.«
Sie starrte ihn an. Dann entspannte sich ihr Gesicht etwas. »Ich hab gleich gewusst, dass er es war. So einen wie Dimitri vergisst man nicht so schnell.«
»Das heißt?«, hakte Georgi nach.
»Wir waren einmal für ein paar Monate liiert. Er hat die LKW-Papiere bei mir abgegeben. Ich sagte: Hallo Dimitri, wie geht es dir? Er schaute mich groß an und tat so, als würde er mich nicht kennen. Dann drehte er sich um und verließ die Raststätte.« Sie schaute Georgi groß an. »Das habe ich ihm aber nicht abgenommen. Ich habe die Kasse meiner Kollegin übergeben und bin ihm nachgegangen. Als ich draußen war, sah ich, wie er in ein wartendes Auto einstieg, das sich sofort in Bewegung setzte.«
»Können Sie das Fahrzeug beschreiben? Haben Sie sich vielleicht die Nummer gemerkt?«, fragte Georgi.
»Ich hab nur noch die ersten beiden Buchstaben gesehen. Es muss auf den Kreis Karlovo angemeldet sein. Es war ein schwarzes Auto, ein Mercedes. Ziemlich groß. Die Scheiben waren getönt. Muss ’nen Bonzenauto gewesen sein.« Sie schloss die Augen und öffnete sie Augenblicke später wieder. »Das Auto hatte auffällige Zierleisten aus Chrom. Die bildeten einen starken Gegensatz zu der schwarzen Autolackierung … Moment, ich hab sogar ein Foto von dem Luxusteil mit meinem Handy gemacht. Vielleicht können sie den genauen Typ bestimmen.«
»Sehr gut«, sagte Georgi. »Können Sie mir das Bild auf mein Smartphone senden.«
Sie lud das Bild hoch und schickte es ihm, nachdem er ihr seine Nummer gegeben hatte. Er betrachtete es. Leider war das Nummernschild nicht zu erkennen. In der Werkstatt, in der er arbeitete, kamen solche Autos nicht vorbei, aber es gab ja das Internet. Hier würde er die genaue Typenbezeichnung finden.
»Warum hat Dimitri sich Ihnen nicht zu erkennen gegeben?«, fragte er.
»Er schuldet mir noch Geld. Fünfhundert Euro.«
Er nickte. Das passte. Dimitri hatte die Frauen immer ausgenommen. Wenn nichts mehr zu holen war, dann gab er ihnen den Laufpass.
»Wenn Sie Ihren Bruder gefunden haben, können Sie ihn dazu bringen, dass er mir das Geld zurückgibt? Ich brauche es dringend.«
»Ich werde es versuchen. Mehr kann ich Ihnen aber leider nicht versprechen«, sagte Georgi.
Er ging zurück in Raststätte, die über ein Internetcafé verfügte. Er setzte sich an einen freien Computer und gab ›Mercedes gehobene Klasse‹ ein, schaute sich die dazugehörenden Bilder an und verglich sie mit dem Foto, das Radka gemacht hatte. Das Auto, in das Dimitri eingestiegen war, gehörte zur S-Klasse von Mercedes, dem Flaggschiff des Autobauers. Es konnte, je nach Ausstattung, deutlich über 100.000 Euro kosten.
In was war Dimitri hineingeraten? Ein derartiges Auto benutzten Leute im Rotlichtmilieu oder Verbrecher, die in der organisierten Kriminalität tätig waren. Die einzige Möglichkeit, an den Eigentümer des Fahrzeugs zu kommen, ging nur über einen Polizeicomputer. Er musste mit Boris sprechen. Er war der einzige seiner ehemaligen Kollegen bei der Polizei, der dort noch arbeitete, allerdings hatte er ihn schon Jahre nicht mehr gesehen. Er verließ das Internetcafé und nahm Kurs auf das Polizeipräsidium in Varna.
Die Zeit hatte an Boris genagt. Von seinem schon schütteren schwarzen Haar war ein fettiger Haarkranz geblieben. Sein Gesicht war deutlich runder geworden. Georgi glaubte, dass sein ehemaliger Kollege bestimmt zwanzig Kilo zugenommen hatte. Er hatte Karriere gemacht, war um drei Dienstränge aufgestiegen und hatte jetzt ein eigenes Dienstzimmer. Was nicht bedeutete, dass sich sein Gehalt deutlich erhöht hatte. Das machte pro Monat vielleicht zwei- bis dreihundert Euro mehr aus, aber er war in einen Rang aufgestiegen, bei dem er Informationen weitergeben konnte, für die ein ›besonderes Trinkgeld‹ bezahlt wurde. Außerdem hatte er Zugang zu Ermittlungen, die er beeinflussen konnte. Um es deutlich auszudrücken, er war in einen Rang aufgestiegen, in dem man gegen Geld Straftaten vertuschen konnte. Georgi war klar, dass er seine Informationen nicht umsonst bekommen würde. Sofia hatte ihn aber mit Spesen ausgestattet, die für solche Angelegenheiten vorgesehen waren.
Boris’ Büro war geräumig, auf seinem großen Schreibtisch standen Computer, Drucker, Telefon und einige kleine Bilderrahmen. An der Wand hinter dem Schreibtisch hing eine vergilbte Wandkarte von Bulgarien.
»Was führt dich nach so langer Zeit zu mir?«, fragte Boris. »Willst du wieder in den Dienst einsteigen?«
»Nein, nein. Ich brauche eine Information von dir.«
Boris wurde distanzierter. »Du weißt, dass ich keine polizeilichen Daten an Privatpersonen weitergeben darf.« Er schaute auf die Bilder, nahm eins heraus und zeigte es seinem ehemaligen Kollegen. »Das sind Luba, meine Frau, und meine beiden Kinder. Sie sind vier und sechs Jahre alt. Die Große kommt bald in die Schule. Ich will ihr eine gute Ausbildung ermöglichen, deshalb wird sie im Herbst eine Privatschule besuchen. Das kostet eine Menge Geld. So gut ist mein Gehalt nun auch wieder nicht. Und Luba geht erst nächstes Jahr in ihren alten Job zurück.«
»Ich will die Information nicht umsonst«, sagte Georgi.
Boris‘ Gesicht entspannte sich etwas. »Was brauchst du denn?«
Georgi erzählte ihm vom Verschwinden seines Bruders. »An der Raststätte ist er in einen großen schwarzen Mercedes eingestiegen. Es handelt sich um ein Modell der S-Klasse. Von diesem Typ dürfte es nicht so viele Exemplare in Bulgarien geben. Ich brauche den Namen des Fahrzeughalters.« Er nannte dem Polizisten die Kreisstadt.
Boris zögerte.
»Ich biete dir zweihundert Euro an, wenn du mir das infrage kommende Autos heraussuchst«, sagte Georgi. Darauf würde Boris eingehen, hoffte er, schließlich war das mehr als ein Viertel seines Monatsgehalts.
Einen Moment lang schien Boris noch zu überlegen, dann nickte er und tippte in die Tastatur. »Es gibt ein einziges Auto dieses Typs in dem Landkreis«, sagte er schließlich. »Wenn ich dir die Daten ausdrucke, dann macht das noch zusätzliche fünfzig Euro.«
»Druck sie aus«, sagte Georgi und legte Boris zweihundertfünfzig Euro auf den Tisch.
Dieser nahm die Geldscheine sofort und steckte sie hastig in seine Jackentasche. So, als könnte im nächsten Moment jemand den Raum betreten und ihn bei der Annahme des Geldes überraschen. Schließlich gab er den Druckbefehl. Einige Mausklicks später überreichte er seinem ehemaligen Kollegen einen Ausdruck.
»Von mir hast du die aber nicht. Du weißt, ich kann in Teufels Küche kommen, wenn jemand erfährt, dass ich dir die Daten gegeben habe.«
»Ich werde schweigen wie ein Grab«, antwortete Georgi, faltete das Blatt und steckte es in seine Gesäßtasche der Hose. Was war das für eine Welt, in der jedermann brisante Informationen von den Behörden kaufen konnte? Er war sich im Klaren darüber, dass Boris noch ganz andere Dinge für Geld tun würde. Er dachte nicht weiter darüber nach. Weil er diese Verhältnisse nicht hatte ertragen können, hatte er ja den Polizeidienst quittiert. Kurze Zeit danach verabschiedete er sich.
Als Georgi eine halbe Stunde später in seiner Wohnung in Varna am Behelfsschreibtisch saß, betrachtete er die Daten, die ihm Boris gegeben hatte. Der Fahrzeughalter hieß Simeon Blaskow, sein Wohnsitz war in Karlovo. Das war rund dreihundertfünfzig Kilometer von hier entfernt. Hin und zurück machte das siebenhundert. Er schaute auf die Uhr. Heute würde er die Strecke nicht mehr schaffen, aber gleich morgen früh aufbrechen.
Auf dem Ausdruck, den Boris ihm gegeben hatte, stand, dass Blaskow als Immobilienmakler tätig war. Georgi gab dessen Namen in die Suchmaschine ein. Viele Einträge gab es nicht über ihn, was einerseits verwunderte. Ein Immobilienmakler, der viel Geld machen wollte, hatte normalerweise eine deutlich stärkere Internetpräsenz. Andererseits schien gerade das den Verdacht nahezulegen, dass Blaskows Immobilienfirma eine Scheinfirma war. Möglicherweise diente sie zur Geldwäsche.
Georgis Instinkt meldete sich. Die Suche nach Dimitri würde gefährlich werden. Er fuhr in die Werkstatt, wo er eine Pistole im Spind versteckt hatte. Zum Glück war keiner seiner Kollegen im Betrieb. Er holte die Waffe aus dem Versteck und steckte sie in eine Box, die verborgen im Beiwagen angebracht war. Dann suchte er ein Elektronikgeschäft auf und kaufte sich ein Handy mit Prepaidkarte. Anstelle des Ausweises legte er einen Fünfzig-Euroschein auf den Tresen und gab dem Verkäufer einen falschen Namen und Adresse an. So konnte ihn keiner mit dem Handy in Verbindung bringen. Damit man ihn nicht so leicht orten konnte, hatte er ein älteres Gerät mit einem herausnehmbaren Akku gekauft. Bei den neuen Mobiltelefonen war das meist nicht mehr möglich.
Als er wieder in seiner Wohnung war, rief er Sofia an und berichtete, was er herausgefunden hatte und was er morgen unternehmen würde. Das hatte den Vorteil, dass Sofia wusste, wo er sich aufhielt. Sollte ihm etwas passieren, dann kannte sie bei etwaigen Nachforschungen zumindest seinen letzten Standort.
Herzberg / Osterode
16. Juli 2018, morgens bis nachmittags
Der Kleinbus der Wetzels stand abfahrbereit vor Sandras Haus. Jacqueline und Rainer saßen vorn, Sandra und Henriette auf den Sitzen dahinter. Pierre küsste seinen beiden ›Frauen‹. »Dann bis Donnerstag«, sagte er, verließ das Fahrzeug und schloss die Schiebetür. Noch einmal sah er die beiden durch die Scheibe an. Henriette schien mit beiden Händen zu winken und lächelte ihren Vater an. Dann setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Rexilius würde am Donnerstag mit Sandras Auto nachkommen. Als sie aus seinen Augen verschwunden waren, holte er sein Fahrrad und radelte in Richtung Inspektion los.
Als Pierre an seinem Schreibtisch saß, holte er den Harz Kurier aus dem Rucksack. Auf der Titelseite stand ein großer Bericht über die Inspektion Osterode. Wahre Lobeshymnen schrieb das Blatt über die Leistungen der Osteroder Polizei. Besonders die Rolle von Pierre wurde hervorgehoben. Der Autor bezeichnete ihn als ›Helden, der mit seinen Ermittlungserfolgen selbst das BKA ausgestochen hatte‹. Er glaubte, dass Rexilius wohl nicht mehr lange in der Inspektion bleiben und bald in eine höhere Instanz versetzt werden würde. ›Vielleicht sogar in die Polizeiakademie, wo er seinen einmaligen Spürsinn an die Studenten weitergeben und die Qualität der Ermittlungen erheblich verbessern würde. Auch das FBI in den USA würde von den Fähigkeiten des Leiters der Mordkommission profitieren können.‹
Nun, da irrt der Zeitungsschreiber aber gewaltig, dachte Pierre. Zum einen fuhr er nicht in die USA, und zum anderen würde er die aktive Polizeiarbeit niemals gegen eine Lehrtätigkeit tauschen. Auch dachte er im Traum nicht daran, zum LKA oder BKA zu wechseln. Sein Platz war hier in Osterode in der Mordkommission. Außerdem wurmte es ihn, dass die Zeitung nur seinen Beitrag an der Aufklärung in den Himmel gehoben hatte. Um erfolgreich zu sein, bedurfte es einer guten Zusammenarbeit in einem eingespielten Team, und das war der Fall. Er hätte sich gewünscht, dass in dem Bericht auch auf die Rolle von Imse, Sandra und den anderen Kollegen, die mitgearbeitet hatten, eingegangen worden wäre.
Pierre steckte sich eine Pfeife an und öffnete das Fenster. Warme Luft strömte in das Büro. Auch heute sollte es wieder über dreißig Grad warm werden. Er sah auf den verdorrten Rasen vor der Inspektion. Seit vielen Wochen hatte es nicht mehr geregnet. Er dachte an das Jahr 2003. Auch damals wurden Hitzerekorde gebrochen. Dann reflektierte er den Fall, bei dem seine Mordkommission nach intensiver Ermittlungsarbeit den Mörder überführt hatte, der drei Geschäftsführer aus Freiburg ermordet und den vierten zum Krüppel gemacht hatte.
Er setzte sich wieder an den Schreibtisch und überflog den überregionalen Teil der Zeitung. Hier gab es einen umfangreichen Bericht über die langandauernde Hitze und Trockenheit dieses Jahres. Einige Wetterexperten gingen davon aus, dass die trockene Witterung bis weit in den September hinein andauern würde. Der ›durch den Menschen gemachte Klimawandel sei in vollem Gange‹. Pierre fand aber auch einen kleinen Beitrag, in dem ein relativ unbekannter Klimaforscher an das Jahr 1540 erinnerte, in dem von Ende Februar bis in den Oktober praktisch kein Regen gefallen sei und in dem es Hungersnöte gegeben habe. Die großen Flüsse Rhein und Elbe waren in jenem Jahr vollständig ausgetrocknet. ›Damals‹, so äußerte sich der Klimaforscher, ›habe es noch keine Industrie oder Autos gegeben, die einen Anstieg des Kohlenstoffdioxids bewirkt hätten.‹ Für den Wissenschaftler hatte auch die gegenwärtige Hitzeperiode natürliche Ursachen. Pierre fand seine Theorie logisch, war aber kein Experte, der sich ein Urteil darüber hätte erlauben können.
Er legte die Zeitung weg und holte die Akte von dem Mord heraus, der am Donnerstag im Landgericht in Göttingen verhandelt werden würde, wo er als Zeuge aussagen sollte. Er schaute sich noch einmal alle Details an. Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Frank Imse kam herein und schaute auf die Uhr.
»Es ist halb eins, was hältst du davon, wenn wir Adrianos Pizzeria aufsuchen, ich hab mächtigen Kohldampf.«
»Gute Idee«, antwortete Pierre und legte die Akte in seinen Schreibtisch zurück.
Am Nachmittag verabschiedete sich Rexilius von Herbert Wagner. Dieser packte ein paar Utensilien aus der ›KTU-Werkstatt‹ in seinen Spurensicherungskoffer, die er mit in die USA nehmen würde. In der kommenden Nacht würden er, der Inspektionsleiter und drei weitere Mitarbeiter in die USA fliegen. »Ich bin mal gespannt, was für Möglichkeiten die amerikanischen Kollegen haben. Schade, dass du nicht mit in die Staaten kommst. Die Amis könnten von deiner Intuition profitieren. Aber ich glaube, jetzt hat erst mal der Urlaub mit deiner Familie Vorrang.«
»Ja, seit vier Jahren haben Sandra und ich keinen gemeinsamen Urlaub mehr gemacht. Außerdem hasse ich solche Veranstaltungen. Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt und viele neue Erkenntnisse«, antwortete Rexilius.
Bad Sachsa
16. Juli 2018, abends
Als Pierre am Abend den Aufenthaltsraum des Seniorenheims keuchend betrat, hatte er wieder einmal ein ›Rennen‹ gegen den beinlosen Rollstuhlfahrer Walter Vieth verloren. Dieser saß am Tisch und trommelte scheinbar gelangweilt mit den Fingern auf die Tischplatte. Auf dem freien Platz stand ein Pott mit dampfendem Kaffee, der für Pierre bestimmt war.
»Endlich hast du einmal Anerkennung für deine Leistungen erhalten. Ich hab den Harz Kurier gelesen. Er ist voll des Lobes über dich. Oberrat Rauert wird sicherlich sehr neidisch sein«, sagte Walter.
»Kann ich mir vorstellen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Leider hat der Zeitungsschreiber die Kollegen der Mordkommission nicht erwähnt, die gehören auch zum Team«, sagte Pierre bescheiden.
Der Hauptkommissar blieb noch eine Stunde bei Walter. Er verabschiedete sich von seinem Freund, musste ihm aber versprechen, noch einmal bei ihm vorbeizukommen, bevor er nach Amrum fahren würde.
»Es wird langweilig ohne dich und ohne Mordfälle werden«, sagte Walter.
»Spätestens in drei Wochen werde ich ja wieder in Bad Sachsa sein«, sagte Pierre.
Als er wenig später in seiner Wohnung war, rief er seine Urlauber an. Die vier waren schon einmal für eine Stunde am Strand gewesen.
»Henriette ist kein bisschen wasserscheu«, sagte Sandra. »Sie ist bis zur Schulter ins Wasser gegangen. Das Wetter ist herrlich. In drei Tagen bist du ja bei uns.« Pierre hörte Henriette ein paar Mal Papa rufen. »Ich glaub, es will dich jemand sprechen«, sagte Sandra.
Henriette übernahm das Telefon. Es folgte ein Monolog, von dem Pierre aber nicht viel verstand. Wahrscheinlich berichtete sie ihm in ihrer Kindersprache über die Erlebnisse am Strand und über ihren ersten Gang ins Meerwasser. Schließlich war Sandra wieder am Telefon. »Jetzt sind es noch drei Tage und dann wirst du endlich hier sein. Ich liebe dich.«
»Ich dich auch, und gib Henriette ein Küsschen von mir.«
Pierre erinnerte sich, dass er noch nicht dazu gekommen war, nach der Post zu sehen. Er ging zum Briefkasten am Hauseingang, öffnete ihn und stellte erfreut fest, dass Susanne Kinne, die einen Buchladen in Bad Lauterberg führte, ihm ein lang ersehntes und vergriffenes Buch besorgt hatte. Es behandelte die Geschichte der nordamerikanischen Indianer. Als er wieder in seiner Wohnung war, kochte er sich einen Cappuccino und zündete sich eine Pfeife an. Im Wohnzimmer setzte er sich in einen Sessel und begann genüsslich zu lesen.
Bulgarien, Karlovo
16. Juli 2018, morgens
Um zehn Uhr erreichte Georgi Karlovo. Hinter der Stadt erhob sich der Balkan mit seinen mächtigen, über zweitausend Meter hohen Bergen. Einige Gipfel waren noch mit Schnee bepudert.
Karlovo, gelegen ›im Tal der Rosen‹, hatte etwa 25.000 Einwohner. Weltweit wird hier das meiste Rosenöl produziert. Zur Erntezeit Ende Mai, Anfang Juni zog betörender Rosenduft durch das Tal am Fuße des Balkans. Die Menschen feierten das mehrtägige farbenfrohe Rosenfest, zeigten Ernterituale mit Musik und Tanz, kürten die Rosenkönigin und zogen in Paraden durch die Stadt. Mittlerweile kamen viele ausländische Touristen hierher, um den Feierlichkeiten beizuwohnen.
Beim Anblick der Stadt kam Wehmut in Georgi auf. Zweimal hatte er mit seiner Frau Charlotte am Rosenfest teilgenommen. Es war lange her, noch ganz am Anfang ihrer Liebe, aber alles wurde wieder gegenwärtig. Die langen durchtanzten Nächte, der betörende Rosenduft, der Liebreiz seiner Charlotte. Tränen standen ihm in den Augen. Hätte er sie bei ihrer letzten Bergtour doch nur begleitet… Wie so oft fragte er sich, was wäre, wenn sie noch leben würde. Wie viele Kinder hätten sie jetzt? Was wäre aus ihnen geworden? Er hielt kurz am Straßenrand an, wischte sich die Tränen aus den Augen. Aber es half alles nichts. Niemand konnte ihm Charlotte zurückbringen. Er startete seine Maschine wieder und fuhr weiter.
Er hatte gestern Abend im Internet ein Satellitenbild des Gebäudes gefunden, in dem Blaskow gemeldet war. Es handelte sich um ein Sanatorium für gut situierte Patienten. Gehörte ihm die Einrichtung?
Zunächst würde er an dem Gebäude vorbeifahren und sich einen ersten Überblick verschaffen. Es lag etwas abseits von der Stadt. In seinem Kern bestand es aus einem etwa hundert Jahre alten Haus, um das sich einige Neubauten mit vielen Fenstern angliederten. Nachdem er den Komplex hinter sich gelassen hatte, fuhr er noch einige hundert Meter weiter und suchte sich einen Standort aus, von dem aus er das Gelände überblicken konnte. Er fand einen Parkplatz, auf dem Sitzreihen mit massiven Tischen aus Eiche standen, an denen Besucher Picknick machen konnten. Er war der Einzige. Er holte sein Frühstücksbrot und seine Thermoskanne, die mit kaltem Tee gefüllt war, aus dem Rucksack. Dann setzte er sich an einen Tisch, biss ein paar Mal in sein Brot und trank seinen Eistee. Erst jetzt fühlte er die große Hitze. Die Temperatur hatte sicherlich schon dreißig Grad überschritten. Er nahm das Gelände in Augenschein. Ein Hitzeflimmern, das Wasser vortäuschte, hatte sich darüber gelegt. Es war gut und gerne so groß wie sechs bis sieben Fußballplätze. Um das Gelände herum verlief ein Drahtzaun. Georgi schätzte ihn auf etwa vier Meter Höhe.
Er holte sein Fernglas aus dem Rucksack, um genauere Details erkennen zu können. Als Abschluss befand sich Stacheldraht auf dem Zaun. In Abständen von etwa hundert Metern wurde auf Schildern vor Berührung des Zaunes gewarnt. Unter der Warnung stand das Symbol für Starkstrom. Dort hinein zu kommen und nach Dimitri zu suchen, würde nicht einfach werden. Wozu brauchte ein Sanatorium für gut situierte Patienten eine solche Absicherung? Ein weiterer Aspekt beunruhigt ihn: Am Zaun im Inneren des Geländes erschienen zwei bewaffnete Wachen mit Rottweilern. Offensichtlich reichte der Starkstromzaun nicht aus, um mögliche Eindringlinge abzuhalten.
Er schwenkte zum Einlass. Dort waren zwei Schranken angebracht. An der rechten hielt gerade ein großer Audi. Ein Wächter schaute in das Fahrzeug, machte einen militärischen Gruß. Ein zweiter Wächter kurbelte sofort die Schranke hoch. Das Auto konnte passieren. Die Wachen trugen Uniformen, die weder zum Militär noch zur Polizei gehörten. Offensichtlich hatten die Eigentümer des Sanatoriums einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. Am Gürtel trugen sie Handfeuerwaffen.
Georgis Blick kehrte zum Zaun zurück. Die Patrouille war an einem Abschnitt stehen geblieben. Eine der beiden Wachen sprach in ein Funkgerät. Wenig später untersuchten sie den Zaun am Boden. Offensichtlich war der Strom abgestellt worden. Der Wachmann schien aber nichts Besonderes gefunden zu haben und sprach in das Funkgerät. Sofort entfernte er sich einige Meter von den Maschen. Die Umzäunung musste wieder unter Spannung gesetzt worden sein. Georgi verabschiedete sich erst einmal von seinem Plan, in das Gelände einzudringen, er würde jetzt in die Stadt zurückfahren, ein Café aufsuchen und dort Erkundigungen über das Sanatorium einholen. Er packte seine Sachen zusammen und verließ den Parkplatz.
Eine halbe Stunde später hatte er ein Lokal gefunden. Trotz der Hitze bestellte er sich einen Milchkaffee. Am Nachbartisch saßen zwei Männer. Wie Georgi ihrem Gespräch entnahm, handelte es sich um Einheimische, die arbeitslos waren. Er fing mit einem der beiden ein Gespräch an.
»Ich will ein paar Tage hier in Karlovo Urlaub machen. Was hat die Stadt denn so zu bieten? Können Sie mir ein gutes, aber nicht so teures Hotel empfehlen?«
Der Mann erteilte Georgi bereitwillig Auskunft, sein Tischnachbar beteiligte sich am Gespräch. Sie nannten ihm einige Sehenswürdigkeiten der Stadt und rieten ihm, auch ins Gebirge zu fahren und an einer Wandertour teilzunehmen.
»Das Jägerhorn ist ein gutes Hotel und kostengünstig. Dort können Sie gut Urlaub machen«, sagte der Mann, den Georgi zuerst angesprochen hatte. »Ich heiße übrigens Kosta, und das ist mein Freund Kristian.«
»Georgi«, sagte er und gab den beiden die Hand. »Darf ich mich an euren Tisch setzen?«
»Gern«, sagten beide gleichzeitig.
»Und euch ein Getränk ausgeben?«
»Gern«, sagte Kosta, »wenn man arbeitslos ist, freut man sich über alles, was man gratis bekommt.«
Georgi sah die beiden nacheinander an. Sie waren etwa Mitte dreißig und wirkten nicht so, als hätten sie keine Lust zum Arbeiten. Er gab dem Kellner ein Handzeichen. Wenig später kam er an den Tisch und nahm die Bestellungen auf.
»Warum seid ihr arbeitslos? Karlovo ist doch eine bekannte Tourismusstadt, da wird es doch genug Arbeitsplätze geben«, sagte Georgi. »Und ihr seht nicht so aus, als würdet ihr euch vor Arbeit drücken.«
»Wir hatten einmal einen sehr guten Arbeitsplatz«, sagte Kosta. »Im Hotel Ambassador. Ich war Kellner und Kristian Koch. Aber vor zwei Jahren sind wir entlassen worden. Der neue Besitzer des Hotels hat nacheinander alle Einheimischen durch eigene Leute ersetzt. Die meisten kommen aus Varna oder aus dem Ausland. Er hat auf dem Gelände des Hotels viele Neubauten errichten lassen und es zu einem Sanatorium umfunktioniert. Allerdings nur für Reiche. Er hat das Gelände zu einer Festung mit Starkstromzäunen und einem Heer an Wachen umgebaut.«
Kosta hatte soeben die Anlage beschrieben, in der sich Dimitri wahrscheinlich aufhielt.
»Warum denn das?«, fragte Georgi und schüttelte den Kopf.
»Man will sich vor Raubzügen der Einheimischen schützen. Dabei hat es in den letzten Jahren nur ein einziges Mal einen Einbruch gegeben, bei dem Betrunkene sich die Anlage einmal von innen anschauen wollten«, sagte Kristian.
»Und unser Bürgermeister genehmigt alles, was dieser Geldsack wünscht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Bestechungsgelder er schon erhalten hat. In zwei Jahren sind Wahlen. Ich werde ihn nicht mehr wählen. Ich hoffe, dass die Bürger von Karlovo auch so denken«, fügte Kosta hinzu.
Georgi nickte. Er hatte eine Menge Informationen erhalten. Was machte Dimitri in der Anlage? Was hatte er mit Blaskow zu tun? Und warum war er so plötzlich verschwunden? Er musste einen sehr lukrativen Job erhalten haben. »Wem gehört denn die Anlage?«, fragte er.
»Angeblich einem Blaskow, aber der ist mit Sicherheit nur ein Strohmann. Es gibt Gerüchte, dass ein Multimillionär aus den USA der Eigentümer ist. Wie er heißt, wissen wir nicht«, sagte Kosta. »Drei- bis viermal im Jahr besucht er die Anlage mit einem Hubschrauber.«
»Kommen Gäste des Sanatoriums auch mal in die Stadt?«, fragte Georgi.
»Selten. In der Anlage gibt es alles, was sich reiche Touristen so wünschen. Mehrere Schwimmbäder, Saunen, ein Casino und so weiter. Das touristische Angebot in Karlovo kann da nicht mithalten. Ab und zu kommen ein paar Wachleute in unsere Kneipen, besaufen sich und pöbeln unsere Frauen an.«
»Wohnen die in der Anlage?«
»Die meisten ja, einige haben auch eine Wohnung in der Stadt«, sagte Kosta und schaute Georgi an. »Du bist kein Urlauber, stimmt’s?«
Georgi antwortete nicht gleich. Was sollte er den beiden sagen? Er kannte sie erst seit einer knappen Stunde. Aber den Betreibern des Sanatoriums und den Wachen standen sie kritisch gegenüber. »Nur so halb. Ich suche meinen Bruder Dimitri. Er ist seit einer Woche spurlos verschwunden. Ich habe Hinweise, dass er sich in der Anlage befindet und dort nicht ganz freiwillig ist.«
Kosta zog die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf. »Georgi, diese Anlage ist etwas für Superreiche. Da würde jeder freiwillig reingehen, auch nur, um sich die Anlage mal anzuschauen. Ich glaube, er hat dort einen gut bezahlten Job. Geh dorthin und frag einfach nach ihm. Wenn du nicht weiterkommst, dann treffen wir uns heute Abend im Champ, das ist so eine Art Disco. Die suchen regelmäßig einige Sicherheitskräfte des Sanatoriums auf. Vielleicht kannst du von denen etwas rausbekommen. Wir werden auch da sein, vielleicht können wir dich unterstützen. Am besten ist es, wenn du erst mal im Jägerhorn eincheckst.«
Nachdem Georgi sich im Hotel einquartiert hatte, machte er sich auf den Weg zur Anlage. In einiger Entfernung davon stellte er sein Motorrad ab. Dann ging er zum Einlass, an dem zwei Wachen standen. Einer der beiden hatte gerade ein Auto in die Einrichtung gelassen und kurbelte die Schranke wieder herunter. Er sprach den Wachmann an. »Ich suche einen Mann namens Dimitri Plantanow. Er hält sich in der Anlage auf. Können Sie mir weiterhelfen?«
Der Mann verzog keine Miene. »Ich kenne keinen Mann mit diesem Namen.«
»Kennen Sie alle Gäste des Sanatoriums?«, hakte Georgi nach.
Der Wächter antwortete nicht gleich. »Nein«, sagte dieser unfreundlich.
»Ich muss ihn unbedingt sprechen. Fragen Sie bitte in ihrer Verwaltung nach, in welcher Abteilung er arbeitet.«
Der Wachmann ließ Georgi stehen und ging zu einem Auto, das vor der Schranke stand und in die Einrichtung wollte. Er schaute in das Auto, lächelte und grüßte zackig. Er kam zu Georgi zurück.
»Gehen Sie zu meinem Kollegen. Er wird in der Zentrale anrufen und nach dem Mann fragen. Ich habe hier vorn viel zu tun, und wenn ich die Leute zu lange warten lasse, kriege ich Ärger mit meinem Chef.«
Der zweite Sicherheitsmann war aufgeschlossener. »Ich kenne Dimitri Plantanow nicht, aber ich rufe in der Verwaltung an«, sagte er und ging ins Wachhaus. Eine Minute später kehrte er zurück. »Tut mir leid, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ihr Bruder gehört weder zum Personal noch zu den Gästen. Er kann sich nicht in der Anlage aufhalten.«
Georgi fasste in seine Jackentasche und zeigte dem Mann ein Foto von Dimitri. Dieser betrachtete es, für einen Sekundenbruchteil blitzten seine Augen auf. Schließlich schüttelte er den Kopf und sagte: »Nie gesehen. Sie müssen Ihren Bruder woanders suchen.«
Der Wachmann hat gelogen, dachte Georgi, seine Augen haben ihn verraten. Er kannte diese unbewusste Reaktion aus seiner aktiven Zeit als Polizist nur allzu gut.
»Dann will ich Sie nicht weiter stören«, sagte Georgi und schaute den Mann noch einmal an. Für einen Moment schien es, als wollte dieser noch etwas sagen.
Bulgarien, Karlovo
16. Juli 2018, abends
Georgi, Kosta und Kristian betraten um acht Uhr die Disco Champ. Der ehemalige Polizist berichtete den beiden kurz von seinem Gespräch mit dem zweiten Sicherheitsmann.
»Vielleicht kommt er hierher, dann werden wir versuchen, etwas aus ihm herauszuholen«, sagte Kosta.
Das Lokal war gut gefüllt. An der gut zwanzig Meter langen Theke saßen Männer, deren Kleidung verriet, dass sie keine Einheimischen waren. Neben ihnen standen bulgarische Frauen, die aufdringlich geschminkt waren.
»Sind die Frauen Prostituierte?«, fragte Georgi.
»Nein«, antwortete Kosta. »Sie versuchen mit den Touristen anzubändeln. Viele träumen von einer Hochzeit, wenn sie einen reichen Westler gefunden haben. Die meisten Frauen werden aber nur als Urlaubsflirt gesehen. Wenn die Touristen verschwinden, wollen sie von den Frauen nichts mehr wissen. Nur in seltenen Fällen kommt es zu einer Hochzeit und die bulgarischen Frauen wandern nach Deutschland, Österreich, Frankreich oder in die USA aus.«
Georgi nickte. Ähnliches hatte er schon zu Genüge an der Schwarzmeerküste erlebt.
»Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden auch die Sicherheitsleute der Anlage hier auftauchen. Ich hoffe, dass der zugängliche Wachmann dabei sein wird«, sagte Kristian.
Es sollte noch eine Stunde dauern, bis die ersten das Lokal betraten. Eine halbe Stunde später kam der Wachmann tatsächlich. Dieser schaute sich um und ging an einen Tisch, an dem Karlovoer saßen. Offensichtlich wollte er sich nicht zu seinen Kollegen gesellen.
»Das ist er«, sagte Georgi zu Kosta und Kristian.
»Das ist Pietro. Er gehörte schon zum Wachpersonal, als ich noch in der Anlage gearbeitet habe«, sagte Kosta. »Er ist vernünftig, was man von den meisten Wachleuten nicht sagen kann. Ich werde ihn nachher an unseren Tisch bitten. Dann kannst du ihn noch mal nach deinem Bruder befragen.«
Georgi nickte und sah zum Tisch, an dem Pietro saß. Dieser stand von seinem Platz auf und ging mit einer schwarzhaarigen Frau auf die Tanzfläche. Erst nach zwanzig Minuten kehrten sie an ihren Tisch zurück. Kosta stand von seinem Platz auf und schlenderte zu dem Wachmann. Nach einem kurzen Gespräch kamen die beiden an Georgis Tisch, wo Pietro den ehemaligen Polizisten misstrauisch beäugte.
»Was wollen Sie noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich den Mann, den sie suchen, nicht kenne.«
»Setzen Sie sich doch erst einmal«, bat Georgi. Pietro zögerte.
»Er ist in Ordnung«, sagte Kosta.
»Ist ein Freund von uns.« Kristian stimmte zu.