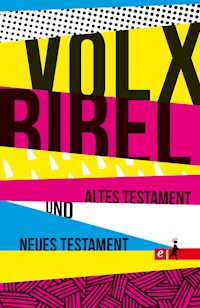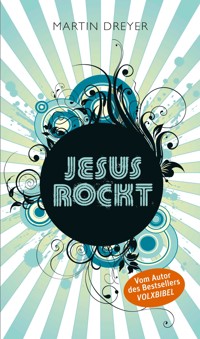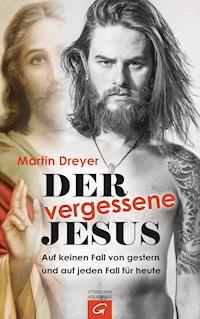Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM R. Brockhaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der Volxbibel-Autor lässt sich hinter die Maske schauen. Von klein auf wollte er jemand sein, der etwas bewirkt, der die Gesellschaft verändert, wenn auch nur an einem winzigen Punkt in der Weltgeschichte. Und das tut er dann auch, als er groß ist: Martin Dreyer gründet eine neue, dynamische, so nie dagewesene Bewegung, die Jesus Freaks. Mit einem Schlag ist sein Privatleben nicht mehr privat. Er schwankt durch extreme Höhen und Tiefen, ist als Prediger quer durch Deutschland und durch die Denominationen unterwegs - mit einem ständigen Begleiter: Panik. Und dann findet er den Weg in die Freiheit ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTIN DREYER
Panik Pastor
WIE GOTT MIR MEINE ANGST NAHM
SCM R.Brockhaus ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
Dieses Buch beruht auf Tatsachen. Dennoch wurden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte einige Namen und Umstände geändert. Der vorliegende Text gibt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wieder.
ISBN 978-3-417-26991-8 (E-Book)
ISBN 978-3-417-26964-2 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
© 2021 SCM R.Brockaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Bodenborn 43 · 58452 Witten
Internet: www.scm-brockhaus.de; E-Mail: [email protected]
Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen
Weiter wurden verwendet:
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Martin Dreyer: Die Volxbibel, © 2014 Volxbibel-Verlag in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen
Lektorat: Katharina Töws
Umschlaggestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.grafikbuero-sonnhueter.de
Titelbild: Urban Zintel Photography, www.urbanzintel.de
Autorenbild: © Tom Norberg
Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach
In Gedenken an meinen alten Freund und mein Vorbild, Pastor Storch Karsten Schmelzer. Ich glaube, dieses Buch hätte dir gefallen.
»Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.«
Bibel, Josua 1,9
»Weil uns so viele Glaubenshelden dabei zusehen, wie wir unser Leben mit Gott leben, lasst uns alles, was uns dabei behindert und belastet, ablegen! Wie bei einem Marathonlauf sollten wir alle Sachen, die uns beim Laufen stören, wegschmeißen und das Ding mit Gott einfach durchziehen […] Das kriegen wir nur hin, wenn wir dabei die ganze Zeit Jesus im Blick haben. Mit ihm hat bei uns glaubensmäßig alles angefangen, und mit ihm wird auch alles irgendwann aufhören. Er hat seinen Marathonlauf auch bis zum Ende durchgezogen.«
Bibel, Brief an die Hebräer 12,1-2; Volxbibel
»Wenn du zögerst, wächst deine Angst.Wenn du etwas wagst, wächst dein Mut.«1
Mahatma Gandhi
INHALT
Über den Autor
PROLOG: Hallo Angst!
1 CHEMNITZNovember 2008
2 ESSENNovember 2009
3 SCHNEEBERGJuni 2012
4 KENIAJuni 1998
5 WACKENAugust 2014
6 NÜRNBERGJuli 2006
7 KÖLNAugust 2006
8 DÜRENOktober 2011
9 DRESDENMai 2017
10 DENVER, USAOktober 1985
11 ADELSHOFENOktober 2017
12 HAMBURGMai 2016
13 KÖLN UND MÜNCHENNovember 2014
14 OELSNITZJuni 2019
15 DEUTSCHLAND-TOUR MIT ARNE KOPFERMANNMärz 2017
16 OFTRINGEN, SCHWEIZNovember 2019
EPILOG
ANMERKUNGEN
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
ÜBER DEN AUTOR
MARTIN DREYER Martin Dreyer (Jg. 1965) wurde in den 90er-Jahren als Gründer der »Jesus Freaks« bekannt.
Er studierte Theologie, Psychologie, Beratungsmethoden und Pädagogik.
Heute arbeitet der Autor der Volxbibel konfessionsübergreifend als freier Theologe.
Mit seiner Familie wohnt er in Berlin.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
PROLOG: Hallo Angst!
Wie alles begann.
Meine erste Angstattacke hatte ich kurz vor einer Predigt in einem Gottesdienst im Hamburger Musikklub »Marquee«. Es war die Hochzeit einer christlichen Jugendbewegung, den »Jesus Freaks«, die ich vier Jahre zuvor in meinem kleinen Wohnzimmer gegründet hatte. Ich war bereits lange Zeit überzeugter evangelisch-freikirchlicher Christ, ordinierter Pastor und erster Vorsitzender des als gemeinnützig anerkannten Vereins der »Jesus Freaks«.
In diesem Punkt ist meine Reise wohl nicht typisch und entspricht nicht dem Klassiker, dem normalen Verlauf, wie man ihn in christlichen Kreisen immer wieder hört. Dort wird es doch meist so geschildert: In der Vergangenheit liegt die Hölle, die Gottesferne, der Teufel, Tod, Verlorenheit, Angst, Krankheit und Abhängigkeiten. Dann aber vollzieht der Berichtende einen radikalen Wandel. Es kommt zu einer Bekehrung: vom Saulus zum Paulus, vom Nichtchristen zum Christen. Und damit wird aus Hölle der Himmel, es entsteht Gottesnähe, Heilung, Befreiung. Das große Motto der Hippiebewegung aus den 70er-Jahren »Alles wird gut« wird zu einer bekennenden Wahrheit, und der neue Christ fliegt nur noch von Wolke sieben über Wolke acht immer weiter, der seligen Ewigkeit entgegen.
Doch bei mir war es anders.
Sicher gab es zuerst die Hölle mit all ihren Fehlern und Folgen, ihrer großen Verlorenheit. Und dann kam auch eine Phase des Himmels, in der Siege gefeiert, Heilung erfahren, eine Befreiung erlebt wurde. Doch dann kam sie wieder, die Hölle. Die Dunkelheit, das Manko von ungelösten Problemen, von Süchten, von Krankheiten, von Depressionen. Und es kam auch immer wieder die Angst, die in meinen Leben eine viel zu große Rolle einnahm. Fast so, als wollte sie mein Leben bestimmen, als wollte sie mich weiter beherrschen und mich nie ganz loslassen.
Die Angst kam in der Hochzeit der »Jesus Freaks« immer wieder und nahm in meinem Leben eine viel zu große Rolle ein.
Trotz dieser Angst hatte ich mit den »Jesus Freaks« meine ganz eigene Kirche gegründet. Wir feierten unsere Gottesdienste nicht in alten Kirchengemäuern. Wir gingen auf die Straße, an ausgefallene Orte, dorthin, wo sich sonst kein Christ gerne sehen lässt. Auf der Reeperbahn in St. Pauli, mitten im Rotlichtviertel, neben Prostituierten und Junkies, in dunklen Kellern und versifften Bars. Aber auch im alten Hamburger Elbtunnel oder mitten auf einem zentralen Platz im Szeneviertel stimmten wir unser Gotteslob an. Zur Kirche wurde auch das »Marquee«, ein damals stadtbekannter alternativer Musikklub in Hamburg. Er lag gleich neben der weltbekannten und immer noch besetzten Hafenstraße, mit Blick auf die Elbe und den Hamburger Hafen. In seinem Keller war jahrelang eine besonders dreckige Transsexuellen-Prostitution zu Hause. Genau dort richteten wir unser Büro ein. Der Klub war bekannt dafür, dass Bands wie »Nirvana«, »Faith No More« oder »Queens of the Stone Age« dort spielten, lange bevor sie überhaupt irgendjemand kannte. Über zufällige Umstände kam meine Gruppe in diese Klubräume rein und konnte hier am Freitagabend ihre ungewöhnlichen Gottesdienste zelebrieren, bevor das Hauptprogramm startete.
Und genau dort passierte es, dort ging mein Kampf mit der Angst los.
Warum ausgerechnet in einem Gottesdienst? Lange zerbrach ich mir darüber den Kopf. Ich konnte es nicht verstehen. Hatte der Kampf spirituelle Gründe oder doch nur menschliche? Kam er aus dieser oder aus einer anderen Welt, aus einer unsichtbaren, geistlichen Dimension? Ging es um psychologische Ursachen oder um übernatürliche, ja, sogar dämonische Fakten?
Das Selbstverständnis von Christen müsste sich doch eigentlich ganz anders anfühlen. Jesusnachfolger glauben einfach. Bedeutet: Sie vertrauen, sie vertrauen auf einen Gott. Das entscheidende Wort »Glaube« wird in moderneren Bibelversionen sehr oft mit Vertrauen übersetzt. Es geht um ein Grundvertrauen an ein allmächtiges, übernatürliches Wesen, das schon alles irgendwie gut machen wird. Eine Macht, die größer ist als wir selbst, die den Überblick hat, der man sich blind anvertrauen kann. Wie ein gigantisches Sicherheitsnetz, welches unter jedem Leben aufgespannt wurde, so sollte der Glaube wirken. »Niemand kann tiefer fallen als in Gottes Hand«, dieser Satz fällt in jeder Kirche – ständig. Angst hat keinen Platz, wo Vertrauen großgeschrieben wird. Angst und Vertrauen, das sind doch Gegensätze. Oder?
Christen sollten per se die entspanntesten Menschen der Welt sein. Fehler sind erlaubt, bei Christus waren sie das. Der Gottessohn hatte sich mit Verlierern umgeben und liebte sie trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb. Prostituierte, Zöllner, Straßenpack, Versager, Sünder, das waren seine engsten Freunde.
Zu Christus zu gehören bedeutet eigentlich auch, ein »Alles-wird-gut-Feeling« in Dauerpacht zu besitzen. Die Erlösung mit einem Gebet, Frieden im Geist, über den Dingen stehen, siegen und nicht verlieren, den Himmel auf Erden. Ohne Schuldgefühle, ohne Sorgen, ohne Ängste leben zu können. Der Gott der Bibel bezeichnet sich an einer Stelle sogar als »Friedensfürst«. Der Fürst des Friedens, der Chef des »Entspanntseins«, bei ihm ist alles friedlich und gut. Ist das nicht der Wahnsinn, ein großartiges Geschenk? Sicher, das ist es. Aber nicht bei mir. Bei mir regierte nicht der Frieden, zumindest in diesen Augenblicken. Vor jeder Predigt gab es nur eins: die nackte, schmerzhafte, tödliche Angst.
Ich weiß immer noch nicht, woher die Angst auf einmal kam. Sie war anfangs nicht da. Zumindest nicht so stark, dass sie mich behindert hätte. Lag es an einer andauernden Überarbeitung? War mir die ganze Sache mit dieser christlichen Arbeit doch über den Kopf gewachsen? Hatte ich vielleicht im göttlichen Dienst Gott selbst aus dem Blick verloren? Ging es nur noch um mich, um meinen Ruf, um meine Arbeit, um meine Jugendbewegung, und nicht mehr um ihn und um seine Kirche? Letzteres wäre zumindest eine logische Erklärung. Wenn nur noch mein Erfolg im Mittelpunkt meines Denkens stand, dass ich gut aussah, dass mein Dienst unbedingt erfolgreich sein musste, dann hätte ich allen Grund gehabt, Angst zu haben. Niemand ist perfekt. Eine schlechte Darstellung der eigenen Person, Misserfolge, so etwas kann passieren. Und zwar jedem.
Auch wenn der Verdacht für den Beobachter naheliegt: Von Beginn an war das nicht meine Einstellung. Ganz im Gegenteil, es ging mir nie um mich, sondern nur um die göttliche Sache. Dazu war ich viel zu fromm. Ich wollte, dass jeder etwas mitnimmt, dass durch meine Arbeit Menschen göttlich geholfen wird. Ich wollte auch in meiner Hochphase der Angst Verlorene retten, Kaputten Heilung bringen, das war mein vordergründiger Antrieb. Vielleicht war aber auch genau dieser Anspruch viel zu hoch und kaum zu erfüllen?
Dieses Angstgefühl ist schwer zu fassen, ich kann es nur ungenau beschreiben. Es ist eine Angst, Fehler zu machen, ja, das stimmt. Aber nicht das allein, es ist mehr. Ich habe Angst, mich zu blamieren, und ich habe Angst, dadurch der Bewegung zu schaden, ja sogar der Kirche selbst, dem Ruf des christlichen Glaubens. Ich will nicht peinlich sein. Es ist eine Angst zu versagen. Und es ist die Vorstellung, dass ich mit einem schlechten Auftritt dem Fortschritt des Glaubens im Weg stehen könnte, anstatt ihn zu fördern.
Das Gefühl genau und exakt auszumalen – es gelingt mir nicht. Die Angst ist diffus, schwer zu fassen und auch veränderbar. Und doch so real, so schmerzhaft, lähmend, zersetzend, ja, fast tödlich. Angst als pures Gefühl, das mich übermannt, vor der ich nicht fliehen kann, die die Kontrolle übernimmt, der ich nichts mehr entgegensetzen kann, weil sie so stark ist.
Es ist wie sterben. Jedes Mal vor einer Predigt sterbe ich.
Wie oft habe ich Gott angefleht, mir die Angst zu nehmen. Ich habe gefastet, Christus gebeten, mich von dieser Marter zu befreien. Seelsorge in Anspruch genommen, Therapien gemacht, Bücher gelesen, Strategien entworfen. Tabletten genommen, Medikamente geschluckt. Nichts hat nachhaltig geholfen. Sie war zu dieser Zeit immer da und begleitete mich stets. Wie ein immer wiederkehrender Dämon, der sich nicht abschütteln lässt, trotz spirituellem und psychologischem Kampf.
Der Gottesdienst, in dem die Angst zum ersten Mal kam, fand eigentlich unter keinen besonderen Umständen statt. Ich war wirklich gut vorbereitet, meine Predigt saß. Es lag eine volle Arbeitswoche hinter mir, aber trotzdem gab es genug Zeit, dass ich mich ausreichend auf den Dienst einstellen konnte. Das Thema der Predigt kam mir zugute, und ich hätte auch viel spontan dazu sagen können, selbst wenn ich mich nicht vorbereitet hätte.
Vielleicht war es die Anwesenheit von einem Reporter der TAZ. Er hatte sich in der Woche zuvor per E-Mail angekündigt, unseren Gottesdienst besuchen zu wollen. Die TAZ ist bekanntlich darauf spezialisiert, kirchliche Themen mit bissigen, verächtlichen und scharfen Worten in der Luft zu zerreißen. Der Reporter hatte mich vorher über drei Stunden interviewt und sehr viele Fragen gestellt. Das Gespräch lief eigentlich gut, ich war gelassen, freundlich und vielleicht sogar ein bisschen witzig.
Aber dann, in dem Augenblick, als der Gottesdienst anfing, spürte ich, wie es um meinen Kopf herum heiß wurde. Das Adrenalin stieg in mir auf und übernahm langsam, aber unaufhörlich die Kontrolle. Ich konnte nichts dagegen tun, es war stärker als mein Wille, meine Entscheidungskraft. Dieser Moment war das Grauen. Ich fühlte eine aufsteigende Wärme, fing an zu schwitzen und mir wurde übel. Und dann der Darm, oh ja, der Darm! Ich rannte aufs Klo und musste mich komplett entleeren. Immer wieder neu. Ich hatte Krämpfe und Schmerzen. Und ich konnte nicht fliehen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Ich musste die Situation bestehen, ich musste da jetzt durch. Niemand wusste davon, es war mein Geheimnis. Ich wollte diese Schwäche nicht eingestehen, sie sollte nicht öffentlich werden. Es wäre eine zu große Blamage gewesen und passte nicht zum Bild eines erfolgreichen Christen. Nach einer Weile wurde mein emotionaler Zustand etwas besser, vielleicht gewöhnte sich der Körper an den harten Adrenalinausstoß. Aber kurz vor der Predigt rannte ich ein zweites Mal auf die Toilette. Alles musste raus. Wieder und wieder. Magenkrämpfe. Schlimme Schmerzen. Es war wie ein langsamer Tod, aber auch wie eine Geburt.
Schließlich war es so weit. Ich wollte mir nichts anmerken lassen. Ich wollte der große Prediger sein, der mit seinen Worten die Gemeinde begeistern und mitreißen kann. Aber an meinem Hals waren überall tiefrote, hektische Flecken. Sie waren so rot und so abgegrenzt, dass jeder, der bis zu einem Meter vor mir stand, sie sehen konnte, ja, sehen musste. Ich versuchte mich zu beruhigen. Ich sprach mir Mut zu, ich sagte Bibelverse auf, ich meditierte. Wenn es ging, bekannte ich wild irgendwelche Sünden, damit nichts zwischen Gott und mir stehen konnte. Aber ich schaffte es nicht. Das letzte Lied spielte. Die Ansage kam. Dann war ich dran. Der Gottesdienstleiter rief meinen Namen auf. Langsam ging ich den Gang entlang. Ich betrat die Bühne, das Scheinwerferlicht knallte mir ins Gesicht. Und dann starb ich.
Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, bin ich immer noch unterwegs. Ich besuche Gemeinden, Gottesdienste, freie Werke. Ich werde eingeladen, um geistliche Wahrheiten zu verkünden, um eine biblische Predigt zu halten oder eine Lesung. Auch an öffentlichen Diskussionsrunden, Talkshows, Fernsehsendungen nehme ich teil. Man erwartet von mir Antworten und Lösungen. Vielleicht sogar eine Provokation, einen Ruf ins Leben oder einen Ruf zum Kreuz Jesu Christi.
Kirchenübergreifend werden mir Türen geöffnet, durch die ich gerne eintrete. Ich fühle mich von Gott beauftragt, auch wenn das nach einer religiösen Psychose klingt.
Wenn das nicht so wäre, würde ich diesen Job nicht machen, ich hätte schon längst aufgeben. Dieser Auftrag gibt mir ein Gefühl von spiritueller Sinnhaftigkeit. Eine Gewissheit, der richtige Mensch am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Es ist wie eine Bestimmung, eine göttliche Berufung, eine Aufgabe nur für mich, direkt aus dem Himmel.
Darum gehe ich auf die Reise, eine Reise mit Gott durch die Gemeinden in Deutschland und in anderen Ländern. Aber immer auch eine Reise zu mir selbst, zu meinen Abgründen. Eine Reise mit mir und der Angst.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1
CHEMNITZ
November 2008
Verkrampft und aufgeregt in einem Jugendgottesdienst der evangelischen Kirche
Als ich die Anfrage bekomme, in einer alten evangelischen Kirche in Chemnitz eine Predigt zu halten, muss ich erst mal schlucken. Chemnitz? Ist das nicht der Ort, der zu DDR-Zeiten noch Karl-Marx-Stadt genannt wurde? Ja, genau! Von 1953 bis 1990 wurde die Stadt anlässlich des Karl-Marx-Jahres nach dem großen Theoretiker des Sozialismus benannt. Aber relativ schnell nach der Wende sprachen sich in einer Abstimmung nahezu achtzig Prozent der Bevölkerung dafür aus, dass die Stadt wieder ihren ursprünglichen Namen zurückerhalten sollte.
Chemnitz ist aber nicht nur für den Namenswechsel deutschlandweit bekannt. Durch die nahe liegende Grenze zu Tschechien wird Sachsen insgesamt mit Crystal Meth geradezu überflutet, das von der WHO zurzeit als gefährlichste Droge eingestuft wird. Vor allem trifft das auf die drei großen Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz zu. In einer Studie, die erst vor Kurzem in diversen Magazinen und Zeitungen veröffentlicht wurde, hat man herausgefunden, dass im kleinen Chemnitz mehr Crystal Meth konsumiert wird als in allen anderen Großstädten Europas. Die Studie des »European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction«2 untersuchte in ihrer Forschungsarbeit nicht direkt den Konsumenten oder die Kriminalstatistik, sondern ausschließlich das Abwasser der Städte, welches von den Toiletten in die Kanäle geleitet wird. Da diese sogenannte »Teufelsdroge« eindeutige Rückstände im Urin hinterlässt, die sich nur sehr langsam im Wasser chemisch abbauen, kann man die Spuren von Crystal Meth relativ leicht noch Wochen später nachweisen und Konzentrationen berechnen. Das bedeutet, dass die Menge der Droge, welche von den Einwohnern in Chemnitz pro Tag konsumiert wird, ziemlich genau bekannt ist. In dieser Untersuchung lag Chemnitz weit vor Dresden, Bratislava oder Nürnberg, obwohl deren Einwohnerzahl doppelt und dreifach so groß ist. Die Mengen wurden tatsächlich mit dreihundert Prozent über dem normalen Schnitt aller anderen deutschen Städte gemessen.
Ein weiteres Problem der Stadt ist ein sich ausbreitender Nationalsozialismus unter den jungen Menschen. Chemnitz hat sich zu einer Hochburg für rechtsextreme Straftaten in Sachsen entwickelt. Im letzten Jahr kamen auf 100000 Einwohner 78 Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist deutscher Rekord.
Ich kenne Chemnitz schon länger, da ich bereits zweimal von einem bemerkenswerten christlichen Werk dorthin zum Predigen eingeladen worden bin. In dieser eher unfrommen Stadt hatte sich vor vielen Jahren ein Mann namens Tilo Reichelt aufgemacht, ein christliches Werk für junge Menschen auf die Beine zu stellen, in dem es zentral um den Glauben an Jesus Christus geht. Seine Biografie ist schnell erzählt: Als begabter Musiker und Inhaber einer Eventagentur stellt er auf der Höhe seines Erfolges plötzlich eine unendliche Leere in seinem Leben fest. Er begibt sich auf die Suche nach Erfüllung und trifft auf Gott. Reichelt erlebt durch eine spirituelle Erfahrung im Glauben eine richtiggehende Befreiung von seiner kleinen Ego-Welt und findet seinen Sinn darin, für junge Menschen in der Stadt eine Heimat mit christlichen Werten aufzubauen. Reichelt gründet sein eigenes Werk, das »New Generation«, renoviert mit Jugendlichen eine verfallene Disco und zieht seitdem Tausende junger Menschen mit seiner Arbeit an. Diese Geschichte fasziniert mich.
Heute werde ich allerdings nicht von Tilo Reichelt, sondern von einer großen evangelisch-lutherischen Kirche aus Chemnitz in ihren Jugendgottesdienst eingeladen. Und ich freue mich schon sehr auf den Einsatz.
Die Stadt ist mit dem Auto bequem unter drei Stunden von Berlin aus zu erreichen. Ich nutze die Zeit im Pkw immer gerne, um mich innerlich auf die bevorstehende Arbeit einzustellen. Nirgendwo anders kann ich besser beten, Musik oder Predigten hören als in unserem alten VW Sharan mitten auf der Autobahn. Die Ablage der Mittelkonsole wird zu meinem Altar, der Fahrersitz zu meiner Gebetsbank. Ich habe schon so viele intensive Zeiten in meiner kleinen Autokirche mit dem Schöpfer gehabt.
Das Navi scheint diesmal eine gute Strecke ausgewählt zu haben, es gibt wenig Staus und ich habe meistens freie Fahrt. »Hilfe, Gott!«, bete ich mal wieder und es muss für den da oben wie ein tiefer Seufzer klingen. »Obwohl ich mich ja eigentlich auf den Einsatz freue, fühle ich mich überhaupt nicht fit dafür! Ich bin völlig schlapp, kraftlos und ausgelaugt!«
Die letzten Nächte waren für mich der Horror. Seit einiger Zeit habe ich zunehmend Probleme mit meiner unteren Bandscheibe. Und komischerweise spüre ich die Schmerzen meist erst im Bett, weniger tagsüber. Rückenschmerzen sind etwas Furchtbares, jeder, der sie kennt, weiß, wovon ich rede. Es ist kein Schmerz, den ich mal eben ausschalten kann. Er trifft mich in der Mitte des Körpers und macht aus mir einen Krüppel. Treppensteigen, normales Gehen, sogar mich ins Bett zu legen, alles bereitet mir Schmerzen. Nachts drehe ich mich von rechts nach links, von links nach rechts, in der Hoffnung, eine möglichst schmerzfreie Schlafposition zu finden.
Dazu kommt, dass unser zweijähriger Sohn in letzter Zeit immer öfter nachts in unser Ehebett krabbeln möchte. Und der findet seine Schlafposition anscheinend noch schlechter als sein Vater. Nicht selten wache ich mitten in der Nacht auf, weil sein kleiner Zeh sich in eins meiner Nasenlöcher gebohrt hat. Na super. Wenn dann noch die Tochter dazukommt, ist an einen erholsamen Schlaf nicht mehr zu denken. Trotzdem liebe ich die beiden so sehr, dass ich sie auf keinen Fall aus dem Bett jagen möchte. Kinder sind ein großes Geschenk Gottes. Was für eine Freude haben die zwei in meine Existenz gebracht! Es ist mit Sicherheit die größte Aufgabe und die kraftaufreibendste dazu, welche Gott in das Leben eines Menschen stellen kann: Kinder großzuziehen. Ständige Müdigkeit, Stress pur, ungeahnte Ängste, dem Kind könnte etwas passieren, Sorgen vor Versorgungsengpässen, aber auch harte Wutausbrüche und unkontrolliertes Weinen, das alles bringt ein Kind in dein Leben.
Aber auf der anderen Seite braucht es nur ein Lächeln, ein Lachen, ein vergnügtes Quietschen von deinem Nachwuchs, eine herzliche Umarmung, ein Kuss und all das wird locker wettmacht. Ich weiß noch, wie ich meine Tochter immer gegen Mittag vom Kindergarten abgeholt habe, als sie noch klein war. Sie saß dort im Raum ganz konzentriert in einer Ecke und spielte mit bunten Bauklötzen. Plötzlich erblickte sie ihren Vater, sprang auf, rannte mit offenen Armen und einem großen Lächeln auf ihrem Gesicht auf mich zu und rief ganz laut: »Papaaaaa!!!« Das sind Momente, die mir mehr Kraft geben als jedes Erfolgserlebnis, jedes Lob, jeder geschriebene Bestseller und auch jeder noch so erfolgreiche Dienst für Gott.
Nachdem ich einen der wenigen Staus hinter mir habe, komme ich immer schneller voran. Der zäh fließende Verkehr hat sich endlich aufgelöst, und ich finde etwas Ruhe, um mich auf den Abend vorzubereiten. Der Pastor der Kirche hatte mir am Telefon etwas von seiner Arbeit erzählt. Vor Jahren kam sein Vorgänger auf die Idee, dass die große alte Kirche für Jugendliche umgestaltet werden müsse. Ihm wurde klar, dass junge Menschen in Chemnitz seine Kirche nicht besuchen würden, weil Kirche an sich einen schlechten Ruf hatte. Wer Spaß haben will, wer etwas erleben möchte, wer gerne seinen Horizont erweitert, der geht überallhin, aber nicht in die evangelische Kirche. Also gründete er mit einigen wenigen, aber motivierten Konfirmanden ein Team. Ziel war es, alle zwei Monate einen Jugendgottesdienst zu organisieren, der eine Ausstrahlung auf die ganze Stadt haben sollte. Zur Zeit meiner Einladung kommen bereits vierhundert Besucher zu der Veranstaltung. Der Gottesdienst wird nun heute zum fünften Mal gefeiert und immer wieder werden die Teilnehmerzahlen erneut getoppt.
Das ist eine Geschichte, die ich auf meinen Reisen schon oft gehört habe: Manchmal braucht es nur einen einzigen Menschen, einen jungen Pastor, einen Jugendleiter, einen Diakon, der genug Feuer für eine Idee hat. Er oder sie muss nicht viel mitbringen außer eine richtig gute Vision, Begeisterung, die Sprachfähigkeit, die Vision auch anderen zu übermitteln, und der Rest entwickelt sich wie von selbst. Allerdings muss diese Person, egal, ob männlich oder weiblich, großes Durchhaltevermögen mitbringen. Denn in toten Kirchen dauert es eine ganze Weile, bis der harte Boden aufgemeißelt, umgegraben und neu bepflanzt werden kann. Immer wieder höre ich, dass Träume und Ideen für eine lebendige Jugendarbeit an einem verstockten, trockenen und gealterten Kirchenvorstand gescheitert sind.
Der Pastor in Chemnitz hat zum einen die Begabung, seine Vision in Worte zu fassen, und auch das Durchhaltevermögen, diese neuen Ideen gegen alle Widerstände durchzusetzen. Und das Ergebnis lässt sich sehen.
Endlich bin ich da. Langsam fährt mein Auto auf den Kircheninnenhof und ich kann schon eine Traube von Jugendlichen auf dem Vorplatz entdecken. Der Pastor begrüßt mich freundlich und führt mich, nachdem ich meinen Koffer abgestellt habe, in einen hinteren Raum der alten Kirche. Dort sitzen ca. zwanzig aufgeregte junge Menschen. Jeder will mich begrüßen und mir seine Geschichte erzählen. So viele freundliche Gesichter auf einem Haufen, das tut gut. An jeder Ecke kann ich erkennen, wie bis ins Detail diese Veranstaltung durchgeplant und vorbereitet wurde. Das ist definitiv nicht überall so. Auf einem großen Tisch in der Mitte des Vorraums stehen ausreichend Saft und Wasserflaschen. Dazu gibt es leckere belegte Schnittchen mit Lachs, Käse, Wurst und Fleischaufschnitt. Ein reges Treiben herrscht im Raum, da noch eine Menge Vorbereitungen anstehen.
Der Pastor hat mir eine junge Frau zur Seite gestellt, die ein bisschen auf mich aufpassen soll. Ich erfahre, dass sie Lydia heißt, zwanzig Jahre alt ist und schon als kleines Kind Teil der Kirche war. »Meine Eltern haben mich hier getauft und konfirmieren lassen. Aber so richtig dabei bin ich erst, seitdem unser Pastor diesen Jugendgottesdienst ins Leben gerufen hat«, erzählt sie mir. Lydia hat ein umwerfendes Lächeln und ist wirklich sehr hübsch. Nach unserem kurzen Gespräch nutze ich die freie Zeit, um mir die Kirche einmal genauer anzuschauen.
Ich schätze, dass es sich um ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert handelt. Diese großen alten Kirchen wirken auf mich immer etwas bedrückend. Überall hängen Bilder von verstorbenen Menschen, die vermutlich vor Hunderten von Jahren Geld für den Bau gespendet haben. Die hohen Decken und auch der oft monströse Altar flößen mir Respekt, aber auch eine undefinierbare Furcht ein. Vor Jahren hörte ich auf einer offiziellen Führung von einem Kirchenhistoriker, dass die Architekten von der damaligen Kirchenleitung angehalten wurden, die Gebäude so hoch wie möglich zu bauen, damit die Gläubigen in der Kirche Angst und Respekt vor der Größe Gottes hätten. Es ging also nicht darum, ein schönes und imposantes Gebäude zu errichten, um darin Gottes Größe zu feiern, sondern um eine Art Angsttheologie, die Furcht vor Gott in den Herzen der Menschen wecken sollte. Ein einfacher Christ sollte sich beim Betreten einer Kirche vor Gott fürchten, vor seiner starken Hand, vor seiner Macht, vor seiner unermesslichen Größe. Für die heutige Zeit ein völlig inakzeptables Konzept, finde ich. Ein Ort des Glaubens, der Angst und Ehrfurcht erzeugen soll? Aber damals hat das vermutlich so gepasst.
Die Stimmung in dem Vorraum lockert sich immer mehr auf. Ich kann bestimmt über vierzig Mitarbeiter zählen, die sich alle dort versammelt haben. Schließlich ruft der Pastor alle zusammen, um den Ablauf des Gottesdienstes noch einmal durchzusprechen. In jedem Jugendgottesdienst gibt es ein paar immer wiederkehrende Programmpunkte. Dazu gehört neben der Begrüßung, den Ansagen, einem Anspiel, einem Musikteil und einem Gebet natürlich auch die Predigt. Für Letzteres bin ich heute zuständig.
»Liebe Leute, heute haben wir einen Gastsprecher bei uns, den Martin Dreyer«, begrüßt mich der Pastor freundlich. »Schön, dass du da bist!« Ich freue mich auch und sage noch ein paar Sätze zur versammelten Mannschaft. Dabei merke ich, wie unlocker und verkrampft ich an diesem Abend wieder bin. Warum das so ist, weiß ich gar nicht genau. Mir wird klar, dass unser Vorbereitungsteam mich als so eine Art Stargast im Programm vorgesehen hat. Vielleicht ist das der Grund für meine Angst. Die ganze Werbung, Flyer, Poster: Überall ist mein Name dick und breit aufgedruckt, inklusive Foto. Martin, der christliche Star. Martin, der große Prediger. Martin, die Rampensau. Vielleicht ist das der Grund für meine innere Verkrampfung, denn ich mag diese Rolle nicht. Sicher hat das in einem Jugendgottesdienst einen Effekt, aber ich kann mich selbst nicht als einen christlichen Star definieren. Ich kenne mich nur zu gut. Ich habe so viele Fehler. Ich habe so tiefe Abgründe. Und ich habe so eine Angst.
Manchmal frage ich mich, was wohl wäre, wenn jeder meine dunkelsten Gedanken lesen könnte, wenn alle von meinen Schwächen und von meinem Angstproblem wüssten. Ich denke, niemand würde mit mir zu tun haben wollen, niemand würde meiner Predigt zuhören.
Dazu kommt, dass ich noch nie mit hohen Erwartungen an mich angemessen umgehen konnte. Die Rolle des Underdogs gefällt mir dagegen sehr. Wenn keiner etwas von mir erwartet, dann bin ich angespornt, besonders gute Leistung zu bringen und alles zu übertreffen. Formuliert aber einer eine konkrete Erwartung an mich, schnürt es mir die Kehle zu, ich fühle mich unter Druck und dieser Druck erzeugt Angst. Angst, den Maßstab nicht zu erreichen, die hoch gelegte Latte nicht überspringen zu können. Sicher ist das nicht sehr professionell, aber so ist es nun mal.
Schließlich geht der Gottesdienst los. Die Mitarbeiter setzen sich auf ihre Plätze und auch ich gehe auf einen für mich reservierten Platz in der ersten Reihe. Als ich mich umdrehe, stelle ich fest, wie voll die Kirche ist. Heftig. Überall sitzen die jungen Menschen. Sogar der Mittelgang ist mit Jugendlichen belegt, die sich auf ihre Jacken auf den Fußboden gesetzt haben. »Herzlich willkommen zum ersten Jugo in diesem Jahr«, sagt ein sehr junges Mädchen vorne am Mikrofon. Ich schätze sie auf vielleicht zwölf Jahre, sie macht die Moderation schüchtern, ohne große Gestik, aber auch sehr charmant, und vermutlich ist jeder im Raum sofort auf ihrer Seite. Das Mädchen stellt den Ablauf des Gottesdienstes vor und sagt auch, dass ich heute als Gast da bin und wann ich mit der Predigt drankomme.
Als nächster Programmpunkt wird ein kleines Theaterstück aufgeführt. Die Idee, mit solchen kurzen Vorführungen einen Gottesdienst einzuleiten, kommt von einer Gemeinde aus den USA. Willow Creek, so heißt sie, hat mit ihrem Konzept des »gästesensitiven Gottesdienstes« auf der ganzen Welt etwas Neues ins Leben gerufen. Überall wird dieses Konzept mittlerweile kopiert. Im Groben geht es darum, einen Gottesdienst auf die Gäste auszurichten und nicht auf die Gemeindemitglieder oder eine alte Kirchentradition. Musik, Anspiel, Ansagen, Videosequenzen, alles soll in einer lockeren Art vorgetragen werden, sodass Gäste sich wohlfühlen. Eine Maxime ist, dass jeder fromme Part immer wieder neu erklärt werden muss. Ein gästesensitiver Gottesdienst soll davon ausgehen, dass es immer wieder Besucher gibt, die zum ersten Mal da sind.
Ich bin heute viel zu aufgeregt, um mir das ganze Stück anzuschauen. Ich rutsche auf meinen Platz hin und her. Immer wieder diese Nervosität vor jeder Predigt, immer wieder diese Angst. Wird das denn nie besser? Zu guter Letzt spielt auch wieder der Magen verrückt. Adrenalin, Krämpfe, Schmerzen, die mir sagen, dass ich unbedingt noch auf die Toilette gehen muss. Es ist ein altes Spiel, ich kenne das. »Sag mal, habt ihr hier ein WC in der Kirche?«, frage ich den Pastor notgedrungen, der zum Glück direkt neben mir sitzt. Ich halte den Druck nicht mehr aus. »Ja klar, in der Sakristei!«, antwortet er überraschend freundlich. Vielleicht kennt er ja das Problem? Schnell verschwinde ich hinter den Vorhang und gehe auf das stille Örtchen. Was für eine Erleichterung. Ich höre im Hintergrund, dass die Moderatorin mein Video ansagt. Es gibt einen fünfminütigen Clip von meiner Lebensgeschichte, die ein Freund in Berlin aufgenommen und geschnitten hat. Das Video trägt den Namen »Gott gibt dich nicht auf«, man kann es sich von Youtube aus dem Internet runterladen. Das hatte der Veranstalter wohl getan und für die Jugendlichen im Gottesdienst an eine Leinwand geworfen. Jetzt aus der Toilette raus, Hände waschen und schnell zurück in das Hinterzimmer der Kirche.
Schließlich höre ich, wie mich das Mädchen nach vorne bittet. »Und jetzt kommt Martin Dreyer und hält seine Predigt!« Sofort packe ich meine Bibel unter den Arm, renne durch die Sakristei direkt auf die Bühne. Uff. Schritt für Schritt gehe ich auf das Rednerpult zu und mit jedem Schritt wird das Gefühl der Angst größer. Ich spüre ein Pochen in meinem Hals, das Blut steigt in meinen Kopf, mir wird warm. Auch wenn ich am liebsten wegrennen will, etwas zwingt mich weiterzugehen, weiter nach vorne. Ich möchte niemanden enttäuschen, die Jugendlichen haben sich so viel Mühe gemacht. Ich spüre die erwartungsvollen Blicke der Gottesdienstbesucher. Ein Rückzug ist unmöglich, ich muss da jetzt durch. Also gehe ich weiter in Richtung Mikrofon und Rednerpult. Jetzt stehe ich vorn.
In der Kirche ertönt lauter Beifall. Sehr ungewöhnlich und es fühlt sich auch etwas komisch an. Aber auch nicht schlecht, es dämpft meine Angst ein wenig. Das Mädchen stellt mir einige gute Fragen, die Jugendliche vor dem Gottesdienst auf einen Zettel schreiben und in eine Box werfen konnten. Da stehen solche Fragen drauf wie: »Was ist deine Lieblingsband?« (Kraftklub). Oder: »Wie sah dein schönstes Erlebnis aus?« (die Geburt meiner Tochter). Oder: »Was ist dein Fußballverein?« (St. Pauli). Ich merke, dass mit dem Interview meine Angstattacke langsam abschwillt. Das ist gut. Nachdem unser Gespräch vorbei ist, geht das Mädchen von der Bühne, und der Schweinwerfer fällt auf mein Lesepult. Also kann ich mit meiner Predigt beginnen. Der Pastor hat vorher eng mit mir abgestimmt, zu welchem Thema ich sprechen soll. Ihm ist es wichtig, eine Predigt über die Konsequenzen zu hören, die jeder tragen muss, wenn er Christ sein will. Dazu habe ich mir passend ein Gleichnis von Jesus als Bibelstelle ausgesucht, in der Christus die Radikalität der Glaubensnachfolge aufzeigt. Ich lese aus der Bibel die Stelle aus dem Matthäusevangelium im 13. Kapitel ab Vers 14 vor. Dort vergleicht Jesus das Himmelreich mit einem Schatz, der in einem Acker versteckt liegt. Er beschreibt, wie jemand diesen Schatz zufällig entdeckt und so begeistert davon ist, dass er seinen ganzen Besitz verkauft, nur um diesen einen Acker zu erwerben, in dem der Schatz verborgen ist. Das Lesen fällt mir nicht schwer, egal, wie groß mein Lampenfieber ist, vorlesen kann ich immer.
»In diesem Gleichnis von Jesus stecken eigentlich nur zwei Aussagen. Aber die haben es in sich!«, rufe ich den Jugendlichen zu. »Die erste Aussage benenne ich so: Das Leben mit Gott ist wie ein unheimlich wertvoller Schatz! Es macht dich reich, es ist das Beste, was dir passieren kann. Viele Leute glauben das nicht! Immer wieder höre ich, dass Menschen denken, Christsein wäre unheimlich mühsam, es würde das Leben einschränken, es wäre dumm, es wäre langweilig, es wäre nicht attraktiv. Es würde dich arm machen. Aber Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Der Glaube ist ein riesengroßer Schatz! Wer diesen Schatz einmal entdeckt hat, der will ihn nie wieder hergeben. Er ist das Wertvollste, was ein Mensch jemals in seinem Leben finden kann. Es gibt nichts Besseres, glaubt mir. Wisst ihr das? Glaubt ihr das?« Ich schaue in die Runde und habe das Gefühl, die meisten der Jugendlichen hören mir zu. In der ersten Reihe sehe ich einige Gesichter, die mich freundlich lächelnd anschauen. Das ist der Durchbruch. Jetzt ist meine Aufregung plötzlich komplett verschwunden. Ich fühle mich erleichtert und frei. Es braucht eine positive Reaktion, um mit meiner Panikattacke umgehen zu können, das ist interessant.
Also rede ich weiter: »Aber Jesu sagt noch eine zweite Sache: Wenn du diesen Schatz haben willst, musst du vorher alles verkaufen, was du hast. Der Schatz ist nicht billig. Er ist nicht kostenlos, er ist kein Spiel. Er ist nichts zum Wegwerfen, zum einmal Gebrauchen und dann in den Müll. Er kostet dich etwas, nämlich alles.« Im Kirchenschiff wird es still. Der nächste Abschnitt ist dafür da, den Jugendlichen klarzumachen, was das für sie praktisch bedeuten könnte. »Nur von Samstag in der Jugendstunde bis Sonntag im Gottesdienst Christ zu sein bringt es nicht wirklich. Erst wenn du deinen Glauben auch im Alltag lebst, sieben Tage die Woche, dann kann er seine ganze Kraft entfalten. Dieser kraftvolle Glaube kostet etwas, er durchdringt alle Entscheidungen, er bestimmt letztendlich das ganze Leben. Aber wenn er das tut, dann gibt es auch nichts Besseres. Christ zu sein hat eine unheimlich hohe Qualität, und viele Nichtchristen beneiden Menschen, die an Gott glauben können. Das wird mir immer wieder erzählt.«
Jetzt bin ich so richtig in Fahrt und habe völlig vergessen, wie spät es eigentlich ist und auch, was der Pastor mir vorher im Briefing an Regeln gesagt hatte. In einigen Kirchen ist es ausdrücklich erwünscht, dass man nach einer Predigt auch einen Aufruf macht. Aufruf ist ein Fachbegriff aus der evangelikalen Szene. Es bedeutet, dass man den Zuhörern eine Möglichkeit gibt, durch eine öffentliche Geste auf die Predigt zu reagieren. Diese Geste oder dieser Schritt nach vorne ist dabei immer mit einem Gebet verbunden. Das kann bedeuten, dass die Zuhörer, wenn sie sich angesprochen fühlen, nach einem Aufruf von ihren Plätzen zum Gebet aufstehen. Oder auch dass sie aufstehen und sogar nach vorne zum Altar kommen, um dort für sich beten zu lassen. In anderen Kirchen möchte das der Leitungskreis oder auch der Pastor ausdrücklich nicht, weil sie es als manipulativ und unecht empfinden. Wie ich es hier in Chemnitz machen sollte? Ich habe es in dem Augenblick vollkommen vergessen. Ich bin voll im Flow und lasse mich von meinen Gefühlen leiten. Also gehe ich einfach weiter mit meinen Gedanken.
»Gibt es hier jemanden, der heute alles verkaufen will, was er hat, um Christus ganz zu gehören? Wenn das jemand möchte, so soll er doch bitte als Zeichen vor Gott aufstehen!«, höre ich mich sagen. Ich bin nicht gut im Schätzen von Zahlen, aber ich denke, mindestens hundert junge Leute stehen sofort auf. Das haut mich in dem Augenblick einfach um. Dass junge Menschen in diesem Teil des Gottesdienstes reagieren, ist sehr ungewöhnlich, besonders in der Pubertät. Ich hätte mich über fünf Reaktionen übermäßig gefreut. Bei zehn Leuten wäre ich innerlich fast geplatzt. Aber dass es so viele, sind, erlebe ich kaum noch.
Völlig begeistert lade ich die Stehenden zu einem Gebet ein und alle beten laut mit. Danach kommt noch einmal die Band nach vorne und spielt ein paar Lieder. Schließlich ist der Gottesdienst vorbei und einige junge Menschen verlassen die Kirche. Viele bleiben aber noch, reden miteinander oder kommen mit einem aus dem Seelsorgeteam ins Gespräch.
Ich bin jetzt total erschöpft und möchte am liebsten schnell in mein Apartment gehen. Auch wenn es nur eine Ansprache ist, die über dreißig Minuten geht, bin ich danach innerlich oft sehr kaputt und ausgelaugt. Aber da sehe ich schon in einem Augenwinkel, dass mindestens ein halbes Dutzend Jugendliche noch vorne auf mich wartet, um mit mir zu sprechen. Das Zuhören und gleichzeitige Mitdenken in solchen Seelsorgegesprächen kosten mich unheimlich viel Kraft, besonders nachdem ich eine Predigt gehalten habe. Ich habe auch den Eindruck, dass der Kampf mit meinem Lampenfieber dazu erheblich beiträgt. Es ist sehr anstrengend, dagegen anzugehen, und kostet einiges an Energie. Aber ich kann jetzt auch nicht verschwinden.
Also setze ich mich mit dem ersten jungen Mann am Rand auf die vorderste Kirchenbank, auf der er mir sein Leid erzählen will. Nun kommt eine Geschichte, die ich in unterschiedlichen Varianten immer wieder hören muss. Er berichtet mir, schon viele Jahre eine »Sucht nach Pornografie« entwickelt zu haben und einfach nicht davon loszukommen. »Egal, was ich mir vornehme, es passiert immer wieder, dass ich stundenlang Pornos im Internet anschaue. Es ist zum Verzweifeln. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll«, erzählt er mir mit Tränen in den Augen. »Letzte Woche habe ich mir ein Tapetenmesser gekauft und wollte mir meinen Penis abschneiden. Aber der erste kleine Schnitt hat schon so wehgetan, dass ich es nicht ganz geschafft habe.«
Mir gefriert das Blut in den Adern. »Hey, mach das nicht!«, rufe ich dem Jugendlichen ins Gewissen. »Weißt du, es gibt kaum einen Mann in der Kirche, der diese starken Gefühle der Sexualität nicht kennt. Von ganz jung bis ganz alt habe ich schon Dutzende Geschichten gehört von Männern, die sich zu viel Pornografie im Internet anschauen. Aber das mit dem Tapetenmesser ist definitiv der falsche Weg, dieses Problem in den Griff zu kriegen! Ich würde dir gern einen Tipp geben, tue ab sofort Folgendes: Danke Gott jeden Tag für deine Sexualität. Kämpfe nicht länger dagegen an, das macht dich nur krank. Nimm sie dankbar an und freue dich darüber. Sexuelle Gefühle sind ein Geschenk Gottes. Sie sind etwas Wundervolles. Du kannst sie genießen und dich daran freuen. Versuche nur positiv damit umzugehen. Es ist sicher eine Kraft, bei der du lernen musst, sie in die richtige Richtung zu lenken. Du kannst sie nicht abstellen, abschneiden oder einen Pfropfen draufmachen, sodass sie nicht mehr rauskommt.
Aber du kannst diese Energie in die richtigen Bahnen lenken. Das ist eine Aufgabe, die Gott jedem jungen Menschen stellt. Und das Lernen im Umgang mit Sex soll dir Spaß machen und dich nicht in eine Verdammnis führen. Die Bibel sagt, dass die dunkle Seite, die auch um uns herum wirkt, dich dazu verführt, gerade das Verbotene zu tun. Sogar Paulus schreibt, dass er genau das tut, was er nicht tun will. Er schreibt, das Gesetz verleitet ihn dazu. Aber dann feiert er in dem biblischen Text, dass Gott ihn von diesem Gesetz befreit hat. Ich würde an deiner Stelle diese Negativität aus deiner Sexualität rausnehmen. Und zwar ganz. Sei dankbar für das, was Gott dir geschenkt hat. Danke Gott für deine Sexualität, jeden Tag. Für die irren Gefühle, die dabei entstehen, für den Rausch, für die Entspannung. Deine dunkle Seite will dich kleinhalten und dir ein schlechtes Gewissen machen. Aber Jesus ist nicht so. Er will uns Kraft geben, uns ermutigen, uns befreien!«
Anschließend beten wir noch lange zusammen und am Ende segne ich ihn. Ich hoffe sehr, dass ich dem jungen Mann seine Pläne mit dem Tapetenmesser ausreden konnte. Das ist wirklich schlimm. Diese enge Sexualmoral in einigen Kirchen hat so viel Unheil angerichtet. Sie macht Menschen kaputt, sorgt für eine kranke Sexualität. Und letztendlich bringt sie die Christen weg vom Glauben an Gott.
Nachdem ich noch einige Gespräche geführt habe, fährt mich der Pastor in ein schönes Hotel. Wir schwärmen beide während der Fahrt von dem tollen Event. Er ist auch sehr zufrieden mit dem Ablauf und freut sich wie verrückt, dass so viele junge Menschen gekommen sind. Ich bin total platt und kraftlos. Nachdem wir im Hotel ankommen, suche ich schnell mein Bett auf und lege mich hin. Vor dem Einschlafen muss ich noch lange über die moralischen Werte und ihre negativen Auswirkungen auf die Christen nachdenken. Was ich immer wieder verrückt finde: Der Gründer des Christentums, Christus selbst, war so überhaupt nicht moralisch. Jesus hat nie sexuelle Sünden verurteilt, nicht ein einziges Mal. Sogar als eine stadtbekannte Prostituierte bei ihm war, hat er sie für ihre sexuellen Verfehlungen nicht kritisiert. Das ist doch erstaunlich. Warum tun das nur die Christen immer wieder, warum ist das Thema in der Kirche so groß?
Ganz im Gegenteil wurde durch seinen Apostel Paulus die Freiheit von dem Gesetz ausgerufen. Jesus selbst wird in der Bibel so zitiert: »Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist …, ich aber sage euch …« (Matthäus 5,21-22). Das war wie ein ständiger Spruch auf seinen Lippen. Was die Alten sagten, war eine Gottesbeziehung, die sich durch Belohnung und Bestrafung, durch Segen und Fluch, durch das Befolgen von Regeln ausgedrückt hat. Taten die Nachfolger Gottes das, was er verlangte, wurden sie von ihm beschenkt. Taten sie es nicht, wurden sie von ihm bestraft. Und zwar richtig hart, da wurden zum Teil ganze Familien ausgerottet.
Doch mit Jesus hat sich das radikal verändert. Alles wurde anders durch ihn. Auch wenn viele Familien und Völker das bis heute noch nicht verstanden haben. Christus hat den sogenannten »Fluch des Gesetzes« auf sich genommen, so beschreibt es die Bibel. Alles Negative, alle negativen Folgen unserer Taten auf unsere Gottesbeziehung, hat er radikal zum Positiven verwandelt. Gott hat durch Jesus klargemacht, dass er sich Freunde wünscht und keine Soldaten. Jesus nennt seine Nachfolger Freunde und nicht Diener. Gott möchte keinen Befehlsgehorsam, sondern eine liebevolle Beziehung zu uns.
Wenn mir ein moralisches Christentum begegnet, bin ich innerlich immer sehr zerrissen. Ich kann bei vielen moralischen Forderungen dieser Geschwister nicht mehr mitgehen. Auch wenn Christus in genau dieser Bibelstelle, welche in meiner Predigt genannt wurde, davon sprach, alles zu verkaufen. Es geht mir heute nicht mehr in meine Vorstellung, dass er damit auch einen hohen moralischen Lebensstil einfordern wollte. Also frei nach dem Motto: Alles zu verkaufen bedeutet einen harten Weg der Nachfolge Christi zu wählen und alles was mich ausmacht, meinen Willen und meine Begabungen, mein Geld, meinen Besitz, alles was mir guttut, komplett abzugeben. Das wäre ja die naheliegende Deutung der Moralisten. Du musst alles verkaufen, dich radikal und ganz aufgeben, deine Wünsche, dein Leben, deine Freuden, deine Sehnsüchte, deine Sexualität, alles muss Gott geweiht sein. Erst dann erhältst du den Schatz, die Belohnung, vorher nicht. Im Umkehrschluss bedeutet das ja: Behältst du nur ein klein wenig für dich, gibst du dich ihm nicht zu hundert Prozent hin, dann wirst du auch nicht den ganzen Segen, den ganzen Schatz bekommen können. Ich selbst habe das jahrelang so vertreten und geglaubt. Doch was für ein krankes Gottesbild steckt dahinter? Als würde es Gott doch nur um unsere Taten gehen und nicht um unser Vertrauen, unseren Glauben, unser Herz.
Ich vermute, dass es Christus in dieser Geschichte um unseren tatsächlichen Reichtum ging, um unser Geld. Geld hat so eine Macht in der Gesellschaft und das war schon immer so. Es gibt noch einige Bibelstellen mehr, in denen Jesus sich gegen Besitz und die Macht des Geldes ausspricht. Was er sagen will, ist, dass wir unser Herz nicht an Geld hängen sollen, nicht an Besitz und Reichtum. Es ist die kleine Perle, die wir so gerne haben wollen, die wir unbedingt brauchen, sie ist letztendlich viel mehr wert. So würde ich es heute auslegen und verstehen.
Im Rückblick tut es mir sehr leid, wenn durch meinen Dienst Jugendliche unter einen moralischen Druck gekommen sind. Ich bin kein konservativer Christ. Ich möchte junge Menschen ermutigen, sich von dem Druck zu befreien und die Freiheit zu entdecken, die der Glaube an einen Gott schenken will. Wir sind zur Freiheit berufen, so steht es in der Heiligen Schrift.