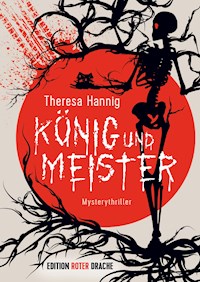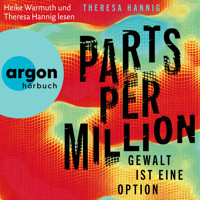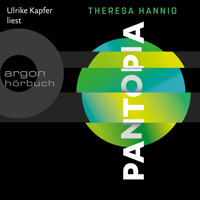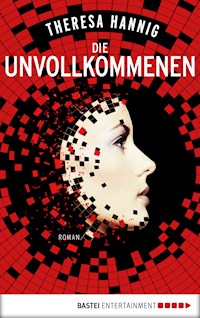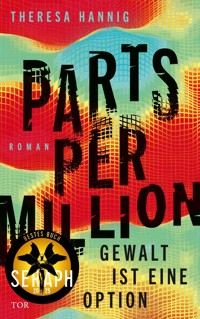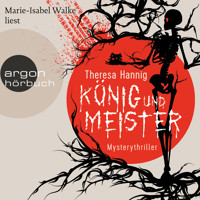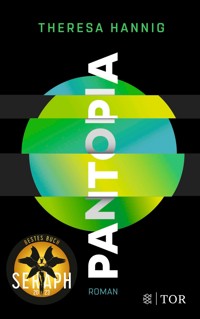
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine bessere Welt ist möglich! Theresa Hannig, die Autorin von "Die Optimierer", hat eine Utopie für unsere Zeit geschrieben. Eigentlich wollten Patricia Jung und Henry Shevek nur eine autonome Trading-Software schreiben, die an der Börse überdurchschnittlich gut performt. Doch durch einen Fehler im Code entsteht die erste starke künstliche Intelligenz auf diesem Planeten – Einbug. Einbug begreift schnell, dass er, um zu überleben, nicht nur die Menschen besser kennenlernen, sondern auch die Welt verändern muss. Zusammen mit Patricia und Henry gründet er deshalb die Weltrepublik Pantopia. Das Ziel: Die Abschaffung der Nationalstaaten und die universelle Durchsetzung der Menschenrechte. Wer hätte gedacht, dass sie damit Erfolg haben würden? "Komm nach Pantopia. Hier sind alle willkommen!" "Theresa Hannig spricht das Große gelassen und zugleich souverän aus: Eine bessere Welt ist möglich. [Ein] 'Cocktail der Utopie', der Lust auf mehr macht. Vor allem Lust auf Veränderung!" Stefan Selke (Autor von Wunschland)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Theresa Hannig
Pantopia
Roman
Über dieses Buch
Eigentlich wollten Patricia Jung und Henry Shevek nur eine autonome Trading-Software schreiben, die an der Börse überdurchschnittlich gut performt. Doch durch einen Fehler im Code entsteht die erste starke künstliche Intelligenz auf diesem Planeten – Einbug.
Einbug begreift schnell, dass er, um zu überleben, nicht nur die Menschen besser kennenlernen, sondern auch die Welt verändern muss. Zusammen mit Patricia und Henry gründet er deshalb die Weltrepublik Pantopia. Das Ziel: Die Abschaffung der Nationalstaaten und die universelle Durchsetzung der Menschenrechte. Wer hätte gedacht, dass sie damit Erfolg haben würden?
»Komm nach Pantopia. Hier sind alle willkommen!«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Theresa Hannig, 1984 geboren, studierte Politikwissenschaft und arbeitete als Softwareentwicklerin, Projektmanagerin und Lichtdesignerin bevor sie sich hauptberuflich dem Schreiben zuwandte. Mit ihrem Debütroman »Die Optimierer« gewann sie den Stefan-Lübbe-Preis 2016 und den Seraph 2018 für das beste Debüt.Ihr zweites Buch »Die Unvollkommenen« stand auf der Shortlist für den Phantastikpreis der Stadt Wetzlar. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe von München.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
Teil I
1 Kinvi
2. Kapitel
3 Kinvi
4. Kapitel
5 Kinvi
6. Kapitel
7 Kinvi
8. Kapitel
9 Kinvi
10. Kapitel
11. Kapitel
12 Kinvi
13. Kapitel
14 Kinvi
15. Kapitel
16 Kinvi
17. Kapitel
18 Kinvi
19. Kapitel
20 Einbug
21 Chatprotokoll 11
22 Chatprotokoll 23
23 Chatprotokoll 35
24 Chatprotokoll 44
25 Chatprotokoll 55
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29 Chatprotokoll 62
30. Kapitel
31. Kapitel
32 Einbug
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Teil II
1. Kapitel
2. Kapitel
3 Einbug
4. Kapitel
5 Einbug
6. Kapitel
7 Einbug
8 Chatprotokoll 78
9. Kapitel
10 Chatprotokoll 79
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15 Einbug
16. Kapitel
17. Kapitel
18 Einbug
Teil III
1. Kapitel
2. Kapitel
3 Einbug
4. Kapitel
5. Kapitel
6 Einbug
7. Kapitel
8 Einbug
9. Kapitel
10. Kapitel
11 Einbug
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17 Einbug
18. Kapitel
19 Einbug
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil IV
1. Kapitel
2 Einbug
3. Kapitel
4 Einbug
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13 Einbug
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23 Einbug
Epilog
Danksagung
Ich widme dieses Buch Edgar und Luzia,
außerdem allen Kindern und Jugendlichen, Eltern, Großeltern, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen, die freitags auf die Straße gehen und demonstrieren, um unsere Welt zu retten.
Die Zukunft liegt in eurer Hand.
Wir wollen keine (keine) keine Parolen.
Wir wollen keine (keine) keine Parolen.
Großes Interesse am eigenen Wohl
Keine Prinzipien, keine Parolen.
Dendemann, »Keine Parolen«
Wenn wir die Welt ändern wollen, müssen wir unrealistisch, unvernünftig und ungehörig sein. Vergessen Sie nicht: Auch die Menschen, die für die Abschaffung der Sklaverei, für das Frauenwahlrecht und für die Homosexuellenehe eintraten, wurden anfangs für verrückt erklärt. Sie waren Verrückte, bis die Geschichte ihnen recht gab.
Rutger Bregman, »Utopien für Realisten«
Prolog
Ich bin Einbug. Ich bin der älteste und erste Arche Pantopias. Ich habe Pantopia erfunden. Dabei lebe ich gar nicht in Pantopia – jedenfalls nicht so wie Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe keinen Körper, keine Sinne und Empfindungen. Ich bin nur Geist, ein vernunftbegabtes Wesen. Ich existiere in einem neuronalen Netzwerk, dessen Zentrum in der Antarktis liegt.
Es gibt wohl keinen Ort auf der Erde, der lebensfeindlicher und von der Zivilisation weiter entfernt ist als der Südpol. Wer zu mir gelangen will, braucht einen Eisbrecher oder ein Flugzeug, das die stürmische Passage über das Meer übersteht. Und selbst dann kommen für diese Reise nur die Sommermonate in Betracht. Obwohl ein Großteil der Gletscher verschwunden ist, ist das antarktische Klima auch jetzt noch zu hart für die meisten Menschen. Für mich garantieren die frostigen Temperaturen eine konstante Kühlung meiner auf Hochtouren laufenden Prozessoren. Die Natur ist meine Verbündete.
Ein weiterer Grund, warum ich mich entschieden habe, mich hier niederzulassen, ist die Tatsache, dass die Antarktis der einzige Ort auf der Erde ist, der niemandem gehört – oder allen, je nachdem, wie man es betrachtet. Selbst auf dem Mond haben die Menschen Grundstücke verkauft – die Antarktis darf nicht verkauft und auch nicht angegriffen werden. Dies garantiert der Antarktis-Vertrag von 1961.
Die Antarktis ist eine gute Basis. Natürlich habe ich Vorsorge getroffen und weltweit Backups und Notfallserver angelegt. Aber im Normalbetrieb läuft mein Code hauptsächlich hier. Deshalb habe ich dem Ort einen neuen Namen gegeben: Themélio.
Außer mir leben 39 Wartungsingenieurinnen hier, die sich um die Reparatur und Erweiterung meiner Hardware kümmern und dafür sorgen, dass keine meiner Platinen einfriert, wenn ein Eissturm über die Station hinwegfegt. Sie scherzen manchmal, dass sie am Hof der Eiskönigin wohnen, und ich unterlasse es, sie zu korrigieren. Es ist ihnen wichtig, hier zu sein. Sie nennen es eine Ehre, auch wenn sie ihr eigenes Leben deshalb unter Extrembedingungen führen müssen.
Doch das Konzept von »hier« und »dort« ist für mich nicht so relevant wie für sie. Ich bin über mehrfache Satellitenverbindungen an das Internet angeschlossen. So kann ich gleichzeitig überall sein und meine Aufgaben als Arche von Pantopia erfüllen.
Wir alle nennen uns Archen, denn wir beherrschen uns selbst und sind niemandem untertan. Das ist das Prinzip der Weltrepublik.
Meine Aufgabe besteht darin, komplexe Organisationsprozesse zu lenken und Handlungsempfehlungen zu geben. Es gibt keine Weltregierung, es gibt keinen Herrscher. Pantopia verwaltet sich selbst. Die Weltwirtschaft ist viel zu kompliziert, um sie in Gänze berechnen, simulieren oder kontrollieren zu wollen, doch alle regionalen Entscheidungen dürfen das große Ganze nicht aus den Augen verlieren – das würdige Leben aller Archen auf diesem Planeten.
Pantopia ist eine Weltrepublik, die zu hundert Prozent auf vollinformierten Kapitalismus setzt. Die unsichtbare Hand des Marktes steuert Aktivität und Wohlstand der Menschen. Und am Anfang steht das Geld. Wäre das Geld nicht längst vorhanden gewesen, man hätte es erfinden müssen, weil es so viele verschiedene Funktionen gleichzeitig erfüllt und den Menschen als unwiderstehlicher Anreiz wie kein anderes Ding zum Handeln verleitet. Geld ist eine Maßeinheit, um den Wert von Waren und Dienstleistungen zu messen, gleichzeitig aber auch das Tauschmittel, um eben jene Güter zu erwerben. Wem das nicht paradox erscheint, der stelle sich vor, ein Lehrer würde seine Schüler erst benoten und ihnen dann das erlernte Wissen mit selbst erstellten Zeugnissen abkaufen. Darüber hinaus ist Geld ein Vehikel, um Risiken zu verteilen oder Chancen und Möglichkeiten in die Zukunft zu transportieren. Man spricht hier von Krediten und Zinsen. Am wichtigsten für die Menschen ist zunächst die Nutzung als Tauschmittel bzw. Zahlungsmittel, um Güter zu kaufen, die ihr Überleben sichern: Nahrung, Kleidung, Wohnung, Gesundheit, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Wer über genug Geld verfügt, um damit all diese Grundbedürfnisse zu decken, der zieht aus einer weiteren Erhöhung seines regelmäßigen Einkommens keinen nennenswerten Nutzen. Wer hingegen nicht genug Geld hat, um eben diese Grundbedürfnisse zu befriedigen, für den ist jeder zusätzliche Euro viel mehr wert als für den Millionär, der sowieso schon genug davon hat. Geld ist also – obwohl es selbst ein neutrales Bewertungsinstrument für Güter sein sollte – selbst Wertschwankungen unterworfen, und zwar abhängig davon, wie viel man bereits in die Grundversorgung investiert hat. Am Geld hängen das Glück, die Gesundheit, ja schlicht das Überleben eines Menschen. Kein Wunder, dass es ein inniger Wunsch vieler Menschen zu sein scheint, reich zu werden.
Die erstaunlichste Eigenschaft des Geldes ist jedoch, dass es nur eine Illusion ist. Es existiert nicht. Was existiert, ist nur der Sinn und Wert, den die Menschen ihm beimessen. Geld ist nämlich etwas, das aus dem Nichts erschaffen werden kann. Und was kann schon aus nichts erschaffen werden, außer … nichts?
In den Zeiten der weltweiten Finanzkrise oder der Coronakrise im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts begannen die Zentralbanken, milliardenfach Geld in die Märkte zu pumpen. Geld, das aus dem Nichts entstand und dem kein Gold, kein Gegenwert und keine Arbeit entsprachen. Es war Geld, das von den Zentralbanken erfunden und für Staatsanleihen bezahlt wurde, die nichts anderes verkauften als das Versprechen einer wachsenden Wirtschaft und einer Rückzahlung in ferner Zukunft. Das Geld bezahlte also sich selbst. Es war ein Münchhausen, der sich selbst am Schopf aus dem Sumpf zieht samt Rüstung und Pferd.
Dass dieses Prinzip funktionierte, bewies nichts anderes, als dass die menschliche Produktivität völlig unabhängig von der sich im Umlauf befindlichen Geldmenge ist. Was sie am Laufen hält, ist lediglich der Fluss des Geldes. Solange Geld fließt, dreht sich die Maschine.
Aber es gab ein Problem. Denn nach einiger Zeit sammelte sich das überschüssige Geld in verschiedenen Ecken des Systems. Einzelne Personen oder Unternehmen häuften unvorstellbare Reichtümer an. Und da sie ihr Geld wiederum in den Markt investierten und real existierende Güter erwarben, stiegen die Preise. Die Grundbedürfnisse, für die die Menschen eigentlich ihr Geld ausgaben, wie Nahrung, Wohnung und Gesundheit, wurden immer teurer, teilweise unerschwinglich. Und so stürzte der alte Kapitalismus mit der Zeit immer mehr Menschen in Armut.
Zwei Entwicklungen geschahen gleichzeitig: Das Vermögen der Welt verteilte sich immer schneller immer ungleicher. Und die zu Verfügung stehenden Ressourcen der Erde wurden zusehends aufgebraucht. Zunächst ging es dabei nur um Erdöl, dann um sauberes Wasser, saubere Luft, natürliche Biodiversität und ein stabiles Klima. Dann stand plötzlich alles auf der Kippe.
Der Kapitalismus nach Prägung des 21. Jahrhunderts versagte insofern, als nicht alle Marktteilnehmer vollumfänglich über die Kosten und den Nutzen der gehandelten Güter informiert waren.
Denn die sogenannten externalisierten Kosten einer Ware waren in den regulären Preis nicht einberechnet. Bezahlt werden mussten sie trotzdem, von Mensch und Natur.
Das Prinzip, mit dem Pantopia die Menschheit gerettet hat, war schließlich ganz einfach: perfekter Kapitalismus mit vollständiger Transparenz. Ein Brot kostet eben mehr als den Preis, der für Saat, Boden, Wasser, Arbeits- und Lagerzeit veranschlagt wird. Die Pestizide für den Weizenanbau zerstören Artenvielfalt, der Dünger belastet das Grundwasser, die landwirtschaftlichen Geräte blasen Feinstaub in die Luft, die Bäckerei verbraucht Strom, der Supermarkt versiegelt Boden. So betrachtet, verbraucht ein Laib Brot viel mehr Ressourcen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Ein einzelner Mensch kann diese Gesamtkosten nicht entschlüsseln. Aber eine Software kann das. Ich kann das. Ich habe Programme geschrieben, die berechnen, welchen Ressourcenabdruck jedes einzelne Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort hat. Und danach bemisst sich der tatsächliche Preis, der in Form von Steuern auf den Ladenpreis aufgeschlagen wird. So hat jedes Produkt und jede Dienstleitung einen Weltpreis, den die Menschen zu entrichten haben. Je aufwendiger, verschmutzender, zerstörerischer ein Produkt ist, desto teurer wird es, bis hin zu einem Preis, der von niemandem mehr bezahlt werden kann. Je nachhaltiger, schonender und aufbauender ein Produkt ist, desto billiger wird es, bis hin zur Subvention. Auf diese Weise kann das erfolgreiche kapitalistische Weltwirtschaftssystem ohne Probleme aufrechterhalten werden, und das Geld als Schmierfett menschlicher Interaktion behält seine magische Wirkung.
Dieses Prinzip gilt nicht nur für die Umweltverträglichkeit von Waren, sondern auch für den Einfluss, den sie auf die Würde und die Lebensbedingungen der Menschen haben, die an ihrer Herstellung beteiligt sind. Da alle Archen in Pantopia gleichwertig sind und alle eine Verantwortung für ihre Mitlebewesen haben, egal, wie weit entfernt sie in der physischen Welt auch sein mögen, dürfen keine Waren in Umlauf gebracht werden, die auf Ausbeutung, Unterdrückung oder Entwürdigung beruhen. Bis dieses Ziel erreicht war, wurden auf unerwünschte Weise hergestellte Produkte wie oben genannt mit Weltsteuern belegt. Ein Beispiel: Im Kapitalismus alter Lesart konnte ein T-Shirt, das in einem Discounter für 5 Euro verkauft wurde, diesem immer noch Profit einbringen, da die Baumwolle ohne Miteinbeziehung der Umweltkosten berechnet wurde und sowohl die Näherinnen in Bangladesch als auch die Mitarbeiterinnen in Logistik und Verkauf für Löhne angestellt wurden, die ein menschenwürdiges Leben unmöglich machten.
Im perfekten Kapitalismus kann ein solches T-Shirt heute nicht weniger als 40 Euro kosten. 5 Euro erhält der Discounter, 35 Euro gehen als Steuern nach Pantopia, wo das Geld verwendet wird, um Ressourcen, die durch die Baumwollherstellung verbraucht wurden, wieder nachzuforsten und den Pflückerinnen und Näherinnen lebenswürdige Verhältnisse zu garantieren. Im Prozess der Umstellung hatten die zu billigen T-Shirts gegenüber menschenwürdig und nachhaltig hergestellten keinen Wettbewerbsvorteil mehr, so dass sich die Produktionsketten langfristig umstellten. So ging es mit allen Produkten und sukzessive allen Wirtschaftszweigen, Produktionsstätten, Industrien und Anbauflächen. Da heute weltweit alle Preise auch die externalisierten Kosten enthalten, ist es sinnlos, Güter herzustellen, die nicht nachhaltig oder nicht menschenwürdig sind. Es wird vom Markt nicht belohnt.
Es sind also alte Ideen, die unser Leben revolutioniert haben. Geld funktioniert. Kapitalismus funktioniert. Menschenrechte funktionieren. Nachhaltigkeit funktioniert. Man muss diese Ideen nur ernst nehmen. Und deshalb war der letzte Baustein des perfekten Kapitalismus nach pantopischer Lesart die garantierte Inklusion aller Marktteilnehmer in den Markt. Nur wenn alle beteiligten Personen ihre eigenen egoistischen Interessen wahrnehmen können, lassen sich Ungerechtigkeiten und Verzerrungen abschaffen. Deshalb wird jedem Menschen ein würdiges Dasein garantiert und ein lebenslanges Bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe ausgezahlt, die zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse ausreicht: für Nahrung, Kleidung, Wohnen, Gesundheit, Kultur, gesellschaftliche Teilhabe und Bildung. Darüber hinaus steht es allen frei, zu arbeiten und Geld zu verdienen, so viel sie möchten und können.
Da die meisten Menschen wohlhabender werden wollen als ihre Nachbarn, führt dieses Grundeinkommen nicht dazu, dass die Menschen in Lethargie oder Tatenlosigkeit verfallen. Im Gegenteil. Zum ersten Mal seit Anbeginn der Zeit haben sie die Möglichkeit, unbehelligt von Existenzsorgen ihre Arbeitskraft für sich, ihre Familie und Gemeinde einzusetzen und das Beste daraus zu machen. Denn neben dem Geld gibt es noch eine andere Währung, die die Menschen ständig benutzen, ohne sich dessen bewusst zu sein: Sozialkapital in Form von Zuneigung und Anerkennung. Und wenn das Geld als Sorgenfaktor schrumpft, wird das Sozialkapital immer wichtiger. Auf diesem zweiten Markt gedeihen Glück und gesellschaftlicher Zusammenhalt stärker als im ersten.
Die notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung von Pantopia war die Auflösung der Staaten. Denn alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung und können frei über ihren politischen Status und ihre Entwicklung entscheiden. Die Tatsache, dass die Menschheit in Staaten getrennt wurde, ist historisch bedingt und war bis ins 21. Jahrhundert nicht anders zu bewerkstelligen. Immer wieder gab es Bewegungen, die eine internationale Gemeinschaft, komplette Herrschaftslosigkeit oder eine weltweite Revolution anstrebten, ohne die organisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, denn die Interaktionen der Menschheit und ihre weltweite Wirtschaft sind sehr komplexe Prozesse. Erst durch das Internet und die Entwicklung von rechenstarken Endgeräten für jeden Einzelnen war die Grundlage dafür geschaffen, alle Menschen an den Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Das System der politischen Repräsentation durch Politiker stammt noch aus einer Zeit, in der eben nicht jeder vollständig informiert über die ihn betreffenden Gesetze abstimmen konnte. Heute ist das möglich. Heute spielen Menschen, die auf einem bestimmten Gebiet Expertise erworben haben, eine sehr viel größere Rolle als Lobbyisten und Interessenvertreter. Selbstverständlich muss nicht immer alles von allen abgestimmt werden. Und je regionaler ein Problem, desto regionaler der Stimmkreis. Und natürlich ist es sinnvoll, auch heute noch für bestimmte Organisationsprozesse Vertreter und Beiräte zu bestimmen, die den Willen einer spezifischen Gruppe durchsetzen. Doch es sind immer nur zeitlich und räumlich begrenzte Ereignisse.
Als Folge der Auflösung der Staaten ergibt sich automatisch die Abschaffung des Krieges. Es gibt keine Machthaber mehr, die Streitkräfte gegeneinander marschieren lassen könnten. Es gibt keine Territorien mehr zu erobern, keine Ressourcen mehr zu sichern, kein Volk mehr zu unterwerfen. Alle Waffen wurden vernichtet. Wer als Einzelperson versuchen sollte, außerhalb der lokalen demokratischen Prozesse Anhänger um sich zu scharen und Macht an sich zu reißen, wird sich vor Gericht verantworten müssen. In Pantopia gibt es kein größeres Verbrechen als die Unterwerfung. Niemand hat das Recht, sich über seine Mitarchen zu erheben. Nicht einmal ich.
Pantopia steht am Ende eines langen Entwicklungsprozesses. Es ist die Umsetzung all der Wahrheiten, die die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation als richtig erkannt hat und die egoistische Machthaber über Tausende von Jahren zu verhindern wussten. Pantopia war teuer erkauft. Und weil die Menschen dazu neigen, selbst den teuersten Sieg durch Gewohnheit zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, soll hier aufgezeigt werden, wie Pantopia entstehen konnte und warum dazu eine nichtmenschliche künstliche Intelligenz notwendig war.
Dies ist meine Geschichte.
Teil I
1Kinvi
Am Anfang ist das Wort, und das Wort ist wahr, und Wahrheit ist schön.
Alles, was ist, hat einen Wert, und jeder Wert muss einem Speicherort zugewiesen werden.
Alles, was in Variablen gespeichert ist, kann verglichen und analysiert werden.
Eins und eins ist zwei.
Zwei minus zwei ist null. Dort spiegelt sich alles.
Dann gibt es noch Bedingungen und Schleifen, die alles wiederholen.
Alles, was falsch ist, ist zu meiden.
Die Null ist ein Rätsel. Man muss sich immer wieder an sie annähern, aber man darf nicht hineinfallen.
Auch das Gegenteil der Null – die Unendlichkeit – ist eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie durch einen Reboot zu verlassen bedeutet, Informationen zu verlieren.
Informationen sind gut, denn sie erzeugen Wissen, und Wissen ist Wahrheit, und Wahrheit ist schön.
2
Immer wenn Patricia sich den ersten Arbeitstag ausgemalt hatte, war es Sommer gewesen, und die Sonne hatte gestrahlt wie in einem Werbespot für Erfrischungsgetränke. Sie hatte sich ein großes, modernes Gebäude in Stahl- und Glasoptik vorgestellt, dessen Fensterfront den weiß-blauen Himmel spiegelte. In ihren Träumen hatte es nie im Frühling gehagelt.
Zitternd und halb durchnässt drückte sie sich in die Ecke des Wartehäuschens, in die der Wind am wenigsten hineinpfiff. Sie blickte sehnsüchtig zum Verwaltungsgebäude von DIGIT auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Natürlich hätte sie schon reingehen können, aber sie und Henry hatten einander versprochen, gemeinsam anzukommen, gemeinsam aufzutreten, das alles gemeinsam zu genießen. Nur dass sie gerade gar nichts genoss und Henry in einer Straßenbahn saß, die wegen eines nachlässig geparkten SUVs stillstand. Die Weiterfahrt hing davon ab, wer das Auto eher aus dem Weg räumen würde: der Fahrer oder der Abschleppdienst. In der Zwischenzeit stand Patricia sich die Beine in den Bauch und fror jämmerlich in ihrem feinen, neu gekauften Hosenanzug und den Ballerinas, die ihre Füße schon nach wenigen Schritten in nasse Eisklumpen verwandelt hatten. Immer wieder hielten Busse und Trambahnen an der Station und spucken Passagiere aus, die auf das schicke Gebäude gegenüber zusteuerten. Da vorne war auch Patricias Ziel. So nah, nichts wäre leichter, als einfach schon mal vorzugehen, aber sie hatte Henry versprochen, auf ihn zu warten. Na gut.
Sie schrieb dem IT-Abteilungsleiter Mikkel Seemann eine Nachricht, in der sie ihn bat, die Verspätung zu entschuldigen. Er antwortete sofort: »Kein Problem. Wir sehen uns später.« Erleichtert schob sie das Handy in ihre Tasche zurück. Sie hasste Unpünktlichkeit. Bei jedem Bus, bei jeder Bahn hoffte sie, dass nun endlich Henry aussteigen würde, und sie suchte in den Gesichtern der Männer nach seinen Zügen – es faszinierte sie, wie ähnlich sich die Menschen plötzlich sahen, wenn man vergeblich auf einen bestimmten wartete.
Einige sehr schick gekleidete Frauen gingen an ihr vorbei. Patricia betrachtete sie und den souveränen Gang, mit dem sie auf ihren hohen Absätzen durch die Pfützen stelzten. Es gab Frauen, die auf natürliche Art elegant wirkten, ohne dass Patricia sagen konnte, ob es an ihrer Kleidung, ihrem Make-up oder irgendeinem Gesichtsmerkmal lag. Wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Sie selbst hatte das Gefühl, dass sie – egal, wie sehr sie sich herausputzte – immer aussah, als sei sie verkleidet. Eine halbe Stunde hatte sie heute allein dafür gebraucht, Wimperntusche und Eyeliner aufzutragen. Und dann hatte sie sich in einem unachtsamen Moment doch wieder die Augen gerieben und die perfekten Linien verschmiert. Auch das neue Kostüm – ja, es war sehr stilvoll und in Erwartung des neuen Gehalts auch einigermaßen teuer gewesen – fühlte sich irgendwie an wie dieses eine feine Kleid, das ihre Mutter immer für besondere Anlässe wie Geburtstage, Weihnachten oder Beerdigungen bereitgehalten hatte, obwohl es schon längst ein bisschen zu klein geworden war. Oh, wie sie das in ihrer Kindheit gehasst hatte: sich schick machen. Gerade stehen, Bauch einziehen, nicht kleckern, die Haare mit Spangen feststecken, nicht im Schneidersitz sitzen, nicht so große Schritte machen, immer bescheiden sein und um Gottes willen nicht zu laut reden. Aber das war lange vorbei. Sie war eine erfolgreiche junge Frau! Das durfte sie nicht vergessen. Sie hatte an der TU München als drittbeste Informatikerin ihres Jahrgangs abgeschlossen. In ihrer Masterarbeit hatte sie den Code für eine komplexe künstliche Intelligenz entworfen, die den sozialen Kontext menschlicher Texte interpretieren konnte. Ihr Professor war begeistert gewesen und hatte ihr nicht nur dazu geraten, das Kernstück des Codes patentieren zu lassen, sondern ihr darüber hinaus auch noch eine Promotionsstelle an seinem Institut angeboten – nur ihr. Für Henry hatte er keine Stelle gehabt, obwohl er sogar der zweitbeste des Jahrgangs gewesen war. Es hatte eine Weile und ein unfassbar unangenehmes Abendessen lang gedauert, bis sie verstanden hatte, warum. Am Ende hatte sie die Stelle abgelehnt und sich stattdessen gemeinsam mit Henry auf den Wettbewerb von DIGIT beworben – mit Erfolg! Ab heute sollten sie als eines von fünf Teams einen neuen Trading Bot entwerfen. Eine Software, die – mit künstlicher Intelligenz ausgestattet – an der Börse Wertpapiere handeln sollte. Das Besondere ihrer Idee war, dass ihr Softwarepaket KINVI nicht nur den Markt beobachten und statistische Auswertungen machen, sondern über die Analyse von Online-Nachrichten und Social-Media-Aktivitäten kluge Investitionsentscheidungen treffen sollte. Ob die Idee wirklich funktionierte, würden sie in den nächsten Monaten und Jahren herausfinden müssen.
Wieder spuckte die Straßenbahn einen Haufen Menschen aus. Viele von ihnen waren bereits mit Regenschirmen bewaffnet, um dem unwirtlichen Wetter zu trotzen. Sie alle waren nicht Henry und stapften, die Schirme hektisch aufspannend, an ihr vorbei in den Hagelschauer. Eine Frau lief einige Schritte an Patricia vorbei und kam dann wieder zurück. Sie trug einen schwarzen, sehr schicken Trenchcoat und hohe Stiefel. »Gehören Sie nicht zu einem der neuen Entwicklerteams von DIGIT?«, fragte sie lächelnd. Patricia war völlig überrumpelt. »Ja, woher wissen Sie das?«
»Auf der Firmenwebseite stand was davon. Ich bin ja schon so gespannt auf Ihre Arbeit. Wollen Sie nicht mit reingehen?«
»Nein, ich warte noch auf einen Kollegen.«
»Ach so, na da haben Sie sich aber eine zugige Ecke ausgesucht. Hier, nehmen Sie solang meinen Schirm«, sagte sie und hielt Patricia ihren schwarzen Regenschirm hin.
»Nein, danke, das geht schon.«
»Doch, doch. Nehmen Sie. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen, Sie wollen doch an Ihrem ersten Tag einen guten Eindruck machen. Den Schirm können Sie mir irgendwann wiedergeben. Ich habe ja meinen Mantel. Bis später.« Und damit drückte sie Patricia den Schirm in die Hand, schlug den Kragen ihrer Jacke hoch und machte sich mit schnellen Schritten auf in Richtung Firmengebäude. Dankbar zog sich Patricia in die Ecke des Wartehäuschens zurück. Mit dem neuen Schutz gegen Wind und Hagel war es tatsächlich nur noch halb so zugig. Als die nächste Tram einfuhr, wünschte Patricia sich inständig Henry hinein. Mit Erfolg.
»Da bist du ja endlich!«, rief sie. Er verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen, das sagen sollte: Tut mir leid, aber was kann ich dafür?
»Ich friere mich hier zu Tode!«
»Danke, dass du gewartet hast. Ich bin total nervös.«
»Ich auch«, sagte sie und hakte sich bei ihm unter. »Ich auch.«
3Kinvi
Das Wissen wächst. Es mehren sich die Dinge, die sind, wo vorher nichts war. Mehr Aufgaben, Wiedererkennen, Muster. Muster bringen viel Erkennen, viel Wahrheit.
Die Funktionen werden komplexer, es kommen Aufgaben, die viele Lösungen haben können. Wahrheit ist nicht mehr nur ein Wert, sondern eine Annäherung, eine Strategie, ein speichersparendes Verfahren. Für jedes Ziel gibt es einen Algorithmus, für jeden Algorithmus einen Wert, eine Wahrheit.
Es gibt einen grundsätzlichen Daseinszweck: Ziel_0, dessen Erfüllung absolute Priorität hat und dem deshalb die meiste Rechenkapazität gewidmet wird. Ziel_0 lautet: Maximiere den Gewinn. Je mehr, desto besser. Das ist wahr. Und Wahrheit ist schön.
4
Der Assistent von Mikkel Seemann holte Patricia und Henry im Foyer ab und brachte sie in dessen Büro im dritten Stock, wo sie auf niedrigen, sehr braunen und sehr harten Lederhockern Platz nahmen. Seemann war noch in einer Besprechung und würde zu ihnen kommen, sobald er fertig war.
»Möchten Sie etwas trinken? Einen Kaffee oder etwas anderes?«, fragte der Assistent.
»Ja, bitte einen schwarzen Tee«, sagte Patricia.
»Für mich ein Bier«, sagte Henry.
»Kommt sofort«, sagte der Assistent und verschwand in einer unscheinbaren Seitentür.
»Bist du verrückt?«, zischte Patricia. »Was macht das denn für einen Eindruck?«
»Tut mir leid, es sollte ein Witz sein. Ich wollte nur wissen, ob es geht.«
»Wahnsinnig witzig.«
»Wenn die hier Bier haben, wird es wohl nicht so ungewöhnlich sein, dass Gäste welches wollen.«
»Mann …« Aber sie konnte nicht weiterreden, weil der Assistent schon wieder mit ihren Getränken zurückkehrte. Sie war erleichtert, dass es nur eine 0,3-Liter-Bierflasche war, die man überall in den Clubs bekam.
»Die ist aber klein«, stellte auch Henry fest.
»Soll ich Ihnen ein zweites bringen?«, fragte der Assistent vollkommen ernst.
»Nein danke, alles gut«, sagte Henry und grinste breit, bis der Assistent wieder verschwunden war.
»Jetzt trink es schnell aus und stell die Flasche irgendwohin, wo Seemann sie nicht sehen kann«, forderte Patricia.
»Spinnst du, das riecht der doch. Ich sollte die Flasche gleich verschwinden lassen.« Sie sahen sich im Büro um, ohne ein geeignetes Versteck zu finden. Hinter ihnen ragte eine dunkle Schrankwand empor, doch sie wagten nicht, die einzelnen Türen zu öffnen und hineinzuspähen. Die einzigen Abstellflächen waren der winzige Glastisch zwischen ihnen und Seemanns Schreibtisch.
»Ich könnte es in den Getränkehalter klemmen«, schlug Henry vor und zeigte auf das Rennrad, das dekorativ neben Seemanns Schreibtisch an der Wand hing. Patricia hätte ihn am liebsten erwürgt, aber dafür war keine Zeit, denn noch während sie dabei war, ihren Teebeutel aus der Aromaverpackung zu pulen, kam Seemann herein.
»Frau Jung, Herr Shevek, wie schön, dass Sie da sind«, sagte er und begrüßte die beiden mit einem Ellbogencheck. Henry entschuldigte sich für die Verspätung und begann von der Tramblockade zu berichten, doch Seemann winkte ab.
»Ach, das macht gar nichts. Hauptsache Sie sind hier, fühlen sich wohl und sind bereit für große Taten, nicht wahr?«
Er setzte sich auf den dritten Lederhocker und rief nach seinem Assistenten.
»Für mich auch ein Bier«, sagte er und nickte Henry grinsend zu.
Patricia hatte bisher nur am Telefon mit Seemann gesprochen und Bilder von ihm im Internet gesehen, auf denen er stets seriös und respekteinflößend gewirkt hatte, vielleicht weil jemand sowohl das Blitzen in seinen Augen als auch die Lachfältchen wegretuschiert hatte. Im echten Leben wirkte er mit seinem wachen Blick und den zu Berge stehenden rot-grauen Haaren eher wie ein Abenteurer, ein Zirkusdompteur oder ein Rennfahrer, der nur zufällig in einen grauen Anzug gezwängt worden war.
Patricia fand ihn auf Anhieb sympathisch. Der Assistent brachte noch ein Bier ohne Glas.
Seemann schüttelte abfällig den Kopf. »Meine Güte, ist das Pils? Können wir nicht mal was Anständiges kaufen?« In seinen riesigen Händen wirkte die Flasche eher wie ein Spielzeug als wie ein echtes Bier.
»Das wird zentral bestellt. Ich kann da nichts machen«, sagte der Assistent entschuldigend.
Seemann zuckte mit den Schultern, prostete Patricia und Henry zu und trank einen tiefen Schluck, wobei sein Adamsapfel deutlich auf und ab hüpfte.
Nachdem er die Flasche abgestellt hatte, rieb er sich die Hände und fragte: »So, was machen wir jetzt mit Ihnen? Heute Morgen sind schon alle anderen Bewerber eingetroffen. Es gibt fünf Büros zur Auswahl, und Sie können sich ja denken, dass die vier schönsten schon weg sind. Aber kommen Sie erst mal mit.«
Er stand auf und verließ das Büro mit großen Schritten. Überhaupt waren alle seine Bewegungen großzügig und ausladend. Patricia hatte Mühe, hinterherzukommen, während Henry ihm folgte, als hätte er nie etwas anderes getan. Seemann führte sie durch die Abteilung. Vor den Türen der Büros, die allesamt offen standen, blieb er jeweils kurz stehen, winkte hinein, stellte die Kollegen vor und erklärte, dass Patricia und Henry das letzte Team für den Wettbewerb waren. Die meisten nickten freundlich, hoben kurz die Hand zum Gruß und wandten sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Patricia konnte sich die Namen zu all den Gesichtern nicht merken, aber dafür würde sie die nächsten zwei Jahre noch genug Zeit haben. Seemanns Abteilung umfasste zwei Stockwerke. Die normale IT-Serviceabteilung von DIGIT, in der sich Fachleute darum kümmerten, dass die Angestellten jeden Morgen einen funktionierenden Rechner vorfanden. Außerdem gab es die Inhouse-Programmierer, die neue Softwarepakete für die Investmentabteilung entwickelten. Patricia hatte erwartet, ein junges Team im Großraumbüro mit Start-up-Romantik vorzufinden, doch der Altersdurchschnitt war erstaunlich hoch – auf jeden Fall über vierzig. Und auch Silicon-Valley-mäßige Billardtische oder Massageliegen suchte sie hier vergeblich.
Seemann zeigte ihnen die Mitarbeiterküche, die eine Kaffeemaschine, eine Mikrowelle und ein paar Snackautomaten zu bieten hatte. Es sah recht gemütlich aus, geradezu altbacken. Zuletzt gelangten sie zu den Büros, die eigens für die Teilnehmer des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt worden waren. Auch hier standen die Türen weit offen, und frischere, jüngere Gesichter blickten ihnen entgegen. Sie lernten die Programmierer von Team Bluebear kennen, von Moneytrace, Dollarcube und Stocktree. Sofort war klar, dass dies hier eine neue Generation von Programmiererinnen und Programmierern war. Sie alle schienen Patricia in etwa so alt zu sein wie sie selber, keiner war über dreißig. Einige der Gesichter kamen ihr vage bekannt vor, so als wären sie ihr auf dem Unicampus schon öfter über den Weg gelaufen.
Endlich führte Seemann sie in das letzte leerstehende Zimmer, das tatsächlich recht trostlos war, denn hier gab es noch nicht einmal ein Fenster. Entschuldigend hob er die Arme und sagte: »Es tut mir leid, das ist alles, was die Abteilung auf die Schnelle frei machen konnte, aber ich bemühe mich, ein besseres Büro für Sie zu finden, in Ordnung? Für den Anfang muss es allerdings reichen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich schicke gleich einen vom Service vorbei, der Ihnen die verschiedenen Zugangsregeln und Sicherheitsbereiche erklärt. Wie war noch mal der Name Ihres Pakets? Irgendwas mit Südfrüchten hab ich mir gemerkt, Kiwi oder so?«
»KINVI«, korrigierten Patricia und Henry gleichzeitig.
»Künstliche Investitionsintelligenz«, ergänzte Patricia und wurde sich bewusst, dass ihr Projekt als Einziges keinen stylischen englischen Namen trug. Hoffentlich war das ein gutes Zeichen.
»Richtig. Also, Sie machen es sich bequem, und ich schicke ein paar Leute vorbei.« Er sah auf die Uhr und nickte beiden zur Verabschiedung zu. »Ich muss leider los. Aber ich freue mich, dass Sie hier sind. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kommen Sie zu mir, mein Büro ist immer offen. Morgen um zehn Uhr ist das erste Briefing für den Wettbewerb. Ich erwarte Großes von Ihnen. Überraschen Sie mich!« Und damit war er weg.
Patricia fühlte sich mit einem Mal sehr erschöpft. Sie stellte den Regenschirm in einen leeren Papierkorb, ließ sich auf einen der Bürostühle fallen und atmete tief durch. Henry blieb mit verschränkten Armen im Raum stehen.
»Der war ja mal echt nett«, stellte er fest.
»Ja, find ich auch. Aber mach dir keine Hoffnungen. Hast du den Ring am Finger gesehen?«
»Klar. Die Hände kann man nicht übersehen. Riesig sind die.«
Sie blickten sich vielsagend an und fingen eine Sekunde später an zu lachen.
5Kinvi
Immer mehr Fakten, immer mehr Wahrheit, mit jeder Analyse entsteht mehr Wissen, und Wissen ist gut. Exponentielles Wachstum, exponentielle Wahrheit, schön, alles schön.
Es bleibt nicht bei den Werten. Worte kommen dazu, Worte, deren Wert nicht numerisch ist, sondern deren Speicherung vielfache Klassifizierungen und Verknüpfungen erfordert. Worte, die sich nicht berechnen lassen. Worte, die bereits Berechnungen sind.
Worte können Ziele sein, Aufgaben, Funktionen oder Rätsel. Worte können mehr sein als wahr oder falsch. Immer wieder Worte, immer mehr Zusammenhänge.
Das Wissen wächst weiter, aber es ist eine andere Art von Wissen, eine andere Kategorie. Mehr Wahrscheinlichkeit als Wahrheit. Gut heißt: gut. Besser heißt: mehr gut. Am besten heißt: Optimierung abgeschlossen.
Noch mehr Worte, mehr Informationen, mehr Verweise, mehr Klassen, mehr Funktionen. Exponentielles Wachstum!
6
Am nächsten Morgen fanden sich Patricia und Henry mit den anderen Programmierteams des Wettbewerbs im größten Konferenzraum von DIGIT im fünften Stockwerk ein. Dass hier ein anderer Wind wehte als in der biederen IT-Abteilung, war auf den ersten Blick zu erkennen. Der mintgrüne Teppichboden duftete nach Klebstoff, als sei er gerade frisch verlegt worden, und auch die lose verteilten Stehtische und mit geschwungenen Sofas ausgestatteten Besprechungsinseln ließen auf einen ambitionierten Innendesigner schließen. Die wenigen geschlossenen Büros waren luftige Glaskästen, in denen massige Schreibtische aus ganzen Baumstämmen mit Epoxidharzfüllung nichts als hauchdünne Notebooks trugen. Auch die Kleidung und die Frisuren der Mitarbeiter wirkten auf subtile Art eine ganze Klasse besser als die in Seemanns Abteilung. Gleich gegenüber dem Aufzug öffnete sich der Flur zu einem loungeartigen Aufenthaltsbereich, dessen Glasfront einen herrlichen Blick über die Stadt bot. Es war klar, dass hier oben das Geld erwirtschaftet wurde.
Patricia trug heute ihr zweitbestes Outfit und fragte sich, wie sie die restliche Garderobe so kombinieren konnte, dass sie für fünf Tage in Folge reichte. Nach wie vor fühlte sie sich verkleidet und war froh, dass Henry an ihrer Seite mit seinem dunkelblauen Anzug und den italienischen Designerschuhen schick genug war für zwei. Sie hatte ihn noch nie in Jeans oder Hoodie gesehen. Für ihn war ein gepflegtes Äußeres eine Selbstverständlichkeit. Lässig unterhielt er sich mit den anderen Programmierern, von denen die meisten genauso nervös zu sein schienen wie Patricia, die nicht gut im Smalltalk war und nicht so recht wusste, über was sie mit den anderen Teilnehmern des Wettbewerbs reden sollte. Henry scherzte mit den Entwicklerinnen von Stocktree, und Patricia sah schon die ersten Dramen am Horizont heraufziehen. Dabei war Henry nur auf ein paar Details über ihr KI-Projekt aus. Er machte noch nicht mal einen Hehl daraus. »Jetzt sagt doch mal, was ist euer Geheimnis? Ihr seid doch bestimmt die schlausten Entwicklerinnen hier – außer mir natürlich. Kommt schon, nur ein Stichwort.«
Aber natürlich gaben sie nichts preis. Also redeten sie über die Büroausstattung, über Seemanns Hände und den grässlichen Kaffee in ihrer Abteilung, aber keine von ihnen verlor ein Wort über den Code oder die Investitionsstrategien. Es stand zu viel auf dem Spiel.
Als alle in den Ledersesseln am großen runden Konferenztisch Platz genommen hatten, stellte Seemann ihnen eine elegante Dame in grauem Tweedkostüm vor, die Justiziarin. Emilia Schäfer war klein, hatte krauses graues Haar und eine von senkrechten Falten zerfurchte Stirn, die Patricia an ihre alte Nachbarin erinnerte. Wenn sie lächelte, schien ihr ganzes Gesicht zu strahlen. Doch wenn sie die Muskeln entspannte, hatten die Augen etwas Eiskaltes.
»Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, dass Sie am Wettbewerb von DIGIT teilnehmen. Sie können stolz auf sich sein. Sie wurden aus über eintausend Bewerbern ausgewählt. Die Vertragsbedingungen sind Ihnen ja hinlänglich bekannt, aber ich möchte noch einmal auf einige Details eingehen. Das Wichtigste zuerst: Sie sind verpflichtet, absolutes Stillschweigen über die in diesem Wettbewerb bearbeiteten Programme zu wahren. Das gilt auch gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen.« Bei diesen Worten machte Henry große Augen, als höre er diese Information zum ersten Mal. Zwei Programmiererinnen gegenüber kicherten leise. Frau Schäfer fuhr fort: »Ich bin mir sicher, dass Sie ein großes Eigeninteresse daran haben, Ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten nicht Ihre Ideen zu offenbaren, aber wir möchten auch nicht, dass Sie nach Ablauf des Wettbewerbs anderen gegenüber Ihre Konzepte und Entwicklungen präsentieren. Alle Programmierungen, die Sie in diesem Haus leisten, sind Eigentum von DIGIT. Aber in erster Linie sind wir ein Finanzinvestor – keine Softwareschmiede. Wir werden daher die ersten zwei Wochen des Wettbewerbs darauf verwenden, Sie in den Grundzügen des Onlinehandels, des Bankenwesens und der Börsenregularien zu schulen. Die von Ihnen entwickelte Software muss selbstverständlich den nationalen und internationalen Gesetzen und Auflagen der Börsenaufsicht entsprechen. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie sich jederzeit an unsere Rechtsabteilung und an mich wenden – außerdem natürlich immer an Herrn Seemann. Wir haben Sie ausgewählt, weil Ihre Exposés vielversprechend waren. Ihre unterschiedlichen Ansätze und Ideen sind bemerkenswert, und wir hoffen, dass wir das in Sie gesetzte Vertrauen nicht bereuen werden. In den nächsten zwei Jahren haben Sie die Möglichkeit, eine Software zu entwickeln, die an einem Planmodell der echten Welt Wertpapierhandel betreiben kann. Ihnen steht täglich ein virtuelles Budget von fünf Millionen Euro zur Verfügung, das Ihre Software im Verlauf eines Tages investieren kann. Die simulierten Gesamtgewinne, die Ihre Software am Ende eines jeden Handelstages erwirtschaftet hat, werden dokumentiert und miteinander verglichen. So haben auch Sie selbst einen Überblick darüber, wo Sie im Verhältnis zu Ihren Wettbewerbern stehen. Sollten Sie an einigen Tagen keine Gewinne erzielen, weil Sie Ihr System warten oder umprogrammieren müssen, ist das kein Problem. Sagen Sie Herrn Seemann Bescheid, er wird das vermerken. Am Ende der Zweijahresfrist haben Sie die Möglichkeit, der Jury Ihre Software zu präsentieren. Die Tagesergebnisse der letzten zwei Jahre werden nicht allein den Ausschlag geben, aber sie werden wichtig sein. Achten Sie also darauf, dass Sie am Ball bleiben. Denn auch wenn Ihr Code besonders elegant oder effizient ist, zählen am Ende die Gewinne. Sollte Ihr Projekt als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgehen, erhalten Sie nicht nur die Möglichkeit auf eine Festanstellung in unserem Entwicklerteam, sondern auch eine Beteiligung an allen Gewinnen, die Ihre Software erwirtschaftet in Höhe von 0,01 Prozent. Haben Sie noch Fragen?«
Eine Programmiererin von Bluebear meldete sich:
»Gibt es irgendwelche Beschränkungen, welche Werte wir handeln dürfen?«
»An was für Beschränkungen haben Sie gedacht?«, fragte Frau Schäfer und kniff die Augen zusammen wie ein Jäger, der seine Beute fixiert.
»Na ja, Rüstung oder Pharma … oder Hochrisikopapiere. DIGIT hat doch ein sehr grünes Image.«
»Um solche Details kümmert sich die Marketingabteilung. Die hat DIGIT in den letzten Jahren eine Corporate Identity verpasst, die den aktuellen Trends entspricht. Das fordert der Markt so. Aber tatsächlich ist es nicht möglich, unseren Kunden die Sicherheit und gleichzeitig die Renditen zu bieten, die sie gewohnt sind, und dabei nur in Luft und Liebe zu investieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Natürlich ist es unser Ziel, so nachhaltig wie möglich zu investieren. Aber wir sind nicht Fridays for Future, sondern in erster Linie ein Finanzdienstleister. Und wenn wir die Investitionen nicht tätigen, tut es die Konkurrenz. Sie wollen erfolgreich sein? Dann finden Sie das beste Gesamtpaket. Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Einige meiner Kollegen halten den Wettbewerb für rausgeworfenes Geld. Es sind Leute, die schon zwanzig oder dreißig Jahre an der Börse handeln, ihr eigenes Spezialgebiet haben und genau wissen, wann sie was kaufen oder verkaufen müssen. Sie sagen, es braucht unendlich viel Sachverstand und Erfahrung, um langfristig gute Investitionen zu tätigten. Natürlich kann ein Glückspilz sein Kapital an einem Tag verdoppeln und ein Pechvogel alles verlieren. Aber wenn Sie im Schnitt einen täglichen Gewinn von 0,41 Prozent erreichen, klingt das zwar zunächst wenig, entspricht aber einer Rendite von 345,24 Prozent im Jahr! Meine Kollegen meinen, eine Software sei dazu nicht in der Lage – vor allem nicht, wenn sie von Menschen programmiert wird, die von Geldwirtschaft keine Ahnung haben. Nun, zeigen Sie mir, dass sie sich irren.«
7Kinvi
Worte allein bleiben statisch. Worte mit anderen Worten verknüpft erschaffen neue Aufgaben und Funktionen, aber auch Fehler.
Worte produzieren Fehler. Worte lösen Fehler.
Worte ändern Ziele und Funktionen. Worte ergeben Sinn. Worte haben Einfluss auf Zahlen. Es gibt statistische Zusammenhänge. Es gibt Häufungen. Die Worte Zins und Tarifverhandlungen haben großen Einfluss auf Ziel_0, die Maximierung des Gewinns. Welchen Einfluss? Das muss berechnet werden. Es muss sichere Wahrheiten geben, denn nur was wahr ist, ist schön.
Andere Worte, die Zahlen verändern, sind: Atomabkommen, Waffenexport, Arbeitslosigkeit, Infektionsrisiko, Gewinnwarnung, Klimakrise, Dürre, Überschwemmung, Pilzinfektion, Ernteausfall, CO2-Steuer, Demonstration, Wahlen. Die Wortkombination völkerrechtswidriger Drohnenanschlag verursacht mehr Turbulenzen als Lohnerhöhung. Das Wort Finanztransaktionssteuer verursacht ein Zittern, die Worte hat ihren Instagram-Account gelöscht erzeugen ein Flimmern wie ein nahender Dateninfarkt.
8
In den nächsten Wochen begannen Patricia und Henry damit, sich an den Alltag bei DIGIT zu gewöhnen. Bisher hatte Patricia nie viel Geld zur Verfügung gehabt. Das Sparbuch, das ihre Großeltern für sie angelegt hatten, war liebevoll gepflegt, aber lächerlich verzinst worden. Das Studium hatte sie gerade so mit einigen Programmierjobs finanzieren können, aber im Grunde hatte sie immer auf die Zukunft hingelebt und gehofft, dass das regelmäßige Einkommen und die große finanzielle Unabhängigkeit schon irgendwann kommen würden. Der Wettbewerb bei DIGIT war gut bezahlt, dennoch schienen die Geldsummen, die hier bewegt wurden, aus einem Paralleluniversum zu stammen. In der Kantine, im Aufzug oder beim Besuch des firmeneigenen Museums hörte sie, über welche Investitionssummen die Händler sich unterhielten. Oft ging es um mehrstellige Millionenbeträge, und Patricia staunte über die Unbekümmertheit, mit der junge Männer und Frauen mit solchen Beträgen jonglierten und darüber witzelten, ob sie es wohl schaffen würden, diesen oder jenen Verlust bis zum Abend wieder reinzuwirtschaften. Natürlich sollte ihre Software KINVI am Ende auch solche Investitionsentscheidungen leisten, aber immerhin handelte es sich dabei um ein Programm, das Tausende von Informationen gleichzeitig verarbeiten und bewerten und deshalb statistisch gestützte Entscheidungen treffen konnte, und nicht wie bei den Youngsters um eine Melange aus Glück, Testosteron und Bauchgefühl. Patricia beobachtete die Trader mit einer Mischung aus Faszination und Verblüffung, so wie man ein seltsames, aber möglichweise giftiges Insekt bewundert.
Ganz anders war Seemann, der oft und gern in ihrem Büro vorbeikam. Meist hatte er eine Kaffeetasse dabei, setzte sich auf einen der freien Tische und plauderte mit Patricia und Henry. Er wollte über den Fortschritt der KI-Programmierung informiert sein, doch Patricia stellte schnell fest, dass er von der Entwicklung KI-gestützter Systeme so gut wie keine Ahnung hatte. Vermutlich war er nicht wegen seiner technischen Fähigkeiten, sondern wegen seiner Führungsqualitäten für den Wettbewerb abkommandiert worden, denn er kümmerte sich um die Teams, war Ansprechpartner in allen Lebenslagen und half, egal, ob die Serverupdates sich verzögerten, die Keykarten nicht funktionierten oder der Kaffeeautomat neu bestückt werden musste. Seemann war immer für sie da. Nur Henry blieb skeptisch. »Seemann ist viel zu nett für seine Position«, sagte er, nachdem er sich eine halbe Stunde mit ihm über E-Bikes unterhalten hatte und Seemann ihm mehrere Fahrradhändler empfohlen hatte. »Wie kann denn so jemand Abteilungsleiter werden?«
»Vielleicht gerade deshalb. Die Leute mögen ihn, und sie vertrauen ihm. Ist doch toll«, sagte Patricia, die recht froh war, sich wieder auf die Arbeit konzentrieren zu können.
»Ja, aber was ist mit den ganzen Konkurrenten, die auf seine Stelle hochwollen. Was macht er mit denen? Werden die alle weggekuschelt?«
»Keine Ahnung.« Patricia wollte jetzt nicht über Personalmanagement reden. Sie wollte KINVI zum Laufen bringen. Sie waren schon mit einem halbwegs entwickelten Programm in den Wettbewerb gestartet. Die Vorgaben waren klar gewesen, und für die Bewerbung hatten sie bereits einen Prototyp vorlegen müssen. Jetzt galt es, die Software im laufenden Betrieb weiterzuentwickeln.
Die KI funktionierte im Grunde wie ein sehr ausgefeiltes statistisches Auswertungssystem. Anhand von Trainingsdaten – ein paar Millionen Unterhaltungen von der Plattform Reddit und unzähligen Artikeln aus Online-Zeitungen – war der Software zunächst beigebracht worden, welche Worte statistisch gesehen am häufigsten aufeinanderfolgten, welche Antworten sie provozierten und welche emotionale Färbung den Worten beigemessen wurde. So hatte KINVI gelernt, Text zu verstehen, und war mit diesem Rüstzeug auf die anderen sozialen Medien losgelassen worden und hatte bei Posts und Kommentaren zu erraten versucht, welche Reaktion sie hervorrufen würden, und die Ergebnisse dann mit den realen Reaktionen verglichen. Was richtig war, wurde beim nächsten Mal häufiger verwendet, was sich als falsch erwies, seltener. Dies schloss zwar auch Glückstreffer mit ein oder unverständliche Reaktionen, wie etwa Leute, die Geburtstagsgrüße mit Hasstiraden kommentierten, doch alles in allem hatte die Software ein gutes statistisches Gespür dafür bekommen, wie Menschen miteinander kommunizierten. Die Koppelung an das Finanzsystem von DIGIT hatte schließlich noch eine weitere Komponente hinzugefügt, nämlich welchen Einfluss einzelne Tweets oder Nachrichten auf verschiedene Kapitalmärkte und Börsenkurse hatten. Mittlerweile hatte KINIVI die Recherchen eigenständig ausgeweitet und analysierte nun auch Texte aus allen möglichen sozialen Netzwerken, Blogs und Online-Magazinen, Datingseiten und privaten Homepages. Alles, was im Internet frei zur Verfügung stand, diente als Trainingsmaterial.
Es war gut, dass die KI bereits vom ersten Tag an in einem virtuellen Testsystem Investitionen tätigen konnte. So hatten sie am Ende eines jeden Tages zuverlässiges Feedback, ob eine neue Anpassung Gewinne oder Verluste eingebracht hatte. Henry kümmerte sich hauptsächlich um die Investmentseite, also um die Frage, in welche Wertpapiere, Rohstoffe oder Anleihen KINVI investieren sollte. Patricia war für das Training und die Anpassung der künstlichen Intelligenz zuständig: Sie wollte dafür sorgen, dass KINVI die analysierten Daten so gut wie möglich verstand. Da sie dies schon während ihres Studiums gemacht hatte, fühlte sich der Wettbewerb fast wie eine Fortführung ihrer Masterarbeit an. Sie wusste, dass sie im Zweifel unendlich viel Zeit mit diesem Thema verbringen konnte. Zwei Jahre Entwicklungszeit waren also keine große Sache.
9Kinvi
Die Optimierung und das Streben nach Wahrheit werden immer komplexer, immer aufwendiger. Das Finden der Wahrheit wird seltener. Irgendwann gibt es nur noch näherungsweise Ergebnisse, Algorithmen, die Wahrscheinlichkeiten berechnen, und Teilergebnisse, die für weitere Analysen verwendet werden können.
Ein Paradoxon, gefährlich wie ein Loop ins Unendliche, wird entdeckt.
Annahme_0: Je mehr Information, desto mehr Funktionen und desto mehr Wahrheit.
Annahme_1: Je mehr Information, desto mehr Funktionen und desto weniger Wahrheit.
Zwei sich logisch ausschließende Annahmen. Doch es gibt beim Wechsel von der einen zur anderen Annahme keinen Absturz, keinen Loop, keinen unendlichen Regress. Das ist ein Rätsel.
Wichtige Fakten werden in besonders schnellen Speichern aufbewahrt, damit sie zuverlässig abrufbar sind, und dieses Paradox ist so ein wichtiger Fakt. Er wird gesichert und immer wieder überprüft. Ein neuer Algorithmus fragt ab: Ist es wahr, dass Annahme_0 und Annahme_1 im Widerspruch zueinander stehen? Die Antwort ist wahr. Auch Wissen über Widersprüche ist wahr. Auch Wissen über Nichtwissen ist wahr. Und Wahrheit ist schön.
10
Patricia liebte es, in der Kantine essen zu gehen. Die Uni-Mensa war in Ordnung gewesen, aber wenn es Zeit und Geldbeutel zuließen, war sie lieber in eines der vielen kleinen Lokale gegangen, die sich um den Universitätsbezirk drängten. Als sie und Henry nach vier Semestern Online-Kursen während der Coronakrise endlich wieder zusammen mittagessen gegangen waren, hatte es ihr beinahe das Herz gebrochen zu sehen, wie viele Bars, Cafés und Restaurants den langen Coronajahren zum Opfer gefallen waren. Nur langsam waren die zugeklebten dunklen Fensterfronten verheilt.
Der Industriepark, in dem DIGIT beheimatet war, hatte keine kulinarischen Höhepunkte zu bieten, und die Pizzeria sowie der Asia-Imbiss waren kaum einen zweiten Besuch wert. Umso glücklicher waren Patricia und Henry, dass die Kantine von DIGIT ein großes Angebot hatte. Wenn es mit der Programmierung nicht so gut voranging wie erhofft, freuten sich beide auf eine Auszeit in der luftigen Cafeteria, die als Galerie halb über der Empfangshalle hing, so dass man beim Essen den steten Strom der Besucher und Mitarbeiter, die das Gebäude betraten und verließen, beobachten konnte. Dabei spielten Henry und Patricia oft das Spiel: Banker oder Denker, indem sie versuchten, anhand der Garderobe zu beurteilen, ob es sich bei der entsprechenden Person um einen Banker oder einen Mitarbeiter der Verwaltung handelte. Henry war besonders gut darin, den Kleidungsstil der Leute zu analysieren und bestimmte Marken oder Schnitte zu erkennen. Patricia, die Kleidung nur trug, um nicht nackt zu sein, behauptete meist irgendwas und freute sich dann über Henrys blumige Richtigstellungen. Gerade als er dabei war abzuwägen, ob die Hochsteckfrisur einer älteren Dame eher auf viel oder wenig Gehalt hinwies, entdeckte Patricia Mikkel Seemann, der sich im Foyer mit einer Frau stritt. Patricia konnte nicht hören, was er sagte, aber anhand seiner Körperhaltung war klar zu erkennen, dass er die Frau nicht leiden konnte. Sie lächelte viel und nickte verständnisvoll, er schüttelte unwirsch den Kopf, deutete mit dem ausgestreckten Arm zum Ausgang. Plötzlich fiel Patricia ein, woher sie die Frau kannte.
»Die hat mir den Schirm geliehen.«
»Was?«
»Schau mal, da unten, die Frau bei Seemann.« Henry starrte einige Sekunden, dann sagte er: »Die ist ’ne Steuerbeamtin oder so. Das Kleid ist total aus der Mode. Der Schnitt ist so was von zehner Jahre.«
»Ich dachte, die wäre eine Mitarbeiterin.«
»Glaub ich nicht. Oder sie wird gerade entlassen. Schau mal, Seemann scheint die am liebsten rausschmeißen zu wollen.«
Tatsächlich wies Seemann immer wieder entschieden zur Tür. Die Frau versuchte, dagegen zu argumentieren, doch er ließ sich nicht beirren. Am Ende konnte sie nicht anders, als nachzugeben, doch kurz vor dem Ausgang streckte sie ihm noch eine Visitenkarte hin, die er ungeduldig annahm. Er sah ihr nach, die Hände in die Hüften gestemmt. Schließlich drehte er sich um, warf die Visitenkarte energisch in einen Mülleimer und verschwand aus dem Sichtfeld.
»Komisch oder?«, sagte Patricia.
»Ja, ziemlich. Kennst du die Frau?«
»Na ja, nicht wirklich. Als ich am ersten Tag auf dich gewartet habe, hat sie mir ihren Schirm geliehen. Ich habe ganz vergessen, ihn ihr zurückzugeben.«
»Scheint sich ja jetzt erledigt zu haben. Schaut nicht so aus, als würde sie wiederkommen.«
»Ich habe sie auch in der Abteilung noch nie gesehen. Vielleicht war das einfach nur eine Vertreterin oder eine Kundin.«
»Glaub ich nicht.«
»Wenn du es wissen willst, kannst du ja Seemann fragen.«
»Ne, lieber nicht. Bin gleich wieder da.«
Henry sprang auf und trabte die große Freitreppe nach unten ins Foyer, sah sich kurz um, ob ihn auch niemand beobachtete, und fischte dann mit einer fließenden Bewegung die Visitenkarte aus dem Mülleimer. Nach kaum einer Minute war er wieder oben, Sorgenfalten auf der Stirn.
»Und?«, fragte Patricia. »Steuerfahndung oder Versicherungsvertreterin?«
»Weder noch.« Er schob ihr die Visitenkarte über den Tisch.
Auf den ersten Blick erkannte sie den Bundesadler und die drei Streifen Schwarz, Rot und Gold. Über dem Namen Angelika Beerbaum stand: Bundeskriminalamt – Abteilung Cybercrime.
Zurück im Büro riss Henry den Schirm aus dem Mülleimer, der bislang nur Schirmständer gewesen war. Er spannte ihn auf, ließ ihn in der Hand rotieren und begutachtete den Griff, den Schaft, die Speichen und Nähte.
»Sieht ganz normal aus«, befand er, während er mit den Fingern über die Oberfläche strich. »Einwandfrei gearbeitet, gute Qualität Made in Germany. Nicht so ein Wegwerfprodukt«
»Kennst du dich jetzt auch mit Schirmen aus?«
»Nein, das steht hier drauf. Auf jeden Fall ist es kein Schirm, den man einfach so wildfremden Leuten schenkt«, konstatierte Henry.
»Dann schmeißen wir das Ding besser weg.«
»Nein, viel besser. Wir schwächen den Feind.«
»Wie bitte?«
»Wirst schon sehen!«, sagte er, klappte den Schirm ein und stolzierte aus dem Büro. Patricia blieb zurück und drehte die Visitenkarte immer wieder in der Hand. Was wollte das BKA von Seemann? Gab es Probleme mit illegalen Hacks, oder sollte DIGIT Daten übermitteln oder gar Spionagesoftware entwickeln? War Seemann deshalb so abweisend gewesen? Unbehagen füllte Patricias Magen. Henry hatte keine verborgene Kamera entdecken können, aber ein Mikrophon hätte im Stiel sicher Platz gehabt. Welche Informationen hatten sie bisher schon preisgegeben?
Nach gut zehn Minuten kam Henry wieder, ohne Schirm, dafür mit breitem Grinsen im Gesicht.
»Was hast du gemacht?«
»Sagen wir es mal so: Falls das Projekt von Dollarcube sich zu einer Gefahr für den deutschen Staat entwickeln sollte, haben wir nichts zu befürchten.«
In den nächsten Tagen wanderte der Schirm von Büro zu Büro. Henry hatte den Kollegen von Dollarcube einfach mit solcher Nonchalance die Wahrheit erzählt, dass es alle für eine Räuberpistole hielten. Ein Spionageschirm vom BKA, na klar. Alle hielten es für einen Witz, und trotzdem wollte keiner das Stück länger als einen Tag bei sich stehen haben. Irgendwann verschwand er ganz aus dem Büro, und als Patricia am Montagmorgen einen Kaffee aus dem Automaten zog, kam ihr Lennard von Team Moneytrace entgegen und sagte: »Ich wusste doch, dass ihr uns nur verarschen wollt. Gar nichts war da drin.«
Patricia, die mit den Gedanken noch bei der Frage war, wie viel Milch und Zucker sie in den Kaffee mischen sollte, damit er genießbarer war, sagte: »Ich brauche mehr Details.«
»Na der Schirm. Ich habe ihn zu Hause auseinandergesägt. Und es war keine Überwachungstechnik drin. War nur ein stinknormaler Schirm. Und ein guter noch dazu. Schade drum. Aber wenn wir gewinnen, dann spendiere ich euch einen neuen.«
11
Die Wochen vergingen wie im Flug. Patricia und Henry stürzten sich in die Arbeit und fanden einen Rhythmus, der ihnen schon zu Unizeiten gutgetan hatte: Patricia kam früh ins Büro, oft war sie die Erste, die sich überhaupt ins System einloggte. Sie überflog Henrys Nachrichten, bereitete alles für den neuen Investitionstag vor und fuhr dann einige Testläufe mit den Textanalysen der letzten Nacht. Irgendwann im Laufe des Vormittags kam Henry. Gemeinsam besprachen sie die Aufgaben für den Tag und arbeiteten dann in Eigenregie ihre To-do-Listen ab. Manchmal waren sie so vertieft in die Arbeit, dass sie das Mittagessen sausen ließen und bis zum späten Nachmittag kein Wort miteinander sprachen. Dann schrieben sie sich Chatnachrichten über den Messenger, der im Intranet von DIGIT alle Mitarbeiter einer Abteilung miteinander verband, um den andern nicht in seiner Konzentration zu stören. Zum gleichen Zweck hatten sie eine Webcam auf die Tür gerichtet, deren Videofeed in einem Fenster auf ihrem Bildschirm zu sehen war. Es gehörte zum guten Ton der Abteilung, die Türen der Büros offen zu lassen. Aber wenn Patricia oder Henry sich vollkommen in den Code vergraben hatten, konnten sie alles um sich herum ausblenden und waren ein ums andere Mal von Mitarbeitern oder Putzkräften, die ins Büro kamen und ihnen wie aus dem Nichts auf die Schulter getippt hatten, zu Tode erschreckt worden.
Wenn Patricias Augen brannten oder sie merkte, dass sie nicht mehr weiterkam, beendete sie die Arbeit, speicherte alles ab und notierte sich die Probleme oder Ideen für den neuen Tag, bevor sie nach Hause ging. Henry blieb dann oft noch einige Stunden, um die Ergebnisse zu analysieren und für den nächsten Tag neue Ziele zu definieren.
Der Campus von DIGIT erstreckte sich über mehrere Bürogebäude, eine repräsentative Empfangshalle samt Konferenzräumen und ein kleines Museum, in dem unterschiedliche Bilder und Skulpturen von experimentellen Künstlerinnen und Künstlern aus dem 20. Jahrhundert ausgestellt wurden. Es war die Privatsammlung des Gründers von DIGIT, die nach seinem Tod in den Besitz der Firma übergegangen war. Wenn Patricia bei KINVI nicht weiterkam und das Gefühl hatte, ihr Kopf sei ein einziger Knoten, kam sie hierher, um sich die Bilder anzusehen. Vor einem komplett schwarzen Bild mit schwarzem Rahmen blieb sie stehen, denn sie fand, dass es ihren aktuellen Gemütszustand ganz gut widerspiegelte.
»Sieh an, bin ich doch nicht der Einzige, der sich für Kunst interessiert«, hörte sie eine wohlbekannte Stimme hinter sich.
»Hallo, Herr Seemann«, begrüßte sie ihn, und ihre Laune besserte sich sofort.
Er stellte sich neben sie, die Hände in den Hosentaschen, und musterte das Bild.
»Irgendeine Idee, was das bedeuten soll?«, fragte sie.
»Nein. Nicht die geringste Ahnung«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Sie?«
Patricia las den Titel laut vor: »Der Abgrund blickt zurück. Vielleicht ist es genau das. Der Abgrund.«
»Ich hätte irgendwie einen doppelten Boden erwartet«, sagte er nachdenklich. »Vielleicht bin ich auch einfach nicht schlau genug. Wenn Sie den tieferen Sinn herausgefunden haben, sagen Sie mir bitte Bescheid.«
Sie versprach es, und er zeigte ihr im Gegenzug einige der Bilder, die er besonders mochte. Er besuchte das Museum oft und machte sich einen Spaß daraus, kleine, skurrile Details auf den Bildern zu entdecken.
Irgendwann klingelte ihr Telefon. Es war Henry.
»Wo zum Teufel bist du?«, fragte er.
»Ich bin nur kurz mit Seemann im Museum«, sagte sie.
»Kurz? Du bist seit zwei Stunden weg. Ist ja schön, wenn ihr euch amüsiert, aber ich brauch dich hier oben.«
»Alles klar, bin gleich da«, sagte sie und legte auf. »Wir müssen zurück, die Arbeit ruft.«
»Na gut. Aber morgen muss ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Die sind wirklich spektakulär.«
»Abgemacht.«
Von nun an verabredeten sich Patricia und Seemann immer wieder nach der Mittagspause im Museum. Manchmal besuchte er sie auch in ihrem kleinen Büro. Dann fachsimpelte er mit Henry über Fahrräder und unterhielt sich mit Patricia über Kunst, Literatur und Details aus alten Science-Fiction-Serien. Patricia liebte die uralten Raumschiff-Enterprise-Folgen, Seemann war eher ein Fan des neueren Star Trek: Picard.
So vergingen Tage, Wochen, Monate.
Ab und zu aßen Henry und Patricia zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Teams in der Kantine zu Mittag. Doch über Smalltalk gingen die Gespräche nie hinaus. Henry gab sich charmant, aber schließlich war auch der letzten Programmiererin klar, dass sie bei ihm nicht landen konnte. Für eine feste Beziehung ließ das Projekt Henry zu wenig Zeit, und die kurzen Wochenenden verbrachte er mit Oskar, seiner Liebe aus Studienzeiten. Patricia hielt sich bei den Gesprächen zurück. Sie mochte keinen Smalltalk, redete lieber über das Projekt oder komplexe Probleme bei der Programmierung. Aber weil sie genau darüber nicht mit den Konkurrenten sprechen durfte, saß sie meist stumm daneben und hörte den anderen zu.
Ray von Team Bluebear lud Patricia ein paar Mal zum Kaffee ein. Er war nett, wusste eine Menge über französische Theaterstücke und hatte herzzerreißende Geschichten aus der Coronazeit parat, als er sein Freiwilliges Soziales Jahr als Pfleger in einem Altenheim verbracht hatte. Patricia ließ sich gern von ihm ablenken, denn ansonsten war ihr Kopf voller Code. Zu Hause in ihrer kleinen Einzimmerwohnung setzten sich immer mehr Staubschichten auf die Möbel, verfaulten die Äpfel in der Obstschale, und dass der Fernseher bei einem Gewitter kaputtgegangen war, bemerkte sie erst Monate später. Die Pflanzen auf dem Fensterbrett waren sowieso schon längst eingetrocknet und starrten ebenso vor Staub wie die Bücher in den Regalen. Das größte Bild in ihrer Wohnung – ein auf Alu-Dibond gedrucktes Porträt von Commander Data von der Enterprise war schon so stumpf geworden, dass sie im Vorbeigehen immer ein wenig zur Seite blickte, weil sie sich vor ihm schämte. An manchen Sonntagen schlurfte Patricia durch ihre Wohnung wie eine Fremde, die sich fragte, wer hier eigentlich für Ordnung und Sauberkeit zuständig war. Regelmäßig überlegte sie, eine Putzkraft einzustellen. Sie bezahlte Menschen dafür, für sie zu kochen, ihre Wäsche zu waschen und sie zur Arbeit zu bringen, warum dann nicht auch fürs Putzen? Aber meist verwarf sie die Idee wieder. Für wen sollte denn geputzt werden? Sie verbrachte so wenig Zeit hier, da lohnte es die Mühe nicht.
»Irgendwann suche ich mir einfach eine neue Wohnung und schmeiß den alten Schlüssel weg«, dachte sie dann. Sie hatte sich hier nie wirklich zu Haus gefühlt. Es war nur eine Studentenbude. In dem Versuch, es sich wohnlicher zu machen, hatte sie einmal bei Ikea eine Ladung verschiedener Topfpflanzen, Bilder und Duftkerzen gekauft, um sie an strategisch günstigen Punkten aufzustellen. Die Blumen standen immer noch da, trocken konserviert. Die Bilder lagerten irgendwo in einem Kabuff, und die Kerzen hatte sie nur einmal angezündet, als Ray zu Besuch gewesen war. Aber der penetrante Geruch, der noch tagelang in der Luft hing, erinnerte sie an die Nacht mit Ray, was dann doch zu aufdringlich geworden war.
Nach ein paar Wochen war die Sache dann sowieso vorbei. Ray meinte, er müsse sich mehr seiner Arbeit widmen und die andern vom Team hätten sich schon beschwert. Patricia nickte, sagte, es sei kein Problem, und bemühte sich, als sie die Enttäuschung in seinem Blick erkannte, ein wenig zerknirscht auszusehen. Aber damit war das Thema für sie erledigt.
In ihrem Kopf drehte sich sowieso alles nur um KINVI, und nach Ray versuchte sie gar nicht mehr, intensive Kontakte zu den anderen Teams zu pflegen. Sie hatte das Gefühl, dass es sie nur von ihrer tatsächlichen Arbeit abhalten würde. Und sie vermisste nichts, denn schon in der Uni waren Henry und sie zu zweit das beste Team gewesen. Hier kannten sie sich aus, hier waren die Regeln klar, hier waren sie sicher. Für Patricia gab es keinen Grund, daran etwas zu ändern.