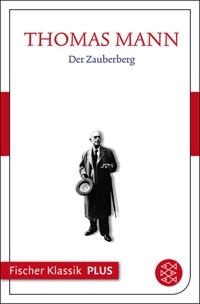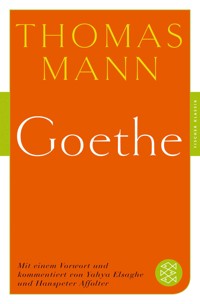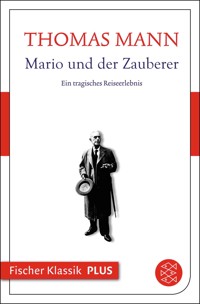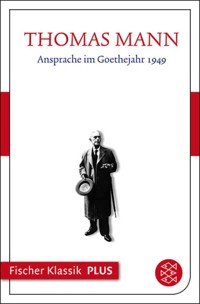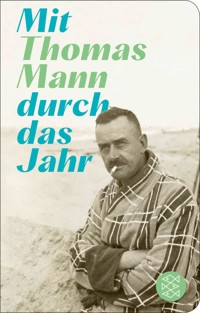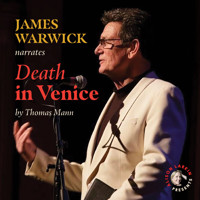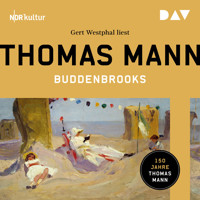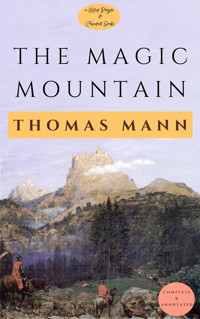3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
»Ein Abenteuer ersten Ranges« war Thomas Manns Reise nach Paris im Januar 1926 – die politischen Fronten zwischen Deutschland und Frankreich waren noch verhärtet, beiderseitige Vorurteile hatten Hochkonjunktur. In der Rolle eines inoffiziellen Kulturbotschafters der Weimarer Republik warb Thomas Mann für die deutsch-französische Freundschaft und die Völkerverständigung. Seine Aufzeichnungen dokumentieren den überaus herzlichen Empfang und zahlreiche Gespräche mit politischen und literarischen Persönlichkeiten. Bereits damals wurde die europäische Einigung diskutiert. Diesem »privaten Fädchenspinnen« attestierte Mann »fast erotischen Reiz.« Eine Fülle von Detailbeobachtungen und auch Manns Selbststilisierung nach Goethe'schem Vorbild tragen erheblich zum Lesevergnügen bei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Ähnliche
Thomas Mann
Pariser Rechenschaft
Essay/s
Fischer e-books
In der Textfassung derGroßen kommentierten Frankfurter Ausgabe(GKFA)Mit Daten zu Leben und Werk
{1115}Pariser Rechenschaft
Es ist nur, daß ich es nicht vergesse. Ich will, solange ich es noch Stunde für Stunde am Schnürchen habe, das turbulente Diarium dieser neun Tage doch wiederherstellen und festhalten, da sie immerhin für meine Verhältnisse ein Abenteuer ersten Ranges bedeuteten. Es sind Verhältnisse, unter denen alle Wirklichkeit, alles Leben nach außen und Erleben von außen diesen Charakter gewinnt. Ich habe es einmal in nachlässigen Versen gesagt, daß den Träumer Wirklichkeit träumerischer dünke als jeder Traum und ihm tiefer schmeichle. Lassen wir es gut sein, daß diese kindische Eitelkeit auf das Wirkliche ihre Rolle spielt bei Lebensunternehmungen wie dieser, welche man also nicht allzu moralisch als Leistungen des Gehorsams und Pflichtgefühls sich aufputzen und vorempfinden darf, obgleich ihnen etwas von moralischer Gewaltsamkeit und Unnatur zweifellos anhaftet … Und doch, die Wagnerschen »Geistesfreuden«, das »würdig Pergamen«, ist das der Friede? Die Literatur, der Traum, das Werk, ist das kein Abenteuer? Habe ich je zu schreiben aufgehört, ohne mir zu sagen: Na, lange treib’ ich’s nicht mehr? Nicht abenteuerlich sind am Ende nur die Strecken entspannten Alltags und farbloser Regelmäßigkeit zwischendurch; ein Wunder eigentlich und Zeichen von zähem Fond, daß man nicht abgelebter ist.
Jetzt freilich bin ich denn etwas krank. Man glaubte aktiv bleiben und da nur fortfahren zu können, wo man digressiverweise aufgehört; aber der Körper, dies sonderbar selbständige Ich neben dem andern, das in der knabenhaftesten Weise oben hinaus will, wußte es besser und hat »uns« auf dem Wege einer kleinen Infektion für acht oder zehn Tage Bettruhe verschafft. Es ist die Grippe, wie sie jetzt umgeht: mit niedrigen {1116}Übertemperaturen, langwierigen Affektionen der Luftwege und gastrischen Störungen, nicht schwer genug, um den Geschmack an der Zigarette ohne Rest zu verderben. Im Grunde, ich bin schon nicht mehr ärgerlich. Ich kann meine verwahrloste Korrespondenz in Ordnung bringen, komme endlich einmal wieder dazu, »Abdias« und »Salambo« zu lesen und kritzele dies an der zum Pulte schräg gestellten Platte des über das Bett zu schiebenden Spezialtisches, an dem ich auch meine Mahlzeiten nehme und der mir als Sinnbild einer Konzentration erscheint, die nur das Krankenzimmer gewährt.
In Mainz hatte ich Heidelberg, Köln und Marburg hinter mir, erfreuliche Aufenthalte, reich an Gesichten und Gesichtern, der Hauptaffäre absichtlich vorgeordnet. Keine Plötzlichkeiten. Aus dem Münchener Arbeitszimmer und Isarufergehölz nicht unvermittelt in die Pariser Aktion. Man muß einen Anlauf schaffen, sich in Gang setzen, das Reden wieder lernen, sich geläufig machen. Am vierten Schauplatz war ich schon abgebrüht, umgänglich, schamentwöhnt in Hinsicht auf ein schwatzhaftes Ungefähr des Ausdrucks, zugleich katarrhalisch und geschmeidigt. Ich traf dort mit meiner Gefährtin zusammen, die mich in die französische Hauptstadt begleiten sollte. Das war neu und glücklich. Ich war auf dergleichen Wegen so gewöhnt, sie fern daheim zu wissen, daß ihre Gegenwart, obgleich natürlich vereinbart, eine heitere Unwahrscheinlichkeit gewann. Begegnung denn also wahrhaftig in der Halle des »Hofs von Holland«, Rheinstraße, als ich abends mit Herren des Vorstandes aus der Vorlesung zurückkehrte – in jenem Zustand von Erhitztheit und Erleichterung, der dem Kontakt mit einer sinnlichen Öffentlichkeit zu folgen pflegt. Ich will die Reize nicht verleugnen, die das Befahrnis in seinen verschiedenen Stadien noch heute für mich besitzt, obgleich die {1117}Annehmlichkeit dieser Stadien gelinde gesagt ihre Grade hat. Das Bild vom »Sprung ins kalte Wasser« hat viel Zutreffendes. Die zehn Minuten im Wartezimmer, während das Murmeln des Saals durch die geschlossene Tür dringt, erinnern stark an die Gefühle lustiger Beklommenheit, mit denen man sich in einer Kabine entkleidet und fröstelnd am Ufer zögert. Aber dann tummelt man sich im Elemente warm, und in der wohligen Erschlaffung, die folgt, kommt die Verwandtschaft auf ihren Gipfel. Sechshundert oder auch tausend Menschen anderthalb Stunden lang ohne Unterbrechung durch das gesprochene Wort in Atem zu halten, zusammenzuhalten, daß sie nicht auseinanderstreben, die Gemeinschaft genauen Lauschens sich nicht lockert, ist eine bedeutende körperliche Anstrengung. Husten im Saal ist ein Zeichen beginnender Auflösung der Disziplin und mit allen durch das Material gegebenen Mitteln hintanzuhalten. Heiterkeit muß sich akkumulieren; ihr Sichgehenlassen würde ebenfalls Entspannung bedeuten, weshalb sie im Ausbrechen durch rasches Weitergehen zu ersticken ist, d.i. durch die Bedrohung, in entfesseltem Zustande Un-er-setzliches zu versäumen. Kurzum, es ist viel Wachsamkeit nötig, ein Regieren mit Schultern und Armen, als ob man mit sechsen führe; nachher ist man hungrig und geneigt, viel Wein hinunterzuschütten.
Wir gingen zu Tische: der Theaterintendant, die Herren vom Vorstande, die Damen. Ich saß am Ende der Tafel, und die Frau zu meiner Rechten hatte eine Tochter am Ende des Nachbartisches hinter mir: Tänzerin von Beruf und mit pikanten Augen. Auf Grund festlichen Dispenses aus anderer Tischgegend plauderte ich über die Lehne meines Stuhles hinweg länger mit der Kleinen, als übrigens höflich gegen meine Dame hätte sein mögen, wäre sie nicht eben die Mutter gewesen.
War es nicht am Ende das letzte Gespräch für einige Zeit, das {1118}legitimerweise und mit stämmiger Berechtigung durch Grund und Boden auf deutsch geführt werden konnte? Denn Mainz ist natürlich so deutsch wie möglich, obgleich man sich auch wieder schon ein wenig im Übergang fühlt – nicht nur, wenn man jetzt auf der Straße mit einem gewissen Erstaunen gemeine Soldaten Französisch sprechen hört. Wir machten am nächsten Vormittag, sehr wohl geführt, einen Spaziergang durch die Stadt. Der historisch-kulturelle Einfluß von drüben springt in die Augen: Die rote Sandsteinarchitektur des früheren kurfürstlichen Schlosses, in dessen Erdgeschoß man das römische Museum untergebracht hat, ist eleganteste französische Renaissance; man denkt auf dem prächtigen Hof an gewisse Blätter von Doré; und auch das Barock des großherzoglichen Palais wird den französischen General, der dort vorübergehend domiziliert, nicht weiter zivilisationswidrig anmuten. Der Vorstandsherr, der uns gütigerweise begleitete, emigrierter Elsässer, Rechtsanwalt ehemals, nun Geschäftsmann und kunstgeschichtlich wohl nicht sonderlich fest, hatte einen gelehrten jungen Museumsbeamten mitgebracht, unter dessen Beistand wir die schöne Jupitersäule besichtigten, zu deren öffentlicher Wiederaufstellung wirklich die Mittel beschafft werden sollten. Doch, es geht einigermaßen römisch-gallisch zu in der Stadt, die einmal »Maguntiacum« hieß und nicht weniger als viermal von den Franzosen genommen wurde. Thorwaldsens Gutenbergdenkmal auf dem Gutenbergplatz (wir sind an der Geburtsstätte der Presse!) ist in Paris gegossen. Die Stadthalle am Rhein, soeben von den Okkupationstruppen geräumt und dem Volke von Mainz zur Belustigung wieder übergeben, hatte statt der Trikolore die rotgelbe Karnevalsflagge gehißt … Wir waren im Martinsdom, dessen Inneres wir leider durch Reparaturvorkehrungen arg verbaut fanden. Wir waren auch in den Gassen der Altstadt und {1119}sahen, was an malerischem Väterwerk nach allem Ungemach, das die Stadt durch die Jahrhunderte erfahren, nach Belagerungen, Eroberungen, Zerstörungen und Explosionen, noch übrig ist. Um vier Uhr nachmittags ging unser Zug.
Man reist verteufelt angenehm in einem Schlafwagenabteil, in dessen schmucker Enge man noch einige Tagesstunden verbringt, bevor die Betten gemacht werden. Da wir uns in Mainz mit Proviant versehen hatten, konnten wir den Speisewagen meiden und aßen am Klapptischchen zu Abend, ein Vergnügen, das ich von jeher zu schätzen gewußt habe. Wir baten dann bald um Herstellung der Lager, denn wir würden früh ankommen. Die Schaffner internationaler Schlafwagen sind merkwürdige Leute, heimatlos undefinierbare und mehrsprachige Grenz- und Mischtypen zumeist; der Geist des Verkehrs und des Abenteuers spricht aus ihren von Kohle imprägnierten Zügen, die von einer gewissen niedrigen Mondänität geschärft erscheinen. »Die Herrschaften –!« sagte der unsrige abends beim Einsteigen. Morgens in Paris sagte er: »M’sieur et dame –!«
Mittwoch, den 20. Januar, 6 Uhr: Gare de l’est. Leichte Behandlung des großen Gepäckstücks durch die Douane und lange Autofahrt durch die noch nächtige, halb erwachte Stadt. Diese Gefährte sind für uns sehr billig. Um es auf 5 Franken zu bringen, also zur Zeit auf weniger als eine Mark, muß man weit fahren. Gewöhnlich kommt man auf zwei oder drei, also nach unserem Gelde auf beinahe nichts. Dieser Ankunftschauffeur blieb der einzige, der uns übervorteilte: er forderte 15 Franken, keineswegs zu viel für unsre Begriffe, bevor wir im Bilde waren, aber wir haben acht Tage später denselben Weg für weniger als die Hälfte gemacht.
Hotel Palais d’Orsay, Quai d’Orsay, weitläufiger Bau mit {1120}stattlicher Halle, in der noch frühmorgentlich verschlafene Stimmung herrschte. In der Réception Zuweisung eines Zimmers im zweiten Stock, das sich mit seinem kleinen Vorplatz, an dem das Bad lag, als sehr freundlich erwies, aber im Punkte der Bequemlichkeit der Einrichtung nicht allen Wünschen genügte. Schließlich, man braucht eine Kommode! Den obligaten Kamin mit der vergoldeten Stutzuhr hätten wir gern für ein Möbelstück in Kauf gegeben, das unsere Wäsche bergen könnte.
Indem wir hier abstiegen, fanden wir uns vorzüglich beraten in Hinsicht auf die Lage unseres Quartiers, die sehr praktisch ist, aber weniger in Ansehung seines Charakters. Das Palais d’Orsay, obgleich es üppige Appartements zu bieten hat, ist vorwiegend Touristenhotel, für längeren Aufenthalt nicht eingerichtet. Auch ist es Festlokal des Pariser Mittelstandes, beliebter Schauplatz von Hochzeitsdiners, Vereinsbällen und dergleichen erhitzenden Veranstaltungen mehr, deren sich täglich mindestens eine hier abspielt. Dann stehen befrackte Diener, goldene Ketten um den Hals, empfangend und wegweisend auf allen Podesten, auf den Treppen flirtet die Jugend und tanzt im Saal, es riecht nach Festivität, und die Musik ist miserabel. Übrigens erwies sich unser Zimmer als durchaus schallfest, und eine Kommode wurde auf unsere Klage alsbald hereingerückt. Man stellte Sonderberechnung dafür in Aussicht, hat aber, wenn mir recht ist, schließlich darauf verzichtet.
Wir ließen Frühstück kommen – diesen herrlichen ersten Imbiß des Tages, der an Reiz und Wert in meinen Augen jede spätere Mahlzeit übertrifft. Große Erheiterung über den Kellner, der, als wir etwas Honig vermißten, statt »miel« »bière« verstand und sein Erstaunen über dies rohe Verlangen hinter der größten Bereitwilligkeit verbarg, uns um sieben Uhr mor{1121}gens Bier in beliebiger Menge herbeizuschaffen. Wir tranken unseren Tee mit dem erhöhten Vergnügen, das die Annehmlichkeiten des Lebens auf Reisen gewähren, und fanden es später sehr wohltuend, nach durchrüttelter Nacht und bis die Stadt sich beleben würde, in feststehenden und bequemen Betten noch eine Stunde zu schlummern. Dann wurde durchs Telephon Besuch gemeldet.
Dies Pariser Telephon ist der ergreifendste Apparat, der mir je vorgekommen – das unsrige wenigstens war das. Seine Lebensäußerungen warfen sich aufs Gemüt, man konnte ihm nicht schnell genug zu Hilfe eilen, und war man nicht abkömmlich für den Augenblick, so rief man ihm unwillkürlich von weitem laute Tröstungen und Versprechungen zu. Es hatte ein kleines Lichtauge, womit es auf die erregendste Art blinkte und blinzelte, und eine erbarmungswürdige kleine Kopfstimme, mit der es ängstlich winselte: »Ach, rasch, ach, bitte, bitte, rasch …« Man war ja schon da, in Gottes Namen, was gab es denn! Und jedesmal wieder war man enttäuscht und erleichtert von dem, was wirklich gemeldet wurde, da man mit Bestimmtheit die Nachricht von einem erbarmungswürdigen kleinen Unglück gewärtigt hatte.
Dies erste Mal war es nur Besuch von der Botschaft, der deutschen Botschaft, unserer Botschaft, und ich stieg hinab, den diplomatischen Landsmann in der Halle zu begrüßen. Botschaftsrat Dr. R. war kein germanischer Recke, sondern ein zierlicher Herr von höflich gescheitem Wesen, das für seine Laufbahn die besten Hoffnungen erweckte. Oh, schade, er war mit einem Wagen am Bahnhof gewesen – zu irrtümlicher Stunde, da man uns mit dem Zuge von München und nicht von Mainz her erwartet hatte. Es wurde einiges für den Nachmittag, den Abend besprochen. Schon jetzt erfuhr ich, daß gestern bei dem öffentlichen Vortrag des ebenfalls anwesenden Dr. Al{1122}fred Kerr sich törichte Unliebsamkeiten ereignet hatten. Serbische Jugend hatte politisch randaliert und war an die Luft gesetzt worden. Für mich war die Folge, daß Ängstlichkeit im Schoße des Vorstandes der Carnegiestiftung Platz gegriffen hatte und noch im vorletzten Augenblick der Entschluß gefaßt worden war, die heutige Veranstaltung auf intimeren Fuß, als ohnedies vorgesehen, zu bringen. Ich war es zufrieden; und nach vorläufiger Verabschiedung von Dr. R. machten wir uns, frei für diesen ganzen Vormittag, zu einem ersten Spaziergang auf.
Da war sie denn also nach fünfzehn Jahren wieder einmal, die milde, halbdurchsonnte, silbrig neblige Pariser Luft – aromatisiert freilich jetzt durch die Dünste der Autos, deren Zahl ins Verwirrende und Schwindelerregende angewachsen ist. Straßenübergänge sind ernste Angelegenheiten, zu deren Abwicklung Phlegma und Umsicht die rechte Mischung eingehen müssen. Es sind mehr Wagen, glaube ich, als in London, und ihr Benzin duftet anders und nicht besser als das unsrige: es hat einen Schweißgeruch, an den man sich nicht sofort gewöhnt. Da war auch der erste Büchertrödler am Quai! Wir schmökerten eine Weile bei ihm nach gutem Brauch, überschritten die schiffbare Seine auf der nächsten Brücke und fanden uns, nach einem flüchtigen Wiedersehen mit dem Tuileriengarten, dem Louvre, unter den Arkaden und vor den Auslagen der Rue de Rivoli. Wir hatten dort und in der Rue de l’Opéra kleine Einkäufe und Wechselgeschäfte zu erledigen. Im Treiben der Welt gingen wir die prächtige Straße bis zur Oper hinauf. Die Zeit verstrich. Wir frühstückten ausgezeichnet in dem sympathischen Café Rohan, gegenüber dem Palais Royal, betreut von einem ehrgeizigen und gefälligen Aufwärter, der von vornherein erklärte, daß hier alles sei, wie es sein müsse, sich auch in der Folge nicht Lügen strafen ließ und sehr ange{1123}nehm mit einer Dame zu scherzen verstand. Ich war recht glücklich über den weißen Bordeaux, den wir bekamen, diesen charaktervollen und halbsüßen Graves Supérieur, dem ich in den folgenden Tagen noch oft und beifällig zugesprochen. Wir ließen es uns nicht nehmen, auch den Heimweg zu Fuß zu machen.
Um vier Uhr wurde es Ernst. Henri Lichtenberger (diese elsässischen Namen werden französisch gesprochen; das Konversationslexikon würde die Weisung »Lieschtangberscheh« erteilen), der Germanist der Sorbonne, erwartete uns am Fuß der Hoteltreppe, um uns zum Vortrage abzuholen. Professor Lichtenberger ist ein hochgewachsener Mann mit schmalem Anatole-France-Schädel, einem weißen Knebelbart und den liebenswürdigsten Formen. Seine Gewandtheit im Deutschen vermochte mich sehr bald, mein Negerfranzösisch einzustellen. Er hat eine reizende Art, zu sagen: »Ja, ich bitte nur –« oder: »Durchaus nicht –«. Aber ein wahres Vergnügen ist es, ihn im Salon Französisch plaudern zu hören, – causer, man denkt daran, daß unser »kosen« kein anderes Wort ist als dieses, und auch einmal »reden«, »verhandeln« bedeutet hat; sein heutiger Sinn ist zärtlich einschlägig in jenem »causer«, es ist ein Kosen der Sprache, gedämpft, delikat und genußreich; ich hatte ein ähnliches Gefühl, als ich Gilbert Murray in Oxford sein Englisch heiter zelebrieren hörte; den ganzen aristokratischen Reiz der humanistischen Zivilisation des Westens kostet man beim Lauschen, spürt auch genau, was diese Alte Welt unter »Barbarei« versteht und weiß dabei, daß es eine todgeweihte Welt ist, schon tot eigentlich, im Begriffe, von östlich-proletarischen Wogen verschlungen und begraben zu werden. Am Ende hieße es nicht der Weltgeschichte in die Speichen fallen, wenn man zugäbe, daß es immerhin irgendwie ein bißchen schade darum ist …
{1124}Es gab noch Aufenthalte durch Photographen und Journalisten im Foyer. Dann führte uns ein Wagen in wenigen Minuten zum Quartier der europäischen Zentrale der »Dotation Carnegie pour la paix internationale«, Boulevard Saint-Germain.
Wartende Menschen am Eingang, Kontrolle, Anzeichen einer gewissen Spannung. Wir passierten unter unseres Führers bedeutendem Schutz. Begrüßungen im Flur, Bekanntschaft am Fuße der Treppe mit J. E. Spenlé, dem Straßburger Professor und aufmerksamen Beobachter der deutschen literarischen Produktion, dem auch ich zu großem Dank verpflichtet bin. Weitere Vorstellungen in dem oberen Wartezimmer mit Bureaucharakter: Earle B. Babcoch, der Neuyorker Gelehrte und directeur-adjoint der europäischen Zentrale, Paul Desjardin von der Union pour la vérité, Dr. Zifferer von der österreichischen Gesandtschaft, Charles du Bos, Sekretär der Union Intellectuelle Française und ausgezeichneter Kritiker, der eben noch eine Folge sehr eindringlicher Studien unter dem mich verwandt anmutenden Titel »Approximations« zusammengefaßt hat, und andere mehr. Noch einmal gab es den Magnesiumchok einer Aufnahme am Schreibtisch für die Zeitungen. Botschaftsrat Dr. R. sondierte das Terrain. »Nicht wahr also, der Botschafter kann kommen?« – Unbedenklich! Die Kontrolle war scharf gewesen und blieb es bis zum letzten Augenblick. Man hatte sich gegen jede Störung gesichert.
Herr von Hoesch erschien. Er ist ein Mann von vierzig Jahren, moderner Typus, rasiert, von sehr angenehmem Äußern. Ein Mitarbeiter des »Cri de Paris«, der zu dem nachfolgenden Empfang auf der Botschaft geladen gewesen war und seinem Blatt recht konventionelle Beobachtungen darüber lieferte, schilderte den »jeune ambassadeur« als einen Mann mit der »élégance précise d’un capitaine de cavalerie«. Das ist {1125}eine ganz falsche Charakteristik. Die Umgangsformen unseres Geschäftsträgers entbehren jeder überflüssigen Schärfe und törichten Korrektheit; sie sind zivilisiert und gewinnend, und seine Sprechweise, leicht rheinisch gefärbt, ist sanft und gescheit. Bei der Berührung mit ihm versteht man sehr bald die ungewöhnliche Raschheit seines Aufstiegs als Diplomat.