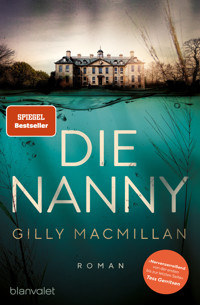6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Raffinierte britische Psycho-Spannung um eine junge Pianistin mit dunkler Vergangenheit – von der Autorin des New York Times-Bestsellers "Toter Himmel". Niemals darf Zoes Stiefvater erfahren, was vor drei Jahren geschehen ist. Das hat ihre Mutter Maria der 18-Jährigen wieder und wieder eingetrichtert. Nichts darf die Idylle ihres perfekten neuen Lebens zerstören. Doch als die hochbegabte Pianistin Zoe gemeinsam mit ihrem Stiefbruder ein Konzert gibt, taucht im Publikum ein Mann auf, der Zoe als Mörderin beschimpft. Wenige Stunden später ist ihre Mutter tot. Und es zeigt sich, dass Zoe nicht die einzige ist, die ein dunkles Geheimnis hütet ... In nur 24 Stunden bricht eine scheinbar heile Welt zusammen: Gilly Macmillan enthüllt ein Familiendrama in perfiden, elegant verschachtelten Häppchen, die es unmöglich machen, diesen Thriller aus der Hand zu legen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Ähnliche
Gilly Macmillan
PERFECT GIRL – Nur du kennst die Wahrheit
Thriller
Aus dem Englischen von Maria Hochsieder
Knaur e-books
Über dieses Buch
Niemals darf Zoes Stiefvater erfahren, was vor drei Jahren geschehen ist. Das hat ihre Mutter Maria der 18-Jährigen wieder und wieder eingetrichtert. Nichts darf die Idylle ihres perfekten neuen Lebens zerstören. Doch als die hochbegabte Pianistin Zoe gemeinsam mit ihrem Stiefbruder ein Konzert gibt, taucht im Publikum ein Mann auf, der Zoe als Mörderin beschimpft. Wenige Stunden später ist ihre Mutter tot. Und es zeigt sich, dass Zoe nicht die einzige ist, die ein dunkles Geheimnis hütet …
In nur 24 Stunden bricht eine scheinbar heile Welt zusammen: Gilly Macmillan enthüllt das Drama in perfiden, elegant verschachtelten Häppchen, die es unmöglich machen, dieses Buch aus der Hand zu legen.
Inhaltsübersicht
Für meine Familie
»Wir tanzen herum, und vermuten, im Kreis,
Das Geheimnis doch sitzt in der Mitte und weiß.«
Robert Frost, Das Geheimnis sitzt, 1942
»Heute ist Mama gestorben.
Vielleicht war es auch gestern.«
Albert Camus, Der Fremde, 1942
Sonntag und Montag
Musikalischer Sommerabend
Sonntag, den 24. August 2014
19 Uhr
Holy Trinity Church, Westbury-on-Trym, Bristol
Zoe Maisey und Lucas Kennedy
spielen
Brahms, Debussy, Chopin, Liszt und Scarlatti
»Diese beiden hochbegabten Teenager sollten Sie bei ihrem Debüt in Bristol nicht verpassen – es verspricht ein ganz besonderer Abend zu werden.« Bristol Evening Post, Veranstaltungstipps
Zugunsten des Vereins für familiäre Trauerbegleitung
Eintritt: Erwachsene £6, Kinder £3
Familienticket £15
Für Reservierungen und Informationen über künftige Auftritte wenden Sie sich bitte an Maria unter: [email protected]
Sonntagabend
Das Konzert
Vor dem Konzert stehe ich im Vorraum der Kirche und blicke das Mittelschiff hinunter. In den Gewölben lauern Schatten, obwohl es draußen noch nicht dämmert; die großen Holztüren hinter mir sind zugezogen.
Vor mir haben sich die letzten Konzertbesucher auf ihren Plätzen niedergelassen. Es ist beinahe voll. Die Gespräche kommen als dumpfes, halblautes Grummeln bei mir an.
Ich schaudere. In der schwülen Nachmittagshitze, verschwitzt und müde vom Proben, habe ich vergessen, dass es in der Kirche kalt sein kann, auch wenn es draußen brütend heiß ist. So habe ich ein kurzes schwarzes Kleid für den Abend gewählt, und jetzt fröstele ich ein wenig, und auf meinen Armen ist Gänsehaut.
Die Kirchentüren sind geschlossen und sperren die Hitze aus. Außerdem wollen wir nicht vom Lärm auf der Straße gestört werden. Auch wenn dieser Vorort von Bristol nicht gerade für randalierende Bewohner bekannt ist, so haben die Besucher doch gutes Geld für die Tickets bezahlt.
Aber es geht nicht nur darum. Tatsache ist: Dies ist mein erster Auftritt, seit ich aus dem Jugendarrest entlassen wurde, das erste Konzert in meinem Zweiten Leben.
Ungefähr hundert Mal hat meine Mutter es heute gesagt: »Der Auftritt muss perfekt werden.«
Ich werfe Lucas, der neben mir steht, einen Blick zu. Nicht mehr als ein oder zwei Millimeter Luft sind zwischen uns.
Er trägt eine schwarze Hose mit einer Bügelfalte, die meine Mutter heute Nachmittag hineingebügelt hat, und ein schwarzes Hemd. Er sieht gut aus. Sein dunkelbraunes Haar ist gerade so eben gezähmt, aber nicht ganz, und ich glaube, wenn er es darauf anlegen würde, könnte er die Mädchen, die doof genug sind, um immer noch Vampirromanzen zu lesen, zum Dahinschmelzen bringen.
Auch ich sehe gut aus, beziehungsweise werde gut aussehen, wenn die Gänsehaut erst einmal abgeklungen ist. Ich bin zierlich, habe eine blasse, klare Haut und lange hellblonde, aber feine Haare, wie Spinnweben im Sonnenlicht, die wunderbar mit dem schwarzen Kleid kontrastieren. Im richtigen Licht sieht mein Haar geradezu weiß aus und verleiht mir ein unschuldiges Aussehen.
»Wie ein Rehkitz, zerbrechlich und zart«, beschrieb mich die Staatsanwältin, was mir gefiel. Allerdings schmerzt mich die Erinnerung immer noch, dass sie hinzufügte: »Aber lassen Sie sich nicht täuschen.«
Ich biege meine Finger durch und verflechte sie miteinander, damit die Handschuhe extra eng anliegen, so, wie ich es am liebsten mag, und dann lasse ich die Arme herabhängen und schüttle sie, um meine Hände beweglich zu machen. Meine Finger sollen warm und weich sein. Sie sollen gut durchblutet sein.
Lucas neben mir schüttelt seine Hände auch, langsam, erst die eine, dann die andere. Pianisten stecken sich gegenseitig mit dem Händeschütteln an wie andere Leute mit dem Gähnen.
Am vorderen Ende des Mittelschiffs, auf einem niedrigen Podest vor dem Altar, steht der Konzertflügel; auf der Innenseite des aufgestellten, glänzend schwarzen Deckels spiegeln sich die Innereien aus Hämmern und Saiten. Er wartet auf uns. Lucas starrt ihn hochkonzentriert an, als sei da eine senkrechte Gletscherwand, die er mit bloßen Händen erklettern muss.
Wir beide gehen unsere Nervosität unterschiedlich an. Er wird ganz still, beginnt, durch die Nase zu atmen, ganz langsam, und reagiert auf niemanden.
Im Gegensatz zu ihm bin ich zapplig, und die Gedanken überschlagen sich, weil ich alles, was ich zu tun habe, im Kopf in der richtigen Reihenfolge durchspielen muss, bevor ich auftreten kann. Erst wenn ich die erste Note anschlage, hüllen mich die nötige Konzentration und die Musik selbst ein, rein und weiß wie ein Schleier, und alles andere verschwindet.
Bis zu diesem Augenblick aber ist mir, nicht anders als Lucas, übel vor Nervosität.
Neben dem Flügel hat eine Frau das Publikum begrüßt, und nun gibt sie uns einen Wink und entfernt sich unter Scharren und Verbeugungen von der Bühne.
Für uns ist es an der Zeit, nach vorn zu gehen.
Schnell ziehe ich die Handschuhe aus und werfe sie auf einen Tisch neben mir, wo der Kaffee und die Katechismusheftchen sind, und gemeinsam schreiten Lucas und ich den Gang entlang zum Altar, als führten wir eine Hochzeit auf. Die Köpfe des Publikums wenden sich uns zu, eine Reihe nach der anderen.
Wir gehen an meiner Tante Tessa vorbei, die zuständig ist für den Videorekorder, mit dem unser Auftritt aufgenommen werden soll. Der Zweck des Ganzen ist, unser Spiel später auf Fehler hin durchzugehen und die Stellen herauszuarbeiten, die wir noch besser hinbekommen müssen.
Tessa kneift angesichts der Kamera ein wenig nervös die Augen zusammen, als würde sie erwarten, dass das Objektiv sich zu ihr umwendet und ihr ins Gesicht springt, doch sie reckt ermutigend den Daumen hoch. Ich mag Tessa total gern, sie ist viel gechillter als meine Mum. Sie hat keine eigenen Kinder, und deshalb bin ich für sie umso wichtiger, sagt sie.
Die anderen Leute in der Kirche lächeln, als Lucas und ich zwischen ihnen hindurchgehen, und je näher wir ihnen kommen, desto eindringlicher zeigt sich der Zuspruch auf den Gesichtern. Ich bin siebzehn, aber ich kenne diesen Blick, seit ich ein kleines Kind war.
Mum nennt diese Leute unsere »Unterstützer«. Sie sagt, dass sie immer mal wieder auftauchen, um zu sehen, ob wir gut spielen, und es ihren Freunden weitererzählen. Aber ich mag die Unterstützer nicht. Ich kann es nicht leiden, wie sie nach dem Konzert auf einen zukommen und Sachen sagen wie: »Du hast eine solche Begabung«, als müssten wir nicht Tag für Tag daran arbeiten, unser Klavierspiel immer weiter zu perfektionieren.
Beinahe kann man das Wort »Genie« in Neonschrift verlockend hell in ihren Köpfen aufleuchten sehen. Hüten Sie sich vor diesem Wort, würde ich sagen, wenn Sie mich fragen würden. Nehmen Sie sich in Acht vor Ihren Wünschen, denn alles hat seinen Preis.
Die letzten Gesichter, die ich anblicke, in der vordersten Kirchenbank, gehören meiner Mum und dem Dad von Lucas. Oder, wenn man es anders ausdrücken will, meinem Stiefvater und seiner Stiefmutter, denn Lucas und ich, wir sind Stiefgeschwister. Wie üblich haben sie die übertrieben optimistische Miene von Eltern aufgesetzt, die versuchen, ihren Ehrgeiz zu verschleiern, mit dem sie ihre Kinder geradezu ersticken könnten.
Als wir am Ende des Mittelgangs angelangt sind, ist Lucas mir voraus, und er setzt sich bereits an seinen Platz, als ich auf das Podest mit dem Flügel steige.
Wir werden mit einem Duo beginnen, einem Publikumsrenner, das haben sich unsere Eltern so überlegt. Außerdem meinen sie, dass wir leichter mit der Nervosität fertig werden, wenn wir anfangs zu zweit spielen.
Sowohl Lucas als auch ich würden lieber allein spielen, aber wir geben nach, einerseits, weil wir keine Wahl haben, andererseits, weil wir aus ganzem Herzen Musiker sind, die auftreten wollen, auftreten müssen, die den Auftritt lieben.
Ein Musiker wird darauf getrimmt, aufzutreten.
Also tun wir es, und zwar so gut wir können.
Als ich mich ans Klavier setze, halte ich mich gerade und lächle für das Publikum, auch wenn meine Eingeweide sich zusammengezogen und verknotet haben wie ein Knäuel Gummibänder. Doch ich lächle nicht zu sehr. Es ist auch wichtig, dass ich bescheiden wirke und mein Konzertgesicht genau richtig hinbekomme.
Es gibt ein kleines Hin und Her, während Lucas und ich uns hinsetzen und die Klavierhocker anpassen. Wir wissen, dass sie perfekt eingestellt sind, weil wir das Klavier ausprobiert haben, bevor das Publikum eintraf, trotzdem machen wir uns daran zu schaffen, korrigieren den Abstand, passen die Höhe minimal an. Das gehört zur Vorstellung. Es hat mit der Nervosität zu tun. Vielleicht ist es auch Effekthascherei. Oder beides.
Als wir beide richtig sitzen, plaziere ich meine Hände über den Tasten. Ich bemühe mich sehr darum, meinen Atem zu kontrollieren, weil mein Herz laut hämmert, aber ich konzentriere mich voll auf die bevorstehende Musik und warte mit jeder Faser auf die ersten Töne, wie auf den Startschuss zu Beginn eines Wettlaufs.
Das Publikum ist verstummt. Nur ein Husten ist zu hören, das zwischen den Gewölben und Pfeilern widerhallt. Lucas wartet darauf, dass das Geräusch verklingt, und in der vollkommenen Stille, die darauf folgt, wischt er sich die Handflächen an seiner Hose trocken und positioniert sie dann über den Tasten.
Von nun an gibt es nichts als das geschmeidige Schwarz und Weiß, das sich unter unseren Händen erstreckt, und ich beobachte seine Hände mit der Aufmerksamkeit eines Tieres, das zum Sprung ansetzt. Ich darf seinen Einsatz nicht verpassen. Noch ein oder zwei Schläge absoluter Stille, dann wölbt er seine Handflächen, und seine Hände federn leicht: einmal, zweimal, dreimal.
Und dann legen wir los, absolut synchron.
Wir wirken stark und schillernd in diesem Augenblick – das sagen alle. Die Kraft von zwei Musikern kann elektrisieren, wenn man es richtig trifft. Es ist ein Drahtseilakt, die Intensität, den Klang und die Dynamik zu kontrollieren, denn alles muss perfekt aufeinander abgestimmt sein, und heute Nachmittag, als wir müde wurden und uns beim Proben in der Hitze übereinander geärgert haben, hat es nicht geklappt. Jetzt am Abend aber ist es großartig. Makellos und wunderschön; wir tauchen beide tief in die Musik ein, und ich muss zugeben, dass es nicht immer so ist. Meistens eher nicht.
Tatsächlich tauche ich so tief ein, dass ich anfangs das Geschrei gar nicht höre, und das Geschrei nicht zu hören bedeutet, dass ich nicht bemerke, dass in diesem Augenblick das Ende begonnen hat.
Ich wünschte, ich hätte es bemerkt.
Warum wünsche ich mir das?
Weil sechs Stunden später meine Mutter tot ist.
Montagmorgen
Um acht Uhr hat Tessa sich noch immer nicht gerührt, ich aber bin seit dem Morgengrauen wach.
Ich bin Strafverteidiger und habe viel zu tun. Oft arbeite ich bis spätabends, und meist schlafe ich tief, bis der Wecker klingelt. Heute jedoch habe ich einen Krankenhaustermin, der vor mehr als einer Woche ein Loch in meinen Kalender gebrannt hat, und in dem Augenblick, da ich die Augen öffne, ist er mir im Sinn.
Die Vorhänge im Schlafzimmer sind zugezogen und verdunkeln den Raum, und mal hier, mal da fällt an den Rändern Licht herein, wenn sie sich in der Brise vom Fluss bewegen. Würde ich sie aufziehen, könnte ich den ausgedehnten Hafen sehen und die bunte Mischung aus modernen Wohnungen und alten Speicher- und Bootshäusern, die sich am gegenüberliegenden Flussufer drängen.
Aber ich tu es nicht.
Ich bleibe, wo ich bin, und mir fällt auf, dass der Windhauch so sanft ist, dass er die Reglosigkeit im Zimmer kaum stört. Gestern Abend hat man uns einen Sturm versprochen, der nicht gekommen ist. Es gab nur einen kurzen, heftigen Regenguss, gefolgt von feinem Nieseln, und es brachte eine flüchtige Atempause von der Hitze, sehr flüchtig, denn schon jetzt staut sie sich wieder.
Tessa kam im Regen mitten in der Nacht.
Sie entschuldigte sich für die Störung, so als habe sie mir den Abend nicht gerettet. Sie sagte, dass sie versucht habe, mich anzurufen. Ich hatte es nicht bemerkt, denn ich war mit den Resten eines asiatischen Nudelgerichts auf dem Schoß und dem Krankenhausbrief auf der Brust vor dem Fernseher eingeschlafen.
Ich öffnete ihr die Tür und sah dunkle Ringe auf der feuchten Haut unter ihren erschöpften Augen, und sie stand ganz still, als ich sie in den Arm nahm, als wäre jeder einzelne Muskel ihres Körpers zu stark angespannt.
Sie wollte nicht reden, und ich drängte sie nicht. Wir pflegen eine ruhige, respektvolle Affäre; wir erbitten oder erwarten keine umfassenden Gefühlserklärungen vom anderen. Bei uns geht es eher darum, dem anderen ein Refugium zu bieten, womit ich einen geschützten Ort meine, an dem wir mit ziemlicher Sicherheit das sind, was weniger zurückhaltende Menschen »verliebt« nennen würden. Wir würden dieses Wort niemals in den Mund nehmen.
Ich bin ein schüchterner Mensch. Vor zwei Jahren bin ich von Devon nach Bristol gezogen. So etwas tut man, wenn man nicht das ganze Leben und die gesamte Karriere im selben kleinen Kreis von Menschen verbringen will, wo man schon aufgewachsen ist. In Bristol gibt es viel mehr Möglichkeiten, und an Zoe Guerins Fall hatte ich mir die Zähne geschärft, also stand mir der Sinn nach einer Veränderung.
Allerdings läuft es nicht so gut. Meine Fälle sind vielfältiger und die Arbeit anstrengender, das stimmt schon, doch neue Freundschaften haben sich nicht ergeben, weil ich ständig arbeite und man bei Gefängnisbesuchen und Gerichtsterminen nicht allzu häufig potenziellen Lebensgefährten begegnet. Als Tessa und ich uns dann eines Tages buchstäblich auf der Straße in die Arme liefen, kam es mir wie ein Himmelsgeschenk vor. Sie war mir vertraut, wir teilten eine Geschichte, wie schwer sie auch gewesen war, und bald gewöhnten wir uns an, hier und da Zeit miteinander zu verbringen, anfangs nur auf einen Kaffee oder Drink, später auch mehr. Allerdings ist Tessa verheiratet, deshalb sind die Dinge in dieser Hinsicht zum Stillstand gekommen. Wir können keinen Schritt weitergehen, solange sie ihren Mann nicht verlässt.
Gestern Abend kam sie herein und ließ sich auf mein Sofa plumpsen, als habe man die Füllung aus ihr herausgeschüttelt, und ich brachte ihr ein kühles Bier und steckte auf dem Weg in die Küche den Krankenhausbrief unauffällig in eine Schublade, damit sie ihn nicht sah. Ich wollte nicht, dass die Sache die Stimmung zwischen uns trübte, nicht, solange ich nicht sicher war. Nicht bevor ich den heutigen Termin hinter mich gebracht hatte. Es war relativ einfach, die Taubheit in der linken Hand zu verstecken. Auch in der Arbeit hatte es niemand bemerkt.
Sie nippte an dem Bier, und wir sahen uns einen Hitchcock-Film an. Das dunkle Zimmer flimmerte von den schwarzweißen Szenen auf dem Bildschirm, so dass es wie belebt schien. Tessa blieb neben mir ganz still und ruhig, ein- oder zweimal drückte sie die kalte Flasche an die Stirn, und ich blickte sie verstohlen an und fragte mich, was los war.
Tessa hat nicht das weißblonde Haar, die blasse Haut und die feinen Gesichtszüge ihrer Schwester oder Nichte – ihr fehlt diese kühle Erhabenheit –, obschon sie die gleichen stechend blauen Augen hat wie sie. Tess bindet ihr dickes, weiches rotblondes Haar meist zusammen, und die Offenheit des herzförmigen Gesichts und die mit feinen Sommersprossen überzogene Haut verleihen ihr eine zugängliche und warme Ausstrahlung. Oft blitzen ihre Augen schelmisch. Sie hat eine sportliche Figur und eine pragmatische, zupackende Art. In meinen Augen ist sie wunderschön.
Ich sehe sie mir im warmen Dunkel des Schlafzimmers an, wie sie daliegt, die Hände auf dem Kissen neben dem Gesicht, die Hand an den Lippen locker zur Faust geballt. Nur der Anblick des abgestoßenen Eherings an ihrem Finger beeinträchtigt das Bild für mich.
Nach einer Weile erhebe ich mich vorsichtig, weil ich frühstücken will. Ich fingere in einem Stapel Wäsche auf dem Boden herum, um etwas zum Anziehen herauszusuchen, als mein Handy zu vibrieren beginnt.
Schnell greife ich danach, um sie nicht zu stören.
Auf dem Display sehe ich, dass es Jeanette ist, meine Sekretärin. Sie ist immer früh am Schreibtisch, insbesondere an Montagen.
Innerlich fechte ich einen Kampf aus, ringe mit mir, ob ich rangehen soll oder nicht. Im Grunde genommen aber bin ich ein gewissenhafter Kerl, also war die Schlacht eigentlich schon in dem Augenblick verloren, als das Telefon geklingelt hat. Ich nehme das Gespräch an.
»Sam, es tut mir leid, aber hier im Büro ist eine Klientin aufgetaucht, die dich sprechen will.«
»Wer?«, frage ich, blättere im Geiste die Liste meiner angeseheneren Klienten durch und frage mich, wer von ihnen diesmal vom rechten Weg abgekommen und wieder im Sumpf gelandet ist.
»Sie ist noch ein Mädchen«, flüstert Jeanette.
»Wie heißt sie?«
Noch während ich frage, denke ich: Das kann nicht sein, oder doch? Ich hatte nur ein einziges Mal eine Klientin, die ein Teenager war.
»Sie sagt, sie heißt Zoe Maisey, doch du kennst sie unter dem Namen Zoe Guerin.«
Ich gehe aus dem Schlafzimmer in das angrenzende Bad, schließe die Tür und setze mich auf den Badewannenrand. Die Morgensonne scheint durch die Milchglasscheibe herein, taucht das Zimmer in gelbes Licht und attackiert meine weit geöffneten Pupillen.
»Du machst Witze?«
»Leider nein, in keinster Weise. Sam, sie sagt, dass man ihre Mutter letzte Nacht tot aufgefunden hat.«
»Oh, mein Gott.«
Diese drei Wörter sind der armselige Ausdruck meines völligen Unglaubens, denn Zoe ist ja Tessas Nichte und ihre Mutter Maria die Schwester von Tess.
»Sam?«
»Kannst du sie mir geben?«
»Sie besteht darauf, dich zu sehen.«
Ich überschlage die Zeit; mein Termin ist erst am späteren Vormittag, vermutlich bleibt genug Zeit, sich wenigstens teilweise um diese Sache zu kümmern.
»Sag ihr, dass ich auf dem Weg bin.«
Ich bin schon fast dabei, das Telefon auszuschalten, als Jeanette hinzufügt: »Sie ist mit ihrem Onkel hier.« Noch einmal dreht sich mir der Magen um, denn Zoes Onkel ist Tessas Ehemann.
Sonntagabend
Das Konzert
Wenn man keine eigenen Kinder hat, neigen die Leute dazu, einem Dinge zu geben, um die man sich kümmern soll. Vermutlich meinen sie, dass einem das Ventil für den Fürsorgetrieb fehlt.
Am Abend von Zoes Konzert ist der Kind-Ersatz, den man mir gegeben hat, eine Kamera. Ich soll den gesamten Auftritt aufnehmen. Meine Schwester erklärt mir in pedantischem Ton, als wäre ich geistig minderbemittelt, dass es eine wichtige Aufgabe ist.
Sollen wir meine Kinderlosigkeit gleich vorweg abhandeln? Na dann. Trotz der Tatsache, dass ich beruflich erfolgreich bin und mich wohl fühle in meiner Haut, scheint es das zu sein, was die Leute am meisten interessiert.
Also: »Ungeklärte Unfruchtbarkeit« ist tatsächlich eine Diagnose, ganz offiziell, auch wenn sie einen so wenig offiziell klingenden Namen hat. Und ich habe das. Mein Mann Richard und ich haben es erst herausgefunden, als wir schon in den Dreißigern waren, weil wir das Kinderkriegen hinausgeschoben hatten, bis wir Reisen unternommen und beide eine berufliche Laufbahn eingeschlagen hatten.
Nachdem es feststand, probierten wir es mit In-vitro-Fertilisation und zogen das dreimal durch, bevor wir aufgaben. Eine Leihmutterschaft wollte ich nicht, dafür war ich zu feige. Adoption: gleicher Grund. Heute würden sie uns ohnehin keine Chance geben, nun, da Richard trinkt.
Was allerdings die Frage angeht, ob mir das Ventil für den Fürsorgetrieb fehlt, da kann ich nur lachen, denn ich bin Tierärztin.
Meine Praxis ist im Stadtzentrum, dort, wo einige der gegensätzlichsten Stadtviertel von Bristol aufeinandertreffen. An einem gewöhnlichen Tag sehe ich wahrscheinlich um die zwanzig bis fünfundzwanzig Tiere, die ich anstupse, untersuche, streichle, beruhige und manchmal mit einem Maulkorb versehe, um ihre gesundheitlichen und hin und wieder auch psychischen Probleme zu lindern. Daraufhin muss ich eventuell ihre Besitzer beruhigen oder beraten und ab und zu auch streicheln, wenn es schlechte Nachrichten gibt.
Kurz gesagt: Ich betreibe den ganzen Tag, und das an den meisten Tagen der Woche, Fürsorge.
Wobei die Sache nicht ohne Ironie ist, wie mir immer dann bewusst wird, wenn ich mit meiner kleinen Schwester zusammen bin, vor allem, wenn ich wie heute Abend zum Helfen eingespannt werde.
Sie müssen wissen, dass Maria, als wir Kinder waren, die Aufmüpfige von uns beiden war, im Gegensatz zu mir, dem stets artigen Mädchen. Sie hatte eine ganze Reihe Begabungen als Kind, insbesondere ihr musikalisches Talent, von dem sich meine Eltern viel versprachen, doch ihre Erwartungen erfüllte Maria nie.
Schon als kleines Mädchen war sie temperamentvoll und witzig, mit vierzehn aber wurde sie richtig wild. Während ich mich abends in unserem Zimmer verkroch, vor mich hin büffelte und vom Tiermedizinstudium träumte, war ihr Schreibtisch auf der anderen Seite des Zimmers übersät von dem Make-up, das sie dort liegen gelassen hatte, nachdem sie sich für den Abend schön gemacht hatte. Sie hörte auf zu lernen, sie hörte auf, klassische Musik zu spielen, und genoss stattdessen das Leben.
Sie könne keinen Sinn darin erkennen, sagte sie, auch wenn die Augen meines Vaters hervortraten, wenn sie so daherredete.
Ich hingegen, ohne Freund, unscheinbarer und weniger gesellig als meine hübsche kleine Schwester, genoss es, stellvertretend durch sie zu leben, und ich glaube, ihr gefiel es auch. Sie flüsterte mir ihre Geheimnisse ins Ohr, wenn sie in den frühen Morgenstunden nach Hause kam: Küsse und Alkohol und Tabletten, die sie genommen hatte. Eifersüchteleien und Triumphe: ein einziges Abenteuer.
Dann aber, gerade mal neunzehn, begegnete sie auf einem Musikfestival Philip Guerin. Er war siebenundzwanzig und hatte bereits die Farm seiner Familie geerbt, und sie machte sich auf und zog zu ihm. Kurz darauf heirateten sie. Einfach so. »Um ihren Traum zu leben«, wie meine Mutter mit Sarkasmus in der Stimme sagte, während sie buchstäblich die Hände rang.
Bald darauf kam Zoe zur Welt. Maria war erst zweiundzwanzig, und ich denke, dass von da an, mit einem kleinen Kind, der Alltag auf dem Bauernhof ein wenig von seinem Glanz verlor. Doch sie gab nicht auf, das muss man ihr lassen. Vielmehr steckte sie all ihre Energie in Zoe, und als deren außergewöhnliche Musikalität sich im Alter von gerade einmal drei Jahren offenbarte und sie begann, auf dem Klavier Melodien zu klimpern, machte Maria es sich zur Aufgabe, dieses Talent zu fördern.
Natürlich war das vor dem Unfall, von dem an die Dinge für sie schiefliefen. Was ich eigentlich sagen will: In der Zwischenzeit hatte ich alles richtig gemacht im Leben, hatte fleißig studiert und alle Regeln brav befolgt, und nun bin ich verheiratet, aber ohne Kinder. Ich habe mich damit arrangiert, aber Richard kommt nicht so gut zurecht, insbesondere seit er eine dramatische berufliche Enttäuschung hinnehmen musste, die mit meiner Weigerung zusammenfiel, es ein viertes Mal mit IVF zu versuchen.
Also sind wir heute Abend hier. Ich helfe meiner Schwester und Zoe, was ich sehr gern mache, wenn Maria es zulässt. Ich freue mich auf den Auftritt, weil Zoes Klavierspiel beinahe das alte Niveau erreicht hat, das sie hatte, bevor sie in den Jugendarrest kam. Ich bin mir sicher, dass sie die Leute total begeistern wird, und hoffe nur, dass ich die Aufnahme nicht verpatze.
Lucas, der Sohn des relativ neuen zweiten Mannes meiner Schwester, hat mir eine dürftige Dreißig-Sekunden-Einführung gegeben, wie man die Kamera bedient. Lucas ist ein echter Film- und Kamerafreak, ich war also in guten Händen, aber eigentlich reichen seine Erklärungen nicht, denn im tiefsten Innern bin ich ein bisschen technikfeindlich, und schon während Lucas sprach, habe ich gemerkt, dass seine Worte in meinem Kopf umherschwimmen wie ein in Panik geratener Fischschwarm.
Ich könnte Richard hier gut gebrauchen, aber er hat mich wieder im Stich gelassen.
Gerade mal eine Stunde ist es her, dass ich ihn gefunden habe, als es Zeit wurde, sich für das Konzert fertig zu machen. Er war im Schuppen am Gartenende, vorgeblich, um ein Modellflugzeug zu bauen. Aber als ich ihn dort aufstöberte, war er gerade dabei, die Reste aus einem Weinschlauch zu pressen. Er hatte den Karton darum herum abgerissen und massierte und verdrehte den silbrigen Schlauch wie ein widerspenstiges Euter über seiner Teetasse.
Während ich ihm von der Tür aus zusah, tröpfelten ein paar schale Tropfen Flüssigkeit aus dem Schlauch in die Tasse. Richard trank sie sofort, dann bemerkte er mich. Er rechtfertigte sich nicht und versuchte auch nicht, zu verbergen, was er tat. »Tess!«, sagte er. »Haben wir noch eine Weinbox?«
Selbst von der Schuppentür aus konnte ich feststellen, dass sein Atem schlecht roch und seine Zunge schwer war. Obwohl er sich bemühte, wie ein zivilisierter Trinker zu wirken, der am Sonntagnachmittag einfach nur ein Glas Weißwein genießt, zeigte sich Scham auf seinem Gesicht und verstärkte sich das Zittern seiner Hände. Das Modell aus Balsaholz, dessentwegen er angeblich im Schuppen war, lag im Karton, die präzisionsgefertigten Teile ordentlich nebeneinander aufgereiht unter der ungeöffneten Bastelanleitung.
»In der Garage«, erwiderte ich. Und machte mich allein auf den Weg zum Konzert.
Jetzt also stehe ich hier mit einer Videokamera, von der ich nicht sicher weiß, ob sie richtig funktioniert, mit dröhnendem Kopf und Verzweiflung im Herzen, und ich sage mir ganz fest, dass ich keinesfalls der Versuchung nachgeben und Sam nach dem Konzert aufsuchen darf, denn das wäre falsch.
Sonntagabend
Das Konzert
Lucas bemerkt das Schreien vor mir.
Er hört als Erster zu spielen auf, aber ich nehme es nicht sofort wahr, weil wir gerade an einer schwierigen Stelle sind, die mich mit der Unaufhaltsamkeit eines Güterzugs mit sich zieht.
Als ich merke, dass seine Hände sich nicht mehr bewegen und ich allein spiele, mache ich zunächst weiter und schaue zu ihm hinüber, um zu sehen, ob er seinen Part vergessen hat. Wir spielen das Duo auswendig, und manchmal passiert es, dass man plötzlich nicht mehr weiterweiß.
Ich erwarte also, dass er jeden Moment wieder in die Melodie einsteigt, ich zwinge ihn gedanklich, sich zu erinnern, weil dieses Konzert doch perfekt sein muss. Aber dann erkenne ich, dass er ganz aufgehört hat, weil ein Mann mitten im Gang steht.
Also höre auch ich auf zu spielen, und während die letzten Schwingungen meiner Akkorde verebben, sehe ich den Mann an und denke, dass ich ihn vielleicht kenne.
Sein Gesicht ist ungewöhnlich verzerrt. Kein Gefallen an unserer Musik ist darin zu entdecken, vielmehr ist es rot vor Wut. Die Sehnen am Hals sind so angespannt, dass sie wie zusätzliche Knochen aussehen.
»Eine Farce!«, schreit er. »Das ist eine Farce! Eine Respektlosigkeit!« Seine Worte hallen durch den Raum, und ein oder zwei Leute stehen auf.
Er starrt mich an, und ich stelle fest, dass ich ihn tatsächlich kenne.
Ich kenne ihn, denn ich habe seine Tochter getötet.
Der Klavierhocker macht kaum Lärm, als ich aufstehe, obwohl er umfällt, denn er steht auf einem kleinen Stück purpurroten Teppich, der den Aufprall abfedert, so dass man nur einen dumpfen Schlag hört.
Meine Mutter steht von der Bank auf. Auch sie kennt den Mann.
»Mr. Barlow«, sagt sie. »Mr. Barlow, Tom, bitte.« Langsam geht sie auf ihn zu.
Ich bleibe nicht. Ich habe zu große Angst, dass er mir etwas antut.
Ich verlasse die Bühne, meine Hüfte stößt schmerzhaft an den Flügel, und dann fliehe ich nach hinten, fort von ihm, hinter den Altar, wo eine Tür ist, die mich aus seinem Blickfeld rettet. Ich drücke sie auf und trample rutschige Steintreppen hinunter in einen winzigen Raum, in dem nur ein Waschbecken ist, über dessen Rand fleckige Lappen hängen. In einer Ecke kaure ich mich hin, zitternd und wieder einmal getränkt vom kalten Schweiß meiner Reue, der Unmöglichkeit dieses Lebens, einer zweiten Chance oder eines Neuanfangs, bis mich meine Mutter schließlich findet.
Sie sagt bedeutungslose Sätze, die ein Versuch sind, mich zu beruhigen. Sie sagt sie mit gedämpfter Stimme, ihre Hand streicht mir über das Haar am Kopf und den Rücken hinunter. Sie sagt: »Pscht. Pscht«, aber ich weiß nicht, ob sie mich damit trösten will oder ob sie hofft, dass mein Schluchzen leiser wird, damit niemand mich hört.
Eine Viertelstunde später – so lange dauert es, bis wir sicher sind, dass man Thomas Barlow und seine rasende Trauer losgeworden ist – führt sie mich durch eine Hintertür hinaus über den Friedhof zum Auto.
Die Frage, ob ich noch spielen kann, stellt sich nicht. Ich zittere immer noch, und die Noten sind in meinem Kopf ohnehin völlig durcheinandergeraten.
Draußen fällt mir auf, dass es dämmert und der Abend warm ist, und ich empfinde das wie Balsam nach der Kälte drinnen. Ich bemerke den intensiven Duft der leuchtend weißen Rosen, die sich über das Tor zum Friedhof ranken, und das dunkle Flattern von Fledermäusen, die von einer Ecke hoch oben am Kirchturm ausschwärmen. Wir gehen über das ausgedörrte Gras, und um uns herum lehnen sich die Grabsteine, deren ausgemergelte Fundamente sie im Stich gelassen haben, stützend aneinander. Ich sehe ein keltisches Kreuz, die Konturen von flechtenüberwucherten Steinhügeln, überall Inschriften, Worte des Gedenkens, und über uns die dunklen, spitzen Nadeln der Eibe, die gierig das letzte Licht verschlingen.
Aus dem Kircheninnern hören wir Lucas den Debussy beginnen. Die Show muss weitergehen. Der Klang ist zunächst ein warmes Bad, dann ein sanft dahinfließender Strom. Ich hülle mich in diese Schönheit ein, um mich vor dem zu schützen, was gerade passiert ist.
Sie lenkt mich davon ab, hinunterzuschauen und am Wegrand die Tafel zu bemerken, die erst kürzlich dort angebracht wurde. »Amelia Barlow« steht darauf. »15 Jahre. Von der Familie geliebt und den Freunden geschätzt. Die Sonne schien heller, als du am Leben warst.« Rundherum wachsen frisch gehegte Pflanzen.
Wir wussten nicht, dass ihre Familie dort eine Gedenktafel aufgestellt hatte. Nie im Leben hätten wir die Kirche als Ort für das Konzert gemietet, wenn wir das gewusst hätten. In tausend Jahren nicht. Kontinente hätten sich verschoben und neu gebildet, bevor wir das getan hätten.
Auf der ganzen Heimfahrt sagt meine Mum kaum ein Wort, außer: »Ist nicht schlimm. Wir können das Konzert ein andermal nachholen, und dann wirst du für das Diplom gerüstet sein. Du bist es jetzt schon.«
Meine Mutter: Niemals spricht sie über das, was wirklich wichtig ist, und jetzt versucht sie, mich zu beruhigen, denn auch wenn der öffentliche musikalische Auftritt als Wunderkind mir heute Abend das Genick gebrochen hat, so glaubt sie doch, dass er letztendlich meine Rettung sein wird. Sie hält mein Dasein als Musikerin für den Katalysator unseres neuen Lebens, den Antrieb, der unser Leben in eine Stratosphäre katapultieren wird, die Abermilliarden Lichtjahre von unserem bisherigen Leben entfernt ist.
Und vielleicht hätte ich genauer hinhören sollen, als sie mit mir sprach, denn es war das letzte Mal, dass sie mich beruhigt hat, das letzte Mal, dass ich gespürt habe, wie die Luft zwischen uns flirrte, weil wir enttäuscht waren über unsere Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren.
Vielleicht hätte ich aus dem Kokon meines eigenen Elends herauskommen und sie fragen sollen, ob alles in Ordnung sei, wobei genau das in den vergangenen Jahren nicht der Fall gewesen war. Nichts war in Ordnung gewesen.
Trotzdem wünschte ich, ich hätte es getan. Gefragt, meine ich. Hätte ich es doch getan.
Montagmorgen
Nach dem Telefonat mit Jeanette sitze ich noch eine Weile im Badezimmer, und bei dem Gedanken, Tessa die Nachricht zu überbringen, steigt schiere Angst in mir auf.
Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit Zoe Maisey, oder Zoe Guerin, wie sie damals noch hieß.
Es ist mehr als drei Jahre her, dass ich Zoe kennengelernt habe. Ich lebte noch im Norden von Devon, und der erste Kontakt kam durch einen Telefonanruf der Anwaltszentrale zustande, weil ich Dienst hatte, als sie verhaftet wurde.
Der Anruf ging um neun Uhr dreißig am Morgen ein, etwa acht Stunden nach dem Unfall. Sie beschrieben Zoe und die Situation wie folgt: »Jugendliche, geeigneter Erwachsener anwesend, Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr, zwei Todesopfer, ein weiteres lebensgefährlich verletzt, steht zur Befragung bereit, Polizeistation Barnstaple. Pflichtverteidigernummer 00746387A.«
Ich rief sofort im Haftbüro des Polizeireviers an, sagte, wer ich sei, und bat den Beamten, mir Zoe zu geben.
»Hallo?«, sagte sie.
Ich stellte mich vor. »Erzählen Sie der Polizei nichts über den Unfall«, ermahnte ich sie. »Ich bin auf dem Weg. In etwa fünfundvierzig Minuten bin ich da. Lassen Sie sich nicht ohne mich vernehmen.«
Als Antwort sagte sie nur: »Okay«, ihre Stimme war vor Schock ganz leise; sie hatte keine einzige Frage an mich.
Ich fuhr übers Land zur Polizeistation. Es war ein wunderschöner, kühler Morgen. Ich kam an weißen, reifbedeckten Feldern vorbei, deren Heckenumrandungen breit, robust und geschmeidig zugleich waren, und obwohl im Winter ohne Blätter, waren sie so dicht, dass sie lange horizontale Schattenstreifen warfen. Der blaugraue, überraschend ruhige Ozean tauchte hier und da auf, wo es Einschnitte in der Landschaft gab, und draußen auf dem Wasser konnte man klar und deutlich die friedliche, uralte und kalte Insel Lundy erkennen.
Im Haftbüro in Barnstaple reichte mir der Beamte ein Protokoll der Anklage.
»Sie will nicht, dass ihre Mutter dabei ist«, sagte er. »Sie lehnt es ab, obwohl die Mama da ist. Die Sozialarbeiterin ist eben eingetroffen. Sie wollte auch keinen Anwalt, aber die Sozialarbeiterin hat sie überredet.«
Ich überflog die Anklage. Es war nicht ganz so, wie sie es am Telefon gesagt hatten.
Der Vorwurf lautete: »Fahrlässige Tötung im Straßenverkehr«, aber es gab einen Zusatz: »unter Alkoholeinfluss«.
Es war eine schockierende Anschuldigung, egal, wer damit konfrontiert wurde. Aber für eine Vierzehnjährige, deren Leben sich nur Stunden zuvor noch gemächlich und voller Möglichkeiten vor ihr erstreckt hatte, war es schlicht verheerend.
»Wurde sie schon befragt?«
»Nein. Die Sozialarbeiterin ist gerade erst gekommen.«
Die Polizei durfte Zoe aufgrund ihres Alters nicht ohne einen »geeigneten Erwachsenen« vernehmen. Da sie sich weigerte, ihre Mutter dabeizuhaben, hatten sie warten müssen, bis eine Sozialarbeiterin ihre morgendliche Schicht angetreten hatte.
Der diensthabende Beamte trug ein schwarzes Uniformoberteil mit hohem Kragen und kurzen Ärmeln, die sich um muskulöse Oberarme spannten. Er redete buchstäblich von oben herab auf mich ein, denn sein Schreibtisch stand auf einer Art Podest. Während er sprach, tippte er eifrig auf seiner Tastatur herum, die Augen fest auf den Bildschirm geheftet.
»Wir hatten gerade erst Übergabe, ich arbeite mich selbst eben erst in die Materie ein, aber sie wurde um vier Uhr dreißig nach zwei Stunden im Krankenhaus hierhergebracht.«
Zoe tat mir leid für die Stunden, die sie in der Zelle verbracht hatte. Selbst jene Klienten, die schon im Gefängnis gewesen waren, sagten, dass sie die Zeit in Polizeigewahrsam mehr als alles andere hassten. Es gibt keinerlei Ablenkung, nur vier Wände, eine Matratze auf einem Brett, eine Toilette, die vielleicht, vielleicht aber auch nicht, richtig abgeschirmt ist, und immer ist ein Paar Augen auf einen gerichtet, entweder konkret oder über die Kamera.
»Warum wollte sie ihre Mutter nicht sehen?«, hakte ich nach. Ich fragte mich, ob das Mädchen in einer Pflegeeinrichtung untergebracht war, beim Vater lebte oder verwaist war.
»Wir wissen es nicht genau. Mein Tipp ist: Sie schämt sich.«
»Schämt sich?«
Er zuckte die Schultern und machte mit den Armen eine ausladende Geste, die Handflächen nach oben gedreht. »Seit Zoe hier eingetroffen ist, sitzt die Mama im Eingangsbereich.«
Bei meiner Ankunft hatte eine einzelne Frau mit weißblondem Haar und zarten Gesichtszügen im Eingang gesessen. Sie hatte sich in eine Ecke gekauert und geschaudert, als die automatischen Türen einen kalten Luftzug mit mir hereintrugen, und sie hatte mir mit dem Ausdruck eines Menschen entgegengeblickt, der nichts Gutes mehr erhofft und keinen nennenswerten Schlaf gehabt hat.
Es war ein weitverbreiteter Gesichtsausdruck in den Wartezimmern, durch die ich kam: auf Polizeistationen und in Gerichtssälen, wo niemand sich auf das freut, was kommt.
Die gutaussehende Frau, die in jenem Augenblick aus dem Leben ihrer Tochter ausgesperrt worden war, war der erste Hinweis darauf, dass dieser Fall alles andere als unkompliziert werden würde.
Ich hatte keine Vorstellung von Zoe, bevor ich ihr begegnete. Inzwischen war ich erfahren genug, um zu wissen, dass es vielerlei Arten von Kriminellen gibt, so dass man nie vorhersehen kann, wie ein Klient sein wird. Hätte ich aber einen Tipp abgeben sollen, hätte ich vielleicht gemutmaßt, dass das Mädchen, dem ich nun begegnen sollte, eine reife Vierzehnjährige und ein womöglich etwas rauheres Exemplar sein würde, vermutlich im Trinken erfahren, vielleicht mischte sie auch ein bisschen in der örtlichen Drogenszene mit, sicher aber wäre sie ein echtes Partygirl.
Aber ich traf auf ein ganz anderes Mädchen. Die Polizei hatte ihr im Krankenhaus zur Beweisaufnahme die Kleidung abgenommen, also trug sie Kleider, die die Schwestern in der Notaufnahme für sie zusammengesucht haben mussten. Übergroße graue Jogginghosen und ein blaues Fleece-Oberteil mit hochgezogenem Reißverschluss. Auf der Schläfe war ein Wundpflaster, ihr Haar war lang und weißblond, eine Nuance heller als das ihrer Mutter, und winzige Glassplitter vom Unfall glitzerten darin.
Sie saß in einem Schalensitz aus Plastik, der am Boden festgeschraubt war, die Füße angezogen und die Arme um die Knie geschlungen. Sie wirkte zerzaust und sehr klein. Ihre Wangenknochen waren zart, die Augen von einem hellen, klaren Blau, und die Haut so blass wie der Reif draußen. Sie hatte die Hände in die Ärmel der Fleecejacke gesteckt, die an den Bündchen etwas schmuddelig wirkte, Flecken eines anderen Lebens, welche die Klinikwäscherei nicht hatte auswaschen können.
Neben ihr saß eine Frau mit dem stoischen Gesichtsausdruck eines Menschen, dem keine Niederung des Lebens fremd war. Sie war im mittleren Alter, die Frisur kurz und akkurat, und ihr Gesicht war tief zerfurcht und grau von den zwanzig Zigaretten, die sie vermutlich seit zwei Jahrzehnten täglich rauchte. Auf dem Tisch hatte sie ein ordentliches Häufchen aus Handschuhen, einem Hut und einem Schal plaziert.
Ich stellte mich Zoe vor, und sie überraschte mich, indem sie aufstand und mir einen verzagten Händedruck anbot. Stehend stellte sie sich als mittelgroß heraus und sehr dünn, sie ertrank fast in den geliehenen Kleidern. Sie wirkte außerordentlich zerbrechlich.
Wir setzten uns einander gegenüber.
Es war nicht der Anfang ihres Alptraums, der war Stunden zuvor gewesen, aber es war der Augenblick, in dem ich mit der heiklen Aufgabe beginnen musste, ihr verständlich zu machen, wie ernst ihre Lage tatsächlich war.
Sonntagabend
Das Konzert
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kamera aufnimmt, als Zoe und Lucas mit ihrem Duo anfangen, denn ein rotes Lämpchen blinkt in der rechten unteren Ecke des Displays, und ein Zählwerk scheint hektisch die Sekunden und Millisekunden, die vergehen, mitzuzählen.
Wie immer sehen Zoe und Lucas wunderbar aus auf dem Podium: ein entzückender Ausdruck jugendlicher Perfektion. Sie sind wie Yin und Yang, blond und dunkel, eine Eisprinzessin und ihr schwarzer Gefährte.
Ich bin eine der Ersten, die Tom Barlow bemerkten, weil das Kamerastativ und ich an der Seite des Gangs postiert sind, recht nah am Eingang, damit ich aufstehen und die Kamera bedienen kann, ohne jemandem die Sicht zu versperren.
Zunächst erkenne ich ihn nicht, und in dem Augenblick, da ich es doch tue, ist es zu spät, um etwas zu unternehmen.
Später frage ich mich, ob es anders gekommen wäre, wenn ich sofort reagiert hätte, ob ich ihn hätte aufhalten können und den Lauf der Dinge verhindert hätte, doch alles Spekulieren ist sinnlos, denn wie der Rest des Publikums mache ich nichts, als mit offenem Mund zuzusehen, wie er herumschreit und seine Spucke in der Luft versprüht.
Zoe ist die Letzte in der Kirche, die ihn bemerkt, dann aber lässt die Angst ihre Glieder wie eine Marionette zucken, und rumpelnd rettet sie sich von der Bühne. Ich kann es ihr nicht verdenken. Tom Barlow wirkt wie besessen, und er ist ein sehr großer Mann.
Als Maria aufsteht und einen schwachen Versuch macht, ihn zu beruhigen, lässt er nicht mit sich reden. »Sie haben Ihre Tochter noch«, sagt er, und wie Schläge treffen sie seine Worte. »Sagen Sie mir nicht, was ich zu tun habe. Sie haben Ihre Tochter.«
»Es tut mir so leid, Tom«, versucht sie, ihn zu beschwichtigen, aber er bügelt sie mit seiner Antwort nieder. »Es ist Ihre Schuld«, erwidert er. »Es war Ihre Schuld.«
Es gibt ein Durcheinander, als die Leute aufstehen und Mr. Barlow umringen, und er sinkt auf die Knie und fängt an zu schluchzen; schreckliche, herzzerreißende Laute, dass sich einem die Haare im Nacken aufstellen.
Ich weiß, wer er ist, denn natürlich kenne ich ihn vom Prozess. Wegen ihres Alters war Zoes Prozess nicht öffentlich, also war ich nie tatsächlich im Gerichtssaal; trotzdem bin ich jeden Tag hingegangen, habe im Zimmer für die Angehörigen der Anklage gewartet und die Opferangehörigen draußen auf der Straße vor dem Gericht gesehen, die dort tagein, tagaus in Gruppen herumstanden.
Wir haben Abstand gehalten, um Streit zu vermeiden, trotzdem weiß ich sicher, dass es Tom Barlow ist, denn sein Foto war auch in der örtlichen Presse. Er und die anderen Eltern wurden auf den Beerdigungen ihrer Kinder groß herausgestellt, schwarz gekleidet und von Trauer geschüttelt.
In dem Durcheinander bei dem Konzert folgt Maria Zoe hinter die Bühne, vorher allerdings gibt es einen angespannten Wortwechsel zwischen Maria und ihrem neuen Ehemann Chris, in dem er ihr Fragen zu stellen scheint und sie den Kopf energisch schüttelt. Maria begegnet meinem Blick, als sie hinausgeht, sie sieht gequält aus, und mit den Lippen forme ich den Satz: »Soll ich mitkommen?« Sie verneint, und ich setze mich zurück auf meinen Platz. Ich bin nicht scharf darauf, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Andere scharen sich kniend um Tom Barlow und kümmern sich um ihn, also muss ich es nicht tun. Es ist besser, wenn er mich zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt. Möglicherweise würde er mich erkennen.
Ich frage mich, woher Tom Barlow wusste, dass Zoe heute Abend hier sein würde. Seitdem sie aus Devon weggezogen ist, hat sie einen neuen Nachnamen, sie hat sämtliche Verbindungen zu den Familien und allem anderen abgebrochen. Wir alle dachten, sie hätte Amelia Barlows Familie hundert Meilen hinter sich gelassen.
Falls wir tatsächlich das Pech haben, dass Tom Barlow mit seiner Frau und den übrigen Kindern ebenfalls hierhergezogen ist, wird es nicht lange dauern, bis die Leute den Zusammenhang herstellen. Womöglich war der Umzug von Zoe und meiner Schwester nach Bristol nicht weit genug, um der Tragödie zu entkommen, und in Bristol machen Neuigkeiten schnell die Runde. In manchen Kreisen der Stadt sind die Leute um nur wenige Ecken miteinander bekannt.
Chris Kennedy folgt Maria und Zoe nicht. Stattdessen stellt er sich neben Lucas, der immer noch am Klavier sitzt. Beide beobachten mit schockiertem, ungläubigem Gesichtsausdruck die abklingenden Zuckungen von Tom Barlows Zusammenbruch, und mich überkommt bleierne Schwere, als ich an all die Geschichten denke, die nun erzählt, all die Wahrheiten, die aufgedeckt werden müssen, und traurig wird mir die Unmöglichkeit bewusst, dass das leuchtende, glückliche neue Leben meiner Schwester weitergeht wie bisher.
Zoe, unsere geliebte Zoe, hat wieder einmal das häusliche Glück zum Implodieren gebracht.
Als Mr. Barlow fortgeräumt ist, aufgewischt wie ein verschüttetes Getränk, wird entschieden, dass Lucas allein weitermacht. Auf diese Nachricht hin setzt sich das Publikum wieder, und ich prüfe, ob die Videokamera noch aufzeichnet. Auf dem Display sehe ich Lucas, und ich finde, dass ich ihn ganz gut im Bild habe. Auch das Profil von Chris Kennedy kann ich sehen; völlig still sitzt er da und blickt starr nach vorn. Nur eine kleine Falte auf seiner Stirn und die vollkommene Reglosigkeit seiner Gesichtszüge verraten, dass er innerlich mit dem Nichtbegreifen ringt.
Sonntagabend
Nach dem Konzert
Das dornige, spitze, übliche Schweigen im Auto auf der Heimfahrt mit meiner Mutter bedeutet, dass ich mich ein bisschen sammeln kann, denn meine Mutter mag es nicht, wenn man weint. Diese Art Schweigen herrscht oft zwischen mir und meiner Mum. Sie hat das Lenkrad fest im Griff, weiß zeichnen sich ihre Knöchel ab. Als ich etwas sagen will, unterbricht sie mich und erklärt, dass sie nachdenken muss.
Also bleibe ich still, doch die Ruhe wird gestört, als wir in die Auffahrt einbiegen, denn die Mauern unseres großen, prächtigen Hauses vibrieren von jener Art stampfender Klänge, die Lucas und ich nur heimlich auf unseren iPods hören können.
Es ist Popmusik, wie die Kids in der Strafanstalt sie mochten. Hier, in diesem Haus, wird dieses Vergnügen streng rationiert, damit Lucas und ich die genau austarierte Zufuhr des klassischen Repertoires nicht stören, mit der wir unsere Musikalität weiter ausbilden sollen.
Mum eilt ins Haus, und ich folge ihr. Wegen der Lautstärke bemerkt uns Katya, unser Au-pair, erst, als wir schon im Wohnzimmer sind und direkt hinter ihr stehen.
Sie sitzt auf dem Sofa und hat meine kleine Schwester Grace auf den Knien, und gleich daneben, so dicht, dass es aussieht, als klebe er an ihr, ist ein Junge, Barney Scott, den ich aus der Schule kenne. Grace lacht lauthals, weil Katya sie an den Armen festhält und auf und ab hopsen lässt, aber als sie uns sieht, streckt sie die Hände nach meiner Mum aus, und Katya und Barney springen vom Sofa auf. Sie streichen sich die verrutschte Kleidung glatt und haben sich in beeindruckender Geschwindigkeit gefasst.
»Hallo, Maria, hallo, Zoe«, sagt Katya und reicht Mum das Baby.
Meine Mutter ist sprachlos angesichts dieser unverfrorenen Übertretung aller häuslicher Regeln: die Musik, der Freund, das Baby zur Schlafenszeit im Wohnzimmer. Sie packt Grace, als hätten wir eben erfahren, dass ein Erdrutsch uns fünf und die gesamte Menschheit demnächst mit sich in den Ozean reißen wird.
»Ich hoffe, nicht schlimm, dass Barney da, aber sein Vater Arzt, und Grace sehr unruhig«, sagt Katya. Ihr starker russischer Akzent und das ausdruckslose Gesicht, die Wangen wie Kalksteinplatten, verleihen dem Satz augenblicklich Gewicht.
Ich schaue zu meiner Mum. Selbst sie ist nicht bescheuert genug, um auf den Teil mit dem Vater und dem Arzt hereinzufallen, aber es ist offensichtlich, dass Katya mit der Bemerkung, dass Grace unruhig war, einen satten Volltreffer gelandet hat.
Grace ist das Baby unseres Zweiten Lebens, das Wunderbaby. Sie ist ein »Geschenk an uns alle«. Sie stammt zur Hälfte von Mum und zur Hälfte von Chris ab und ist somit ein Produkt dessen, was Lucas die »perfekte Verbindung« nennt. Wie Chris bei ihrer Taufe gesagt hat, hat sie ein »wunderbar sonniges Gemüt«, ist eine »Freude für uns« und hat uns allen »bei unserem Neustart geholfen«.
Das bedeutet, dass Katyas Bemerkung die Psyche meiner Mum geschickt auf den Pfad gelenkt hat, den sie am liebsten einschlägt, nämlich den der Sorge um die Gesundheit von Grace.
Und so übersieht meine Mutter die Tatsache, dass Grace bester Laune ist und glänzt vom leichten Schweißfilm der Reizüberflutung. Augenblicklich trägt Mum sie nach oben, um sie hinzulegen, und Katya folgt ihr, während ich mit Barney Scott allein im Zimmer zurückbleibe. Es fühlt sich merkwürdig an, denn im Normalfall wären wir zwei niemals allein in einem Raum, nie im Leben. Das liegt daran, dass er einer der Angesagten Jungs an meiner Schule ist.
Barney Scott zerknüllt sein Gesicht, ich vermute, dass er versucht, mich anzulächeln.
Das wirft die Frage auf, was er und Katya vorhatten, denn nur sein Schuldbewusstsein kann ihn zu so etwas verleiten.
»Hey«, sagt er.
»Hey«, sage ich zurück.
»Ihr seid früher dran.«
»Sieht so aus.«
»Hm.« Er nickt mit dem Kopf wie ein Wackeldackel auf der Hutablage. »Hast du … äh … gut gespielt?«
Barney Scott interessiert sich nicht dafür, wie ich gespielt habe, doch es beeindruckt mich schon, dass er sich die Mühe macht, nachzufragen. Er gehört zu den Jungs, die Sachen posten wie »Treffen im Park. 8 Uhr. Grillen, saufen, huren«. Er hält sich für unglaublich cool, und vermutlich hat er recht, denn Mädchen wie Katya oder die Angesagten Mädchen der Schule gehen dann tatsächlich hin, in mikroskopisch kleinen Shorts, bei denen die Innentaschen unten heraushängen, und mit auf Fernreisen gebräunten Beinen, um sich zu betrinken und anschließend begrapschen zu lassen.
»War okay«, sage ich. Barney Scott braucht nicht zu wissen, was los war, und ich will, dass er abzieht.
Offensichtlich will auch er nicht mit mir zusammen sein. »Ich warte draußen«, sagt er und deutet mit einem Wink auf die Haustür, als wüsste ich nicht, wo sie ist.
»In Ordnung«, antworte ich, aber während ich ihm nachsehe, will ich ihm eigentlich dringend sagen, dass auch schon mal ein Angesagter Junge in mich verliebt war, oder zumindest war er scharf auf mich, und dass ich nicht so doof oder unwitzig bin, wie alle meinen. Das bin ich nicht.
Mein ureigener Angesagter Junge hieß Jack Bell, und er wirkte, als habe er mich gern. Sehr sogar. Leider standen uns Hindernisse im Weg, das größte davon Jacks Zwillingsschwester Eva, die das Allerangesagteste Mädchen der ganzen Schule war. Eva verlor keine Zeit, mir zu sagen, dass ihr Bruder nicht etwa verliebt war, sondern »sich durch die Betten schlafe«. Das Mädchen, das er eigentlich mochte und das er wirklich haben wollte, sagte Eva, war ihre beste Freundin Amelia Barlow.
Und obwohl Eva Bells Wort für die meisten Leute um mich herum Gesetz war, glaubte ich ihr nicht, denn ich merkte, wie Jack Bell mich ansah. Selbst jetzt noch, wenn ich daran denke, habe ich dieses flaue Gefühl. Vielleicht bin ich sozial unbeholfen, das weiß ich schon, aber blöd bin ich nicht.
Aber ich muss dieses flaue Gefühl ganz schnell abtöten, denn Jack Bell ist, genau wie Amelia Barlow, tot und begraben, und ich halte den Schmerz nicht aus.
Das Wohnzimmerfenster steht weit offen, doch immer noch ist es heiß und stickig im Haus. Draußen auf dem Kies höre ich Barney Scott knirschen, und ich sehe, wie er sich an das Gartentor lehnt und auf Katya wartet.
Ich will, dass meine Mum herunterkommt, aber ich möchte sie nicht dabei stören, wenn sie Grace ins Bett bringt. Langsam kriecht die Angst in mir hoch, wenn ich mir ausmale, was passiert, wenn Chris und Lucas nach Hause kommen, denn sie werden wissen wollen, was zum Teufel Mr. Barlow dort in der Kirche gemeint hat, als er herumgeschrien hat. Wenn unsere neue Familie nicht zerstört werden soll, dann müssen Mum und ich uns überlegen, was wir sagen.
Montagmorgen
Ich muss sie wecken, denn ich muss ihr von Maria und Zoe erzählen, auch wenn sich alles in mir dagegen sträubt.
»Tessa«, sage ich. »Tess.« Sie liegt unter einem dünnen Laken, unter dem sich ihr Körper so plastisch abzeichnet, als habe jemand es sorgfältig über sie gelegt, wie die ersten feuchten Bandagen eines Gipsverbandes.
Schnell ist sie hellwach, ihre Augen weit offen. Sie hat in meiner Stimme etwas wahrgenommen.
»Was ist?«, fragt sie, ein Flüstern nur. Noch hat sie sich nicht bewegt.
Ich möchte den Grund, warum ich sie geweckt habe, hinunterwürgen, ihr niemals davon erzählen. Ich will ihr das nicht antun.
»Es tut mir so leid«, sage ich, und ich fühle mich schrecklich förmlich bei diesen Worten, ein steifes Räuspern. Meine Worte rauben uns die Intimität.
In dem Augenblick, als ich Tessa erzählt habe, dass ihre Schwester tot ist, sie sich aufsetzt und in meinen Augen nach der Bestätigung sucht, dass ich die Wahrheit sage, kommt mir die erstaunliche Erkenntnis, dass sie Maria mehr ähnelt, als ich je zuvor wahrgenommen habe.
Nach einer Weile, in der ich sie fest in meinen Armen halte, während sie vom Schock erfasst wird, und mir – egal wie grauenhaft klischeehaft das klingen mag – das Herz schmerzt, muss ich sie loslassen.
Diesem Herzschmerz aber, dem scharfen Stich, darf ich nicht nachgeben. Es ist eine seichte, selbstsüchtige, ölige Gefühlslache im Vergleich zum Ozean aus Schmerz, den Tessas Familie durchlitten hat und nun wieder durchleiden wird. Um die Metapher auf die Spitze zu treiben: Ihr Leid würde den Marianengraben füllen.
Ich suche Tessas Kleider zusammen, und schweigend zieht sie sich an. Als sie fertig ist, frage ich: »Willst du mitkommen? Um Zoe zu sehen? Und Richard?«
Sein Name scheint schwer in der Luft zwischen uns zu hängen, doch in diesem Augenblick ist er ihre geringste Sorge.
»Ich sollte zuerst zum Haus fahren«, meint Tess. »Ich muss sie … und das Baby …«
Sie bringt den Satz nicht zu Ende, der Schock und das Nichtbegreifen schnüren ihr die Worte ab. Wir wissen nicht viel, nur dass Maria in ihrem Haus gestorben ist, nicht aber, wie. Mir ist klar, dass es vorläufig meine Aufgabe ist, mich um Zoe zu kümmern, egal, wer bei ihr ist.
»Soll ich dich dort absetzen?«, frage ich. Ich mache mir Sorgen, dass sie Auto fährt.
Wir stehen im Treppenhaus meines Wohnhauses. Es ist klein und hell, mit Fenstern, die vom Boden bis zur Decke reichen, mit Blick über die stark befahrene Straße voller Pendler; es gibt keinen Aufzug, nur die zweckmäßige Metalltreppe, die hinunter zum Erdgeschoss und dem Parkplatz führt. Es ist stickig und drückend hier.
»Nein«, antwortet Tess. »Du musst zu Zoe. Ich komme später nach.« Dann ist sie fort, und ich höre nur mehr die Sandalen auf den Stufen klackern.
Sonntagabend
Nach dem Konzert
Der Debussy von Lucas dauert vierzehn Minuten und der Bach neun Minuten. Wenn man die Zeit dazurechnet, die Lucas braucht, um hinterher mit dem Publikum zu plaudern, und die Heimfahrt danach, und außerdem einbezieht, dass Mum und ich das Auto genommen haben und Tante Tess sie in ihrem VW-Bus nach Hause bringt, der nicht schneller als sechzig Stundenkilometer fährt, wenn man nicht will, dass schwarzer Rauch aus dem Auspuff kommt, dann dürften Mum und ich ursprünglich etwa eine Stunde und zehn Minuten gehabt haben, bevor Chris und Lucas hier eintreffen, abzüglich der Zeit, die es gedauert hat, Katya und Barney hier auf dem Sofa zu erwischen, und der Minute, die Barney es mit mir in einem Raum ausgehalten hat. Damit bleiben uns etwa achtundfünfzig Minuten.
Ich warte, ausgestreckt auf der Couch, während Mum oben bei Grace ist. Meine Hüfte schmerzt dort, wo ich mich am Klavier gestoßen habe, und ich ziehe das Kleid hoch, um die Stelle zu untersuchen. Schon hat sich ein dunkler Bluterguss gebildet, der empfindlich auf jede Berührung reagiert. Der Anblick treibt mir Tränen in die Augen, und ich schließe sie, lege mich wieder hin und versuche so zu atmen, wie man es mir beigebracht hat, um die Gedanken auszuschalten und mich ganz und gar auf das Gefühl des Ein- und Ausatmens zu konzentrieren.
Es ist heiß. Die Behausung unseres Zweiten Lebens ist ein großer viktorianischer Klotz, und meistens ist es klamm und kalt, egal, welches Wetter draußen herrscht. Doch in diesem Sommer ist es schon so lange heiß, dass die Hitze sich langsam aufgestaut hat; heute fühlt es sich an, als sei der Höhepunkt erreicht, als sei die Luft im Haus endgültig zum Kochen gebracht, heiß wie die Jazzmusik, die in einem vollgepackten Club von der Decke tropft, oder wie die rote Sonne, die über der orangefarbenen Wüste pulsiert, in dem Fotoband, den mir mein Vater schenkte, als ich klein war.
Von oben höre ich, wie die Spieluhr, die über dem Kinderbett von Grace hängt, aufgezogen wird, dann beginnt der blecherne Lärm, in vertrauter Eintönigkeit; nervtötendes Klimpern.
Plötzlich taucht Katya im Türrahmen auf und sieht mich wortlos an.
»Er ist draußen«, sage ich.
»Ich weiß. Ich ihm haben SMS geschrieben. Deine Mutter bringen Grace ins Bett.«
»Ich weiß.«
Katya steht länger in der Tür, als mir angenehm ist, und still liege ich da und wünsche mir, dass sie weggeht.
»Ich haben versucht, deine Freundin zu sein«, sagt sie, aber dafür habe ich jetzt absolut keinen Nerv. Sie hat doch keine Ahnung.
»Danke, Katya«, antworte ich. »Spasibo.« Das sage ich, weil es sie ernsthaft aufregt, wenn ich versuche, Russisch zu sprechen. Ich hole mein Handy heraus und wische darauf herum. Es soll so aussehen, als erwarte ich die Nachricht einer tatsächlich existierenden Person.
»Zoe, du bist deine schlimmste Feindin.«
»Wie originell«, sage ich.
»Wie bitte?«
»Ich habe gesehen, was ihr gemacht habt.« Plötzlich fühle ich mich verwundbar in meiner ausgestreckten Position – merkwürdig, wie man sich auf glamouröse Weise erhitzt und ausgelaugt wie eine keuchende Diva aus einem alten Film fühlen kann und im nächsten Augenblick feststellt, dass man vermutlich einfach nur dämlich aussieht. Also setze ich mich auf und blicke sie über die Rückenlehne der Couch direkt an. »Du und Barney. Ich habe gesehen, wo seine Hand war.«
Sie verzieht das Gesicht zu einem Ausdruck von Abscheu und Trauer über meinen amöbenhaften Entwicklungsstand.
»Unangemessen«, sagt sie. »Total aber auch.« Sie hat oft einen amerikanischen Einschlag, mit dem sie klingt, als moderiere sie den Eurovision Song Contest.
Gerade will ich sagen, dass nicht ich es bin, die sich unangemessen verhält, sondern dass das, was sie gemacht hat, unangemessen war. Hat meine Mum ihr überhaupt erlaubt, heute Abend noch mit Barney auszugehen? Doch dann brummt ihr Handy, und wir sind beide darauf dressiert, still zu sein, wenn ein Telefon brummt – Tante Tessa sagt, das sei eine der Haupteigenschaften unserer Generation: die Ehrfurcht vor dem Klingelton –, also schweigen wir beide, während sie die Nachricht liest.
»Barney wartet«, sagt sie, dreht sich so schnell um, dass die strähnigen Enden ihrer Haare fächerartig herumschwingen, und ist fort, bevor ich meine Replik zusammenhabe.