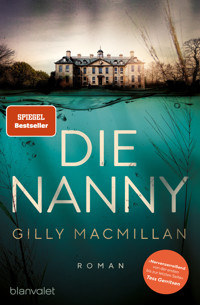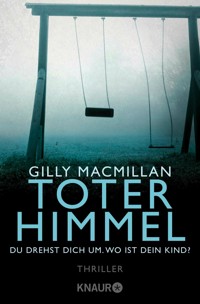9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein abgelegenes Cottage und kein Kontakt zur Außenwelt – wem kannst du trauen? Der hoch spannende Roman
von SPIEGEL‐Bestsellerautorin Gilly Macmillan
Drei Frauen treffen in einem abgelegenen Ferienhaus ein, tief in der Moorlandschaft von Northumbria an der schottischen Grenze. Es ist der erste Abend ihres langen Wochenendes, am nächsten Morgen erwarten sie ihre Ehemänner. Doch auf dem Küchentisch von Dark Fell Barn finden sie einen Brief, in dem jemand behauptet, einen ihrer Ehemänner umgebracht zu haben. Die drei Frauen glauben zuerst an einen perfiden Scherz. Doch sie haben weder Handyempfang noch Internet – und ein Sturm zieht auf. Die Frauen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Als jede von ihnen versucht herauszufinden, was passiert ist – ob überhaupt etwas passiert ist –, werden ihre Freundschaften auf eine harte Probe gestellt. Die Situation droht zu eskalieren ...
Packend, perfide, atmosphärisch: Lesen Sie auch »Die Nanny«, »Die Vertraute« und »Die Witwe«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Drei Frauen treffen in einem abgelegenen Ferienhaus ein, tief in der Moorlandschaft von Northumbria an der schottischen Grenze. Es ist der erste Abend ihres langen Wochenendes, am nächsten Morgen erwarten sie ihre Ehemänner. Doch auf dem Küchentisch von Dark Fell Barn finden sie einen Brief, in dem jemand behauptet, einen ihrer Ehemänner umgebracht zu haben. Die drei Frauen glauben zuerst an einen perfiden Scherz. Doch sie haben keinen Handyempfang. Es gibt kein Internet – und ein Sturm zieht auf. Die Frauen sind von der Außenwelt abgeschnitten, und als jede von ihnen versucht herauszufinden, was passiert ist – ob überhaupt etwas passiert ist –, werden ihre Freundschaften auf eine harte Probe gestellt. Die Situation droht zu eskalieren …
Autorin
Gilly Macmillan wuchs in Swindon, Wiltshire, auf und lebte in ihrer Jugend einige Jahre im Norden Kaliforniens. Sie arbeitete beim Burlington Magazine, für die Hayward Gallery und als Dozentin für Fotografie. Heute widmet sie sich ganz dem Schreiben. Gilly Macmillans Romane erfreuen sich besonders in Großbritannien großer Beliebtheit und sind allesamt Bestseller. Sie lebt mit ihrer Familie in Bristol, England.
Von Gilly Macmillan bereits erschienen
Die Nanny · Die Vertraute
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
Gilly Macmillan
Ein langes Wochenende
Und dein Mörder wartet schon
Roman
Deutsch von Sabine Schilasky
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »THE LONG WEEKEND« bei Century, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Gilly Macmillan
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kerstin Kubitz
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von © Silas Manhood/Trevillion Images und stock.adobe.com (Martin, Taigi, Helen Hotson)
JaB · Herstellung: sam
Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29598-1V004
www.blanvalet.de
Im Andenken an Oscar Macmillan, einen sehr braven Hund
FREITAG
John sollte eigentlich nicht fahren. Das hatten sie gestern mit dem Arzt besprochen, aber Maggie sieht seinen Blick und legt ihm den Schlüssel in die ausgestreckte Hand. Sofort umschließt er ihn mit den Fingern.
Er steigt in den Land Rover, ohne die Taschen mit sauberer Bettwäsche und Handtüchern mit einzuladen, doch Maggie sagt nichts. Sie hievt alles selbst hinein. Die Hündin springt hinterher und legt sich hin, den Rücken gegen die Taschen gedrückt, die Zunge heraushängend und der Blick angespannt. Maggie schließt die Heckklappe.
Heute Morgen weht ein kalter Wind, der ihr durch und durch geht. Es ist erst Anfang September und doch ganz plötzlich schon Herbst. Ein Unwetter liegt in der Luft. Wolken jagen über den Himmel und brauen sich zusammen, wobei ihre Schatten das massive Farmhaus aus Stein und Schiefer streifen, das sich in eine Senke an der Seite des Tals schmiegt.
John lässt den Motor an, über dessen Brummen hinweg Maggie noch ein anderes Motorengeräusch zu hören glaubt. Sie runzelt die Stirn. Ihre Gäste sollen erst am Nachmittag ankommen, und die schmale Straße hier führt nirgends sonst hin. Wer sie entlangfährt, ist entweder auf dem Weg zur Elliott-Farm oder hat sich verirrt.
Trockenmauern trennen und ordnen das Land um das Farmhaus herum. Dahinter liegen viele Morgen offenes Weideland, das steil und nur teils nutzbar ist. In der Ferne geht es ungeordnet in weite, nicht zu bewirtschaftende wilde Heidelandschaft mit versteckten Mooren über, zerklüftet durch abgelegene Täler und raue Schluchten, deren Hänge rutschig von Geröll sind. Felsvorsprünge durchbrechen die Silhouetten der entfernten Gipfel.
Die Farmgrenzen sind nur vage gekennzeichnet. Einiges von der Wildnis gehört noch zum Elliott-Land, und das seit Jahrhunderten. John und Maggie bewirtschaften dreitausend Morgen, auf denen sie achthundert Schafe halten. Hier gibt es gutes und schlechtes Gras, gute und schlechte Jahre. Der Himmel ist stets weit, und die Sterne funkeln nachts heller als irgendwo sonst. Das fällt den Gästen in der Scheune auch immer auf.
Maggie wartet einen Moment, ob sie mehr hört, aber der Land Rover ist zu laut. Sie trödelt nicht. Hier oben können Geräusche täuschen, und sie hat zu tun.
Sie legt ihren Gurt an. »Ich dachte, ich hätte jemanden kommen hören.«
John reagiert nicht. Er tritt aufs Gas, und der Land Rover setzt sich in Bewegung. Maggie sieht John an.
»Geht es dir gut?«
»Warum sollte es mir nicht gut gehen?« Er lenkt den Wagen durch das Gatter und rumpelnd über die Schlaglöcher.
»Sei nicht so.«
»Entschuldige.«
Er blickt nach vorn, und Maggie betrachtet sein Profil. Die Nase und die Wangen sind durchzogen von einem Netz aus roten geplatzten Äderchen, und die Haut spannt sich über den Knochen. Heute hat er sich sehr nachlässig rasiert, doch seine Augen sind so freundlich wie eh und je. Er ist ein guter Mann. Maggie wusste es gleich an dem Tag, an dem sie ihm begegnet war.
Sie schaut genauer hin, sucht nach äußeren Anzeichen des Unsichtbaren: jene Hirnregionen, in denen die Verbindungen genauso brüchig sind wie seine feinen Blutgefäße. »Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Lewy-Körper-Demenz handelt, tut mir sehr leid«, hatte der Arzt gesagt. Wann der Termin gewesen ist, weiß sie nicht mehr genau, weil es so viele gegeben hat, aber sie wird sich immer an die Diagnose und diese Mitleidsbekundung erinnern, denn John zuckte zusammen, als wäre er geschlagen worden.
Sie ist so damit beschäftigt, ihn anzusehen, dass sie das Motorrad nicht bemerkt, das um die Kurve gerast kommt; schwarz, in extremer Schräglage und hochmotorisiert. Es hält direkt auf sie zu und ist viel zu schnell.
John tritt heftig auf die Bremse und stemmt sich im letzten Moment vom Lenkrad ab. Maggie wird nach vorn und wieder zurück geschleudert, sodass ihr die Luft wegbleibt.
»Entschuldige«, sagt er in der Stille danach. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Ich glaube, ja. Und mit dir?« Ihr Herz hämmert, und sie verzieht das Gesicht, als ihr plötzlich ein Schmerz durch Brust und Schulter fährt, wo der Sitzgurt sich gestrafft hat.
»Tut es weh?«, fragt er.
»Ist nicht so schlimm.«
John nickt und sieht nach hinten zu der Hündin. Sie hat zwar die Augen so weit aufgerissen, dass das Weiße zu sehen ist, scheint aber ansonsten unversehrt. Einzig ein Handtuch ist aus den vollen Taschen auf sie gefallen.
»Alles gut, Birdie«, sagt John zu der Hündin.
Das Motorrad ist schlitternd quer auf der Straße zum Stehen gekommen, beängstigend nahe vor der Kühlerhaube des Land Rovers. Der Fahrer ist ein massiger Mann in schwarzer Lederkluft und mit einem schwarzen Helm. Selbst mit dem Helm erkennen sie, dass es keiner der Kuriere aus der Gegend ist.
Er steigt ab. Im Helmvisier spiegeln sich die dunklen Bäume zu beiden Seiten der Straße. Auf einmal bekommt Maggie Angst, dass er wütend auf sie sein und versuchen könnte, ihnen die Schuld für den Beinahezusammenstoß zu geben. Gegen einen Kerl wie ihn wären sie wehrlos. Maggie atmet schwer.
John lässt das Seitenfenster herunter. »Sie müssen aufpassen, wo Sie hinfahren«, ruft er. An seiner Schläfe pulsiert eine Ader.
»Nicht«, warnt Maggie. Früher hat sie sich hier oben vor allem außer vor den Elementen sicher gefühlt. Sie hat es geliebt, so abgelegen, praktisch am Rande der Zivilisation, zu leben. Doch Johns Diagnose hat eine Veränderung herbeigeführt, die dem stürmischen Wind heute ähnelt. Sie hat alles durchgerüttelt, und Maggie fürchtet, dass John und sie einen Punkt im Leben erreicht haben, an dem etwas, das einmal erschüttert ist, für immer lose bleibt.
Birdie steht knurrend auf und schiebt den Kopf zwischen den beiden Vordersitzen nach vorn. Sie bleckt die Zähne.
»Birdie!« Maggie legt der Hündin eine Hand auf den Nacken. Das Knurren verstummt, aber Birdie bleibt spürbar angespannt und ihr Nackenfell gesträubt. Sie fixiert den Motorradfahrer.
Der Mann klappt das Visier hoch, als er sich der Fahrerseite des Land Rovers nähert. Sein Mund ist von einem Bandana verhüllt, und seine Augen liegen im Schatten. »Ich bin auf der Suche nach den Elliotts.« Dem Akzent nach ist er aus dem Süden, also von weit her, denn hier sind sie nur noch einen Katzensprung von der schottischen Grenze entfernt.
»Das sind wir«, antwortet John.
»Ich habe ein Paket für Sie.«
»Pakete sollen unten in die Kiste neben dem Hauptgatter gelegt werden.«
»Ich habe aber Anweisung, es Ihnen persönlich auszuhändigen.«
Sie beobachten, wie er ein Paket hinten von seinem Motorrad holt, wobei er es nicht gerade eilig hat. Dann reicht er John einen Pappkarton, den John an Maggie weitergibt. Der Karton ist nicht zugeklebt, nicht beschriftet und relativ schwer. Maggie öffnet die Klappen und späht hinein zu einem zweiten Karton, der würfelförmig und hübsch in Geschenkpapier mitsamt Schleife verpackt ist. Daneben steckt ein Umschlag. Maggie nimmt ihn heraus und holt die Brille aus ihrer Blusentasche, damit sie die kleinen Worte in sauberer Druckschrift lesen kann. »AN JAYNE, RUTH UND EMILY.«
»Das ist nicht für uns«, sagt sie, doch noch während sie es ausspricht, fällt es ihr wieder ein. »Die Frau, die für dieses Wochenende die Scheune gebucht hat, heißt Jayne. Es muss für sie sein. Für die Gäste.«
»Da ist auch eine Nachricht für Sie.« Der Motorradfahrer reicht ihnen ein Blatt Papier mit getippten Anweisungen. Maggie liest laut vor.
»›Nehmen Sie das Geschenk bitte aus dem Karton und stellen Sie es gut sichtbar auf den Küchentisch im Dark Fell Barn. Bitte lehnen Sie den Umschlag daran, sodass meine Freundinnen das Ganze gleich bei ihrer Ankunft sehen. Es ist eine besondere Überraschung, deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es möglichst genau so handhaben. Vielen Dank.‹«
Es ist keine Unterschrift unter den Anweisungen. Maggie dreht das Blatt um, aber auf der Rückseite steht nichts.
»Na, ich denke mal, das ist in Ordnung«, sagt sie. Ihre Anspannung verebbt. Manchmal tun Gäste die seltsamsten Dinge. »Wir wollen sowieso gerade nach oben zur Scheune.« Sie ist immer noch ein wenig beunruhigt, aber es ist ihr auch peinlich, dass sie vorher solche Angst gehabt hat.
Der Motorradfahrer nickt. Er klappt das Visier herunter und ist so schnell wieder weg, wie er gekommen ist. Von den Motorradreifen spritzt Schmutz auf, und Maggie hat lauter Fragen auf der Zunge. Zum Beispiel, von wem er wo diesen Karton abgeholt hat und warum er sich die Mühe gemacht hat, ihn den weiten Weg herzubringen. Natürlich geht es sie nichts an, aber diese »besondere Überraschung« und die »besonderen Anweisungen« machen sie neugierig.
»So etwas hatten wir noch nie«, sagt sie. »Von wie weit her mag er gekommen sein?«
»Wir hätten ihn umbringen können.«
John spricht mit zusammengebissenen Zähnen. Er ist wütend, weil ihm dieser knapp verhinderte Zusammenprall Angst gemacht hat, denkt Maggie. Sie fragt sich, ob nicht doch lieber sie fahren sollte, falls er sich zu sehr hineinsteigert. Sie will es vorschlagen, aber die Worte bleiben ihr im Hals stecken. Jedes Hilfsangebot von ihr verletzt ihn in seiner Würde, und sie bringt es nicht übers Herz, denn es würde ihn kränken.
Stattdessen hebt sie den Karton an und schwenkt ihn vorsichtig. »Was einige Leute an Mühe auf sich nehmen«, sagt sie. »Ich hoffe, das da drin ist es wert.«
John sieht kurz hinüber, schüttelt den Kopf und murmelt etwas, das Maggie nicht versteht, weil er schon wieder zur Straße blickt. Ihr fällt auf, wie fest er das Lenkrad umklammert. Die dünner werdende Haut an seinen Fingerknöcheln ist weiß.
Diese Hände, denkt sie. Ihr ist bewusst, dass sie seit der Diagnose dazu neigt, zu grübeln und Erinnerungen nachzuhängen, aber das erlaubt sie sich. Sie liebt die Altersflecken, die schnurartigen Sehnen. In ihnen erkennt sie die glücklichen Jahre ihrer Ehe und die Herausforderungen des Lebens auf der Farm.
Doch das feste, beidhändige Umgreifen des Lenkrads, das Kopfschütteln und das Murmeln – das ist er nicht. Es ist eine weitere Veränderung, die neu und beängstigend ist. Noch lernt Maggie, seine Symptome zu lesen und zu entschlüsseln, was sie bedeuten mögen, und sie hat das schlimme Gefühl, dass heute einer der Tage sein könnte, an dem er in einen schrecklichen Pessimismus verfällt.
»Was soll das Kopfschütteln?«
»Es ist was Schlimmes, dieses Paket.«
»Wie kommst du darauf? Woher willst du das wissen?«
Er neigt den Kopf und sagt, er weiß es. Sie will es weglachen, aber es klingt unecht. Und tatsächlich stellt sie fest, dass sie seine Worte irgendwie doch ernst nimmt. John mag in Schwarzmalerei oder Verzweiflung versinken, mag grundlos aufgeregt oder vergesslich sein, manchmal sogar Dinge sehen, die nicht da sind, was alles sehr besorgniserregend ist; aber Maggie kann nicht leugnen, dass er, schon seit sie sich kennen, mehr Dinge wahrnimmt oder erspürt als die meisten Menschen.
Sie berührt ihren Nacken, sucht nach einer Verhärtung von dem Schleudern eben. Die kalten Fingerspitzen lösen ein Erschaudern aus, das ihren ganzen Körper durchfährt. Sie denkt an das Paket, ob es etwas Gutes oder Schlechtes ist. Nachdem sie eine Weile geschwiegen haben, stellt Maggie es in den Fußraum.
Der Land Rover wippt und hüpft die holprige Piste hinauf. Maggie stützt das Paket mit einem Fuß, wenn die Bewegungen zu heftig werden und den Inhalt zu beschädigen drohen. Wenn das, was da drin ist, kaputtgeht, könnten die Gäste eine schlechte Bewertung online stellen, und das wäre das Letzte, was John und Maggie brauchen können.
Ich hatte den Brief geschrieben und das Geschenk eingepackt. Dabei hatte ich mir Zeit gelassen, damit es auch ja schön aussieht. Und ich hatte mir genau überlegt, wie ich die Anweisungen für die Besitzer von Dark Fell Barn formuliere. Schließlich habe ich die Lieferung sorgsam so arrangiert, dass sie nicht zu mir zurückverfolgt werden kann.
Und jetzt habe ich eben die Bestätigung auf meinem Wegwerfhandy bekommen, dass Brief und Paket ausgehändigt wurden, zusammen mit meinen Instruktionen.
Puh!
Es ist wirklich ein tolles Gefühl, hauptsächlich Erleichterung, aber auch Befriedigung, weil mir die Planung solchen Spaß gemacht hat. Wenn man wollte, könnte man mich einen Kontrollfreak nennen.
Was als Nächstes geschieht, liegt allerdings nicht mehr bei mir, und das ist ein sehr beunruhigender Gedanke. Aus der Ferne Regie bei einem Theaterstück zu führen ist nicht einfach.
Ich hoffe, die Elliotts tun, worum ich sie gebeten habe, und platzieren alle Requisiten genau richtig für den Moment, in dem sich der Vorhang zum ersten Akt öffnet.
Draußen ziehen dichte Baumreihen mit schnurgeraden Stämmen vorbei, deren Laub so tief hängt, dass es das Licht des späten Nachmittags abfängt. Emily nimmt einen ihrer Ohrhörer raus. »Das sieht ja aus wie im Märchen«, sagt sie.
Sie räuspert sich nach stundenlangem Schweigen, zieht die Ärmel ihres Pullovers über die Handgelenke und schlingt die Arme fest um den Oberkörper. Sie hätte Jayne oder Ruth bitten sollen, die Heizung hochzudrehen, aber dafür ist sie zu schüchtern. Die beiden sind schon zehn Jahre länger sehr gut befreundet, sodass Emily sich wie ein Eindringling vorkommt.
Jayne, die fährt, zieht die Augenbrauen hoch. Endlich! Emily spricht!, denkt sie. Bisher hat Emily auf der Fahrt entweder geschlafen oder irgendwas gehört.
»Auf gute Art wie im Märchen?«, fragt Ruth und dreht sich zu ihr um. Emily ist Ruth ein Rätsel und eine Frau, die sie dieses Wochenende unbedingt besser kennenlernen will.
»Eigentlich nicht«, antwortet Emily. Die Märchen, die ihr als Kind vorgelesen wurden, waren Furcht einflößend.
Ruth weiß nicht, wie sie reagieren soll. Im Grunde sollte der Altersunterschied von zehn Jahren keine Rolle spielen, das ist ihr klar, aber er ist dauernd da, und sie befürchtet, dass sie bevormundend klingen könnte, obwohl sie es gar nicht will. Sie sieht wieder nach vorn und zum Navi.
»Dauert nicht mehr lange, dann sind wir im Freien«, sagt sie. »Buchstäblich. Und in ungefähr fünfzig Minuten sind wir laut Navi da.«
Sie sind seit Stunden unterwegs. Immer Richtung Norden. Allmählich sind sie alle lahmgesessen und abgestumpft. Ruth hatte darauf bestanden, Proviant für alle einzupacken – halbherzig im Morgengrauen zusammengeworfene Sandwiches. Für Emily verstärkt es den Eindruck, sie seien auf einem Schulausflug.
Als der Wagen den Wald verlässt, flutet Licht die Windschutzscheibe, und vor ihnen breitet sich die Landschaft aus. Jayne lächelt zum ersten Mal, seit sie heute Morgen mit Marks Hand auf ihrem Oberschenkel aufgewacht ist. Zuerst hatte sie gedacht, er wollte mit ihr schlafen, aber es war eher eine vorsichtige Berührung, eine Entschuldigung. Das Handy in der anderen Hand, hatte Mark sie aufgeweckt, um ihr mitzuteilen, dass er heute nicht mit ihnen nach Norden fahren könne. Was bedeutete, dass er die erste ihrer drei geplanten Übernachtungen dort verpassen würde.
Jayne war sauer. Die Nachricht verletzte sie ebenso wie der Streit, den sie deswegen hatten. Unbeholfen hatten sie gezankt, beide müde und empört, wie der andere es aufnahm. Jeder empfand sich als die gekränkte Person.
Doch Jayne geht es besser mit jeder Meile, die sie Richtung Norden zurücklegen. Die Banalität der Autobahn ist tröstlich, und die Vorfreude auf das lange Wochenende, das vor ihnen liegt, kehrt wieder zurück.
Nun wird das Wochenende eben aus einem Mädchenabend bestehen, gefolgt von zwei Nächten, in denen sie alle zusammen sind. Es ist nicht ganz so, wie sie es erwartet hat, aber es ist auch gut, und sie kann Mark immer noch wie geplant überraschen. Wie er schon sagte, vielleicht muss sie daran arbeiten, besser mit Veränderungen klarzukommen. Was sie tun wird. Das Leben lässt sich immer verbessern, und sie scheut sich nicht, sich dafür richtig reinzuhängen.
Sie konzentriert sich auf das Positive. Seit Wochen freut sie sich auf dieses Wochenende. Sie braucht eine Auszeit. Und es fühlt sich an, als hätte sie Ruth kaum gesehen, seit deren Baby da ist. Es wird nett, mal wieder richtig zu quatschen. Und das ist manchmal einfacher, wenn die Männer nicht dabei sind und das Gespräch nicht mit ihren Insiderwitzen und Erinnerungen dominieren.
Emily hinten auf der Rückbank ist wieder verstummt. Sie haucht gegen das Seitenfenster und malt die Initialen von ihr und Paul mit einem Herz drum herum. Ihre Nägel sind manikürt und in einem hübschen Blassblau lackiert; ihre Handrücken sind sonnengebräunt. Am Ringfinger prangt ein großer Smaragd, passend zur Farbe ihrer Augen. Bei seinem Antrag hatte Paul den Ring neben ihr Gesicht gehalten und das Grün des Edelsteins mit dem ihrer Iris verglichen. Und sein Lächeln war so strahlend und offenherzig gewesen, dass es Emily gerührt hatte. Er hatte ausgesehen, als hätte er einen Hauptgewinn gezogen, und genauso hatte sie sich gefühlt.
Emily findet die Vorstellung, eine verheiratete Frau zu sein, immer noch aufregend. Sie hätte niemals damit gerechnet, so früh zu heiraten, mit dreiundzwanzig Jahren, noch dazu einen viel älteren Mann. Aber sie hatte sich verliebt, war quasi hineingestolpert, und bisher ist es fantastisch. Sie betet Paul an und ist völlig begeistert von ihrem gemeinsamen Leben. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass sie allen Zweiflern diesen großen Klunker vor die Nase halten kann, einschließlich ihrer Mutter, die es selbst nie zu einem Ring am Finger gebracht hat. Nachdem Emilys Dad verschwunden war, hatte ihre Mutter sich hauptsächlich toxische Freunde zugelegt, dazu blaue Flecke und eine wachsende Alkoholabhängigkeit.
Emilys Atemdampf an der Scheibe verdunstet und nimmt die Initialen, das Herz und die magischen Erinnerungen mit sich. Draußen kriecht die Landschaft vorbei. Mauern und Tore, Felder und Hügel. Viele Schafe mit schwarzen Köpfen. Ein Pferd, das auf etwas wartet. So viel Leere. Öde.
Ruth und Jayne reden über ein Hörspiel, das im Radio läuft. Das Stück und ihre Unterhaltung klingen prätentiös und bieder, was Emilys Eindruck bestätigt, dass die beiden langweilig sind. Doch obwohl sie keine Lust hat, sich in das Gespräch einzuklinken, bereut sie, dass sie Ruths Angebot, auf dem Beifahrersitz mitzufahren, abgelehnt hat. Hier hinten fühlt sie sich noch mehr wie ein Teenager.
Sie will, dass Jayne aufs Gas drückt und sie schneller zu dem Cottage bringt, denn sie hat genug von der Fahrt. Aber es sind keine weißen Mittelstreifen mehr auf der Fahrbahn, und anscheinend ist die Straße schmaler, sodass sie langsamer werden müssen. Als würde die Straße jetzt bestimmen.
Sie steckt ihre Ohrstöpsel wieder ein, schließt die Augen und denkt an den Urlaub in Südfrankreich, aus dem Paul und sie gerade zurück sind. An die Flüge in der Businessclass, das Hotel, das Spa, den Sex. Es war abgefahren. Paul ist perfekt. Er war ganz Gentleman. Emily kam sich wie eine Prinzessin vor, sogar als ihr die Flugbegleiterin einen Blick zuwarf, der so viel hieß wie: Sie sind nicht das erste junge Ding, das ich hier neben einem älteren Mann sehe, und werden auch nicht das letzte sein. Da hatte Emily es genossen, ihren Ring aufblitzen zu lassen.
Die Ehe ist allerdings nicht nur Spaß. Heute ist sie genervt von Paul. Sie wünschte, er wäre hier bei ihr. Wenn sie ehrlich sein soll, ist sie mehr als genervt. Sie hasst es, dass er darauf bestanden hat, heute zu arbeiten, und sie genötigt hat, in das verlängerte Wochenende vorzufahren – mit diesen anderen Frauen, die sie kaum kennt.
»Ach, komm schon, Em«, hat er gesagt. »Es ist doch nur eine Nacht. Streng dich an. Mir ist wirklich wichtig, dass du versuchst, meine Freunde kennenzulernen.« Emotionale Erpressung.
Bis jetzt konnte sie diese Frauen prima meiden, sich vor Gruppenabenden oder sonntäglichen Mittagessen drücken, weil sie deutlich spürt, dass sie nichts mit ihnen gemeinsam hat. Aber da war diese Andeutung, dass Paul enttäuscht von ihr wäre, wenn sie nicht tat, was er wollte. Also hatte sie zugestimmt. Und jetzt wünscht sie, sie hätte es nicht getan. Vor allem weil die anderen Ehemänner auch nicht hier sind. Mark und Toby sind witziger als ihre Frauen, aber sie konnten auch nicht mitkommen, mussten ebenfalls in letzter Minute verschieben. Nun blühen Emily vierundzwanzig anstrengende Stunden mit Jayne und Ruth. Ruth ist jetzt schon pingelig und bevormundend, und Jayne starrt Emily immer auf diese eindringliche Art an, bei der sie sich farblos und dumm fühlt.
Sie seufzt und haucht wieder an die Fensterscheibe, um ein neues Herz zu malen. Aber diesmal ist sie zu sauer auf Paul, um ihre Initialen hineinzumalen.
John ist danach, das Paket mit zurück zum Farmhaus zu nehmen und in den Müll zu werfen. Und die Gäste würde er am liebsten gleich mit wegschmeißen, wenn es ginge.
Diese verfluchte Sonderlieferung zeigt mal wieder, wie lächerlich und arrogant die Leute sind, die herkommen, um in ihrer ausgebauten Scheune zu wohnen, denkt er. Die wollen nur Party machen und spielen. Sie haben überhaupt keinen Bezug zu dem Land, das seine Familie seit über einem Jahrhundert hütet.
Mit jeder neuen Gästegruppe, die seit dem letzten Jahr zum Dark Fell Barn gekommen ist – seit Maggie eine Website gemacht und mit der Werbung angefangen hat –, wächst Johns Verdruss. Und mit diesem auch das Gefühl, dass jemand widerrechtlich auf dem Grund herumtrampelt, der seiner Familie heilig ist. Er hatte die Scheune selbst restauriert und ausgebaut, um sie für seinen Sohn William und die Generationen von Elliotts zu erhalten, die hoffentlich folgen würden.
Kaum ein Tag vergeht, an dem John nicht an die Menschen denkt, die vor ihm auf seinem Land lebten, und daran, dass man aus der Vergangenheit lernen sollte, denn in ihr sind wir alle verwurzelt.
Er glaubt, dass die Vergangenheit Warnungen enthält, die man respektieren muss. In diesem Teil der Welt, im tiefsten Northumbria, ist die Vergangenheit blutig und durchwirkt von Mythen und Geschichte. Die raue Schönheit mag gut zu fotografieren sein, aber sie ist kein Spielplatz.
Er will Maggie wieder sagen, dass die Scheune nicht vermietet werden sollte, seine Bedenken energischer äußern. Doch sie kennt sie schon, und er erträgt es nicht, noch mehr Mitleid in ihren Augen zu sehen. Sie versteht, wie er empfindet, wird jedoch nur sagen: »Wir können die Leute nicht überprüfen, bevor sie hier sind« und »Wir brauchen das Geld.« Und sie hat recht, deshalb hält er den Mund und konzentriert sich darauf, sie heil den Weg hinaufzubringen.
Die Fahrt zur Scheune ist heikel. Sie dauert ungefähr zwanzig Minuten, und je steiler es bergan geht, desto schlimmer rumpelt und schlingert der Land Rover. Schließlich macht der Weg eine scharfe Biegung, und sie verlassen den Wald hoch oben in einem einsamen Tal.
Man kann meilenweit sehen, aber Dark Fell Barn ist das einzige Gebäude weit und breit. In sämtlichen Richtungen sorgen die sich jagenden Wolken für ein sich stetig veränderndes Muster von Licht und Schatten auf dem endlosen Terrain. Die Perspektive verengt und weitet sich abwechselnd. Flecken sind mal verdunkelt, dann wieder im hellen Licht. Die Farben changieren zwischen stumpf und intensiv, und einzelne Landschaftsdetails sehen mal samtig einladend aus, dann wieder rau und erbarmungslos.
John Elliott hat sein ganzes Leben hier verbracht und liebt das Land von ganzem Herzen. Er weiß, dass er das Gedächtnis verliert und die Realität für ihn inzwischen verzerrt und nicht mehr leicht zu bewältigen ist. Ihm ist ebenfalls bewusst, dass Maggie sein einziger Anker in der Wirklichkeit ist.
Doch er schwört sich täglich, dass er nie seine Aufgabe als Hüter dieses Landes vergessen wird.
Regen prasselt gegen die Windschutzscheibe wie eine Handvoll geworfener Kieselsteine. Ruth zuckt auf dem Beifahrersitz zusammen und dreht sich zu Emily um. Mütterliche Gewohnheiten sind schwer abzustellen, egal wie neu man sie sich angeeignet hat. Ihr Baby Alfie ist erst sechs Monate alt, und Ruth fühlt sich regelrecht tollwütig vor Beschützerhormonen. Aber sie weiß, dass sie Emily nicht wie einen Kinderersatz behandeln darf, bloß weil sie so jung ist.
Das wäre in vielerlei Hinsicht falsch. Sie sind drei gleichgestellte Frauen, verheiratet mit besten Kumpels, und Ruth hofft, dass sie Emily nach diesem Wochenende als neue Freundin betrachten kann.
Sie schickt noch eine Textnachricht an Toby und fragt, ob er gut bei seiner Schwester angekommen ist. Er hat nicht auf ihre letzten Nachrichten geantwortet, müsste aber inzwischen dort sein und den Ritter in schimmernder Wehr mimen. Wie die beiden anderen Männer hatte auch er in letzter Minute einen Grund gefunden, heute noch nicht hinauf zu der Scheune zu reisen, und Ruth ist nicht gerade froh darüber. Gemeinsame verlängerte Wochenenden sind ein Ritual der Gruppe, und in diesem Jahr, nach Robs Tod, ist es wichtiger denn je, dass sie alle mal zusammen rauskommen.
Also ist es ein denkbar schlechter Zeitpunkt, dass Toby seiner Schwester den Vorrang einräumt, die nie einen Finger für ihn rührt! Wann gibt er jemals Ruth den Vorzug, seiner Frau? Oder, wo sie schon mal dabei ist, ihrem Sohn?
Sie weiß, dass sie nicht so viele Nachrichten schicken sollte – über zehn allein in der letzten Stunde. Aber es macht sie wahnsinnig, wie schlecht Toby im Antworten ist, ganz besonders in Momenten wie diesem, wenn er genau weiß, dass sie eine Rückversicherung braucht.
Solche Dinge sind ihm schlicht egal. Sein Handy ist ein altes Modell, und er weigert sich, ein neueres anzuschaffen. Im Geiste ist er ständig bei seiner Forschung und entsprechend desorganisiert in allem anderen, sodass es an Ruth hängen bleibt, ihr Familienleben zu regeln. Früher hat sie das bei ihm geliebt. Es gab ihr das Gefühl, nützlich zu sein, als wäre sie eine hervorragende Ehefrau, die ihrem Mann den Rücken freihielt. Noch ein Gebiet, auf dem sie glänzen konnte. Doch seit dem Baby ist es zu viel geworden.
Alfie müsste ungefähr jetzt von seinem Mittagsschlaf aufwachen. Seit sie heute Morgen das Haus verlassen hat, ist sie beunruhigt und unsicher, ob ihre Mutter die Geduld aufbringt, so für Alfie zu sorgen, wie Ruth es sich von ihr wünscht.
Gestern Abend war Ruth lange aufgeblieben und hatte Seite um Seite mit Anweisungen gefüllt, wie Alfie zu versorgen ist. Sie hatte alle Eventualitäten berücksichtigt, die ihr einfielen. Und dann nahm ihre Mutter die Blätter beinahe beiläufig entgegen und warf nicht einmal einen Blick darauf. Ruth nahm ihr das Versprechen ab, dass sie alles lesen würde, aber wer konnte wissen, ob sie es wirklich tat? Professor Flora MacNeill weiß es immer besser.
Seufzend verändert Ruth ihre Sitzposition. Körperlich fühlt sie sich genauso unwohl wie geistig. Der Bund der Jeans schneidet ihr in den Bauch, und auf dem Baumwolltop ist ein Kaffeefleck. Ein rascher Blick in den Schminkspiegel bestätigt, dass ihr die Wimperntusche zu dunklen Schlieren auf den Wangen verlaufen ist, und die widerstehen allem Reiben mit einem angeleckten Finger. Das muss sie ohnehin aufgeben, als der Wagen über ein Schlagloch ruckelt und sie sich fast selbst ins Auge pikst. Verglichen mit den anderen Frauen kommt sie sich hausbacken und unansehnlich vor. Emily ist umwerfend, jung und anmutig. Jayne ist gertenschlank, superfit und ungeschminkt. Sie strahlt Gesundheit und Selbstsicherheit aus.
Jayne schaltet die Scheibenwischer aus, als sie zu quietschen anfangen. Der Regen hat aufgehört. Es war lediglich eine vorüberziehende Böe, heftig, aber schnell wieder vorbei. Nichts, worüber man sich aufregen muss.
»Alles okay?«, fragt Jayne und blickt kurz zu Ruth. »Du guckst so finster.« Es gefällt Jayne nicht, wie müde und abgekämpft Ruth wirkt. Zwar ist sie nicht so schweigsam wie Emily, aber auch eindeutig nicht so munter wie sonst. Sie hat Ringe unter den Augen, teigige Haut und sieht ein wenig aufgedunsen aus, als hätte sie in den letzten Wochen, seit Jayne sie zuletzt gesehen hat, nicht auf sich geachtet.
»Mir geht es gut.« Ruth klappt den Spiegel hoch und versucht, sich zu strecken. Ihre Schultermuskeln sträuben sich dagegen. Jayne ist eine gute Freundin. Nie überschwänglich oder reizbar, sondern immer freundlich und ausgeglichen. Stets verlässlich und es wert, dass Ruth sich für sie ein wenig Mühe gibt. »Ich freue mich auf die Scheune.«
»Machst du dir Sorgen, weil du Alfie zu Hause gelassen hast?«
Ruth ist dankbar, dass Jayne fragt, auch wenn sie unmöglich zugeben kann, wie beunruhigt sie ist. Es wäre peinlich vor Emily. »Ein bisschen.«
»Wird schon alles gut gehen.«
Ruth nickt, obwohl ihre Dankbarkeit prompt in Verärgerung umgeschlagen ist, weil die Bemerkung wehtut. Dauernd hört sie solche Sprüche, wenn sie ihre Sorgen um Alfie anspricht. Sie sind fast wie ein Reflex, ähnlich einer automatischen E-Mail-Abwesenheitsnotiz. Aber was, wenn ihre Sorgen verdienen, ernst genommen zu werden? Durch eine weitere Frage vielleicht, mit der Interesse und Verständnis signalisiert wird?
Für Ruth ist eine junge Mutter zu sein das Intimste und zugleich Einsamste, was sie je erlebt hat. Sie fragt sich, wann sie sich ihren Freundinnen zuletzt verbunden gefühlt hat. Auf jeden Fall war es vor Alfies Geburt. Und als ihr klar wird, dass es ein knappes Jahr her sein dürfte, seit sie einige von ihnen zuletzt getroffen hat, überkommt sie ein beklemmendes Verlustgefühl.
Wieder in der Praxis zu arbeiten hilft ihrer Einsamkeit nicht, macht sie eher noch schlimmer. Weil sie Vollzeit arbeitet, was nötig ist, da Toby und sie das Geld brauchen, hat sie auch die neuen Freundinnen eingebüßt, die sie während des Mutterschutzes gefunden hatte. Sie kann nicht mehr zu ihren morgendlichen Kaffeetreffen oder der Babygruppe gehen.
Ihre Tage sind restlos ausgefüllt. Entweder pendelt sie, bringt Alfie in die Krippe oder arbeitet im Eiltempo ihre Patientenliste ab und macht sich Gedanken über das, was sie zu Hause verpasst. Es bleibt nicht einmal mehr Zeit für eine kurze Plauderei mit Kolleginnen oder Drinks nach Feierabend mit Freundinnen. Alles findet gehetzt statt. Und sie fühlt sich permanent unzulänglich, als würde sie nichts gut machen.
Sie blickt auf ihr Handy. Ihre Mutter hat auch nicht auf Ruths letzte Textnachricht geantwortet, aber der Fairness halber sollte sie berücksichtigen, dass der Empfang hier langsam schlechter wird.
Ihre Unruhe gleicht einem Druck, der sich vom Brustkorb aus im gesamten Körper ausbreitet.
Bevor Alfie kam, war sie begeistert davon, Mutter zu werden. Sie wünschte es sich, freute sich darauf und bereitete sich penibel vor. Sie las jedes Buch über Babys, das sie in die Finger bekam, sah sich die neueste medizinische Forschung an. Kein Detail war zu klein, um nicht ernst genommen zu werden; nichts sollte Ruth eiskalt erwischen.
So ist sie das Leben von jeher angegangen, hat ihren Traum erreicht, Ärztin zu werden, und versucht, den Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen. Disziplin, Detailgenauigkeit, harte Arbeit.
Nach Alfies Geburt stellte sie verblüfft fest, wie sinnlos ihre Planung gewesen war. Anstatt das Gefühl von Kontrolle zu haben, reagierte sie auf ihre Mutterschaft in einer primitiven, instinktiven Weise, und das von dem Augenblick an, in dem man ihr ihren Sohn auf den Bauch legte. Alles, was sie gelesen hatte, wurde auf einmal überflüssig. Als hätte sie während der Entbindung eine Persönlichkeitsveränderung durchlaufen.
Sie war wie besessen von der verletzlichen Stelle an seinem verschwitzten Köpfchen, den zarten Hautfalten, jedem noch so kleinen Detail an ihm. In den vergangenen sechs Monaten hat sie die stärksten Gefühle empfunden, die sie kennt. Manchmal denkt sie, sie könnte Alfie zum Abendessen auffressen und mehr von ihm zum Dessert wollen. Es gibt nichts, was sie nicht für ihn tun würde.
Toby empfindet nicht so stark für den gemeinsamen Sohn. Das ist offensichtlich, und Ruth hasst ihn dafür. Es hat einen Keil zwischen sie getrieben.
Seit Wochen hat sie gehofft, dass dieses Wochenende, die erste Auszeit ohne das Baby, ihnen hilft, einander wiederzuentdecken. Sie sehnt sich danach, wieder von ihm berührt zu werden. Es ist beinahe ein Jahr her, seit sie Liebe gemacht haben. Toby hatte aufgehört, sie anzufassen, als sie wenige Monate schwanger war. Und ihr fehlt die Intimität schrecklich.
Aus dem Nichts überkommt sie das starke Verlangen nach einem Drink. Nur einem kleinen. Er würde helfen, ihren Sorgen die Schärfe zu nehmen und in die richtige Stimmung zu kommen, um mit Jayne und Emily zu feiern.
Nach Alfies Geburt, während des Mutterschutzes, hat sie heimlich zu trinken begonnen. Zuerst war es ein Muntermacher, bald jedoch das Einzige, was das Gefühl dämpfen konnte, ihr Leben würde außer Kontrolle geraten.
Und es hörte nicht auf, als sie acht Wochen nach der Geburt wieder arbeiten ging. Alles wurde schlimmer. Sie brachte kaum die Aufmerksamkeit auf, ihren Patienten richtig zuzuhören, und es machte sie wütend, wie viel die von ihr erwarteten und ihr abverlangten.
Sie weiß, dass sie aufhören muss. Es wird zum Problem. Ruth denkt an die E-Mail, die sie gestern von den anderen Partnern in ihrer Praxis bekommen hat, mitsamt einer offiziellen Abmahnung, was ihr Verhalten betrifft. Toby hat sie noch nichts erzählt, denn allein der Gedanke ist erdrückend.
Und das Problem ist, dass sie nicht weiß, wie sie mit dem Trinken aufhören soll, denn in letzter Zeit hat sie zunehmend das Gefühl, nicht nur ihr Leben ist außer Kontrolle, sondern sie selbst. Als hätte sie sich aus der Verankerung gelöst, die sie bisher gehalten hatte.
Um sich von der aufkommenden Panik und dem bohrenden Verlangen nach einem Drink abzulenken, sieht sie nach draußen und betrachtet die Landschaft. Deren schiere Weite ist erstaunlich. Heidelandschaft, die selbst in dieser Jahreszeit karg anmutet. Wie etwas aus einem Schauerroman. Ruth sorgt sich, weil sie während der Fahrt sehr still gewesen ist. Was müssen die anderen von ihr denken? Sie sollte etwas Positives beitragen.
»Ich freue mich richtig auf den Weiberabend heute«, sagt sie. »Nur wir drei, ohne die Männer.«
Sie blickt nach hinten, ob Emily es gehört hat, aber die hat Stöpsel in den Ohren und die Augen geschlossen.
Jayne wird langsamer, um sich umzuschauen. Hier sieht es vollkommen anders aus, als sie es aus Südengland kennen. Es ist wunderschön, und sie fühlt sich klein und geblendet davon. Die Aussicht, noch tiefer in diese Landschaft zu fahren, verursacht ihr ein Kribbeln. Mark wird es auch lieben.
Jayne horcht in sich hinein, wie es ihr jetzt damit geht, dass er in letzter Minute abgesprungen ist. Sie ist nicht mehr ganz so wütend wie heute Morgen, aber auch nicht glücklich.
Was sie nicht abschütteln kann, ist dieser nagende Verdacht. Es liegt in ihrer Natur, Dinge infrage zu stellen – bei der Army hat sie im Nachrichtendienst gearbeitet, und Leben konnten gerettet werden oder verloren sein, je nachdem, an welche Informationen sie kam. Deshalb war sie rigoros und hat alles hinterfragt, was sie hörte oder erfuhr. Die Arrangements für dieses Wochenende indes sind zu solch einer Farce geraten, dass selbst die naivsten Menschen gewiss sagen würden, hier ist etwas faul.
Zuerst schrieb Paul vor wenigen Tagen, er könne heute noch nicht mitkommen, Emily würde aber schon mal dabei sein; dann kam Toby mit einer Geschichte über seine Schwester. Mark war der Dritte, der passte. Seine Ausrede war, dass sich bei der Arbeit etwas ergeben hatte. Es kann doch kein Zufall sein, dass keiner ihrer Männer heute Abend bei ihnen sein kann, auch wenn die sich so benehmen, als wäre es einer. Das ganze Szenario ist einfach so unwahrscheinlich.
Findet ihr es nicht komisch, dass keiner unserer Männer heute mitkommen kann?, möchte Jayne fragen, aber irgendetwas hält sie davon ab. Sie blickt zu Ruth, dann im Rückspiegel zu Emily. Das wollen sie jetzt vermutlich gar nicht hören. Und Emily hat sowieso ihre Ohrhörer drin. Es würde allem nur einen Dämpfer verpassen, wenn Jayne es erwähnte. Sie kann sich vorstellen, dass die beiden selbst ihre Bedenken haben und sie vorerst für sich behalten. Das sollte sie auch tun.
Und Ruth hat recht. Sie können heute Abend ohne die Männer Spaß haben. Jedenfalls weiß Jayne, dass Ruth und sie es können. Ob Emily aus der Reserve zu locken ist, bleibt abzuwarten.
Das Gute ist, dass ihre Männer morgen noch vor dem Mittagessen bei ihnen sein werden, und was immer die drei im Schilde führen, wird irgendwie herauskommen. Keiner der Männer ist toll darin, Sachen für sich zu behalten. Dafür sind sie einander zu vertraut.
Es fehlt noch jemand von ihrer Gruppe, doch anders als bei ihren Männern ist Jayne insgeheim erfreut über diese eine Absage.
Edie hat die Einladung abgelehnt, das Wochenende zu ihnen zu stoßen, und gesagt, es wäre zu schmerzhaft, ohne Rob zu kommen. Jeder verstand es. Seit Robs Tod vor fünf Monaten klaffte in ihrer aller Leben eine Lücke, aber besonders bei Edie. Klar. Rob und Edie sind seit der Schule ein Paar gewesen. Jayne kann nicht umhin, an ihre Tochter Imogen zu denken. Ihr Anblick bei Robs Beerdigung hatte einem das Herz gebrochen. Sie war solch ein Vaterkind gewesen.
Jayne behielt ihre Erleichterung, dass Edie nicht mitkam, vor Mark und allen anderen für sich, weil die Männer sie so sehr lieben.
Vor sich selbst jedoch kann Jayne nicht leugnen, dass sie diesen Ausflug ohne Edie leichter findet. Ob sie gut oder schlecht gelaunt ist, Edie verbraucht immerzu den gesamten Sauerstoff in einem Raum.
»Ich freue mich auch richtig auf heute Abend«, sagt sie. »Lassen wir die Sau raus.«
Das ist eine Sache, die mich selbst überrascht: Man sollte meinen, dass mich die Tatsache, nichts von dem kontrollieren zu können, was oben im Dark Fell Barn heute Abend passiert, nach all der minutiösen Planung rasend macht. Aber eigentlich finde ich es eher spannend. Ja, es gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein, und bestätigt mir, dass ich immer noch etwas empfinden kann.
So weiß ich auch, dass ich das Richtige tue.
Rob ist seit fünf Monaten tot, und ich lebe in einem Zustand der Taubheit. Alle haben es hinter sich gelassen, natürlich. Was mir für mich unmöglich scheint. Ich hinke ihnen hinterher, bleibe allein zurück; allein mit meinem unerträglichen Schmerz, weil er nicht mehr da ist.
Und natürlich mit Imogen. Meiner Tochter. Meinem Rettungsanker. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte.
Manchmal gehe ich online und rufe die Beschreibung von Robs Tod in der North Devon Gazette auf. Es ist eine masochistische Angewohnheit, die ich nicht abstellen kann. Anscheinend muss ich es immer wieder lesen, und jedes Mal regt es mich auf, wie eiskalt der Artikel die »Fakten« darstellt:
Freitag, 17. Mai 2019
Robert Porter, 37 Jahre alt, ist bei einem Unfall nahe Hartland Quay an der Nordküste von Devon ertrunken. Robert hatte die Fauna an der Küste fotografiert, als ihm die Flut den Weg abschnitt und hinaus aufs Meer trieb. Freunde alarmierten die Küstenwache, die um 18:00 Uhr am Mittwoch eine Leiche von den Felsen barg. Er hinterlässt seine Frau Edie und die gemeinsame Tochter Imogen.
Wo bleiben die Worte, die etwas bedeuten? Die vermitteln, wie enorm unser Verlust ist?
Schriebe ich über Robs Tod, würde ich schildern, dass ich völlig zerschmettert bin, so wie das Meer seinen Körper an den Felsen zerschmettert hat. Man würde erfahren, dass mir die Trauer immer noch oft hinterrücks auflauert. Dass es Zeiten gibt, in denen ich denke, sie würde mich innerlich vollkommen abschalten: mein Blut erstarren lassen; meinen Speichel so verdicken, dass ich kaum den Mund öffnen kann; meine Knochen zur Konsistenz von milchgetränktem Brot aufweichen lassen.
Ehrlich, seit er gestorben ist, ist nichts mehr wie vorher. Das geht gar nicht.
Und deshalb habe ich getan, was ich getan habe. Imogen und ich brauchen ein neues Leben.
Wenn alles gut geht, sind das Paket und der Brief bald in der Scheune. Und Jayne, Ruth und Emily kurz danach auch.
Dark Fell Barn ist ein kompakter Klotz aus dem Sandstein der Gegend. Eine Tür und vier Fenster, die asymmetrisch angeordnet und unterschiedlich groß sind, akzentuieren die Fassade. Und jede der Glasscheiben spiegelt die rastlose Wolkenlandschaft.
John und Maggie steigen aus dem Auto, und Maggie öffnet die Heckklappe. Die Hündin springt heraus.
»Trägst du mir die Taschen rein?«, fragt Maggie.
Er nickt. Warum fragt sie? Das muss sie nicht. Selbstverständlich macht er es.
Sie bringt das verpackte Paket in die Scheune. John lenkt die Aussicht ab. Tief im Tal fängt ein kleiner Flusslauf flüchtig das Sonnenlicht ein und glitzert wie von Blitzen gezeichnet. Es ist atemberaubend. Ist es ein Omen? Als Junge glaubte er, dass es in diesem Tal, dem abgelegensten auf dem Grund seiner Familie, jene Wesen gab, vor denen sein Vater ihn gewarnt hatte: die Schreckgespenster und die »Brags«, Gestaltwandler, die einen überlisten und in die Irre führen. Alles hier oben kann sich von einem Moment zum nächsten verändern.
Weiter oben, Richtung Norden, verschleiert eine Regenwand einen Felsvorsprung. Schwere ambossförmige Wolken brauen sich dahinter zusammen, und das so dicht, dass es für John aussieht, als könnte der Himmel unter ihrem Gewicht einbrechen. Das Unwetter ist nur noch wenige Stunden entfernt, und es zieht in ihre Richtung. Sie müssen die Gäste hier herauf bekommen, ehe es losgeht, denn dann wird die Straße unpassierbar.
Er folgt Maggie in die Scheune, Birdie dicht auf seinen Fersen.
»John!«, sagt sie. »Die Taschen!«
»Welche Taschen?«
»Im Wagen. Kannst du die bitte reinbringen?«
»Du brauchst doch nur zu fragen.«
»Habe ich.«
Hat sie nicht. Da ist er sich sicher. Aber er hasst nichts mehr, als mit ihr zu streiten.
Schweigend verrichten sie beide ihre Arbeiten in der Scheune. Maggie überprüft alles, was John tut, damit es auch ja perfekt ist. Und er sagt nichts, auch wenn er es nicht leiden kann.
Sie ist müde und beunruhigt. Heute sollte alles normal sein, aber es geschehen lauter Dinge, mit denen sie nicht rechnet. Diese seltsame Lieferung und schon vorher Johns Benehmen. Er hat einen schlechten Tag.
Als alles abgestaubt ist, die Betten bezogen und die Handtücher aufgehängt sind, der Willkommenskorb mit den hübsch arrangierten hiesigen Erzeugnissen auf den Küchentisch gestellt ist, nimmt Maggie sich die Zeit, das eingewickelte Geschenk und den Brief genau wie angewiesen auf dem Tisch zu platzieren. Sie sieht nach, wie es von der Küchentür und der Küche aus wirkt, korrigiert den Winkel ein wenig und lehnt den Briefumschlag ein bisschen aufrechter gegen das Paket.
John beobachtet es mit einem miesen Geschmack im Mund. Eines der Dinge, die Leute nicht begreifen, wenn sie herkommen, ist, dass diese Scheune mit ihren meterdicken Mauern, an der Grenze zwischen England und Schottland gelegen, einst, wie alle anderen in dieser Gegend, gebaut wurde, um Leute und Vieh vor Angreifern zu schützen. Vor Fremden.
»Gut!«, sagt Maggie. »Das wär’s dann. Fahren wir wieder.«
Er nickt. Wiedersehen, sagt er stumm zu der Scheune. Das macht er immer, wenn er von hier wegfährt, auch wenn er vorhat, in ein paar Stunden wieder hier zu sein und die Gäste abzusetzen. Er findet, dass es die Höflichkeit gebietet.
Als Kind hatte er zum ersten Mal gehört, wie die Wände zurückflüsterten: Wir werden dich schützen. Er hatte es erneut in den langen Monaten gehört, als er die Scheune restaurierte. Und seitdem immer wieder.
Doch für Außenstehende haben diese Mauern eine andere Botschaft. Er spürt die Rastlosigkeit des Gemäuers, wenn er Gäste herbringt, und er hört sie murmeln:
Wir können euch aufnehmen. Wir können euch lehren.
»Warum können wir nicht selbst rauf zu der Scheune fahren?«, fragt Emily.
Sie beobachtet den Farmer, John Elliott, der ihr Gepäck in seinen Land Rover lädt. Das Farmhaus sieht gepflegt aus, aber der Hof ist voller Schlamm, und sie fürchtet, der ist teils auch von Mist durchsetzt. Sie wagt kaum zu atmen, denn der Gestank könnte sich in ihrer Kehle festsetzen.
»Das werden Sie gleich sehen«, antwortet er. Oder zumindest glaubt sie, dass er das sagt. Sein Akzent ist ein befremdlicher Singsang in ihren Ohren und schwer zu verstehen.
»Mit einem normalen Auto kann man den Weg zur Scheune nicht fahren«, erklärt Jayne, ganz die Schlaumeierin. »Da braucht man einen Wagen mit Allradantrieb. Es steht auf der Website. Der Link, den ich dir geschickt habe.«
Emily nickt, doch in Wahrheit hatte sie nie weiter als bis zu dem Hinweis gelesen, dass es nicht zu jedem Schlafzimmer ein angeschlossenes Bad gibt, bevor sie verzweifelt die peinlich primitive Website geschlossen hatte.
Der Farmer reicht ihr eine Hand, um ihr beim Einsteigen zu helfen.
»Geht schon«, sagt sie. Sie versucht, ihn anzulächeln, doch das Lächeln gefriert ihr auf den Lippen. Seine schroffe Art und die wettergegerbte Erscheinung schüchtern sie ein, und seine ausgestreckte Hand schreckt sie ab.
Das Innere des Land Rovers ist billig und ganz und gar nicht sauber. Noch dazu ist die Sitzbank hinten hart. Emily hockt sich hinein, bemüht, sich zwischen die Taschen zu quetschen, und schnallt sich an. Ruth steigt mit einem Stöhnen ein, wobei sie die Hilfe von Mr. Elliott annimmt. Er wirft die Tür zu.
Ruth zieht ein »O Mann!«-Gesicht, und Emily kann nicht anders, als zu grinsen. Sie ist froh, dass sie nicht die Einzige ist, die alles hier zu rustikal findet. Jayne hingegen scheint all das nicht zu stören. Vielmehr sieht sie aus, als würde sie es genießen, als sie neben Mr. Elliott einsteigt – andererseits sind Mark und sie auch mehr so die Naturtypen. Regen rinnt über die Windschutzscheibe.
John Elliott fährt aggressiv. So wie der Wagen rumpelt und schlingert, fühlt es sich eher an, als wäre man in einem ramponierten Kahn auf See unterwegs. Jayne sitzt vorn und klammert sich an den Haltebügel seitlich oben. Emily hat das Gefühl, ihre inneren Organe würden neu sortiert.
Ruth verschränkt die Arme unter ihren Brüsten, damit sie nicht unangenehm wippen, und schneidet wieder eine Grimasse. Emily kichert – sie will nicht, es platzt einfach aus ihr heraus – und stemmt die Ellbogen gegen die Sitzlehne, um sich auszubalancieren, während sie ihre Brüste mit den Händen festhält. Ihr Lachen ist ansteckend. Ruth muss mitlachen, und schnell wird ein hysterisches Gackern daraus, das sie beide halbwegs unterdrücken können, als wären sie ungezogene Schulkinder, die Angst haben, von den Erwachsenen vorn gescholten zu werden.
Als sie schließlich Dark Fell Barn erreichen, lächeln sie nicht mehr, sondern wollen nur noch, dass die Fahrt endlich vorbei ist. Der Regen hat nachgelassen, aber beim Aussteigen aus dem Land Rover peitscht ihnen der Wind entgegen und rüttelt sie durch, während sie sich umschauen.
»So viel zum Thema ›ausgeklinkt‹.« Ruth redet laut, damit sie im Windgeheul zu verstehen ist, und hakt sich bei Jayne ein. »Gut gemacht, Jayne. Du hast unsere Erwartungen übertroffen.« Seit Jahren drängen die Männer auf diese Wochenenden in immer abgelegeneren Gegenden. Und Jayne hat sie weiter weg geschleppt, als sie jemals gewesen sind.
Sie blicken hinaus auf die Landschaft an diesem vollkommen verlassenen Ort. Jayne empfindet eine wachsende Zufriedenheit, während Ruth fühlt, wie Panik an ihr nagt. Sie sieht auf ihr Mobiltelefon: nicht der Hauch von Empfang. Sie war vorgewarnt, doch in der Theorie hat es sich leichter angefühlt. Mr. Elliott will wieder wegfahren, und Ruth möchte dringend zurück in den Land Rover steigen und ihm sagen, dass er sie zurück zum Farmhaus bringen soll. Sie wird nach Hause fahren, Alfie bei ihrer Mutter abholen. Ihr liegt auf der Zunge, Mr. Elliott zuzurufen, er möge stehen bleiben und auf sie warten. Doch die Blamage, eine Drückebergerin zu sein, und Jaynes Arm, der mit ihrem verschränkt ist, halten sie ab.
Auf der Rückfahrt zum Farmhaus denkt John Elliott über die neuesten Gäste nach. Sie hatten ihm ihre Namen gesagt, und die hat er bereits vergessen, aber ihre Gesichter sind ihm noch klar in Erinnerung.
Nur eine der Frauen könnte würdig sein, im Dark Fell Barn zu wohnen, und das ist die, die vorn bei ihm gesessen hat. Maggie hatte ihm erzählt, dass sie es war, die das Wochenende gebucht hat. Ihm haben ihre ruhigen, ernsten Züge gefallen; klar und blass, irgendwie offen. Und die grauen Augen, die sich beim Anblick der Scheune und der Umgebung vor Ehrfurcht verengten. Im Wagen hat sie vernünftige, höfliche Fragen zur Geschichte der Gegend gestellt und sich über die uralten Begräbnisstätten hier oben gewundert, die noch aus dem Neolithikum stammen. Sie wusste, dass sie Hünengräber heißen, und das schätzt John sehr. Und sie war auch passend gekleidet, nicht wie die anderen beiden, die das ganze Wochenende frieren und zu viel Holz verheizen werden, um sich zu wärmen.
Die Jüngste ist nur ein Strich in der Landschaft mit feuerrotem Haar. Die Sorte, die sicher kaum was isst. Sie hat dünne Sachen angehabt, ist stark geschminkt gewesen und hat baumelnde Ohrringe und eine sehr teure Uhr getragen, die sie lieber zu Hause gelassen hätte. Sie ist deutlich jünger als die anderen, und zum ersten Mal fragt John sich, wie und wer die Ehemänner zu diesen Frauen sein mögen und warum sie nicht mitgekommen sind. Als sie die dunkle Sonnenbrille abnahm, hatte John gesehen, dass ihre grünen Augen wässrig glänzten, und gedacht, dass tief drinnen ein Funkeln lauerte, wie man es von Wildtieren kennt.
Die dritte Frau hatte enge Sachen an, die jedoch nicht so gedacht waren. John nimmt an, dass sie ihr zu eng geworden sind. Ihr Haar ist dunkel, lockig und ungekämmt, als würde es zu einem wilderen Geschöpf gehören, denn ansonsten schien alles an ihr weich und zahm. Sie wirkte gleich bei der Ankunft, als wollte sie sofort wieder fliehen. Sorge umschwirrte sie wie ein Schwarm kleiner Mücken. Sie muss in Gedanken oder mit dem Herzen noch zu Hause sein. Das konnte auch ihr Geplapper nicht übertünchen, nicht für John. Zwischen dem Entzücken und dem Dank hat er zu viele Fragen gespürt, was sie tun sollen, falls etwas schiefgeht.
»Verlassen Sie die Scheune nicht, wenn es dunkel ist«, hat er gesagt. Mehr müssen sie nicht wissen.
Jetzt sind sie auf sich gestellt.
Emily blickt John Elliott nach, als er wegfährt. Die Uhr tickt, denkt sie, bis Paul hier ist. Ich muss das nur aushalten. Wind wirbelt vom Tal herauf und heult um die Scheune. Es ist zu viel für Emily. Es fühlt sich an, als würde der Wind durch sämtliche Nähte ihrer Kleidung dringen, und er reißt ihr Haarsträhnen aus dem Knoten, um sie ihr ins Gesicht zu schlagen. Für dieses Wetter ist sie weder angezogen, noch hat sie dafür gepackt. Hier ist es eher wie Winter, nicht wie Herbstanfang.
Sie stellt sich in die geschütztere Tür vom Dark Fell Barn. Umgeben von den dicken Mauern, kommt sie sich klein und eingeschüchtert von dem Bau vor. Er hat etwas Unnachgiebiges. Trotzig und kalt. Sie fröstelt.
Jayne und Ruth stehen vor Emily im Eingangsbereich, haben ihr den Rücken zugekehrt und betrachten die Umgebung. Emily bemerkt, dass sie eingehakt sind, Schulter an Schulter. Es ist schwer, nicht neidisch auf ihre Freundschaft zu sein.
Emily geht leise in die Scheune.
Das Geschenk sieht sie sofort. Es steht am anderen Ende des Flurs auf dem Küchentisch. Das glänzende Geschenkpapier zwinkert ihr aus dem Dämmer des Scheuneninnern zu. Es ist wie ein strahlendes Licht inmitten der gedeckten Töne und matten alten Oberflächen. Solch eine Geste ist klassisch für Paul: eine aufmerksame Überraschung, um sie wissen zu lassen, dass er an sie denkt und es ihm leidtut.
Sie berührt das Geschenk, streicht mit den Fingern über die hübsche Schleife und greift nach dem Umschlag. Er ist an sie alle adressiert.
Emily ist ein bisschen enttäuscht, dass er nicht bloß an sie gerichtet ist, aber Paul ist ebenso großzügig wie fair. Er hätte nicht gewollt, dass eine von ihnen bevorzugt wird. Sie schaut sich über die Schulter um. Die Tür steht auf, und die anderen sind noch an derselben Stelle, die Blicke auf die Aussicht gerichtet. Emily findet nicht, dass sie auf die beiden warten muss, ehe sie das Paket auspackt. Sie darf es ruhig schon.
Lächelnd öffnet sie den Umschlag.
Hi, die Damen,
jetzt fängt euer Wochenende an! Ich hoffe, ihr habt ein paar großartige Tage! Ich bin nicht mitgekommen, weil ich weiß, dass ich nicht willkommen bin.
Dies ist ein Abschiedsgeschenk. Ich gehe fort.
Aber ich will nicht, dass ihr mich vergesst.
Wenn ihr dies hier lest, werde ich einen eurer Ehemänner umgebracht haben.
E.
Es ist schwierig, mich aufs Fahren zu konzentrieren, denn ich denke nur daran, was oben im Norden passieren mag oder nicht. Meine Ruhe ist dahin, und ich sorge mich, dass die Scheunenbesitzer das Paket und den Brief nicht an der richtigen Stelle platziert haben, sodass sich der mit Bedacht choreografierte Moment nicht so entwickelt, wie ich es will.
Ich versuche, mich zu beruhigen, indem ich mir ausmale, was geschehen mag, wenn die Frauen den Brief gelesen und das Geschenk ausgepackt haben. Ein bisschen hilft es. Ich fühle ein leises Kribbeln im Bauch, wenn ich mir ihre Reaktionen vorstelle.
Das Klingeln meines Handys fährt mir bis ins Mark. Es kann nicht das Wegwerfhandy sein, und mein privates dürfte es auch nicht sein. Es sei denn …
Mir wird eiskalt. Ich habe einen Anfängerfehler gemacht. Blöd, blöd! Ich hatte vorgehabt, mein Mobiltelefon vor der Fahrt auszuschalten, damit ich nicht geortet werden kann. Hier kann ich nirgends anhalten, deshalb greife ich zum Beifahrersitz und krame in meiner Tasche. Als ich das Telefon ertaste, geht der Anruf schon auf die Mailbox.
Ich sehe, dass Imogen angerufen hat, und fast gleitet mir das Gerät aus der verschwitzten Hand. Sie sollte jetzt nicht anrufen. Ich habe ihren Tagesplan im Kopf, und in diesem Moment müsste sie bei der Probe für die Abschlussvorstellung in dem Musikcamp sein, auf die ich mich so sehr freue.
Was, wenn etwas nicht stimmt?
In letzter Zeit denke ich so viel an Imogen. Ich habe mir immer eine eigene Tochter gewünscht, mich so sehr nach ihr gesehnt, dass es wehtat.
Ich biege in die Einfahrt zu einem Feld. Meine Nerven spielen verrückt. Ich muss sie zurückrufen. Sie zu ignorieren oder später anzurufen kommt nicht infrage, weil ich mir geschworen habe, sie niemals im Stich zu lassen.
Außerdem kann ich mein Handy jetzt ruhig benutzen, weil es bereits bei jedem Sendemast zwischen hier und der Stadt eingeloggt war. Das ist ein Problem, um das ich mich noch kümmern muss.
Imogen nimmt sofort ab.
»Was ist los?«, frage ich.
»Kannst du mich abholen kommen?« Sie klingt gehetzt und angespannt, sehr emotional, als wäre sie kurz vor einem Zusammenbruch. Was zum Teufel ist passiert? Es ging ihr gut, als ich gestern mit ihr gesprochen habe. Ich drücke mir mit zwei Fingern auf die Nasenwurzel, was eine sinnlose Geste ist, die ich immer mache, wenn ich merke, dass eine Migräne kommt.
»Warum? Was ist passiert?«
»Ich habe es beinahe wieder getan.«
»Was meinst du?« Ich denke, dass ich es weiß. Mir ist, als würde mir jemand Eiswasser über den Kopf kippen.
»Ich wollte mich ritzen.«
Mir wird schlecht. Ich habe mich danach gesehnt, dass sie sich mir in diesem Jahr mehr anvertraut. Und jetzt, da sie es endlich tut, ist es unerträglich. »O nein«, hauche ich.
Sie fällt mir ins Wort. »Ich kann bei der Probe nicht mithalten, weil ich sauschlecht bin und alle anderen hängen lasse. Kannst du mich abholen kommen? Jetzt?« Sie fängt an zu weinen und schluchzt erstickt.
»Bitte, sag so etwas nicht.« Es bereitet mir körperliche Schmerzen, wenn sie so redet. »Du bist brillant. Ein Star. Jeder sagt das.«
Und ich meine es ernst. Wenn das eigene Kind so musizieren kann wie meine Tochter, geht einem das Herz auf, sogar wenn man die längsten, finstersten Monate durchgemacht hat, die man sich vorstellen kann. Ich bin niemand, der viel weint, vor allem nicht in der Öffentlichkeit, aber als ich Imogen das letzte Mal spielen sah, habe ich geheult, bis mein Gesicht rot und verquollen war, und mir war egal, wer mich so sah.
Rob ging es genauso. Bei ihren Konzerten löste er sich jedes Mal in Tränen auf.
»Was ist mit deinem Abschlusskonzert?«, frage ich. Es ist morgen Abend, und ich habe vor, dort zu sein. In der ersten Reihe.
Imogens Schluchzen wird heftiger und zu einem solch gebrochenen Laut, dass ich das Gefühl habe, es könnte sich auf mich übertragen. Aber die Nähe, die uns verbunden hatte, als sie noch kleiner war, scheint auf einmal wieder greifbar zu sein, wenn ich sie jetzt einfach auf die richtige Art unterstütze.
»Ich kann nicht. Bitte zwing mich nicht zu bleiben. Bei der Probe heute haben sich alle über mich lustig gemacht.«
»Was? Warum?« Ich kann meine Wut nicht zurückhalten, und ich könnte denen den Hals umdrehen, wer immer von diesen pickligen kleinen das …
»Ich habe immer wieder gepatzt«, sagt sie. »Deshalb bin ich früher weg. Und da wollte ich mich ritzen.«
»Aber das hast du nicht getan, oder?« Der Gedanke, dass sie sich mit einer Klinge in die Haut schneidet, ist entsetzlich. Ich habe Albträume davon, seit es zum ersten Mal geschehen ist, kurz nach Robs Tod. Hinterher hat sie es mir erzählt, sich aber geweigert, mir die Narben auf ihrem Bauch zu zeigen. Sie hat sich zu sehr geschämt. Sie hatte Angst, sagte sie mir, dass sie nicht aufhören könnte. Und jetzt das.
»Nein«, antwortet sie.
Ich bin unglaublich erleichtert und lehne die Stirn ans Lenkrad, froh, dass sie mich nicht sehen kann. »Das ist fantastisch. Und es ist auch fantastisch, dass du es mir erzählst und nicht für dich behältst. Ich komme jetzt gleich. Pack deine Sachen und sag Bescheid. Ich bin so schnell da, wie ich kann. Spätestens um fünf, hoffe ich.«
»Bis dann«, sagt sie, und es ist wundervoll, ihre Dankbarkeit zu hören.
Das kommt unerwartet. Ich muss meine Pläne für heute ändern, aber es ist auch ein Zeichen, dass es richtig von mir war, zuallererst für Imogen da zu sein.
Ich will den Zündschlüssel drehen, und als ich hingreife, nehme ich einen Geruch wahr, der mir Angst einjagt. Ich schnuppere. Ist das?
Es ist ein ekliger, organischer Gestank, der sich hinten in der Kehle festsetzt.
Mist!
Wieder schnuppere ich und blicke in den Rückspiegel. Ich sollte nachsehen, kann mich jedoch nicht dazu durchringen, den Kofferraum zu öffnen, ehe es nicht unbedingt sein muss. Und was ist, wenn jemand vorbeifährt, mich sieht und denkt, dass etwas nicht stimmt? Anhält. Hilfe anbietet.
Ich versuche, mich durch meine Panik zu atmen, und sage mir, dass nicht alles in sich zusammenfällt. Ich lasse den Motor an, damit ich das Fenster öffnen kann. Ein tieferes Einatmen löst einen Würgereflex aus, weil der Gestank überwältigend ist. Dennoch fühle ich mich schlagartig wie der glücklichste Mensch auf der Welt, denn der Gestank kommt eindeutig von draußen, nicht aus meinem Wagen. Ekelhafter Güllegestank, aber prima für mich, denn für einen Moment hatte ich befürchtet, es wäre etwas anderes.
Was ein furchtbares Problem gewesen wäre, denn ich habe keine Zeit, die Leiche loszuwerden, bevor ich Imogen abhole.
Maggie wartet nervös, dass John von der Scheune zurückkommt. Sie hatte vorgehabt, die Gäste selbst hinzufahren, aber er war ihr zuvorgekommen, hatte die Schlüssel zum Land Rover schon in der Hand gehabt. Und wie könnte sie ihm die vor den Gästen wieder abnehmen?
Die drei Frauen wirkten recht nett. Und entschlossen, auch ohne ihre Männer Spaß zu haben. Das Beste draus zu machen. »Wir bringen Ihre Männer nach oben, sobald sie morgen Vormittag hier sind«, versicherte Maggie ihnen.
Sie scheucht die Hühner in den Stall und genießt es, wie die Federn an ihren Beinen entlangstreifen.