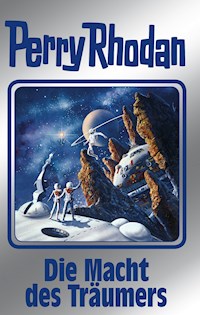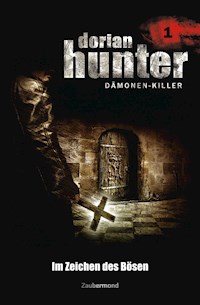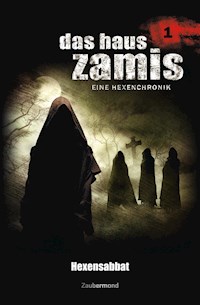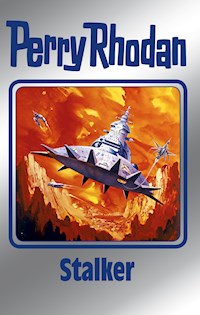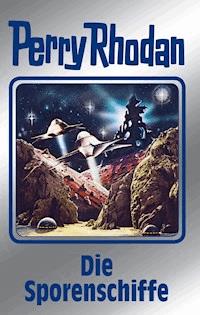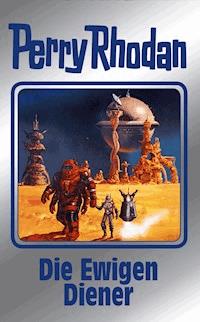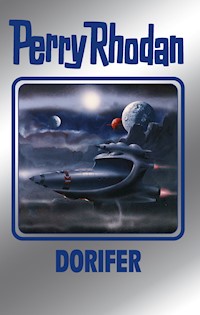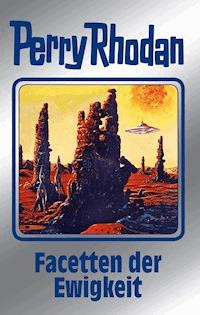
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Silberband
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 3586: Schon sehr lange warten die Trümmerleute, die sich selbst Loower nennen, auf einen sechsdimensionalen Impuls, der sie auf die Spur eines geheimnisvollen Objekts führen soll. Es wurde vor Äonen entwendet und auf einem unbewohnten Planeten verborgen - seither durchstreifen die Trümmerleute das Universum auf der Suche danach. Der unbekannte Planet ist heute Terra, die Heimat der Menschen. Das geheimnisvolle Objekt, das "Auge" des Roboters Laire, das die Loower um jeden Preis wieder in ihren Besitz bringen wollen, wurde bereits von den Ägyptern gefunden. Seit Jahrtausenden lagert es in der Cheopspyramide. Der machtbesessene Mutant Boyt Margor erbeutet das "Auge" und nutzt es für seine eigenen Zwecke. Damit zwingt er die Loower, das Solsystem mit ihrer Flotte zu übernehmen. Achtzehntausend Kampfraumschiffe materialisieren - genau zu der Zeit, als Margor die Macht auf Terra übernehmen will ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Nr. 103
Facetten der Ewigkeit
Im Jahr 3586: Schon sehr lange warten die Trümmerleute, die sich selbst Loower nennen, auf einen sechsdimensionalen Impuls, der sie auf die Spur eines geheimnisvollen Objekts führen soll. Es wurde vor Äonen entwendet und auf einem unbewohnten Planeten verborgen – seither durchstreifen die Trümmerleute das Universum auf der Suche danach.
Der unbekannte Planet ist heute Terra, die Heimat der Menschen. Das geheimnisvolle Objekt, das »Auge« des Roboters Laire, das die Loower um jeden Preis wieder in ihren Besitz bringen wollen, wurde bereits von den Ägyptern gefunden. Seit Jahrtausenden lagert es in der Cheopspyramide.
1.
Jarkus-Telft befand sich auf halbem Weg zwischen der Stadt und den Turmanlagen, als er in die Falle der Duade ging.
Die sengende Hitze des Wüstensands trieb die Monaden zur Raserei. Viele plusterten sich auf und segelten in weitem Bogen dahin, bevor sie irgendwo erschöpft in den Sand zurückfielen. Ihr Toben verriet den nahen Wetterumschwung. Jarkus-Telft fand, dass es an der Zeit war, wenn wieder Bewegung in die träge Atmosphäre kam. Ein Sturm würde nicht nur den Schmutz hinwegfegen, den die Monaden hinterließen, er würde zudem ihre hässlichen Sandsäulen niederreißen, die sie überall errichteten. Was für eine sinnlose Tätigkeit! Diese amöbenhaften Wesen hatten kein Ziel, keinen Lebensinhalt.
Jarkus würde die Neunturmanlage noch rechtzeitig vor dem Wetterumsturz erreichen. Die höchste der Turmruinen war schon über den Dünen zu sehen. Er hatte seine Mission in der Stadt erfüllt und würde wieder einer nützlicheren Beschäftigung nachgehen können. Es galt, die Fehlerquelle zu finden, die den Empfang des Impulses verhindert hatte ...
Urplötzlich gab der Boden unter ihm nach. Der Loower schaffte es nicht, sich aus dem Treibsand freizukämpfen; mit jeder Bewegung sank er tiefer ein.
Dann registrierte er den Psionischen Druck und vernahm die mentale Stimme der Duade. Dich lass ich mir nicht entgehen, Kleiner. Möchte endlich erfahren, was in den Gehirnen meiner Verweser vor sich geht.
Jarkus-Telft versank völlig im Sand, es wurde dunkel um ihn. Instinktiv faltete er die Mantelhäute schützend über seine Sinnesorgane. Erst als er spürte, dass der Sand ihn wieder freigab, entspannte er sich.
Er war in eine Salzsteinhöhle eingebrochen, die im kalten Licht von phosphoreszierenden Kleintieren funkelte. Aus einem senkrechten Spalt zwischen den Kristallgebilden schob sich eine gallertartige Masse in den Vordergrund. Am Ende eines rüsselartigen Fortsatzes entstand eine rhythmisch zuckende Blase, und die ihr entweichende Luft modulierte sich zu einer Stimme.
»Was hast du deiner Königin zu berichten, Trümmermann?«
»Ich war nicht unterwegs, um Bericht zu erstatten«, antwortete Jarkus wahrheitsgetreu. »Der Auftrag des Türmers ...«
»Ich kenne deine Mission. Aber mich interessiert nicht, wie es in eurer Stadt zugeht, sondern welche Fortschritte die Arbeit in der Neunturmanlage macht. Wurde die Fehlerquelle gefunden?«
»Sobald wir den Impuls empfangen, erfährst du es augenblicklich.«
»Ja, ihr könnt mir nichts verheimlichen«, sagte die Duade selbstgefällig. »Aber es genügt mir nicht, zu wissen, dass der ersehnte Impuls von schicksalhafter Bedeutung sein soll. Ich will erfahren, was geschehen wird!«
Der quallenförmige Körper zuckte; ein Zeichen dafür, dass die Duade ihre Erregung kaum beherrschen konnte. »Ihr heruntergekommenes Volk«, schimpfte sie. »Ihr kennt nicht einmal mehr die Bedeutung der größten Errungenschaften eurer Ahnen.«
»Bedenke, welch gewaltige Zeitspanne inzwischen vergangen ist ...«
»Ausreden!«, schimpfte die Duade. »Sieh dir die Neunturmanlage an, dann weißt du, was ich meine. Ihr lasst dieses monumentale Bauwerk einfach verrotten. Die Türme sind in Trümmer gefallen, und ihr tut nichts, um sie wieder in alter Pracht erstehen zu lassen. Wären nicht meine Monaden zur Stelle, um sie einigermaßen in Ordnung zu halten, wäre die Anlage längst unter den Sandmassen begraben.«
»Dafür danken wir dir, deswegen dienen wir dir ...«
»Ihr dient mir, weil ihr meine Macht fürchtet!« Die Duade unterbrach sich, und Jarkus-Telft spürte wieder den mentalen Druck, als sie sein Gehirn durchsuchte. Dabei ließ sie an ihrem Pseudorüssel eine riesige Luftblase entstehen, die sich in einem gewaltigen Knall entlud – das Äquivalent zu einem Wutschrei.
Jarkus war der Grund für diesen Zornesausbruch klar. Er hatte soeben in voller Absicht an die Entstehungsgeschichte der Duade gedacht. Als die Loower vor vielen Generationen nach Alkyra-II kamen, um die Neunturmanlage zu besetzen, da mussten sie feststellen, dass sich einiges geändert hatte. Unter den einzelligen Monaden war eine Mutation entstanden – die Duade. Dieses Amöbenwesen war ins Riesenhafte gewachsen und hatte Intelligenz und parapsychische Fähigkeiten entwickelt. Damals hatte die Duade gerade ihren Teilungsprozess abgeschlossen und besaß nun zwei Körper, die von einem Geist kontrolliert wurden.
Die Loower hatten die Gefahr erkannt und einen der Körper nach Alkyra-I gebracht. Damit war nicht nur die latente Bedrohung abgeschwächt worden, durch diese Trennung hatte sich zudem ein nützlicher Nebeneffekt ergeben. Die Duade herrschte nun auf zwei Planeten und bewachte Alkyra-I für die Loower.
»Ich verdanke meine Macht nicht eurer Gnade!«, zeterte sie. »Nicht die Strahlung eurer Neunturmanlage ließ mich mutieren, sondern ich bin aus eigener Kraft gewachsen. Und ich war es, die den Gedanken in eure Gehirne gesetzt hat, meinen Ableger nach Alkyra-I zu bringen. Ihr seid meine Untertanen. Wenn ich euch eine gewisse Handlungsfreiheit lasse, dann allein deshalb, weil ich euch für die Bedienung eurer Technik brauche. Ihr seid auf meiner Welt nur geduldet. Wenn du das nicht akzeptierst, fresse ich dich.«
Die Duade hatte noch keinen Loower absorbiert, dennoch gab sich Jarkus-Telft unterwürfig. Er war wirklich leicht beunruhigt. Das Gallertwesen wirkte auf eine nicht zu erklärende Weise verändert, und Jarkus fragte sich besorgt, ob es wieder in Teilung begriffen war. Die Hochrechnungen hatten allerdings prophezeit, dass eine Zellteilung nicht vor neun mal neun mal neun Großintervallen zu erwarten sei. Demnach wäre erst in drei Generationen mit diesem Problem zu rechnen.
Mutierte das Biest weiter?
»Geh jetzt! Sag dem Türmer, dass meine Geduld bald am Ende ist. Ich warte darauf, dass der Impuls eintrifft.«
Als Jarkus-Telft zurück an die Oberfläche kam, war der Sandsturm vorbei. Das Unwetter hatte alle Spuren verweht und die Atmosphäre gereinigt, die Dünen zeigten neu aufgeprägte Muster.
Nicht einmal die Neunturmanlage störte den Eindruck unberührter Natur, denn der Sturm hatte auch sie zugeschüttet. Nur die Spitze der höchsten Ruine ragte aus dem Sand.
Bald kamen die ersten Monaden aus ihren Verstecken gekrochen, und ihre sandfarbenen Körper knisterten unter der gespeicherten Elektrizität. Bis Jarkus-Telft die Neunturmanlage erreichte, wimmelte es ringsum von Monaden. Viele von ihnen hatten sich bei den neun Türmen eingefunden, um diese aus dem Treibsand auszugraben. Sie arbeiteten schnell und unermüdlich, als seien sie nur dafür geschaffen, das Ruinenbauwerk von Verwehungen zu säubern.
Jarkus brauchte nicht lange zu warten, bis der Zugang zum südlichen Turm frei lag und er ihn betreten konnte. Die Neunturmanlage würde in wenigen Augenblicken senden, und das wussten die Monaden. Obwohl diese Riesenamöben keinerlei messbare Intelligenz besaßen, verriet ihnen ihr Instinkt, wann die Sendung der Peilsignale fällig war.
Zu dieser Zeit fanden sie sich stets in Massen ein und umschwärmten die neun Türme wie Insekten das Licht.
Der Türmer war alt und weise und auf seine Art ein Philosoph. Obwohl er nicht nur der Verantwortliche für die Neunturmanlage war, sondern zugleich die oberste Instanz der kleinen Loower-Kolonie auf Alkyra-II, wagte man es nur in ganz dringenden Fällen, seine Ruhe zu stören. Jarkus-Telft glaubte, dass sein Anliegen besonderes Gewicht hatte, deshalb suchte er den Türmer in dessen Station auf.
Der Türmer beobachtete die tobenden Monaden auf seinen Monitoren. Er schien gar nicht zu bemerken, dass der junge Loower eintrat, und Jarkus-Telft wagte es nicht, sich bemerkbar zu machen.
Es dauerte lange, bis das Leuchtfeuer erlosch. Dann erst beruhigten sich die Riesenamöben. Der Türmer regte sich immer noch nicht. Ihm war nicht anzumerken, ob ihn das Treiben der Monaden bewegte. Aber Jarkus-Telft wusste, dass ihn diese primitiven Tiere kaum interessierten.
Es war Aufgabe des Türmers, das Leuchtfeuer zu bewachen. Er wartete auf etwas, das längst schon hätte eintreten sollen. Er wartete auf den Impuls des Objekts.
Dieser Impuls war seit nunmehr neun mal neun mal neun Intervallen überfällig, und das war auch der Grund, warum Jarkus-Telft beim Türmer vorsprach.
»Findest du nicht, dass die Monaden in letzter Zeit besonders wild sind, Gleniß?«, richtete Jarkus-Telft endlich das Wort an den Türmer.
»Nein, das finde ich nicht«, antwortete Gleniß-Gem, ohne den ungebetenen Gast anzusehen. »Wenn du das glaubst, bildest du es dir nur ein. Vermutlich spuken irgendwelche fantastischen Spekulationen durch deinen Kopf, dass du mich aufgesucht hast.«
»So ist es, Gleniß. Auf dem Rückweg aus der Stadt hat mich die Duade zu sich geholt. Sie benahm sich recht eigenartig, und mir kam der Verdacht, sie könnte an dem Ausbleiben des Impulses schuld sein. Wäre es möglich, dass sie ihn abgefangen hat?«
»Nein«, sagte der Türmer entschieden. »Ich weiß, du denkst, die Duade könnte weiter mutiert sein und mit ihren seltsamen Fähigkeiten den Impuls gespeichert haben.«
»Genau das waren meine Überlegungen. Sie müsste dazu wenigstens theoretisch in der Lage sein.«
»Ich habe den Aspekt bereits bedacht.«
Es folgte eine lange Pause, in der Jarkus-Telft schon glaubte, dass es der Türmer bei dieser lapidaren Äußerung belassen würde. Er wollte sich schon zurückziehen, aber da fing Gleniß-Gem wieder an zu reden und holte ungewöhnlich weit aus.
»Wir sind vor fünf Generationen auf diese Welt zurückgekehrt, nachdem andere aus unserem Volk vor langer Zeit das Leuchtfeuer entzündet haben«, erinnerte der Türmer. »Wir haben uns hier eingefunden, weil wir wussten, dass der Zeitpunkt nahe war, an dem der Impuls eintreffen würde, der uns den Weg zu jenem unersetzlichen Objekt zeigen soll. Aber unsere Vorfahren fanden auf Alkyra-II veränderte Bedingungen vor, denen sie sich anpassen mussten. Da war die Duade, primitiv zwar, aber gefährlich. Es war klug, sich ihr scheinbar unterzuordnen und sie in dem Glauben zu lassen, dass sie über uns herrscht. Dass es nicht wirklich dazu gekommen ist, verdanken wir der Tatsache, dass wir in zwei Bewusstseinsebenen denken und dass die Duade nur unser Ordinärbewusstsein telepathisch aushorchen kann. Auf diese Weise ist es uns möglich, unsere wahren Absichten vor ihr geheim zu halten. Sie erfährt von uns nur, was sie wissen darf. Die Duade glaubt, dass sie uns dazu gebracht hat, ihren Ableger nach Alkyra-I zu bringen, um ihren Machtbereich zu vergrößern. In Wirklichkeit haben wir den zweiten Körper der Duade als unseren Wächter auf dem ersten Planeten dieses Sonnensystems eingesetzt. Eine geradezu perfekte Tarnung und eine absolut sichere Schutzmaßnahme. Sollte der Feind hier auftauchen, wird er glauben, dies sei der Machtbereich einer Riesenamöbe und wir seien ihre Sklaven. Du siehst, Jarkus, es ist wichtig, den Schein aufrechtzuerhalten. Aber es ist auch nötig, darüber hinaus mehr zu tun, damit uns die Duade eines Tages nicht über den Kopf wächst.«
Der Türmer machte wieder eine Pause. Jarkus-Telft musste sich in Geduld üben, denn diesmal dauerte Gleniß-Gems Schweigen länger an.
»Schon einige Intervalle vor dem Zeitpunkt, zu dem der Impuls eintreffen sollte, habe ich Satelliten in die Tiefe dieser Galaxis geschickt«, fuhr der Türmer endlich fort. »In benachbarten Sonnensystemen wurden Empfangsstationen errichtet, Raumschiffe patrouillieren seit damals in einem Gebiet, das als möglicher Streusektor anzusehen ist. Du erkennst, Jarkus, wenn der Impuls abgeschickt worden wäre, dann hätten wir es von einem der vielen Außenposten erfahren, selbst wenn die Duade ihn abgefangen hätte.«
»Ich glaube trotzdem, dass mit der Duade etwas nicht stimmt«, entgegnete Jarkus-Telft. »Wir haben ihr nicht verheimlicht, dass wir auf den Impuls warten, und mir schien es, dass sie ihm ebenso entgegenfiebert wie wir. Ich hatte den Eindruck, als hecke sie Pläne gegen uns aus.«
»Die Duade glaubt so sehr an ihre Macht, dass ihr nie der Verdacht käme, sie könnte von uns manipuliert werden«, sagte der Türmer. »Sie fühlt sich als Herrscherin in diesem Sonnensystem. Aber selbst wenn sie dunkle Ziele verfolgen sollte, von denen wir nichts ahnen, haben wir von ihr nichts zu befürchten. Uns droht nur von dem Feind Gefahr, der uns von Anbeginn unserer Zeitrechnung durch die kosmischen Räume jagt.«
»Und falls die Duade im Dienst des Feindes steht?«
»Das wäre ein Verhängnis.« Zum ersten Mal zeigte der Türmer eine deutliche Gefühlsregung. »Ein schrecklicher Gedanke, doch er entbehrt jeder Grundlage. Lass mich jetzt allein, Jarkus! Deine verrückten Ideen wühlen mich zu sehr auf.«
Jarkus-Telft ging. Er machte sich zum neunten Mal daran, die Neunturmanlage nach einer Fehlerquelle zu durchsuchen, die den Empfang des Impulses verhindert haben könnte. So wenig sinnvoll diese Tätigkeit erschien, sie entsprach dem entelechischen Denken und der Paralogik der Loower, die besagte, dass Nichtstun weniger zielführend war als eine Tätigkeit mit geringsten Aussichten auf Erfolg.
Ebenso entsprach es der Mentalität der Loower, mit der Furcht vor Entdeckung durch den Feind zu leben, die Möglichkeiten einer unmittelbaren Bedrohung jedoch zu ignorieren.
Die Neunturmanlage war vor einer Ewigkeit errichtet worden. Den Ruinencharakter verdankte sie indes nicht natürlichen Verfallserscheinungen, sondern dem Willen der Erbauer. Diese hatten die Neunturmanlage als Ruine konzipiert, um die Anlagen zu tarnen.
Alle neun Türme durchmaßen an der Basis etwas mehr als fünfzig Körperlängen. Nach oben verjüngten sie sich konisch.
Ihre Höhe war unterschiedlich, gerade so, als sei ihr Verfall ungleich fortgeschritten.
Die drei höchsten Türme, die durchschnittlich sechs Basisdurchmesser in den Himmel von Alkyra-II ragten, bargen die Sendeantennen für das sechsdimensionale Leuchtfeuer ebenso wie die Einrichtung zum Anzapfen der benachbarten Sonnen, von denen die benötigte Energie kam. Die sechs anderen Türme besaßen mehr oder weniger nur symbolischen Wert. Immerhin war die Neun eine mystische Zahl für die Loower.
Die eigentlichen Anlagen, das Kraftwerk mit Energiespeicher und Umformer, Sender und Empfänger für sechsdimensionale Impulse und Signale, befanden sich in neun Ebenen unter dem Oberflächenniveau. Jarkus-Telft schwebte im Antigravfeld bis zur untersten Etage.
Zum wiederholten Mal durchsuchte er die Anlagen systematisch nach einer Fehlerquelle.
Mehrmals kreuzte er den Weg anderer Techniker, die das Gleiche taten wie er und auf der Suche nach dem hypothetischen Fehler nur nach einem anderen Schema vorgingen. Er wechselte kaum ein Wort mit ihnen. Erst als er Gnogger-Zam traf, legte er eine kurze Pause ein.
Sie befanden sich in der neuneckigen Haupthalle. Hier erhob sich der gewaltige Energiespeicher in Form einer neuneckigen Wabe.
Der Speicher bestand aus neun Leitern, die alle einen Durchmesser von neun Körperlängen hatten und zu einem einzigen Strang vereint waren, der um neun Ecken herumführte und wieder in sich selbst mündete. Auf diese Weise entstand das horizontal verankerte Wabengebilde mit einer Höhe von vier mal neun Körperlängen und einem Durchmesser von neunmal der Höhe. Drei von der Decke herabreichende Metallleiter führten die Energie von den Zapftürmen dem Speicher zu. Die Luft war von statischem Knistern und von Ozongeruch erfüllt.
Gnogger-Zam hatte den Energiespeicher nach lecken Stellen untersucht und teilte das Ergebnis seinem Freund mit.
»Ich habe zum x-ten Mal festgestellt, dass es hier keine Raum-Zeit-Verspannungen gibt, durch die sechsdimensionale Energien in ein anderes Universum abgeleitet werden könnten. Nirgendwo im Speicher ist ein Spannungsabfall festzustellen, alle drei mal neun Kapazitoren sind dicht. Ich habe ein ganzes Intervall gebraucht, um die neun mal neun mal neun Wegeinheiten, die der Umfang des Speichers misst, für jeden Kapazitor einzeln abzuschreiten. Es gibt keine undichte Stelle. Aber selbst wenn es sie gäbe, so frage ich dich, was dies mit dem Ausbleiben des Impulses zu tun haben könnte.«
»Wir müssen jede Unwahrscheinlichkeit in Betracht ziehen«, erwiderte Jarkus-Telft.
»Warum nicht auch die Wahrscheinlichkeiten?«, bemerkte Gnogger-Zam mit leichtem Zynismus. »Der Türmer sollte eine Untersuchungskommission zusammenstellen, die sich mit den Monaden befasst. Ihre Aktivitäten scheinen mir mehr Einfluss auf die Funktionsweise der Neunturmanlage zu nehmen, als es mögliche Mächte von außen tun könnten.«
»Ich habe mit dem Türmer über dieses Thema gesprochen«, sagte Jarkus-Telft. »Er will am Status quo aus Sicherheitsgründen nichts ändern. Die Monaden hält er für ungefährlich.«
»Gleniß-Gem muss es ja wissen.«
Wieder glaubte Jarkus-Telft, leisen Spott aus Gnoggers Worten herauszuhören. Es war ihm schon früher aufgefallen, dass der Freund bei Streitfragen gern eigene Meinungen vertrat, statt sich dem Gebot des Türmers unterzuordnen. Jarkus wertete das nicht unbedingt als negativ. Vielleicht wuchs mit Gnogger-Zam ein Kandidat für das Amt des Türmers heran, der Gleniß-Gem eines Tages ablösen konnte.
Ein Alarmsignal erklang. Die beiden jungen Loower erstarrten in der Bewegung. Der Alarm konnte nur vom Türmer selbst ausgelöst werden.
In der riesigen Haupthalle leuchteten Holos auf. Sie zeigten die Umgebung der Neunturmanlage. Jarkus-Telft hielt den Atem an, als er sah, was draußen geschah.
Die Monaden waren außer Rand und Band, obwohl das nächste Peilsignal noch lange nicht fällig war. Die Wüste rund um die neun Türme war graubraun verfärbt, eine wogende Masse pulsierender, zuckender Körper. Die Monaden hingen in dicken Trauben aneinander und schnellten sich im Kollektiv vom Boden hoch. Wie Katapultgeschosse prallten sie gegen die Türme und fielen herab. Etliche fanden jedoch in Rissen des Mauerwerks Halt und saugten sich mit ihren Pseudopodien fest.
Die Trümmer im Innenhof der Neunturmanlage waren mit reglosen Körpern übersät. Einige Monaden plusterten sich dermaßen auf, dass sie platzten. Hunderte Riesenamöben krochen die fast senkrechten Turmwände hinauf und sprangen von den höchsten Spitzen in die Tiefe. Andere rannten gegen die Mauern an, als wollten sie das Material durchbrechen.
»Was ist nur in sie gefahren?«, fragte Jarkus-Telft verständnislos. »Es sieht aus, als wollten sie Massenselbstmord begehen.«
»Vielleicht wollen sie die Neunturmanlage stürmen«, erwiderte Gnogger-Zam. »Bislang haben sich die Monaden während der Intervalle stets ruhig verhalten.«
Während die beiden Wissenschaftler das Treiben der Riesenamöben beobachteten, meldete sich der Türmer über die Rundrufanlage. »Das längst erwartete Ereignis ist eingetreten«, verkündete Gleniß-Gem. »Der Impuls ist mit einer Verspätung von neun mal neun mal neun Intervallen eingetroffen.«
»Endlich«, sagte Jarkus-Telft. »Aber warum klingt die Stimme des Türmers besorgt?«
»Er muss sich fragen, was die Verzögerung verursacht hat«, antwortete Gnogger-Zam. »Die mögliche Antwort darauf trübt die Freude über den Empfang des Impulses.«
2.
»Vargas Denner, Referent für Innere Sicherheit«, meldete der Sekretär des Ersten Terraners.
Julian Tifflor blickte dem Besucher entgegen, der hastig auf ihn zukam, und erhob sich von seinem Platz, um ihn zu begrüßen. Dabei erkannte er, dass der kleine, zur Korpulenz neigende Mann für seine kurzen Beine zu große Schritte machte. Und wie er ging, so sprach er auch, überhastet und atemlos, wobei er jedes Wort mit Gesten und Grimassen unterstrich.
Tifflor bot ihm Platz an.
»Sie sind etwas früh dran, Denner. Die Frist, die ich mir selbst gesetzt habe, Ihre Eingabe zu überprüfen, läuft erst morgen ab. Doch wenn Sie schon hier sind, können wir das Thema sofort erörtern. Ich habe Ihre Akte bereits eingesehen.«
»Ich wusste, dass Sie dieses Problem vorrangig behandeln würden«, sprudelte der Referent hervor. »Die Angelegenheit ist auch viel zu wichtig. In der augenblicklichen Krise bedürfen Sicherheitsfragen schneller Entscheidungen. Ich hoffe zudem, dass Sie die Akte nicht nur eingesehen, sondern nach bestem Wissen und Gewissen geprüft haben. In diesem Fall konnten Sie gar nicht anders, als sich für das ›Projekt Wespe‹ zu entscheiden.«
Tifflor hatte im Lauf der Jahrhunderte genug Erfahrung gesammelt, um sich von Verhandlungspartnern nie deren Taktik aufzwingen zu lassen.
»Von welcher Krise sprechen Sie eigentlich?«, fragte er ruhig und gebot seinem Gegenüber durch eine Handbewegung Schweigen, als dieser hastig zur Antwort ansetzte. »Wir haben alle Probleme bewältigt, die sich durch die Rückkehr der Erde an ihren angestammten Platz im Solsystem und die Zuwanderung der Menschen aus der Provcon-Faust und den Kolonialwelten ergaben. Wir haben die Liga Freier Terraner gegründet und eine Regierung gewählt, die ausgezeichnet funktioniert. Die GAVÖK hat unsere Bemühungen um eine friedliche Koexistenz honoriert, indem sie die LFT in die Galaktische Allianz aufnahm. Wir leben in einer Zeit des relativen Friedens, der sicherer ist als in den Jahren vor dem Auftauchen der Laren.«
Tifflor machte eine kurze Pause, hob aber wieder die Hand, um seinen Besucher am Sprechen zu hindern. Denner war deutlich anzumerken, wie schwer es ihm fiel, den Mund zu halten.
»Wann hat es das jemals gegeben, dass die Völker der Milchstraße ihre Streitigkeiten auf diplomatischer Ebene austragen und sich mit dem Überreichen von Protestnoten begnügen?«, fuhr Tifflor fort. »Die GAVÖK macht es möglich – oder müsste man nicht sagen, Mutoghmann Scerp macht es möglich? Denn er hat die GAVÖK sicher im Griff. Zum ersten Mal, seit die Menschen zu Bürgern der Milchstraße geworden sind, ist ein galaktischer Friede in Sicht. Von welcher Krise also sprechen Sie?«
»Ich meine die internen Spannungen, die sich aus der Rückwanderung der Milliarden Menschen ergeben. Nach außen hin steht natürlich alles zum Besten, die AID organisiert den Transport der Heimkehrer. Aber wie steht es mit der inneren Sicherheit? Wer sorgt dafür, dass sich auf Terra keine zwielichtigen Elemente einschleichen, Spione fremder Mächte, Saboteure, Verbrecher und Aufrührer? Terra braucht eine Organisation wie die ›Wespe‹, eine Sicherheitstruppe, die das Übel an der Wurzel packen und durch gezielte Aktionen jede Gefahr im Keim ersticken kann. Eine solche Institution fehlt.«
»Auf der aphilischen Erde hat es sie gegeben«, erwiderte Tifflor.
Die Erinnerung an die Aphilie weckte in dem Ersten Terraner durchaus gegenwartsbezogene Assoziationen. Schließlich handelte es sich bei der BASIS, die vor zwei Monaten das Sonnensystem verlassen hatte, um eine Konstruktion der Aphiliker. Schon während der ersten Flugetappe zur Galaxis Tschuschik, wo die Besatzung das Rätsel von PAN-THAU-RA zu entschlüsseln hoffte, war es zu einem spätaphilischen Effekt gekommen. Das Monstrum Dargist wäre der Besatzung fast zum Verhängnis geworden.
Julian Tifflor war über diese Ereignisse von der Mannschaft der BAIKO unterrichtet worden. Mit dem Großraumschiff war Roi Danton der BASIS nachgeflogen.
»Der Vergleich mit den Aphilikern ist an den Haaren herbeigezogen«, drang Vargas Denners aufgeregte Stimme in seine abschweifenden Gedanken. »Die ›Wespe‹ soll die Bürger nicht kontrollieren, sondern schützen. Wenn Sie die Unterlagen geprüft haben, dann wissen Sie, dass eine solche Organisation nicht aufwendig zu sein braucht. Kein großer Verwaltungsapparat, weil ein einzelner Mann die Zügel in der Hand hält. Nur wenige ausgesuchte Personen mit besonderen Vollmachten im Außendienst. Sie können eine größere Wirkung erzielen als ganze Armeen, weil sie flexibler sind und rasch und rigoros zuzupacken vermögen. Der finanzielle Aufwand fällt, gemessen an der erzielten Wirkung, überhaupt nicht ins Gewicht. Die Versorgung mit der technischen Spezialausrüstung ist auch kein Problem mehr, seit auf Luna die Produktion voll angelaufen ist. Eine Flotte kleiner Spezialraumschiffe würde genügen. Jedenfalls wäre der Kostenaufwand nur ein Bruchteil dessen, was die BASIS verschlungen hat.«
»Mir geht es nicht um die Kostenfrage«, sagte Tifflor bedächtig. »Was mich an Ihrem Projekt stört, ist die Tatsache, dass eine einzelne Person unumschränkte Macht erhalten soll. Die ›Wespe‹ wäre ein Staat im Staat. Sie wären zweifellos der geeignete Mann, eine solche Organisation zu leiten, Referent Denner, aber die LFT braucht keine ›Wespe‹.«
Denners Gesicht rötete sich, und er sagte schwer atmend: »Ich habe dabei gar nicht an mich gedacht. Sicherlich würde sich ein fähigerer Mann finden. Ich habe sogar schon einen Kandidaten ...«
»Es wird keine ›Wespe‹ geben!«, fiel Tifflor ihm ins Wort. »Das ist alles, Referent Denner. Guten Tag!«
Vargas Denner versuchte erst gar nicht, seinen Ärger und seine Enttäuschung zu verbergen. »Das werden Sie noch bereuen, Erster Terraner«, sagte er und erhob sich. »Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen. Ich werde weiterhin dafür eintreten, dass Terra eine wirksame Schutzmacht bekommt!« Er wandte sich brüsk ab und verließ den Raum.
Tifflor lehnte sich aufatmend in seinem Sessel zurück. Es würde immer wieder Männer wie Denner geben, die versuchten, die Wirren des Wiederaufbaus zu nutzen, um an die Macht zu kommen. Das zeigte dem Ersten Terraner deutlich, wie verletzlich die LFT noch war.
Seit Roi Danton sich zur BASIS abgesetzt hatte, ruhte die Verantwortung auf Tifflor und Adams. Rhodan, Atlan, Bull und Waringer waren mit der SOL in den Tiefen des Alls verschollen. Und jene Personen der neueren Generation, die für größere Aufgaben geeignet erschienen, bildeten die Besatzung der BASIS oder waren wie Ronald Tekener mit anderen Missionen betraut.
Aber zum Klagen bestand dennoch kein Grund. Immerhin herrschte Ruhe in der Galaxis, und ein dauerhafter Friede unter den Milchstraßenvölkern zeichnete sich ab.
Mit der Vermutung, dass Vargas Denner mit der ›Wespe‹ ein Machtinstrument für eigennützige Ziele schaffen wollte, hatte Tifflor ins Schwarze getroffen. Doch tat er dem Referenten unrecht, wenn er glaubte, Denner wollte diese Macht für sich selbst beanspruchen. Der Referent wollte die Macht für jemanden, in dessen Dienst er stand, besser noch, in dessen Abhängigkeit er sich befand.
Denner war ein Paratender Boyt Margors.
Nach seinem Besuch bei dem Ersten Terraner begab er sich auf dem schnellsten Weg in einen von Margors geheimen Stützpunkten. Das mehrstöckige Gebäude, das früher die Botschafter einer Siedlungswelt beherbergt hatte, galt heute offiziell als Sitz der »Gesellschaft zur Erforschung paranormaler Phänomene«, deren ehrenamtlicher Leiter Denner war. Dadurch hatte die GEPAPH halbamtlichen Charakter bekommen, obwohl sie privater Initiative entsprungen war, und galt als über jeden Zweifel erhaben. Neben kleineren Stützpunkten in aller Welt unterhielt die Gesellschaft auf der griechischen Halbinsel Agion Oros in den verwaisten Athosklöstern eine Klinik für geistig instabile und abnorme Menschen.
Als Denner das Gebäude betrat, suchte er nicht sein Büro auf, sondern schwebte mit dem Antigravlift in den Keller. Er musste einige Sicherheitsmaßnahmen über sich ergehen lassen, bevor er die Bunkeranlagen betreten konnte. Die meisten der in diesem Gebäude Beschäftigten, obwohl durchweg Personen, die in besonderer Psi-Affinität zu Boyt Margor standen, hatten keine Ahnung von dem unterirdischen Versteck.
Denner erreichte einen wohnlich und luxuriös eingerichteten Raum, der nur durch wenige Lichtquellen indirekt beleuchtet war. Im Halbdunkel sah er drei Gestalten um eine mit technischen Raffinessen ausgestattete Liege stehen. Er erkannte in ihnen den Parapsychologen Ove Hermsted, den Psioniker Dentrov Quille und den Paraphysiologen Guntram Peres. Hermsted löste sich von den anderen und kam ihm entgegen.
»Wenn Sie keine gute Nachricht für Boyt haben, wäre es besser, Sie würden ihn in Ruhe lassen«, sagte der Parapsychologe statt einer Begrüßung und ergriff Denner am Arm. »Sein Zustand ist nach wie vor bedenklich, er scheint wieder dem Höhepunkt einer Krise zuzusteuern.«
Denner schüttelte die Hand ab. »Ich dachte, Sie und Ihre Kollegen wollten sich etwas einfallen lassen, um Boyt von allen äußeren Einflüssen abzuschirmen. Aber was haben Sie wirklich erreicht?«
»Wir haben alles Menschenmögliche getan. Wir haben den Bunker gepanzert und den Strahlenschutz durch Energieschirme verstärkt. Dennoch konnten wir nicht verhindern, dass sich Boyts Zustand verschlechtert hat.«
Denner stieß Hermsted beiseite und eilte zu der Liege. Dort lag ein großer, schlanker Mann mit ungewöhnlich heller Haut und jugendlichem Aussehen. Er hatte ein schmales Gesicht mit stark vorgewölbter Stirn. Das Gesicht hatte etwas Kindliches, zugleich aber auch etwas Greisenhaftes.
Boyt Margor stöhnte. Er rollte mit den großen Augen, als wolle er seine Umgebung erforschen, sah aber scheinbar durch alles hindurch. Er hatte die Arme abgewinkelt, die Hände lagen auf der Brust, und seine langen Finger spielten mit dem Amulett, das er um den Hals trug.
Denner schaute schnell zur Seite, um nicht in den Bann des walnussgroßen Brockens fremdartiger Materie zu geraten.
»Boyt, kannst du mich hören?«, sagte er in seiner plärrenden Art. »Ich bin es, Vargas. Ich bin wieder zurück.«
»Vargas?«, fragte Margor stirnrunzelnd. Jäh ruckte sein Oberkörper hoch. Er stützte sich auf die Arme und sah sich blicklos um. »Wo bin ich? Was bedeutet die Dunkelheit? Wer hat mich eingeschlossen?«
»Du bist in deinem Versteck im Keller der GEPAPH.«
Margor schien ihn nicht zu hören. Die Spinnenfinger des Albinos wanderten über die seitlichen Konsolen der Liege und versuchten, sich an der verwirrenden Tastatur zu orientieren. Plötzlich wurde der Raum in gleißendes Licht getaucht, alle Beleuchtungskörper strahlten so grell, dass Denner und die anderen geblendet die Augen zukniffen.
»So dunkel ...«, murmelte Margor. »... so schwer. Ich sinke immer tiefer. Verschafft mir Erleichterung, nehmt die Dunkelheit von mir.«
Dentrov Quille trat an seine Seite und betätigte den Helligkeitsregler, bis der Raum wieder in gedämpftem Licht lag.
»Was sollen wir tun, Boyt?«, fragte Peres aus dem Hintergrund. »Sage uns, wie wir dir helfen können.«
»Bringt Denner zu mir«, verlangte Margor schwach. »Ich muss wissen, was er in Sachen ›Wespe‹ erreicht hat ... Nein! Er ist tot. Ich weiß es. Er ist tot und der andere auch, oder er ist mir einfach nur entglitten ...«
»Ich bin da, Boyt.« Denner beugte sich hinunter, bis sein Gesicht auf gleicher Höhe mit dem von Margor war. »Ich bin eben erst zurückgekommen. Es war ein Fehler, beim Ersten Terraner wegen einer Schutzmacht vorzusprechen. Er hat das Projekt abgelehnt. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, du bekommst deine eigene Schutztruppe, das verspreche ich. Ich werde meinen ganzen Einfluss aufbieten, um das Projekt durchzuboxen ...«
»Harso Sprangohr ist tot, ich habe das sofort gespürt«, fiel Margor dem Referenten für Innere Sicherheit ins Wort. »Es ist immer so. Wenn ein Paratender stirbt, ist das, als stürbe ein Teil von mir – in Sprangohrs Fall nur ein winziger Teil, aber ... Und Hamiller musste ich freigeben, er ist mir entglitten. Kein Kontakt mehr ...«
»Sprichst du von der BASIS, Boyt?«, fragte Denner in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Mutanten auf sich zu lenken. Boyt hatte in den letzten Tagen oft von der BASIS fantasiert. Ob ein Zusammenhang zwischen diesem Raumschiff und seinem Zustand bestand, der bald nach dem Aufbruch der BASIS eingesetzt hatte? Hermsted verneinte das, doch was verstand der Parapsychologe schon von Margors Psyche. Man musste selbst übernatürliche Fähigkeiten haben oder zumindest so viel Einfühlungsvermögen besitzen wie er, Denner, um sich in Boyts Lage versetzen zu können.
Margor gab keine Antwort. Er sank auf die Liege zurück und starrte über sich ins Leere.
»Ich habe Angst«, gestand Quille bebend. »Was soll aus uns werden, wenn Boyt weiter verfällt? Er ist unsere Seele, unser Gehirn. Ohne ihn würden wir ins Uferlose treiben.«
»Boyt braucht uns ebenso wie wir ihn!«, herrschte Denner die anderen an. »Wenn ihr schlappmacht, statt nach einem Ausweg aus dieser Krise zu suchen, dann ist Boyt verloren. Wie lautet Ihre Diagnose, Ove?«
»In seinen lichten Momenten habe ich mit Boyt das Problem erörtert«, antwortete der Parapsychologe. »Er sendet und empfängt vielleicht stärker als zuvor, aber er ist auf ein unbekanntes Etwas fixiert. Boyt kann nicht einmal sagen, ob es sich um ein Lebewesen oder um sonst etwas handelt. Er weiß nur, dass in diesem Fall er der passivere Teil ist.«
»Wenn ich den Vorgang richtig verstehe, dann ist dieses Etwas eine Art Psionischer Parasit, der sich an Boyts Geist festgesaugt hat«, überlegte Denner. »Verhält es sich so, Dentrov?«
»Das genaue Gegenteil ist der Fall«, antwortete der Psioniker. »Boyt wird nicht ausgesaugt, sondern psionisch aufgeladen. In ihm wächst ein Überdruck von Psi-Energie, deshalb hat er die Kontrolle über sich verloren. Solange wir die Ursache nicht kennen, können wir ihn nicht heilen. Aber wir könnten ihm Erleichterung verschaffen, wenn wir ihn nach Agion Oros zum Idioten bringen.«
»In seinem Zustand wäre ein Transport zu riskant«, sagte Denner warnend. »Boyt hat Feinde, vergesst das nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden, ihm zu helfen.«
»Ich schließe mich Dentrovs Meinung an«, bemerkte der Paraphysiologe. »Boyts Energiehaushalt ist völlig durcheinander. Wenn er weiterhin aufgeladen wird, kann er dem Überdruck bald nicht mehr standhalten, und die psionischen Energien werden nach einem Ventil suchen. Deshalb bedeutet er eine Gefahr für sich und seine Umgebung. Boyt kann seine Kräfte bald nicht mehr kontrollieren. Er braucht den Idioten als Blitzableiter. Diese Methode hat sich bisher bewährt. Deshalb verstehe ich nicht, warum Sie sich auf einmal dagegen sträuben, Vargas.«
»Weil das keine endgültige Lösung sein kann«, sagte Denner heftig. »Boyt nach Agion Oros zu bringen wäre natürlich der bequemere Weg. Aber ich will, dass ihr eure Gehirne anstrengt.«
»Sie tun uns unrecht, Vargas«, widersprach Hermsted. »Uns liegt ebenso viel wie Ihnen an Boyts Wohlergehen. Wenn er sich nicht auf uns verlassen könnte, wären wir nicht hier. Im Augenblick haben wir keine andere Wahl, als ihn zu Niki zu bringen – bevor es eine Katastrophe gibt.«
Denner, der Margor nicht aus den Augen gelassen hatte, bemerkte, dass mit dem Mutanten eine Veränderung vor sich ging. Boyts Gesicht entspannte sich, und um seinen Mund spielte ein leises Lächeln. Er richtete sich auf, und während er Denner tief in die Augen blickte, als wolle er dessen Seele erforschen, zeigte sich auf seinem Gesicht ein Ausdruck des Erkennens. »Du hier«, sagte er erfreut und legte dem LFT-Referenten beide Hände auf die Schultern. »Niki, wie ich mich freue, dich bei mir zu haben. Ich brauche dich wie nie zuvor, du Lausebengel.«
Denner erkannte entsetzt, dass Margor ihn mit dem Idioten verwechselte. Er versuchte, sich aus dem Griff zu lösen, doch Margor hielt ihn fest.
»Nicht, Boyt!«, schrie der Referent verzweifelt. »Ich bin es, Vargas. Beruhige dich! Wir werden dich zum Idioten bringen.«
Margors Gesicht verdüsterte sich. »Du bist es nicht, Niki?«, fragte er enttäuscht. »Aber wer dann?«
Denner spürte eine alles verzehrende Kraft auf ihn übergreifen, die seine Gedanken im Keim erstickte. Er wurde mit elementarer Gewalt in ein höllisches Inferno gerissen und versank in ewiger Dunkelheit.
Margor hielt den Körper fest, der in seinen Händen geschrumpft war und ein mumienhaftes Aussehen angenommen hatte. »Ein Zwotter«, stellte er überrascht fest, ließ den vertrockneten Körper fallen und sank in wohliger Erschöpfung auf seine Liege zurück.
In die anderen Männer kam wieder Bewegung.
»Das hat er davon.« Peres vermied es, auf das vertrocknete Etwas zu blicken, das von Denner übrig geblieben war. »Was nun?«
3.
»Meine Freude über den Empfang des Impulses wird durch die große Verzögerung getrübt«, eröffnete der Türmer das Gespräch. Jedoch befasste sich nur sein entelechisches Bewusstsein mit diesem Problem. Sein zweites und oberes Bewusstsein war auf einen anderen Komplex fixiert, denn der Türmer wusste, dass die Duade ihn und seine Gesprächspartner belauschte. Da es der parapsychisch begabten Riesenamöbe nicht möglich war, in das tiefere Bewusstsein der Loower vorzudringen, konnte sie die wahre Natur der Konferenz nicht erkennen.
Die gesamte Turmbesatzung hatte sich in der Zentrale des Türmers eingefunden, insgesamt drei mal neun Wissenschaftler.
»Bevor ich entscheide, was zu tun ist, möchte ich euch die Vorgeschichte in Erinnerung rufen«, fuhr Gleniß-Gem fort. »Währenddessen soll sich euer Ordinärbewusstsein jedoch mit den renitent gewordenen Monaden auseinandersetzen, damit die Duade nicht misstrauisch wird.«
Er hatte das kaum ausgesprochen, als sich schon eine mentale Stimme meldete. Glaube ja nicht, dass du gegen mich intrigieren kannst, Türmer. Ich erfahre jeden hinterhältigen Gedanken. Was soll der Kriegsrat? Planen meine Verweser den Aufstand?
Wir sind besorgt wegen des aggressiven Verhaltens der Monaden, formulierte Gleniß-Gems Ordinärbewusstsein. Gleichzeitig sagte er laut: »Das Objekt wurde vor Äonen in dieser Galaxis versteckt, damit es dem Feind nicht in die Hände fällt. Aus Sicherheitsgründen wurden die Koordinaten vernichtet. Aber wir wissen, dass das Objekt auf dem Planeten eines Sonnensystems innerhalb eines bestimmten Spiralarms versteckt wurde. Jedes Mal, wenn diese Sterngruppe einmal um ihre Achse rotiert, sendet das Objekt den Impuls aus. Die Zeitspanne von einem Impuls zum anderen ist genau 226.000-mal die Umlaufbahn des besagten Planeten um seine Sonne. Anhand dieser Daten und mit dem Wissen, wann der Impuls zuletzt gesendet wurde, konnten wir uns ausrechnen, wann er wieder fällig war. Schon lange vorher kamen unsere Vorfahren hierher, um sich auf diesen großen Augenblick vorzubereiten. Denn endlich, nach einer unsagbar langen Zeit des Wartens, sind wir in der Lage, das Objekt seiner Bestimmung zuzuführen ...«
Wollt ihr Krieg gegen meine Monaden führen?, wetterte die Duade. Euer verdammter Impuls ist an ihrer Verwirrung schuld. Oder leugnest du, dass ihr den so sehnlich erwarteten Impuls empfangen habt, Türmer?
Wie könnte ich das leugnen, dachte Gleniß-Gem auf oberer Ebene; entelechisch dachte er ganz anders, und das sprach er auch aus: »Was für ein Schock war das, als der Impuls nicht zum gegebenen Zeitpunkt eintraf! Nun haben wir ihn endlich empfangen. Doch diese unerklärliche Verzögerung ist mindestens ebenso bedenklich, als wäre er überhaupt nicht abgegeben worden. Etwas muss vorgefallen sein, was weder vorauszusehen war noch im Bereich des Wahrscheinlichen lag.«
Für die Duade dachte der Türmer: Wir haben vermutet, dass der Impuls die Monaden zur Raserei gebracht haben könnte. Doch wir haben dich vorgewarnt. Es liegt an dir, Königin, die Monaden zur Räson zu bringen.
Sie sind meiner Kontrolle entglitten, sie gehorchen mir nicht mehr. Sieh nur, wie sie sich ins Verderben stürzen!
Der Türmer sah es in den Holoabbildungen. Der Strom der Riesenamöben, die zu den neun Türmen pilgerten, nahm kein Ende. Es war, als hätte der Impuls sie an diesen Ort gelockt und ihnen befohlen, die Ewigkeitsmauern zu stürmen. Aber die Türme hielten dem Ansturm stand. Die toten Monaden bedeckten bereits den Trümmerhof im Innern der Anlage.
Ist das ein Eingeständnis deiner Ohnmacht, Königin?, fragte des Türmers Ordinärbewusstsein. Willst du tatenlos zusehen, bis die sterblichen Hüllen deiner Monaden die neun Türme bedecken?
Wozu habe ich euch? Entzündet das Leuchtfeuer, dann werden sich die Monaden sofort beruhigen. Es bedarf nur des unsichtbaren Turmsignals, um die Ruhe wiederherzustellen. Gebt den Monaden das Signal, und sie werden friedlich sein.
»Das wirst du hoffentlich nicht tun, Gleniß!«, rief Jarkus-Telft erschrocken aus, und er dachte auf beiden Ebenen so. »Die Dauer der Intervalle, in denen das Leuchtfeuer strahlt, darf nicht verändert werden.«
»Ist das nicht in unserem Tiefenbewusstsein fest verankert?«, sagte der Türmer mit leichtem Tadel zu dem jungen Wissenschaftler und registrierte zufrieden, dass dieser Beschämung wegen seiner vorlauten Äußerung zeigte. »Eher würde ich sterben, als den Rhythmus des Leuchtfeuers zu stören.« Diese Äußerung war für die Duade gedacht. Für seine Artgenossen fügte er hinzu: »Schweifen wir nicht vom Thema ab! Spart eure verwirrenden Gedankengänge für die Duade auf und nur für sie. Wir müssen hier und jetzt zu einer Entscheidung kommen, was zu geschehen hat.«
Was gedenkst du zu tun, Türmer?
Gleniß-Gem justierte das größte Holo neu, sodass die Szenerie mit den Monaden verschwand. Die Projektion zeigte nun das Schema zweier Impulse auf sechsdimensionaler Basis. Beide Projektionen glichen einander bis auf geringe Abweichungen.
»Zur Linken ist das Piktogramm des Impulses zu sehen, wie er in der Memo-Anlage gespeichert ist. Rechts ist der Impuls sichtbar gemacht, den wir empfangen haben. Jeder kann leicht erkennen, dass er modifiziert wurde. Welche Einflüsse daran schuld sind, müssen wir herausfinden.«
Zweifellos hat diese Modifizierung des Impulses die Monaden um die Kontrolle über sich gebracht, dachte Jarkus-Telft auf zweiter Ebene. Laut fügte er hinzu: »Wir sollten eine Expedition starten, um nach der Ursache der Veränderung zu suchen. Es wäre möglich, dass wir damit gleichzeitig den Grund für die Verzögerung herausfinden.«
Alle stimmten zu, und der Türmer schwieg, was einem Einverständnis gleichkam. Selbst die Duade war von diesem Plan angetan.
Eine Expedition in die Tiefen der Galaxis – und ich selbst werde sie anführen!
»Das wäre zu gefährlich«, sagte Gnogger-Zam diplomatisch. »Wir können unsere Königin nicht der Gefahr aussetzen, dem Gegner in die Falle zu gehen. Schließlich müssen wir damit rechnen, dass der Feind den Impuls manipuliert hat.« Er sprach damit aus, was die anderen in ihr Tiefenbewusstsein verdrängt hatten, die Angst, dass der Feind das Objekt gefunden haben könnte.
»Gesundes Misstrauen ist angebracht.« Der Türmer formulierte in seinem Ordinärbewusstsein eine Gedankenkette, die der Duade plausibel machen sollte, warum sie an dieser Expedition nicht teilnehmen konnte. Es war ein Appell an ihren Selbsterhaltungstrieb.
In Wirklichkeit ging es Gleniß-Gem darum, der Riesenamöbe keine Gelegenheit zu geben, ihre Macht auf andere Sonnensysteme auszudehnen. Im Alkyra-System war sie relativ isoliert und harmlos. Da sie nicht die Möglichkeit hatte, aus eigener Kraft die Leere zwischen den Sternen zu überwinden, konnten die Loower sie unter Kontrolle halten. Aber es war nicht auszudenken, was passierte, wenn ein Volk in ihren Bann geriet, das sich den gedanklichen Befehlen nicht zu entziehen vermochte.
Während die Loower die Duade mit ihren Ordinärgedanken einlullten, ging die Diskussion über eine Expedition weiter.
»Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen«, mahnte Gnogger-Zam. »Also darf die Expedition im Fall einer Entdeckung keine Rückschlüsse zulassen. Die Zahl der Teilnehmer muss gering gehalten werden, damit sie sich gegebenenfalls eliminieren können und keine Hinweise auf unser Volk hinterlassen. Ich selbst melde mich freiwillig und würde es begrüßen, wenn Jarkus-Telft mich begleiten dürfte.«
Es ist rührend, wie ihr um meine Sicherheit besorgt seid, meldete sich die Duade. Gut, ich stimme der Expedition zu; wenn nicht mehr als zwei Verweser daran teilnehmen. Meine Bedingung ist, dass ich von den beiden durch Gedankenprotokolle über den Verlauf der Expedition informiert werde.
»Ihr habt es gehört, die Königin hat ihre Zustimmung gegeben«, sagte Gleniß-Gem amüsiert, aber seinen Ordinärgedanken ging dieser belustigte Unterton ab. »Nun sollen beide Kandidaten selbst bestimmen, in welcher Form sie ihre Mission gestalten wollen.«
Gnogger-Zam und Jarkus-Telft berieten sich eingehend, bevor Letzterer ihren Beschluss dem Türmer bekannt gab. »Unter den gegebenen Umständen bleibt keine andere Wahl, als auf das Materiallager auf Alkyra-I zurückzugreifen. Wir haben uns entschlossen, uns des Saqueth-Kmh-Helks zu bedienen. Bei dem Versunkenen handelt es sich nicht nur um eine der größten Errungenschaften unseres Volkes, sondern auch um eine sehr wirkungsvolle Waffe. Wir werden ihn aus dem Feuersee Sahlmo bergen und mit ihm das Unternehmen wagen.«
»Eine gute Wahl«, sagte der Türmer anerkennend und fragte in Gedanken: Und was hält unsere Königin davon?
Ich habe meine Schwester auf Alkyra-I verständigt, antwortete die Duade. Sie erwartet die beiden Kandidaten und wird sich ihrer annehmen.
»Dann sei es«, erklärte der Türmer.
»Selbst auf die Gefahr hin, dass du mich belächelst, Gleniß, muss ich wiederholen, dass mir das Verhalten der Duade missfällt«, sagte Jarkus-Telft. »Sie heckt etwas aus. Stimmt es dich nicht ebenfalls nachdenklich, dass sie unseren Plänen so widerspruchslos zugestimmt hat?«
Beide Wissenschaftler suchten die Waffenkammer auf, um die für die Bergung des Versunkenen notwendige Ausrüstung selbst zusammenzustellen. Da auf dem innersten Planeten des Alkyra-Systems vierfache Körpertemperatur herrschte, mussten sie besondere Schutzmaßnahmen treffen.
Gnogger-Zam entschied sich für einen schweren Kampfanzug aus widerstandsfähigen Metallplatten, die durch Gelenkverschlüsse miteinander verbunden wurden. Ein solcher Kampfanzug konnte individuell gestaltet werden, da er aus vielen neuneckigen Platten bestand, die sich beliebig variieren ließen.
Als Gnogger-Zam in voller Ausrüstung dastand, glich er einem geflügelten Roboter. Sein Individualanzug war vollständig mit Metall ausgelegt, durchweg mit silbrig spiegelnden Plättchen, die Auswüchse, Vertiefungen und Rissmuster aufwiesen. Dabei handelte es sich um Ortungsgeräte und Waffen. Selbst seine Sinnesorgane hatte er hinter einem Metallelement mit spezieller Sichteinrichtung versteckt.
Jarkus-Telft begnügte sich damit, seine Beine und die empfindlichen Körperstellen durch Metallplatten zu schützen. Die Lücken schloss er mit ebenfalls neuneckigen und foliendünnen Plastikelementen. Vor seine Sinnesorgane setzte er ein versenkbares Klarsichtbauteil.
Obwohl seine Ausrüstung fast zerbrechlich wirkte, war er nicht minder geschützt als Gnogger-Zam. Denn er musste die Energie des eingesetzten Miniaturkraftwerks nicht für die Aufhebung von zusätzlichem Ballast verwenden, sondern konnte sie nahezu ausschließlich für die Errichtung eines Schutzschirms einsetzen.
Die beiden Loower verließen die Waffenkammer und stellten sich dem Türmer, der sie kritisch inspizierte.
»Ihr seid gut gerüstet und werdet euch im Notfall perfekt ergänzen«, sagte Gleniß-Gem zufrieden. »Ich lasse euch passieren.«
Nach dieser traditionellen Verabschiedung wurden die beiden in den Transmitterraum geführt. Gnogger-Zam betrat als Erster das Transmitterfeld; Jarkus-Telft überließ ihm somit kommentarlos das Kommando. Jarkus wartete, bis der Freund entstofflicht war, dann nahm er seinen Platz ein.
Der vertraute Anblick der Transmitterhalle verschwand, und Jarkus-Telft fand sich in fremder Umgebung wieder. Er hatte noch nie das Arsenal auf Alkyra-I betreten, wenngleich er sich anhand der Aufzeichnungen mit den Gegebenheiten vertraut gemacht hatte. Er wusste, wo er in den subplanetaren Anlagen herauskommen würde. Aber noch bevor er sich orientieren konnte, erreichte ihn Gnogger-Zams Warnung.
»Schalte deinen Schutzschirm ein! Das ist eine Falle!«, vernahm Jarkus die Stimme seines Freundes aus der Dunkelheit. Er wunderte sich noch, dass nicht zumindest eine Notbeleuchtung aktiv geworden war, aber er befolgte den Rat.
Im nächsten Moment wurde er von bläulich züngelnden Lichtblitzen eingehüllt, die seine Ortungsgeräte als Magnetstrahlung auswiesen. Sofort wurde ihm klar, welches Schicksal Gnogger-Zam erlitten hatte. Wegen der Magnetstrahlung musste er in seinem Vollmetallanzug hilflos gefangen sein.
Jarkus-Telft fand erst jetzt Gelegenheit, sich umzusehen. Die Auffanghalle auf Alkyra-I bot für knapp fünfzig Loower Platz. Ihr Grundriss entsprach einem gleichseitigen Neuneck, die Wände fielen schräg nach innen und trafen sich in einer Höhe von fünfzig Körperlängen. Unter der Spitze dieser so entstandenen neuneckigen Pyramide war der Transmitterblock mit anderen technischen Ausrüstungen untergebracht.
An einer der Wände, zwei Körperlängen über dem Boden, hing Gnogger-Zam bewegungsunfähig in seinem Plattenanzug. Die Elemente hatten sich unter dem Einfluss der Magnetstrahlung bläulich verfärbt.
»Ich bin schon unterwegs zu dir!« Jarkus näherte sich vorsichtig und im Schutz seines Energieschirms. »Wie konntest du nur in diese missliche Lage kommen?«
»Ein Fehler der Sicherheitsautomatik. Vermutlich ist sie falsch programmiert.«
Jarkus-Telft erreichte den Gefährten und justierte seine Messgeräte auf ihn. »Es gibt nur zwei Möglichkeiten«, stellte er fest. »Entweder du harrst in dieser Lage aus, bis ich den Fehler in der Programmierung gefunden habe, oder du gestattest mir, dass ich das Magnetfeld gewaltsam sprenge. In diesem Fall kann ich aber keine Garantie geben, dass dein Kampfanzug noch zu gebrauchen sein wird.«
»Ich will, dass du mich augenblicklich aus dieser misslichen Lage erlöst«, erwiderte Gnogger-Zam.
Jarkus-Telft justierte einen Projektor aus seiner Brustplatte und löste dessen Funktion aus. Die Panzerplatten von Gnoggers Kampfanzug verloren ihren bläulichen Schimmer und wurden matt. Nacheinander lösten sie sich und fielen klirrend zu Boden. Der Kampfanzug zerfiel förmlich in seine Einzelteile, und schließlich löste sich auch Gnogger-Zam von der Wand und landete auf dem Häufchen unbrauchbar gewordener Platten. Er trat wütend darauf herum.
»Sämtliche Verschlüsse wurden durch die Magneteinwirkung zerstört!«, rief er. »Ich könnte höchstens versuchen, die Einzelteile zusammenzukleben.«
»Beruhige dich! Wir werden in diesem Arsenal schon Ersatz finden. Viel schlimmer ist die Tatsache, dass die Sicherheitsautomatik feindlich auf uns reagierte.«
»Jemand muss sie manipuliert haben.«
»Aber wer?«, fragte Jarkus-Telft ungläubig. »Die Sicherheitsautomatik würde eher die Vernichtungsschaltung auslösen, als einen Fremden diese Anlagen betreten zu lassen ...«
Noch während er redete, vernahm er eine wispernde Stimme in seinem Oberbewusstsein.
Willkommen auf Alkyra-I. Meine Schwestermutter hat mich von eurem Kommen unterrichtet. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall dämpft euren Tatendrang nicht. Ihr werdet euch auf weitere Überraschungen gefasst machen müssen. Die Automatik des Stützpunkts spielt nämlich seit einiger Zeit verrückt.
»Warum hat uns die Duade davor nicht gewarnt?«, fragte Gnogger-Zam laut. »Wir hätten uns dann besser gewappnet.«
Dazu bestand keine Veranlassung, antwortete der Ableger der Duade. Hier steht ihr unter meinem Schutz und habt nichts zu befürchten.
Jarkus-Telfts Verdacht verstärkte sich. Der Türmer mochte damit recht haben, dass die Duade selbst ihnen nichts anhaben konnte. Aber wie stand es mit ihrem zweiten Körper?
»Glaubst du, dass der Ableger den Stützpunkt in seine Gewalt gebracht hat?«, fragte Jarkus-Telft und verbannte diesen Verdacht gleichzeitig aus seinem Oberbewusstsein.
»Es wäre ungeheuerlich«, sagte Gnogger-Zam. »Das würde voraussetzen, dass die Intelligenz des Ablegers unglaublich zugenommen hat und dass er unsere Technik zu handhaben weiß. Trotzdem müssen wir diese Möglichkeit ins Auge fassen.«
»Ich werde den Türmer sofort von der Sachlage unterrichten und Verhaltensmaßregeln einholen.«
Jarkus-Telft versuchte, mit Alkyra-II in Funkverbindung zu treten, doch er musste erkennen, dass dies nicht möglich war.
»Wir sind abgeschnitten«, erklärte er. »Was sollen wir nun tun?«
»Wir müssen alles daransetzen, den Versunkenen aus dem Feuersee zu heben und unsere Mission zu erfüllen«, antwortete Gnogger-Zam entschlossen. »Sollte uns der Ableger der Duade dabei in die Quere kommen, werden wir ihn töten. Wir dürfen ihn nur nicht merken lassen, dass wir sein Spiel durchschauen.«
»Vielleicht ist unser Verdacht auch unbegründet«, gab Jarkus-Telft entgegen seiner Überzeugung zu bedenken.
»Das wollen wir nicht hoffen.« Gnogger-Zam straffte sich. »In diesem Fall müssten wir annehmen, dass der Feind das Arsenal entdeckt hat.«
Ein Schott öffnete sich, und ein fladenartiger Organismus quoll herein. Jarkus-Telft wich zurück, um von der zuckenden Masse nicht erdrückt zu werden. Gnogger-Zam, der schutzlos war, stellte sich hinter ihn.
4.
Er hatte Hunger.
»Eines schönen Tages wirst du dich überfressen«, tadelte ihn seine Betreuerin. »Du bist fett! Wenn du weiterhin alles Essbare in dich hineinstopfst, wirst du platzen.«
Er hatte Hunger und war unersättlich.
»Willst du nicht allein essen? Nimm den Löffel in dein Patschhändchen und führe ihn an den Mund. Es ist ganz einfach.«
Er wollte nicht, deshalb musste er gefüttert werden. Obwohl die Nurse Löffel um Löffel des nahrhaften Breis in seinen aufgerissenen Mund stopfte, ließ sein Hunger nicht nach. Der Hunger tat weh, und er zeigte seinen Schmerz.
»Nicht weinen«, redete ihm die Nurse zu.
»Hunger!«, brüllte er. Sein Magen war voll und rebellierte.
»Schmeckt es dir nicht?«
Sein Hunger wurde zur Qual, gleichzeitig bereitete ihm das Völlegefühl Übelkeit. Er verschloss den Mund, presste die Lippen aufeinander, verweigerte die weitere Nahrungsaufnahme. Ihn gierte nicht nach dem Brei oder sonst einer anderen Nahrung. Sein Hunger war anderer Natur.
»Mach schon den Mund auf! Komm, stell dich nicht so an!«
Er presste die Lippen noch fester zusammen in der Angst, sie könnte versuchen, ihm den Löffel mit Gewalt einzuführen. Wie konnte er ihr nur klarmachen, dass sein Hunger auf diese Weise nicht zu stillen war?
Er dachte daran, wie er zum ersten Mal von jenem Trunk gekostet hatte, den ein edler Spender ihm verabreichte, und allein der Gedanke verursachte ihm wohlige Gänsehaut. Seit damals war er geradezu süchtig nach jenem belebenden Genussmittel, das er manchmal »Saft« nannte, obwohl es nicht flüssig war. Dieser Trunk war nicht einmal zu sehen. Dennoch sättigte und beruhigte er, stärkte ihn und klärte seinen Kopf. Er brauchte mehr davon.
Er hörte aus seinem Innern ein glucksendes Geräusch und sah wie aus weiter Ferne, dass die Nurse die Hände zusammenschlug. Sie verschwand, kam zurück und wischte die Bescherung auf.
Er weinte still vor sich hin. Aber die Tränen konnten die innere Leere nicht ausfüllen, und das machte ihn nur noch trauriger.
»Sei artig, ja?«, redete die Nurse auf ihn ein – er stellte sich taub, war mit den Gedanken weit fort, konnte aber seinen Körper nicht mitnehmen. Er kehrte nach Saint Pidgin zurück, wo er nie Hunger gelitten hatte.
»Ich muss dich jetzt waschen und anziehen. Du bekommst nämlich Besuch.«
Er ließ alles mit sich geschehen, während er weinte. Die Nurse putzte ihn fein heraus, er sah sich im Spiegel. Sein Spiegelbild war wohlgenährt, obwohl er Hunger leiden musste. Er zeigte sich die Zunge.
»Benimm dich!«
Er lachte glucksend, es war ein weinerliches Lachen, ein Lach-Weinen. Er spielte das Spiel weiter, versuchte damit, von seinem Hunger abzulenken. Aber das Lach-Wein-Spiel beeindruckte nur die anderen, für ihn erfüllte es den Zweck.
Ein dunkler Raum. Er allein mit seiner Gier. Allein? Aber nein! Da war noch einer. Etwas Vertrautes ging von ihm aus. In der Luft lag ein würziger Geruch, wie er charakteristisch für den Saft war.
Vor ihm kauerte der Spender. Ein Häufchen Elend wie er selbst, übersprudelnd wie eine Quelle, deren Austritt versiegelt worden war, und deshalb schmerzgekrümmt. Gepeinigt von dem inneren Stau.
Er ging zu dem Spender und brach das Siegel der Quelle, sodass der Saft ihn überschwemmte und er darin baden konnte und alles begierig in sich aufsaugte, bis das Hungergefühl gestillt war und sein Spender von seinen Qualen erlöst.
Satte, wohlige Müdigkeit.
Glücksempfinden. Das Bedürfnis, den Spender zu umarmen, ihn an sich zu drücken, ihn festzuhalten und ihm so zu zeigen, dass er gebraucht wurde.
Die drei Personen umstanden den Körper eines Menschen, der mumifiziert zu ihren Füßen lag. »Das ist eindeutig Boyt Margors Handschrift«, sagte die junge Frau. »Kennst du den Namen des Opfers, Dun?«
»Es handelt sich um einen Mann namens Vargas Denner, einen Referenten der LFT-Regierung«, antwortete der Angesprochene. Mit seinen 38 Jahren war er fast doppelt so alt wie die Frau, und er war fast um einen Kopf größer als sie. Er hatte ein Pferdegesicht mit stark ausgebildeter Nase, der Mund wirkte verkniffen.
»Diesmal ist Margor zu weit gegangen«, erklärte die dritte Person. Mit seinen 62 Jahren war er der Älteste der drei. Er war um eine Handspanne kleiner als Eawy, hatte ein großporiges, derb wirkendes Gesicht mit einer fleischigen Nase, und was ihm an Körpergröße fehlte, hatte er in der Breite angesetzt. Obwohl vom Typ her Pykniker und massig wirkend, war er nicht fettleibig, sondern muskulös. Aber wie bei den beiden anderen ließ auch bei ihm die äußere Erscheinung keine Rückschlüsse auf seine besonderen Fähigkeiten zu.
»Wir dürfen nicht länger untätig zusehen«, fuhr er fort. »Es wird höchste Zeit, dass wir Margor endlich das Handwerk legen. Wie hast du das Verbrechen entdeckt, Dun? War es dir nicht möglich, es zu verhindern?«
Vapido schüttelte bedauernd den Kopf. »Denner wurde schon in diesem Zustand hierher gebracht. Offensichtlich sollte seine Leiche im Müllkonverter verschwinden. Bevor es dazu kam, habe ich einen Hagelschauer erzeugt, der die Helfershelfer in die Flucht jagte. Beide waren kleine Ganoven, die von Margors Existenz keine Ahnung haben. Ich wurde auf sie aufmerksam, als ich das Gebäude der GEPAPH beobachtete, bis wohin ich Denner gefolgt war. Sein Tod zeigt, dass ich auf der richtigen Fährte war. Margor muss sich in der Hauptniederlassung der Gesellschaft aufgehalten haben, wahrscheinlich kontrolliert er diese Organisation. Wir sollten die ›Gesellschaft zur Erforschung paranormaler Phänomene‹ im Auge behalten, um Hinweise auf seinen weiteren Aufenthalt zu bekommen. Das wäre deine Aufgabe, Eawy.«
Das war eine ungewöhnlich lange Rede für den sonst so verschlossenen Wettermacher und Paralogiker.
»Ich werde mich in das Funknetz der Gesellschaft einschalten, sobald wir in unserem Quartier sind«, erklärte Eawy ter Gedan. Wegen ihrer Fähigkeit, Funksendungen jeder Art, sofern sie nicht kabelgebunden waren, nur mit ihrem Geist empfangen und auswerten zu können, wurde sie auch »Relais« genannt.
»Gehen wir«, beschloss Bran Howatzer, der Pykniker mit der fleischigen Nase. »Hier können wir ohnehin nichts mehr tun.«
Sie verließen das Gelände der Müllverwertungsanlage Nord und bestiegen den Privatgleiter, mit dem Howatzer und die Frau angeflogen waren, nachdem Vapido sie informiert hatte. Zu dritt kehrten sie ins Zentrum von Terrania zurück.
Auf dem Weg in ihr Quartier informierte Howatzer die Behörden über den öffentlichen Notruf anonym davon, dass sie beim nördlichen Müllkonverter eine Leiche finden würden. Eawy suchte sich die Frequenz der GEPAPH heraus und schaltete sich in deren Funkverkehr ein, während Howatzer und Vapido das Problem diskutierten.
»So schwer es uns fällt, wir müssen endlich mit den Behörden zusammenarbeiten«, sagte Howatzer bekümmert. »Die Hoffnung, dass wir mit Margor allein fertig werden, war Selbstbetrug. Es wird Zeit, dass wir uns eingestehen, dass wir aus der Anonymität heraus nichts erreichen ...«
Eawy schreckte aus ihrer Versunkenheit hoch. »In der Gesellschaft geht es hektisch zu«, berichtete sie. »Ein Funkspruch jagt den anderen. Sinn und Zweck sind offenbar, ein neues Versteck für Margor zu finden. Dennoch scheint es sich um reine Ablenkungsmanöver zu handeln, als ahnten die Paratender, dass wir mithören. Ist euch eigentlich bekannt, dass die GEPAPH auf der griechischen Halbinsel Chalkidhiki in den ehemaligen Athosklöstern eine Heilstätte für geistig Gestörte unterhält?«
»Ist das wichtig?«, fragte Vapido mürrisch.
»Möglicherweise. Der Tenor einiger Funksprüche ist, dass dort eine wichtige Persönlichkeit als Patient eingeliefert werden soll. Vielleicht ist Margor gemeint.« Eawy sank erneut mit geschlossenen Augen und hoch konzentriert in ihrem Sessel zurück.
»Wir sollten endlich reinen Tisch machen und der Regierung von Margors Existenz berichten.« Howatzer nahm das Thema wieder auf. »Aber nicht anonym, sondern persönlich und mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen.«
»Als ich Denners Leichnam entdeckte, dachte ich wie du«, sagte Vapido nachdenklich. »Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Wir müssen etwas unternehmen, das ist klar. Aber bevor wir die Regierung über Margor informieren, sollten wir ihm ein Ultimatum stellen. Vielleicht können wir ihn dazu bewegen, die Erde zu verlassen. Eawys Annahme, er könnte in eine Klinik gebracht werden, lässt vermuten, dass Margor tatsächlich Hilfe braucht.«
»Du glaubst, er befindet sich in einer geistigen Krise?«, fragte Howatzer ungläubig. »Das ist reine Spekulation.«
»Und Denners Tod? Das sieht eher nach einem Unglücksfall als nach einer gezielten Aktion aus. Warum hätte Margor einen seiner einflussreichsten Paratender töten sollen? Denner war ihm treu ergeben und hatte gute Beziehungen zu höchsten Regierungsstellen. Margor kann seinen Tod nicht gewollt haben, dennoch hat er ihn mit einer Überdosis psionischer Energie getötet.«
Bran Howatzer nickte zögernd. »Es könnte etwas Wahres dran sein. Warten wir ab, was Eawy herausfindet.«
Wenige Minuten später entspannte sich die Frau.
»Es kann keinen Zweifel geben, dass mit dem geheimnisvollen Patienten Margor gemeint ist. Allerdings ging aus den Funksprüchen nicht hervor, um was für ein Leiden es sich handelt. Ohnehin sind wir zu spät dran. Der Transport ist inzwischen bereits unterwegs.«
»Dann haben wir keine andere Wahl, als ebenfalls die Athosklöster aufzusuchen.« Howatzer seufzte.
»Wir wollten Margor endlich hochgehen lassen!«, rief Eawy. »Warum seid ihr wieder wankelmütig geworden? Ist euch die Anonymität wichtiger als die Zukunft dieses Planeten, auf dem wir leben wollen?«
Boyt Margor fühlte eine unsagbare Erleichterung. Er konnte wieder klar denken, seine Gedanken in die Tat umsetzen, wieder er selbst sein. Der innere Druck psionischer Energie war von ihm genommen.
»Danke, Niki«, sagte er zu dem auf siebzehn Jahre geschätzten Jungen, der wie ein Riesenbaby auf der Matte zusammengerollt lag und mit seligem Lächeln zu ihm aufsah. »Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde.«
In jedem anderen Fall hätte er sich nicht dazu hinreißen lassen, seine Abhängigkeit zu jemandem einzugestehen. Aber der Idiot würde daraus keinen Nutzen ziehen.
»Der Hunger ist gestillt«, brabbelte Niki, rutschte von der Matte und kuschelte sich in das Stroh, das den Boden der primitiven Klause bedeckte. »Auf ein andermal. Sieben – acht – neun – aus! K.o. durch zu viel Safttrinken.« Er schlief auf der Stelle ein.
Margor schlich auf leisen Sohlen aus der Hütte. In der Tür drehte er sich noch einmal um und murmelte ein »Danke«. Das war ehrlich gemeint, wenngleich seine Dankbarkeit nicht tief ging. Niki war für ihn nur Mittel zum Zweck, und ihm war klar, dass es sich umgekehrt ebenso verhielt. Der Junge war süchtig nach psionischer Energie. Dass er ihm, Margor, damit einen Gefallen tat und ihm vielleicht sogar das Leben rettete, war nur ein Nebeneffekt. Niki dachte ebenfalls nur an sich selbst.
Das war die nüchterne Wirklichkeit. Früher oder später, wenn die unheimliche Macht, auf die Margor fixiert war, ihn wieder mit Psi-Energie aufgeladen hatte, würde er den Idioten erneut konsultieren müssen. Darum war es besser, wenn er vorerst in der ehemaligen Klosterrepublik Athos blieb.
Draußen warteten Hermsted, Quille und Peres auf ihn. Margor entsann sich dunkel, dass sie ihn in seiner schwersten Zeit aus dem Hauptquartier auf die Halbinsel gebracht hatten. Trotzdem wollte er nicht daran erinnert werden, denn da war noch etwas ...
»Was ist aus Denner geworden?«, erkundigte er sich.
»Vargas ist tot«, antwortete Hermsted beflissen. »Wir haben ihn ...«
Margor schnitt ihm das Wort mit einer scharfen Handbewegung ab. »Genug davon! Ihr werdet diesen Zwischenfall vergessen, als hätte es ihn nie gegeben. Das ist ein Befehl.«
Die drei Männer erstarrten. Gleich darauf klärte sich ihr Blick wieder.
»Alles in Ordnung, Boyt?«, fragte Peres zögernd.
»Geht an eure Arbeit! Ich bin ein Patient wie jeder andere. Heute Abend findet im Kloster Megiste Lawra eine Lagebesprechung statt, am Fuß des Berges Athos. Bis dahin lasst mich allein.«
Er ging. Weil er über seine Probleme nachdenken wollte. In dem Moment brauchte er niemanden in seiner Nähe.
Margors Fähigkeit, eine Psi-Affinität zu anderen Menschen zu erkennen und diese in seine Abhängigkeit zu bringen, war zu einem Bumerang für ihn geworden. Ohne Vorwarnung war der eigenartige Kontakt plötzlich da gewesen – und noch bevor er diese besondere Affinität hatte analysieren können, war er davon nicht mehr losgekommen.
Es war ihm unmöglich, die Natur dieses unbekannten Etwas zu erkennen, ob es sich um einen Menschen handelte, um ein Fremdwesen oder sonst etwas. Ebenso wenig konnte er dessen Standort aufspüren.
Dieses Etwas lud ihn auf. Er schaffte es nicht, sich dagegen zur Wehr zu setzen, und er konnte nicht anders, als die fremden Impulse aufzunehmen. Dadurch entstand in ihm ein psionischer Überdruck, der ihn zu einer Zeitbombe machte.
Zum Glück waren seine Paratender bei der Suche nach einer Lösung des Problems auf Niki Saint Pidgin gestoßen, der im Zuge der Rückwanderung von einer Pionierwelt zur Erde gebracht worden war. Es hatte sich herausgestellt, dass der paranormal begabte Junge Margors überschüssige Psi-Energie absaugen und schadlos verarbeiten konnte. Trotzdem war Margor immer nur für kurze Zeit seiner Sorgen enthoben. Der Stau psionischer Energien entstand immer wieder neu in ihm.