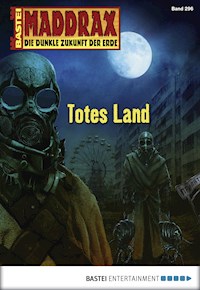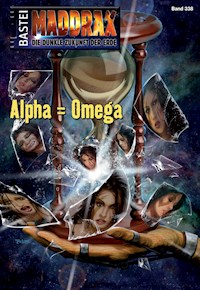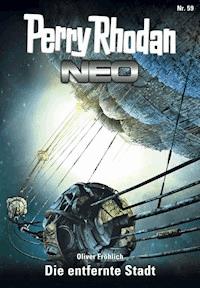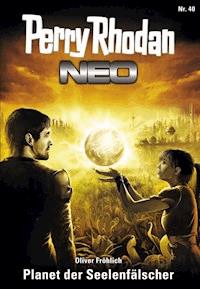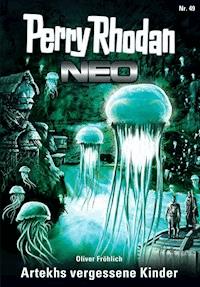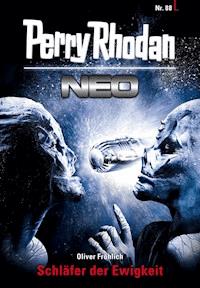Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht dem Jahr 5659 nach Christus. Über dreitausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan seiner Menschheit den Weg zu den Sternen geöffnet hat. Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller Völker der Milchstraße und der umliegenden Galaxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Sternenvölker stehen für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein, man arbeitet intensiv zusammen. Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cassiopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort ist FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chaoporter. Nachdem Perry Rhodan und seine Gefährten versucht haben, gegen die Machtmittel dieses Raumgefährts vorzugehen, bahnt sich eine unerwartete Entwicklung an: FENERIK stürzt auf die Milchstraße zu. In der Heimatgalaxis der Menschheit wappnen sich die freien Völker so gut es geht gegen die unbekannten Absichten und Machtmittel des Chaoporters. Wenig genug ist bekannt: Für zwei durch die Havarie mit der LEUCHTKRAFT ausgeschaltete Quintarchen wird Ersatz benötigt, und Reginald Bull ist einer der möglichen Kandidaten. Von besonderer Bedeutung für FENERIK ist außerdem womöglich DER GENETISCHE ALGORITHMUS ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 3166
Der Genetische Algorithmus
Sie ist eine Keji – die Geschichte einer Deserteurin
Oliver Fröhlich
Cover
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
0. Drei Deserteure
1. FENERIKS Atem
2. Ein gabenloser Makel
3. Die Einsamkeit einer Mutter
4. Über den Wolken
5. Verloren, gefunden – und wieder verloren?
6. Der Genetische Algorithmus
7. Entwicklung
8. Eine fast makellose Gabe
9. Die Folgen des Zweifels
Stellaris 86
Vorwort
»Der Schutzengel« von Roman Schleifer
Leserkontaktseite
Glossar
Impressum
In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 Neuer Galaktischer Zeitrechnung. Dies entspricht dem Jahr 5659 nach Christus. Über dreitausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan seiner Menschheit den Weg zu den Sternen geöffnet hat.
Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller Völker der Milchstraße und der umliegenden Galaxien endlich erfüllen. Die Angehörigen der Sternenvölker stehen für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein, man arbeitet intensiv zusammen.
Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cassiopeia offensichtlich eine neue Gefahr. Dort ist FENERIK gestrandet, ein sogenannter Chaoporter. Nachdem Perry Rhodan und seine Gefährten versucht haben, gegen die Machtmittel dieses Raumgefährts vorzugehen, bahnt sich eine unerwartete Entwicklung an: FENERIK stürzt auf die Milchstraße zu.
In der Heimatgalaxis der Menschheit wappnen sich die freien Völker so gut es geht gegen die unbekannten Absichten und Machtmittel des Chaoporters. Wenig genug ist bekannt: Für zwei durch die Havarie mit der LEUCHTKRAFT ausgeschaltete Quintarchen wird Ersatz benötigt, und Reginald Bull ist einer der möglichen Kandidaten. Von besonderer Bedeutung für FENERIK ist außerdem womöglich DER GENETISCHE ALGORITHMUS ...
Die Hauptpersonen des Romans
Apehei – Die Absorbiererin verachtet FENERIK.
Lejani und Midunjia – Zwei Schwestern werden mental renoviert.
Seharji – Ein Besatzungsmitglied des Chaoporters sucht seine Bestimmung.
Schomek, die Lohe – Die Quintarchin empfiehlt sich als Förderin.
Lidejohi
0.
Drei Deserteure
»Wie lange wird es noch dauern, bis sie uns vertrauen?«
Die Sprechmembran unter Hookadars Facettenaugen vibrierte heftiger als sonst und verlieh seinen Worten einen zittrigen Unterton. Der Laichkange stemmte sich aus dem Sessel in Apeheis Unterkunft hoch, ließ sich in leicht veränderter Position erneut hineinsinken, war mit dem Ergebnis aber erkennbar genauso unzufrieden wie zuvor. Die kurzen, stämmigen Beine und der umso größere Torso vertrugen sich mit den Proportionen des Möbelstücks ebenso wenig wie seine vier Arme.
»Sieben Monate!«, ergänzte er. »Sieben Monate ist es nach ihrer Zeitrechnung her, dass wir sie um Asyl gebeten haben. Und was hat sich seitdem an ihrer Einstellung uns gegenüber geändert? Nichts! Nicht einmal eine passende Sitzgelegenheit haben sie uns zur Verfügung gestellt.«
Apehei sah den Chaogator des Chaoporters FENERIK lange an. Nein, den ehemaligen Chaogator, seit er mit ihr und Hori desertiert war und sich in die Hände der Kosmokratendiener begeben hatte. Obwohl sie stand und er saß, musste sie zu ihm aufschauen.
»Ich finde den Sessel gemütlich«, sagte sie. »Er hat sogar Aussparungen in der Rückenlehne für meine Falthäute. Und falls ich dich daran erinnern darf: Du hältst dich gerade in meinem Raum auf. Die Einrichtung in deinem ist sehr wohl auf dich abgestimmt.«
In der Tat hatten ihnen die Galaktiker durchaus ansehnliche Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Nicht allzu geräumig, aber mit einem weichen Teppich, einem Bett, dessen Liegefläche man auf die gewünschte Härte und Neigung einstellen konnte, und einem Holokubus, über den sich aus einer umfangreichen Bibliothek die unterschiedlichsten Dateien aufrufen ließen: Dokumentationen, teils interessant, teils langweilig; Musikstücke verschiedener Länge, von denen manche Apehei gefielen, während andere ihr in den Gehörgängen schmerzten; Theateraufführungen, virtuelle Rundgänge durch die Museen der Milchstraße und etwas, das die Galaktiker »Spielfilme« nannten.
Besonders angetan hatte es Apehei jedoch die winzige abgetrennte Hygienezelle – und dort die Dusche, bei der man zwischen Reinigung per Ultraschall, Sandstrahl oder Wasser wählen konnte. Mehrmals täglich ließ sich Apehei beregnen. Nicht aus Reinlichkeitsgründen, sondern weil es sie an die Heimat erinnerte, die sie so lange nicht mehr gesehen hatte. An die Schalenwelt der Kejis in FENERIK, an den warmen Dauerregen dort. Sie war zwar vom Chaoporter desertiert. Aber musste das zugleich bedeuten, dass sie die vertraute Welt nicht vermissen durfte?
»Mein Raum oder deiner«, brauste Hookadar auf, »darum geht es doch überhaupt nicht.«
Nein, dachte Apehei. Darum geht es tatsächlich nicht.
Sie kannte den Laichkangen gut genug, um zu wissen, dass er nur mal wieder einen seiner Momente hatte, wie sie es für sich nannte. Eine Phase, in der er seiner Frustration freien Lauf ließ, keinen sachlichen Argumenten zugänglich war und gegen alles schimpfte, was ihn im Augenblick störte. Und sei es ein alberner Sessel, der nicht einmal für ihn gedacht war. Eine Phase, in der man beinahe meinen könnte ...
»Bereust du es etwa?«, sprach sie den Gedanken aus.
»Zum ... Feind übergelaufen zu sein? Keineswegs. Nur weil uns die Liga Freier Galaktiker misstraut, überwacht und ansonsten weitestgehend ignoriert, heiße ich die Absichten des Chaoporters noch lange nicht plötzlich wieder gut. Wir hatten und haben gute Gründe!«
Apehei wandte sich von Hookadar ab und ging zu einem kleinen Tisch, auf dem einige Getränke bereitstanden. Sie vermisste Hori, die Dritte im Bunde der Deserteure und wie Apehei eine Keji. Vielleicht hätte sie ihr helfen könnten, Hookadars schon viel zu lange anhaltenden Moment besser zu ertragen. Und falls nicht, hätten sie wenigstens einen Kelch Lamicox zusammen trinken können.
So musste Apehei allein einen Schluck von dem gelben, zähflüssigen Getränk nehmen. Es blubberte und verströmte einen fruchtigen Duft mit leicht schwefeliger Note. Der Geruch der Heimat. Der Geschmack hingegen ... nun ja. Wie man ihn vom Produkt eines Synthetisierers erwarten durfte, dessen Positronik nie etwas von der Lamicblüte gehört hatte und auf Horis und Apeheis Beschreibung angewiesen war. Ein schaler Abklatsch des Originals. Dennoch nahm Apehei einen zweiten Schluck. Besser als nichts.
Ohne dass sie etwas dagegen tun konnte, sträubten sich ihre Kopffedern leicht und zeigten, dass sie Hookadar gerade außerordentlich anstrengend fand.
»Was hast du erwartet?«, fragte Apehei, ohne sich zu dem Laichkangen umzudrehen. »Dass uns die Galaktiker freudestrahlend empfangen, uns durch die Kopffedern streichen und sich erkundigen, welche Geheimnisse sie uns zuerst verraten sollen? Hätten wir im umgekehrten Fall so reagiert?«
»Aber haben wir nicht inzwischen genug getan, um sie von unserer Aufrichtigkeit zu überzeugen? Wir haben einen Chaotreiber mitgebracht. Wir haben ihre Prüfung bestanden, als sie im Gewand von Chaosdienern vorgaben, uns befreien zu wollen. Wir haben trotz der Gefahr durch den Mnemo-Deletor so viel Informationen weitergegeben wie möglich. Hori hat sie sogar zu dieser Bündnis-Konferenz begleitet, um die Teilnehmer an ihren Erinnerungen teilhaben zu lassen.«
Apehei gönnte sich den nächsten Schluck des synthetischen Lamicox und verzog das Gesicht. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, versuchte sie Zeit zu gewinnen, um abzuwägen, wie sinnvoll eine Diskussion mit jemandem war, der gar keine führen wollte.
»Trotzdem zweifeln sie an unserer Aufrichtigkeit«, fuhr Hookadar fort. »Und du weißt: Die widerstandsfähigste Saat ist der Zweifel. Einmal ausgebracht, kann ihr der härteste Winter nichts anhaben.«
»Dann muss es unsere Aufgabe sein, den Galaktikern dabei zu helfen, die Zweifel zu überwinden.«
»Ein hehres Ziel. Ich möchte doch nur, dass wir nicht länger wie Gefangene behandelt werden. Vorsicht ist seitens unserer ... Gastgeber ja gewiss angebracht. Aber das, was sie zeigen, ist vielmehr Paranoia!«
Innerlich stimmte Apehei ihm zu, sprach es jedoch nicht aus, um Hookadar in seiner Niedergeschlagenheit nicht noch zu bestärken. Sieben Monate konnten sich tatsächlich fürchterlich ziehen, wenn man nichts Besseres zu tun hatte, als sich beobachten zu lassen. Sogar mit einer riesigen Auswahl an Musikstücken und täglichen Duschen.
Ja, sie stimmte ihm zu. Und so hallten selbst Stunden, nachdem sich der Mitdeserteur in sein Zimmer zurückgezogen hatte, die Worte in Apehei nach. Die widerstandsfähigste Saat ist der Zweifel.
Sie wusste nur zu gut, welche Folgen er nach sich ziehen konnte. Das Zerbrechen von Freundschaften, Verlust, sogar den Tod.
1.
FENERIKS Atem
»Willst du sterben?«, fragte Apehei das Kind.
Es mochte vier oder fünf Zyklen alt sein, zu jung jedenfalls, um FENERIKS Atem selbst zu bewältigen. Apehei wusste nicht einmal, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelte. Seine Kopffedern wiesen noch den kindstypischen Weißton auf, in dem sich das Blau der Ausgewachsenen bestenfalls als zarter Schimmer zeigte. Erst wenn sein Körper die Hormonproduktion startete, würden die Federn nachdunkeln und der Genetische Schild aktiviert werden. In etwa 20 Zyklen. Wenn das Kind Glück hatte, vielleicht sogar schon in 15. Falls es so lange lebte.
Apehei bemerkte die vergrößerten Pupillen und den gelblichen Tränenfilm in den dunkelblauen Augen des Kindes. Es hatte Angst, zumindest ein bisschen. Das war gut. Ein erster wichtiger Schritt. Aber er reichte nicht aus.
»Willst du sterben?«, fragte sie erneut, lauter diesmal.
Das Kind zuckte zusammen und senkte eingeschüchtert den Blick.
Apehei schaute zu den Eltern. Sie standen etwas abseits in der kleinen Wohnung neben einem Wandbord, auf dem eine zischende, dampfende Aromaglobe einen schwefeligen Hauch verbreitete. Sie hielten sich an den Händen, starrten sie an – und schwiegen. Genau wie es ihnen Apehei vor wenigen Minuten eingetrichtert hatte.
Sie fragte sich, warum sie den Auftrag überhaupt angenommen hatte. Ondrell und Myriala gehörten nicht gerade zu den privilegiertesten Kejis. Sie lebten weit außerhalb der Zentralstadt in einem Wohnzirkel, hielten sich mit dem Anbau dürrer Lamicsträucher mehr schlecht als recht über Wasser und konnten Apeheis Dienste keinesfalls ausreichend bezahlen.
Warum also war sie gekommen?
Die Antwort war so schlicht wie bitter: weil sich sonst niemand um das Kind kümmerte. Nicht die Genetische Behörde, nicht die Zentralstadtförderung, leider nicht seine Eltern und schon gar nicht FENERIK – und das, obwohl der Chaoporter in gewisser Weise für die Hilfsbedürftigkeit des Kindes verantwortlich war.
Dennoch: Vielleicht hätte sie den Auftrag ablehnen sollen. Jede andere Absorbiererin hätte es getan oder es gar nicht erst so weit kommen lassen. Sie hätte die Verbindungsanfrage bereits in dem Moment abgewiesen, in dem der Kontakter anzeigte, dass der Anrufer und potenzielle Auftraggeber in den Außenbezirken lebte.
Apehei hingegen – die dumme, gutmütige Apehei mit dem viel zu weichen Herzen – akzeptierte die Anfrage nicht nur. Nein, sie stieg nach dem kurzen Gespräch auch sofort in ihren Schweber und raste los. In eine Gegend, in die sie unter anderen Umständen keine Zehenspitze gesetzt hätte. Hin zu den Ausgestoßenen, den Unerwünschten und Vergessenen, den genetisch Missglückten, deren einziger positiver Beitrag zur Gesellschaft darin bestand, dass sie sich früher oder später gegenseitig umbrachten.
Zumindest war das die offiziell vorgeschriebene Sichtweise der Zentralstadtförderung. Apehei hatte schon oft genug Aufträge in den Außenbezirken angenommen, um zu wissen, dass die Wahrheit darüber hinausging. Gewiss, dort draußen herrschten Mord und Totschlag, doch die Unerwünschten lebten nicht an diesem Ort, weil sie kriminell waren – sie waren kriminell, weil sie dort lebten. Weil ihnen keine andere Wahl blieb.
Illustration: Dirk Schulz
Einmal testete die Genetische Behörde eine neue, vielversprechende Genkombination, die unerwarteterweise zu porösen Falthäuten, Schwachsinn oder kaum belastbarem Knochenbau führte. Ein anderes Mal verwandelte eine mentale Renovierung ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft in einen lallenden Idioten. Warum sollten wir uns um die Produkte unserer Wissenschaft kümmern? Steckt sie in die Außenbezirke, dort schlagen sie sich schon irgendwie durch.
Natürlich kam so etwas nicht häufig vor. Aber es kam vor. Ein Detail, das die ZSF nur allzu gerne zu erwähnen vergaß, wenn sie ihre offizielle Sichtweise verkündete.
Nur selten legte ein Unerwünschter diesen Status ab und durfte in die Zentralstadt zurückkehren, nämlich dann, wenn ihn die Genetische Behörde zu einer neuerlichen mentalen Renovierung vorlud. Falls er diese Vorladung erhielt. Falls er ihr folgte – und falls die Renovierung in einer grundlegenden Wesensänderung resultierte, die ihn für die Gesellschaft oder für FENERIK wieder interessant machte.
Die ZSF mochte es anders sehen, Apehei jedoch war der Ansicht, dass auch die Unerwünschten das Anrecht auf ein kleines Zipfelchen Glück hatten. Und welches größere Glück konnte es geben als ein eigenes Kind? Auf natürliche Weise empfangen und geboren, ohne dass die Genetische Behörde das Erbgut vermaß, nach ihren Vorstellungen veränderte und nach der Geburt erneut vermaß?
Apehei wusste, dass die ZSF ihre Einsätze in den Außenbezirken missbilligte. Wen scherten die unerwünschten Kinder der unerwünschten Eltern? Die Zentralstadtförderung würde es eher begrüßen, die Bälger an FENERIKS Atem zugrunde gehen zu lassen. Aber Absorbiererinnen waren selten und ihre Dienste zum Wohle der Kinder in der Stadt so hoch begehrt, dass die ZSF dafür aufkam – und Apehei bei ihrem Privatvergnügen gewähren ließ.
Als wäre es tatsächlich ein Vergnügen.
So senkte sie also eine halbe Stunde nach Ondrells Anruf den Schweber über dem mittleren der drei mindestens 50 Stockwerke hohen, ringförmigen Wohnzirkel. Weitläufige, größtenteils verwildert wirkende Lamichaine umgaben die schäbigen Gebäude. Ein riesiges Gelände, um dessen Erträge sich allerdings Tausende von Unerwünschten stritten, vermutlich sogar prügelten oder noch Schlimmeres.
Apehei stieg aus und schickte das Fahrzeug per Fernsteuerung wieder in die Luft. 200 Meter über dem Dach würde es auf seine Besitzerin warten. Apehei mochte gutmütig und weichherzig sein und deshalb von der ZSF als dumm angesehen werden. So dumm, den Schweber in den Außenbezirken leicht zugänglich stehen zu lassen, war sie allerdings nicht.
Ein Mann mit struppigen Kopffedern eilte durch den Regen auf sie zu. Die goldene Gesichtshaut hatte ihren metallischen Schimmer verloren und wirkte matt und stumpf. Dunkle Flecken auf den Wangen und um die Lippen – schlecht verheilte Geschwüre – zeugten von übermäßigem Harzkonsum. Erstaunlich, dass eine Pflanze, aus deren Blüten sich köstliches Lamicox keltern ließ, zugleich berauschendes und süchtig machendes Harz in sich trug.
Statt von den Federn abzuperlen, wie es bei einem gesunden Keji der Fall gewesen wäre, sickerte der Dauerregen bei dem Mann hindurch und rann ihm über das Gesicht.
»Bist du Ondrell?«, fragte Apehei.
»Bin ich. Und du die Abosbie... Asorb... Absro...«
»So ist es«, sagte sie, um ihrem Gegenüber zu ersparen, sich länger mit dem schwierigen Wort abmühen zu müssen.
»Gut. Hab dich angerufen.«
»Ich weiß.« Sonst wäre ich nicht hier. »Du hast gesagt, es ginge um euer Kind? Ranpui?«
»Ranpui, ja. So heißt es.«
»Ein ungewöhnlicher Name. Ein Junge oder ein Mädchen?«
»Ja.« Und nach kurzem Zögern: »Hat Myriala ausgesucht. Den Namen, nicht das Kind. Nicht dass du denkst, wir hätten es gestohlen oder so was.«
»Das denke ich nicht. Keine Sorge.«
»Weiß man ja nie bei euch Städtern. Soll ich dich hinführen?«
»Das wäre hilfreich.«
Apehei hoffte, bei Ondrells Gefährtin auf etwas mehr Intelligenz zu treffen. Andernfalls wäre es schwierig, den beiden ihre Vorgehensweise zu erklären. Und die Vergangenheit hatte gezeigt, dass Eltern, die nicht verstanden, was sie tat, bei der Absorption eher hinderlich als hilfreich waren.
Sie wurde enttäuscht.
Als sie die Wohnung betrat, empfingen sie der von einer Aromaglobe nur unzureichend überdeckte säuerliche Geruch der Sucht und eine Frau, durch deren Federn an einigen Stellen die Kopfhaut schimmerte. Auch ihre Wangen und Lippen verunzierten zahlreiche dunkle Flecken.
»Gut, dass du endlich kommst«, sagte Myriala. »Ranpui ist krank.«
»Was fehlt eurem Kind?«
»Hörst du nicht zu?« Myriala glotzte sie an, als wäre Apehei nicht bei Verstand. »Ranpui ist krank. Hab ich doch gesagt.«
»Aber euch ist klar, dass ich keine Heilerin bin, sondern Absorbiererin. Ich kann nur helfen, wenn FENERIKS Atem ...«
»Was weiß denn ich? Ranpui hat einen roten Ausschlag neben den Augen und ist ganz heiß. Keine Ahnung, was das für eine Krankheit ist. Aber Deslin hat gesagt: ›Myriala‹, hat er gesagt, ›wenn Ranpui mal einen roten Ausschlag neben den Augen hat und ganz heiß wird, müsst ihr gleich Apehei rufen.‹ Genau das hat er gesagt.«
Apehei erinnerte sich an Deslin. Vor nicht ganz zwei Zyklen hatte sie seine Tochter vor dem Ausbrennen bewahrt.
»Na schön. Das klingt nach FENERIKS Atem.«
»Was soll 'n das sein?«, fragte Ondrell. »FENRICHS Atem?«
Apehei schloss kurz die Augen und bemühte sich um Geduld. Sie rief sich ins Gedächtnis, dass die beiden nichts dafürkonnten, wie sie waren. Welches gescheiterte Experiment der Genetischen Behörde oder welche mentale Renovierung an ihrem Mangel an geistiger Kapazität auch schuld sein mochte, Ondrell und Myriala waren Produkte der Gesellschaft der Kejis. Und somit Produkte von FENERIK. Sie hatten das gleiche Anrecht auf Leben, auf Glück und auf Hilfe wie jeder andere.
Apehei trat an ein kleines schmutziges Fenster und zeigte hinaus zu den dichten Wolken, aus denen es nahezu ununterbrochen regnete. »Ihr wisst, was darüber liegt?«
»Klar«, sagte Myriala. »Die Dunkelheit mit ihren Kriechblitzen. Sieht man ja immer mal durch eine Wolkenlücke. Wir sind nicht dämlich.«
»Natürlich nicht.« Die Beschreibung lag nahe genug an der Wahrheit. Tatsächlich krochen über die Himmelshürde, wie die Städter es nannten, energetische Entladungen. Apehei hätte ihren Auftraggebern erzählen können, dass die Himmelshürde ihre Welt von der benachbarten Schalenwelt im Chaoporter trennte. Oder dass sie unglaubwürdige Geschichten gehört hatte, wonach in einer weiter außen liegenden Welt aus den Blitzen eine Droge gewonnen wurde. Allerdings wollte sie Ondrell und Myriala nicht mit für sie unnützem Wissen überfordern.
»Von den ... Kriechblitzen geht eine starke Strahlung aus«, sagte sie stattdessen. »Sie sammelt sich im Regen, der sie über die ganze Welt verteilt. Diese Strahlung wird FENERIKS Atem genannt. Sie ist überall und durchdringt die Körper aller Kejis.«
Erschrocken schauten Ondrell und Myriala an sich hinab, wischten sich mit den schmalen, vernarbten Händen sogar über Brust und Bauch, als könnten sie damit etwas ausrichten.
»Im Normalfall schadet uns FENERIKS Atem nicht, weil ...« Weil die Genetische Behörde vor Zehntausenden von Zyklen unserem Genom eine Kombination beigefügt hat, die uns befähigt, die Strahlung im Körper abzubauen und auszuscheiden. Oder genauer: Wir bauen das Residuum ab, das wegen der Strahlung in unseren Zellen entsteht und sie nach und nach aufheizt. Oder noch genauer ... Nein, besser nicht so sehr ins Detail gehen. Erstens würden Ondrell und Myriala es wahrscheinlich nicht verstehen, zweitens bezeichnete im Sprachgebrauch der Kejis FENERIKS Atem nicht nur die Strahlung der Kriechblitze, sondern zugleich deren Auswirkung auf den Körper und das Residuum. Nicht ganz richtig, nicht sehr genau, aber erheblich einfacher in der Kommunikation. »Er schadet uns nicht, weil wir damit umgehen können. Aber es gibt Ausnahmen.«
Zum Beispiel den kleinen Teil der Kejis, dachte sie, der mit dem Makel behaftet ist. Bei ihnen arbeitet die Genkombination nicht wie gewünscht. Sie nehmen die Strahlung zwar auf, bauen das Residuum jedoch nicht ab. Was dazu führt, dass sie früher oder später explosionsartig innerlich verbrennen.
Kein hilfreicher Gedanke. Sie schob ihn zur Seite, um sich nicht von der kommenden Aufgabe ablenken zu lassen. Außerdem unterschlug er einen wesentlichen Aspekt. In seltenen Fällen manifestierte sich die Strahlung bei den Makelbehafteten nämlich nicht in einer spontanen Verbrennung, sondern in der Erweckung einer Paragabe. Wiederum ein kleiner Teil der begabten Kejis – und zwar stets Frauen – beherrschte die Fähigkeit des Absorbierens. Kein Wunder also, dass Apehei trotz ihrer unliebsamen Ansichten über die Unerwünschten großes Ansehen bei der ZSF genoss. Denn ihre Gabe ermöglichte es ihr, sich um die zweite Ausnahme in der Bewältigung von FENERIKS Atem zu kümmern.
»Die Körper von Kindern«, fuhr Apehei fort, »können mit der Strahlung nicht umgehen, weil ihr Genetischer Schild noch nicht aktiviert ist. Das geschieht erst, wenn ihre Hormone an der Schwelle zum Erwachsenwerden ...«
»Aha«, machte Ondrell.
Apehei sah ihm an, dass er und seine Gefährtin auch die vereinfachte Form der Erklärung nicht verstanden. Und dass sie allmählich das Interesse verloren.
Also unterbrach sie sich mitten im Satz und verzichtete darauf, zu erzählen, dass die Gebäude der Zentralstadt speziell abgeschirmt waren und dass viele Eltern ihre Kinder dem Regen möglichst selten aussetzten, wodurch etwa die Hälfte keinerlei Symptome bis ins Erwachsenenalter zeigte, weil sich nicht genug Residuum ansammelte. Die andere Hälfte jedoch ... nun ja. Einige Mädchen und Jungen konnten die Absorbiererinnen zwar retten, dennoch stellte die Kindersterblichkeit bei den Kejis ein großes Problem dar. Eines, gegen das auch die Genetische Behörde kein Mittel kannte.
In den Außenbezirken jedoch, wo die Kinder von klein auf in den Lamichainen arbeiten mussten und wo selbst die dünnen Wände der Behausungen keinen Schutz darstellten, lag der Anteil erkrankter – und häufig sterbender – Kinder deutlich höher.
»Der rote Ausschlag neben den Augen und das Fieber sind auf jeden Fall Symptome von FENERIKS Atem. Aber davon kann ich Ranpui befreien.«
»Na, das will ich hoffen«, sagte Ondrell. »Allein schaffen wir nämlich die Ernte nicht.«
Apehei wünschte, sie wäre auf Eltern getroffen, deren einzige Sorge nicht der Arbeitskraft ihres Nachwuchses gegolten hätte. Auf Eltern, die ihr Kind liebten und die es tatsächlich als Zipfelchen des Glücks ansahen. Doch für einen Rückzieher war es nun zu spät. Und vielleicht schaffte Ranpui es eines Tages ja, in die Zentralstadt eingelassen zu werden. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich.
»Was sollen wir machen?«, fragte Myriala.
»Habt ihr als Kinder jemals eine Absorption über euch ergehen lassen müssen?«
»Weiß nicht mehr«, sagte Ondrell.
»Ich war nie ein Kind«, behauptete Myriala.
Apehei widersprach dieser absurden Bemerkung nicht. »Das Wichtigste ist, dass ihr gar nichts tut. Ihr könnt in der Nähe bleiben und zusehen, dürft euch aber keinesfalls einmischen. Die Absorption gelingt nur, wenn ich in Ranpui starke Gefühle hervorrufe. Am besten und zuverlässigsten funktioniert es mit Angst. Ich werde eurem Kind also drohen, werde es einschüchtern und versuchen, es in Panik zu versetzen. Egal, was ich zu ihm sage, ihr dürft es nicht trösten. Habt ihr verstanden?«
»Trösten?«, fragte Ondrell. »Warum sollten wir das tun?«
Ja, warum wohl? »Na gut, dann lasst uns beginnen. Bringt mich zu Ranpui.«
*
Darum stand Apehei also einem Kind gegenüber, von dem womöglich nicht einmal die Eltern wussten, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte. Einem abgestumpften Wesen, das nur die Arbeit in den Hainen kannte und das vermutlich nie Zuneigung erfahren hatte. Wie sollte sie einem solchen bedauernswerten Geschöpf Angst machen?
Bei den Kindern in der Zentralstadt reichte es oft aus, damit zu drohen, ihnen das Lieblingsspielzeug wegzunehmen oder sie von den Eltern zu trennen. Der Vorteil daran war, dass sich Apehei nicht wie das letzte Stück Dreck fühlte und dass ihr Steigerungsmöglichkeiten blieben, sollte der Patient vor dem Erwachsenenalter eine zweite Absorption benötigen.
Ranpui jedoch hatte sich von dem üblichen Repertoire völlig unbeeindruckt gezeigt. Also hatte Apehei keine andere Wahl, als zum äußersten Mittel zu greifen.
»Willst du sterben?«, brüllte sie in einer Lautstärke, dass ihr der Hals schmerzte. Auf Ranpui musste das umso schockierender und bedrohlicher wirken, da Kejis sonst üblicherweise mit leiser, etwas schleppender Stimme sprachen. »Das willst du nicht, hab ich recht? Aber ich sag' dir was: Du wirst sterben.«
Keine direkte Lüge, schließlich starb jeder irgendwann. Dennoch – und obwohl sie wusste, dass sie es nur zum Wohl des Kindes tat – fühlte sich Apehei schäbig. Das schlechte Gewissen fraß sie innerlich auf.
Sie wusste nicht, seit wie vielen zigtausend Zyklen die Kejis im Chaoporter lebten, und sie wusste nicht, warum. Hatte FENERIK ihr Volk vor dem Untergang gerettet, indem er es an Bord geholt hatte? Oder hatte er es sich einfach einverleibt?
Sie wusste nicht, ob die Bewohner anderer Schalenwelten ebenfalls so auf die Strahlung der Himmelshürdenblitze reagierten, ging allerdings davon aus, dass das nicht der Fall war.
Aber sie wusste, dass es ohne den Chaoporter nie FENERIKS Atem, nie die Genetische Behörde, nie die mentalen Renovierungen und nie die Notwendigkeit gegeben hätte, Kinder zu verängstigen. Und deshalb verabscheute Apehei in Augenblicken wie diesen FENERIK.