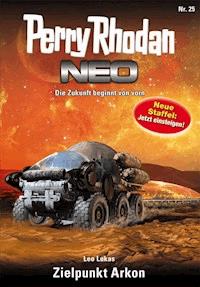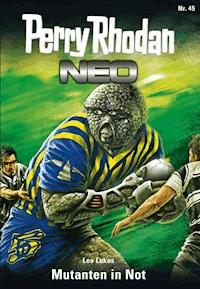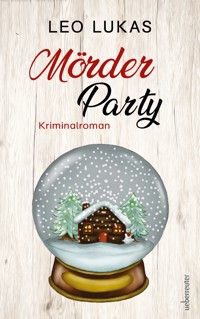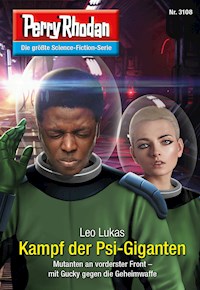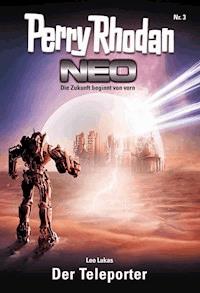
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Im Juni 2036 beginnt eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte: Ein Mann setzt sich zum Ziel, die zerstrittene Menschheit zu einen und zu den Sternen zu führen. Sein Name ist Perry Rhodan, er war Kommandant einer amerikanischen Mondmission. Auf dem Erdtrabanten traf Perry Rhodan auf Außerirdische, die menschenähnlichen Arkoniden, die mit einem riesigen Raumschiff auf dem Mond abgestürzt waren. Rhodan und sein Freund Reginald Bull traten in Kontakt mit den Arkoniden Thora und dem schwerstkranken Crest da Zoltral. Gemeinsam mit Crest flogen die Astronauten zurück zur Erde; dort soll Crest geheilt werden. In der Wüste Gobi werden sie von chinesischen Soldaten eingekreist. Und während sich Crests Zustand in der Wüste Gobi verschlechtert, startet das chinesische Militär seine Offensive gegen die STARDUST. Als sogar ein arkonidisches Beiboot angegriffen wird, holt Thora zum Gegenschlag aus. Was Perry Rhodan noch nicht weiß: Er bekommt Unterstützung durch einen Teleporter ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 3
Der Teleporter
von Leo Lukas
Im Juni 2036 beginnt eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte: Ein Mann setzt sich zum Ziel, die zerstrittene Menschheit zu einen und zu den Sternen zu führen. Sein Name ist Perry Rhodan, er war Kommandant einer amerikanischen Mondmission.
Auf dem Erdtrabanten traf Perry Rhodan auf Außerirdische, die menschenähnlichen Arkoniden, die mit einem riesigen Raumschiff auf dem Mond abgestürzt waren. Rhodan und sein Freund Reginald Bull traten in Kontakt mit den Arkoniden Thora und dem schwerstkranken Crest da Zoltral.
Gemeinsam mit Crest flogen die Astronauten zurück zur Erde; dort soll Crest geheilt werden. In der Wüste Gobi werden sie von chinesischen Soldaten eingekreist. Und während sich Crests Zustand in der Wüste Gobi verschlechtert, startet das chinesische Militär seine Offensive gegen die STARDUST.
Manche mögen sagen, ich sei ein Träumer.
Aber ich bin nicht der einzige.
(John Lennon, Imagine)
Prolog:
Der Überfall
Stell dir vor, dir erscheint ein Gespenst. Oder gleich deren drei, und eins davon blutet.
Du bist in einem dieser austauschbaren Zimmer in einem dieser austauschbaren Hotels in einer dieser austauschbaren Trabantenstädte, hast gerade den letzten aufgeweichten, fade schmeckenden Schokoriegel aus der Minibar verdrückt und surfst noch ein wenig im Netz, um müde genug zu werden, dass du hoffentlich bald schlafen kannst. Es ist noch nicht mal sieben Uhr abends. Aber morgen musst du sehr früh raus, und du solltest ausgeruht sein.
Die Übung ist dir nicht neu. Zur Not wirst du eine Schlaftablette einwerfen, spätestens um acht Uhr, und sie mit einem Glas überteuertem, eisgekühltem Rotwein hinunterspülen. Lieber wäre dir, du könntest darauf verzichten. Du bekommst Sodbrennen von dem Zeug.
Jedenfalls liegst du auf dem Bett, in Unterhose und T-Shirt. Der Anzug hängt fein säuberlich im Schrank, das frische, dem Koffer entnommene Hemd in der Duschkabine. Alter Trick der Handelsreisenden und fahrenden Künstler: zuerst die Dusche voll aufgedreht, auf heißester Stufe, damit sich Dampf bildet – der dann die Falten glättet. Viel besser und bequemer als bügeln.
Auf den hoch gestellten Oberschenkeln balancierst du das Netz-Tablet. Du überfliegst die Sportnachrichten. Deine Mannschaft hat verloren, schon wieder. Nicht gut, weil dich das eher aufregt als einschläfert. Also wechselst du zur Politik: Inhaltsleeres Gelaber funktioniert fast immer.
Bloß, dass dort die pure Hektik regiert. Die Kommentatoren überbieten sich mit dramatischen Formulierungen. Glaubt man ihnen, so scheint es nur eine Frage der Zeit, bis der globale Krieg ausbricht, und eine Frage des Ortes, wo er seinen Anfang nimmt. Taiwan? Der Nahe Osten? Zentralafrika? Oder gar auf dem Mond?
Zu den Mondbasen aller drei Supermächte gibt es keinen Funkkontakt mehr. Was ist dort oben los? Wieso hört man nichts mehr von der Aufklärungsmission der amerikanischen Astronauten um Major Perry Rhodan? Die Regierungssprecher werfen einander gegenseitig Sabotage vor und drohen mit Vergeltungsschlägen an anderen Fronten. Nicht, dass das Säbelrasseln der Militärs und die Panikmache der Journalisten sensationelle Neuigkeiten wären. Das geht schon seit Wochen und Monaten so. Trotzdem will bei dir nicht so recht Langeweile aufkommen. Krieg am Mond?
Na schön, dann Hardcore. Kultur. Kritik eines klassischen Konzerts in der Metropolitan Opera. Haydn, »Symphonie mit dem Paukenschlag«. Prima. Kaum poppt die Seite auf, gähnst du schon. Streckst den Oberkörper, räkelst dich wohlig ...
Funken sprühen – im ganzen Zimmer. Ein Schwall heißer Luft spült über dich hinweg, als hätte die Klimaanlage plötzlich beschlossen, ihre Funktion radikal zu verändern. Ein Kurzschluss? Du lässt das Tablet fallen, wirfst dich zur Seite, reißt die Decke hoch, ziehst sie dir über den Kopf.
Lächerlich, und peinlich. Nutzlos sowieso, falls der Klimakasten tatsächlich explodiert.
Als du den Kopf wieder hinausstreckst, siehst du sie. Die Gespenster, alle drei. Sie stehen mitten im Zimmer. Obwohl du die Tür versperrt hast und die Scheiben der Fenster, die man nicht öffnen kann, unversehrt sind.
»Hau ab!«, kreischt eine Stimme.
Sie gehört zu der Pistole, deren Mündung auf dich gerichtet ist. Du hast erhebliche Mühe, deine Schließmuskeln zu kontrollieren. Schusswaffen erzeugen diesen Effekt bei Menschen, die in der Realität nicht oft mit ihnen konfrontiert werden.
Deine Gedanken überschlagen sich. Die Pistole ist eine Glock, wie sie hierzulande Polizisten verwenden. Halb automatisch, zwölf Schuss, sehr zuverlässig, heißt es. Der sie hält, ist ein Jugendlicher, ein dicker Latino, mit schwarzen, ölig glänzenden Haaren. Er hat etwas an, was wie ein selbst gebastelter Raumanzug aussieht. Deine Panik steigert sich sprunghaft. Der Junge wirkt irre, außer Kontrolle, völlig unberechenbar. Funken tanzen in seinen Augen.
»Ihr kö... könnt alles haben«, stammelst du. »Meine Brieftasche liegt ...«
»Hörst du schlecht? Hau einfach ab!«
Du wälzt dich aus dem Bett, stolperst zum Schrank, reißt die Hose vom Bügel, schlüpfst hinein. Dein Fuß verfängt sich im Innenfutter, du hüpfst auf einem Bein, bewahrst gerade noch das Gleichgewicht ...
Die Begleiterin des Latinos hat nur eine Hand. Ihr linker Arm endet in einem Stumpf. Sie ist winzig, fragil, ein verkrüppeltes Kind. Aber aus ihren Augen blickt eine uralte Hexe. Ihr mitleidiger Blick jagt dir fast noch mehr Angst ein als der Kerl mit der Pistole.
Und der Dritte ...
Seine Kleidung ist von Blut getränkt, eine dunkelrote Pfütze bildet sich um seine Schuhe. Ein deutlich älterer Mann, eigentlich ein Durchschnittstyp. Irgendwie passt er überhaupt nicht zu den beiden Freaks, die ihn stützen. Seine Augenlider flattern. Er ringt mit der Ohnmacht. »Sorry«, würgt er hervor, flach, kaum verständlich. »Wir brauchen dein Zimmer. Bitte geh, nimm deine Sachen mit und schlag nicht sofort Alarm.«
Seine Höflichkeit gibt dir den Rest. Du raffst deine Habseligkeiten an dich und stolperst aus dem Hotelzimmer. Den Gang entlang, in den Lift ...
Du bist über vierzig Meilen gefahren, wie ferngesteuert, als du dein Auto auf dem Parkplatz eines Motels abstellst. Nach dem zweiten Kaffee hast du dich so weit im Griff, dass du dir überlegst, ob du die Behörden informieren sollst.
Später, viel später, wirst du erfahren, dass du, kurz und heiß, vom Atem der Geschichte gestreift wurdest. Du warst in ein historisches Ereignis verwickelt, sozusagen ein Zeitzeuge. Noch deinen Urenkeln wirst du mit dieser Geschichte auf die Nerven gehen.
1.
Häuser aus Sand
30. Juni 2036
Aus dem Staub wuchs eine Stadt. Eine Stadt, wie sie diese Welt noch nicht gesehen hatte.
»Stählerne Heinzelmännchen«, sagte Reginald Bull. »Macht Spaß, ihnen zuzuschauen, gell?«
Perry Rhodan widersprach nicht. Die arkonidischen Roboter wuselten in affenartiger Geschwindigkeit auf dem Wüstenboden hin und her. Als hätten sie Zauberstäbe anstelle von Greifarmen, verwandelten sie Sand zu tragfähigen Strukturen und Ödnis in Architektur, gleichermaßen fremdartig und auf schockierende Weise altvertraut, weil in sich stimmig, ja zwingend logisch.
Die beiden Freunde standen auf dem Flachdach des derzeit höchsten Gebäudes und bewunderten die rapiden Fortschritte. Wie von Geisterhand bewegt, reckten sich an einem Dutzend Stellen Säulen gen Himmel, bildeten Zwischendecken aus und gläserne Fassaden ...
»Guter Name, übrigens«, setzte Bull fort. »›Terrania‹, meine ich. Ob deine Einladung, nach Terrania zu kommen, die richtigen Leute anzieht, will ich freilich dahingestellt lassen. Und ob die ›Geister, die du riefst‹, jemals diese Geisterstadt beziehen werden ...«
»Alles ist offen«, sagte Rhodan leise. »Alles. Endlich. Oder besser: Unendlich. Der Kosmos hat sich uns aufgetan, ein lang ersehntes Fenster.«
»Das schnell wieder zuklappen kann.«
»Deshalb mussten wir die Chance ergreifen.«
Er hatte keinen Augenblick gezögert und wunderte sich nicht mal darüber. Perry Rhodan war felsenfest überzeugt, das Richtige getan zu haben. Ihm schien, die 37 Jahre seines bisherigen Lebens hätten einzig diesem Zweck gedient: ihn hierher zu bringen, an diesen Ort, an diesen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte.
»Ganz deiner Meinung. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr.«
»Nein, es gibt kein Zurück.«
Bull schwenkte den Arm über die Baustelle, die mittlerweile fast den gesamten, knapp einen Kilometer durchmessenden Bereich unter der Schutzschirm-Kuppel umfasste. »Ein zentraler, kreisförmiger Platz, darum herum weitere Ringstraßen beziehungsweise Kreissegmente, großzügig angeordnet, nicht strikt symmetrisch, dennoch klaren Prinzipien folgend ... Hat Crest den Masterplan entworfen?«
»Er trägt viel dazu bei. Er möchte, dass Terrania das Beste arkonidischer und menschlicher Ideen verbindet. Deswegen studiert er akribisch alle Luftaufnahmen, die von den Außenbord-Kameras während des Anflugs erstellt wurden.« Abrupt drehte sich Rhodan auf dem Absatz um 180 Grad und ging zurück zur Treppe. »Ich muss nach ihm sehen.« Auf einmal hatte er ein ungutes Gefühl.
Sein bester Freund hastete ihm hinterher, ausnahmsweise ohne zu protestieren. Schweigend bewältigten sie den Abstieg, ihren jeweiligen Gedanken nachhängend. Drei Tage waren vergangen, seit die STARDUST in der Wüste Gobi gelandet war. Drei Tage, die die Welt verändert hatten ...
Im Erdgeschoss kam ihnen Dr. Eric Manoli entgegen. Sein Gesichtsausdruck bestätigte Rhodan, dass ihn seine plötzliche Ahnung nicht getäuscht hatte.
»Crest geht es nicht gut«, sagte der Arzt. Er sprach ruhig und gefasst wie immer, trotzdem spürte man zwischen den Zeilen die Dringlichkeit. »Er hat eine Infektion, verursacht durch irdische Erreger. Der Schutzschirm seiner Konturliege wurde zwar inzwischen von den Robotern repariert, aber in den Stunden des Ausfalls muss Crest sich angesteckt haben.«
Bull stieß einen Fluch aus. »Das hat uns grade noch gefehlt.«
Rhodan fragte: »Wie schätzt du die Erkrankung ein, Eric?«
»Sehr ernst. Durch seine Leukämie ist unser außerirdischer Gönner ohnedies geschwächt, und sein angegriffenes Immunsystem ...«
»Keine Details. Kannst du ihn heilen? Oder zumindest stabilisieren?«
»Ich fürchte, nein. Unser mobiles Lazarett blieb, wie ihr wisst, auf dem Mond zurück. Und die Mittel der STARDUST reichen nicht aus.«
»Was heißt das?«
»Crest braucht dringend medizinische Hilfe. Sonst stirbt er. Hilfe, die wir ihm hier nicht geben können. «
Abermals fluchte Bull.
Perry Rhodan begriff sofort den Ernst der Lage. Crest war der Schlüssel, der höchste Trumpf in diesem Spiel, im Grunde ihr einziger.
Sollte der Arkonide der Infektion erliegen, erlosch jede Aussicht, die himmelhoch überlegene Technologie seines Volkes für die Menschheit zu sichern. Schlimmer noch: Thora da Zoltral, die Kommandantin der AETRON, jenes riesigen, auf dem Erdmond geparkten Kugelraumschiffs, liebte Crest wie einen Vater. Er hatte sie in seinen Haushalt aufgenommen, nach menschlichen Begriffen adoptiert. Der Schmerz über seinen Verlust konnte zu viel für sie sein und sie zu einer Kurzschlusshandlung verleiten.
Der stolzen, impulsiven Arkonidin traute Rhodan allemal zu, dass sie den Menschen die Schuld an Crests Tod gab und sie gnadenlos dafür bestrafte. Sie war, das hatte sie bewiesen, nicht zimperlich; schon gar nicht gegenüber Leuten, die sie als unterentwickelte Wilde einstufte. Bevor sie sich dazu durchrang, ihn und Bull wenigstens als »Barbaren« zu bezeichnen, hatte Thora sie mehrfach »Tiere« genannt.
Vor seinem geistigen Auge erschien Perry Rhodan ein Racheengel, eine überirdisch schöne, goldäugige, weißhaarige Gestalt, die über die Erde – über Terra – kam mit all den ungeheuerlichen Machtmitteln, die ihr die AETRON bot. Thoras Wut vermochte wahrscheinlich nichts und niemand auf diesem Planeten Stand zu halten ...
Er verscheuchte die Vision. Im Laufschritt eilten Manoli, Bull und er zu Crests Quartier.
Der alte Arkonide hatte sichtlich abgenommen. »Ich grüße Sie«, sagte er, matt die Hand hebend. »Was tut sich draußen?«
»Die chinesischen Truppen haben den Landeplatz abgeriegelt und belagern uns. Sie verhalten sich weitgehend ruhig«, antwortete Bull. »Aus gewissen Anzeichen schließe ich allerdings, dass sie Tunnel graben. Ihr Ziel ist, unseren Standort zu unterminieren.«
»Ach, das braucht Sie nicht zu bekümmern. Der Energieschirm ist kugelförmig und setzt sich im Untergrund fort. Die primitiven Waffen können ihn nicht durchdringen. – Perry Rhodan, ich bin auf interessante historische Parallelen gestoßen. Ihre Stadtplaner haben keineswegs stets auf rechtwinklige Raster gesetzt. Es gab sehr wohl kühne Ansätze zu anderen Formen der Urbanität, freilich eingeschränkt durch die geringwertigen Baumaterialien. Aber selbst die Idee der vertikalen Gartenstadt und ...« Seine Stimme versiegte, er schnappte nach Luft, erbarmungswürdig röchelnd.
»Das ist jetzt zweitrangig.« Rhodan empfand große Sympathie für den Außerirdischen, der äußerlich so frappierend menschenähnlich, menschlich wirkte und doch ein Fremder war, fremder als jede andere Person auf dieser Welt. Zugleich zerriss es ihm das Herz, Crest da Zoltral in einem so üblen Zustand anzutreffen. In den roten, schon bei geringer Erregung tränenden Augen des Albinoiden glomm ein Feuer, ein immenser Hunger nach Leben, nach Erkenntnis und Vervollkommnung. Sein Körper jedoch hielt nicht Schritt mit dem Tatendrang, der vielleicht durch den Kontakt zu den terranischen Astronauten erneut angefacht worden war. Dasselbe Feuer, das in Crests Geist loderte, verzehrte seinen Leib zusehends schneller. »Sie müssen sich schonen. Ihr Wohlergehen hat oberste Priorität.«
Er tauschte einen Blick mit Eric Manoli. Langsam drehte der Arzt verneinend den Kopf. Nichts zu machen, bedeutete die Geste.
»Brücken«, hauchte Crest. »Zwischen den Türmen sollten sich Brücken spannen, welche die Bogenformen des Grundrisses in der dritten Dimension kongruent spiegeln. Sobald ich wieder bei Kräften bin, skizziere ich Ihnen die idealen Proportionen.«
»Ich verstehe. Ja sicher, ausgezeichnete Idee, genauso werden wir es machen. Terrania wird die schönste und lebenswerteste Stadt, die es je gegeben hat. Aber jetzt ruhen Sie sich aus, mein Freund.«
Die Augenlider des Arkoniden fielen herab. Kaum merklich hob und senkte sich sein Brustkorb.
Manoli griff nach Crests Handgelenk, um den Puls zu nehmen. Auf halbem Weg hielt er inne und zuckte resignierend mit den Achseln. »Wir wissen ja nicht einmal sicher, was bei Seinesgleichen noch im unbedenklichen Bereich liegt. Jedenfalls ist sein Zustand kritisch. Unter dem Einfluss der Krankheit beginnt ihm der Bezug zur Realität zu entgleiten.«
»Das habe ich bemerkt.« Rhodan atmete tief durch. »Ich funke Thora an.«
Der Entschluss fiel ihm nicht leicht.
Vermutlich würde die Arkonidin sich in ihren Vorurteilen gegenüber der Erde und den Menschen bestätigt sehen und darauf bestehen, ihren Mentor wieder an Bord der AETRON zu holen. Dann war Crest verloren, nicht nur als Trumpf im Umgang mit ihr.
Andererseits benötigten sie Thoras Unterstützung. Rhodan musste sie unbedingt davon überzeugen, dass Crest nur in einer irdischen Klinik gerettet werden konnte! Und dass sie deshalb Hilfe brauchten, um den Belagerungsring der chinesischen Armee zu überwinden.
Durch und durch angespannt, stellte er die Funkverbindung her. Aber nicht Thoras Abbild erschien auf dem Monitor, sondern jenes eines anderen Arkoniden. Er wirkte desinteressiert und geistesabwesend, sah nicht einmal in die Aufnahmeoptik, sondern mit halb geschlossenen Lidern schräg darüber hinweg. »Was?«
»Perry Rhodan von der Erde. Ich möchte Ihre Kommandantin sprechen.«
»Derzeit nicht möglich. Rufen Sie später wieder an.«
»Warten Sie! Es geht um Crest da Zoltral und ist sehr dringend. Bitte geben Sie mir Thora.«
»Sie ist beschäftigt. Unabkömmlich.«
»Wie lange? Wo steckt sie, was treibt sie?«
Er erhielt keine Antwort. Der Blick des Arkoniden schweifte in unbestimmte Ferne. Auf seinem bleichen Gesicht tanzte der Widerschein bunter, flackernder Lichter.
»Hören Sie mir zu, Mann, sprechen Sie mit mir! Sind Sie Thoras Stellvertreter?«
»Ja.«
»Wie lautet Ihr Name?«
»Kemath da Ordsent.«
»Gut, Kemath. Ihre Kommandantin hat ja wohl hinterlassen, wie man sie in Notfällen erreichen kann. Dies ist ein Notfall!«
Rhodans Gegenüber verzog den Mund zu einem entrückten Lächeln. Was immer seine Aufmerksamkeit endgültig abgelenkt hatte, Kemath drehte sich von der Kamera weg. Das Monitorbild erlosch. Die Verbindung war gekappt worden. Weitere Anrufe erzielten keine Reaktion. Zwar stellte der Bordcomputer sie an Thoras Stellvertreter durch, aber dieser nahm sie nicht entgegen.
In hilflosem Zorn ballte Rhodan die Hände zu Fäusten. Das kugelförmige Schiff der Arkoniden war ein technisches Wunderwerk, die Besatzung jedoch weitgehend unzurechnungsfähig. Offenbar vergnügten sich alle, bis auf Crest und Thora, nahezu ausschließlich in fiktiven, virtuellen Welten. Weder der Zweck ihrer Mission, hatte Crest beklagt, noch sein Leid genügte, sie länger als für wenige Momente zurück in die Realität zu holen. Wozu auch, da sie sich unangreifbar fühlten und scheinbar alles Wesentliche automatisch ablief?
»Vergiss diese Idioten«, knurrte Reginald Bull. »Wir müssen die Krise mit eigenen Mitteln bewältigen.«
Aber wie? Eine Idee schoss Rhodan durch den Kopf, geboren aus Verzweiflung. »Flipper«, murmelte er.
»Clark? Was ist mit ihm?«
»Ich denke, seine Stunde ist gekommen.«
2.
Der Nachhall von Schüssen
Eine Woche davor
Mit größter Mühe schaffte es John Marshall, bei Bewusstsein zu bleiben. Ihm war schwindlig, das Hotelzimmer drehte sich um ihn. Immer wieder wurde ihm schwarz vor den Augen. Aber er verspürte keine Schmerzen. Er stand wohl unter Schock. Der Blutverlust, die vielen Tode, die er hautnah miterlebt hatte, nein: intensiver noch als hautnah ...
Jemand half ihm, sich auf das Bett zu legen. Sue. Kleine, verkrüppelte, tapfere Sue ... Es war falsch. Er sollte der Beschützer sein, nicht der Beschützte. Er hatte die Verantwortung, er gab auf die Kinder des Pain Shelters Acht, nicht sie auf ihn!
Marshall versuchte sich aufzusetzen. Sanft drückte Sue ihn zurück in die Kissen. »Nicht anstrengen«, warnte sie. »Du blutest stark. Ganz ruhig, John. Bitte. Lass mich machen.«
Der Druck ihrer Hand verlagerte sich auf die Wunde an seinem Bein. Ihm war beinahe, als greife Sue in ihn hinein; ein gutes, erstaunlich angenehmes, warmes Gefühl. Er beruhigte sich. Allmählich klärten sich seine Gedanken und seine Wahrnehmung.
Beständiges Rumoren erfüllte das Zimmer. Marschall drehte den Kopf. Die Geräusche wurden von Sid verursacht, der mit allerlei Mobiliar die Tür verbarrikadierte. Dabei brabbelte er unablässig. Nur Bruchstücke waren zu verstehen: »Niemals ... Kriegt mich nicht ... Er darf mich nie wieder ...«
»Keine Angst«, krächzte Marshall. »Der Mann kommt nicht zurück. Er ist in Panik geflohen, weit weg.« Das wusste er mit Bestimmtheit, obwohl er nicht hätte sagen können, woher.
Sid González wirbelte zu ihm herum und starrte ihn verwirrt an. Marshall erkannte, dass der pummelige Teenager nicht den Hotelgast meinte, den er bedroht und verscheucht hatte. Die Pistole der ermordeten Polizistin steckte in seinem Gürtel. »Hast du die Waffe gesichert?«
»Hä? – Natürlich. Was denkst du denn?« Ruckartig wandte Sid sich wieder der Kommode zu und schob sie ächzend weiter Richtung Tür.
John Marshall schloss die Augen. Ja, was dachte er?
Verzweiflung und Schuldgefühle brandeten in ihm hoch. Er hatte versagt. Es war ihm nicht gelungen, die Situation in den Griff zu bekommen, geschweige denn, die Zwillinge Tyler und Damon zur Vernunft zu bringen. Die beiden waren ihm entglitten, lang zuvor schon. Sonst hätten sie nicht hinter seinem Rücken Kalaschnikow-Gewehre gehortet.
Tyler hatte die Polizistin Deborah erschossen, eine gutmütige Frau, mit einem Herz für Kinder, voller Verständnis. Mit ihr hatte man immer reden können ... Und jetzt war sie tot. Sie und ihre Kollegen hatten nach Sid gefahndet, wegen versuchten Bankraubs. Dann war die Lage eskaliert, weil die Zwillinge durchgedreht und ein Feuergefecht ausgelöst hatten.
Marshall hörte, spürte das Echo der Schüsse. Die Kugel, die Deborah traf, in die Brust, und ein Loch schlug, aus dem sekundenschnell das Leben entwich. Abermals starb er im Kugelhagel der automatischen Waffen, mit denen die Polizisten auf den Shelter schossen, fühlte glühend heiß die Projektile, die sich in seinen Oberschenkel bohrten, in die Schulter, in den Schädel, der daraufhin zerplatzte. Aber erst am Ende war John tatsächlich selbst getroffen worden.
Die anderen Verletzungen hatte er sich nur eingebildet. »Nur« mitempfunden, jedoch dermaßen eindringlich ... Wie ging das zu? War er ... krank, geistesgestört? Litt er unter Halluzinationen?
Ein Wort formte sich in seinen Gedanken: Empathie. Es klang ihm lasch, nicht gänzlich daneben, aber zu ungenau. Konnte man denn ein derart extrem übersteigertes Mitgefühl besitzen? Wie war das möglich?
Andererseits hätte er es auch bis vor Kurzem für undenkbar gehalten, dass jemand sich mit bloßer Willenskraft augenblicklich von einem Ort zu einem anderen, meilenweit entfernten versetzen konnte. Mittlerweile hatte Sid – ausgerechnet der dickliche, scheue Sid »Spark« González – mehrfach bewiesen, dass er über diese an Zauberei grenzende Gabe verfügte.
»Was geschieht mit uns?«
Er merkte, dass er laut gesprochen hatte, weil Sue ihm antwortete: »Du musst in ein Krankenhaus.«
»Nein!«, heulte Sid auf. »Kein Krankenhaus. Dort finden sie uns!«
»Siehst du nicht, was mit John los ist? Ich kann die Blutung nicht allein stillen. Willst du, dass er verblutet?«
Der sechzehnjährige Latino überlegte fieberhaft. Schweiß perlte von seiner Stirn, wandelte sich zu stiebenden Funken. Dann war er weg, spurlos verschwunden. Nur die Raumtemperatur hatte sich beträchtlich erhöht, trotz der surrenden Klimaanlage.
Ohne den unglaublichen Vorgang zu kommentieren, stand Sue auf, rannte ins Bad und kam mit Handtüchern wieder, die sie auf Marshalls Beinwunde presste. »Du brauchst einen Druckverband. Aber ich bringe keinen zustande, hier gibt es nirgendwo einen Verbandskasten ...« Es fiel ihm schwer, ihrem Redefluss zu folgen.
Er musste weggedämmert sein. Ein markerschütternder Schrei weckte ihn. Hitze, Funken ... Sid war zurück. Er hatte eine ältliche Frau mitgebracht, die einen weißen Kittel trug. Eine Ärztin. Sie zitterte am ganzen Leib, ihre Augen waren schreckgeweitet. Ihr Schrei erstarb in einem Röcheln.
John Marshall roch ihre Angst. Er konnte nachvollziehen, dass das ungewöhnliche Erlebnis sie hoffnungslos überforderte. Aber woher wusste er, wie sie hieß, obwohl er kein Namensschild sah?
»Doktor Lowenstein. Deirdre«, hörte er sich raunen, langsam, Wort für Wort, in beschwichtigendem Tonfall. »Dies mag Ihnen wie ein Albtraum erscheinen, doch es ist die Realität. Wir wollen Ihnen nichts Böses, verstehen Sie mich? Ich kann alles erklären; nun ja, das meiste. Ich fürchte nur, es bleibt mir zu wenig Zeit. Ich bin schwer verletzt. Bitte helfen Sie mir.«
Im Hintergrund tastete Sid nach der Pistole. Sue schlug seine Hand zur Seite und schüttelte den Kopf. Im ersten Moment wollte der Junge aufbrausen; schließlich fügte er sich.
Einstweilen.
Marshall zupfte die blutgetränkten Handtücher von seinem Unterschenkel. »Ich wurde angeschossen. Sie sind Ärztin. Sie haben einen Eid abgelegt.« Das Sprechen kostete ihn sehr viel Kraft, aber er durfte jetzt nicht nachlassen. Er spürte, dass er kurz davorstand, zu ihr durchzudringen. »Bitte behandeln Sie mich, Deirdre. Ich flehe Sie an, retten Sie mein Leben.«
Nach wie vor zitternd, trat Dr. Lowenstein an sein Bett und beugte sich über ihn. Sie stellte keine Fragen. In sich versunken, wie eine Schlafwandlerin, krempelte sie vorsichtig sein Hosenbein hoch und untersuchte die Wunde. Ihre silbergrauen Haare waren zu einem straffen Knoten gewickelt, der von einer hölzernen Spange fixiert wurde. Schließlich sagte sie: »Sie gehören ins Krankenhaus.«
»Kommt nicht in Frage!«, keifte Sid prompt. »Sie müssen ihm hier helfen.«
»Mit bloßen Händen? Wie stellt ihr euch das vor?«
Funken sprühten ... Diesmal dauerte es nur wenige Sekunden, bis der Junge zurückkehrte, unter dem Arm einen Arztkoffer. Er reichte ihn Dr. Lowenstein. »Das muss reichen.«
Sie ignorierte Sid und insbesondere dessen übersinnliche Fähigkeit, merkte John Marshall, nein: fühlte er. Ihr Gehirn verdrängte das Unerklärliche, blendete auch die beunruhigenden Umstände aus, konzentrierte sich ausschließlich auf ihren Patienten. Gut so. Sie erhob auch keine Einwände dagegen, dass Sue sich zu John aufs Bett setzte und seine Hand hielt.
Alles war einigermaßen im Lot. Er gab seiner Schwäche nach und döste ein.
Nach einer unbestimmten Zeitspanne kam John Marshall wieder zu sich, weil die Ärztin sagte: »Gratuliere. Sie hatten Glück. Die Kugel ging glatt durch die Wade. Ich habe die Wunde gesäubert und desinfiziert und lege Ihnen jetzt einen Verband an.«
»Danke!«
»Außerdem verfügen Sie über eine bemerkenswerte Konstitution. Die Wundheilung setzt erstaunlich früh ein. Ich werde Ihnen schmerzstillende und Kreislauf stützende Medikamente dalassen. Selbstverständlich müssen Sie spätestens übermorgen zur Nachbehandlung und Kontrolle in ein ...«
Es klopfte an der Tür.
»Greater Houston Police Department«, erklang von draußen eine Männerstimme. »Aufmachen!«
Sid González zückte die Pistole.
»Nein, nicht!«, flüsterte Marshall. »Um Himmels willen, denk daran, was zu Hause im Shelter passiert ist. Mach nicht denselben Fehler wie die Zwillinge!«
»Ich wiederhole: Öffnen Sie!«, drang es dumpf, doch unmissverständlich durch die verrammelte Tür. »Wir haben das Haus umstellt, Widerstand ist zwecklos. Machen Sie keine Dummheiten!«
»Ihr kriegt mich nicht«, fauchte Sid, mehr zu sich selbst. »Niemals!« Ein scharfes Klicken ertönte, als er die Waffe entsicherte.
»Schneller«, spornte Sue die Ärztin an. »Sehen Sie zu, dass Sie fertig werden. Sonst geschieht ein Unglück.«
Von der anderen Seite wurde am Türknauf gerüttelt. »Zum letzten Mal, sperren Sie auf! Wir geben Ihnen zehn Sekunden, dann schicken wir das Überfallkommando hinein. Sie haben keine Chance.«
Mit fliegenden Fingern umwickelte Dr. Lowenstein Marshalls pochenden Unterschenkel. Sid umfasste die Pistole mit beiden Händen, spreizte die Beine und ging in Schussposition. Etwas Schweres krachte gegen das Türblatt, das sich nach innen bog, jedoch standhielt. Noch.
Alle im Raum schrien durcheinander.
»Er kriegt mich nicht!«
»Sid, bring uns fort von hier!«
»Ich bin Ärztin und unschuldig ...«
»Gehen Sie in Deckung, Doktor!«
»Nimm den Arztkoffer mit!«
Ein weiterer, wuchtiger Schlag ließ den Raum erbeben. Die Tür zerbarst. Möbel stürzten um. Kommandos wurden gebrüllt. Durch die splitternden Fensterscheiben schwangen sich bewaffnete, schwarz vermummte Gestalten.
John Marshall wappnete sich aufs Schlimmste.
Funken stoben.
Hinterher sollte Dr. Deirdre Lowenstein noch eine Weile gegen das GHPD prozessieren, dessen Beamte sie nicht nur äußerst unsanft behandelt, sondern tagelang festgehalten und verhört hatten.
Weder ihr noch ihren Anwälten oder jenen der Gegenseite fiel jemals ein, zwischen den Vorfällen am Abend des 23. Juni 2036 und den Geschehnissen, die wenig später einen bedeutenden Sektor der Milchstraße erschütterten, einen Zusammenhang herzustellen. Man debattierte stattdessen über Formalfehler, feilschte um Kleinigkeiten, verbiss sich in juristische Scharmützel.
Dass Dr. Lowenstein mit keinerlei Personenbeschreibungen ihrer angeblichen Entführer dienen konnte, sondern angab, betäubt, unter bewusstseinsverändernde Drogen gesetzt und verschleppt worden zu sein, half nicht unbedingt weiter. Irgendwann rang sie sich zur Erkenntnis durch, sie habe schon zu viel von ihrem geerbten Vermögen verschleudert, und stimmte – gegen den Protest der Anwälte, die sie gern noch weiter gemolken hätten – einem Vergleich zu. Von da an lebte sie abgeschieden im Ferienhaus ihrer Familie auf Barbados. Sie verfolgte strikt keine Nachrichten und widmete sich mit großer Inbrunst der Zucht von Rauhaardackeln.
Zu den Fähigkeiten, welche die Gattung homo sapiens sapiens
3.
Der Bessere
30. Juni 2036
Major Michael Freyt flog zum Mond.
Endlich. Endlich doch.
Ihn wurmte immer noch, dass er nicht als Erster zum Einsatz gekommen war. Man hatte ihm Perry Rhodan vorgezogen. Nicht, weil dessen Testergebnisse besser gewesen wären, ganz im Gegenteil! In jeder einzelnen Wertung lag Freyt vorne. Immer schon. Rhodan war bloß ... smarter. Geschickter. Er umgab sich mit der Aura des Schwierigen, Interessanteren, weil Widersprüchlicheren. Indem er bei jeder Gelegenheit aufmuckte, lenkte er das Scheinwerferlicht auf sich.
Ha!
Michael Freyt durchschaute seinen Konkurrenten. Von der ersten Begegnung an, seit sie bei der gemeinsam absolvierten Aufnahmeprüfung die ersten beiden Plätze belegt hatten. Freyt vor Rhodan, dann Reginald Bull, ex aequo mit William Sheldon. Sie vier waren vom selben Jahrgang, vom selben Schlag. Risikopiloten aus Leidenschaft, verrückt nach dem Weltraum, mit mehrfach getesteten Intelligenzquotienten weit jenseits von 130.
Die Pärchen bildeten sich wie von selbst, bereits nach wenigen Tagen. Freyt und Sheldon schätzten bewährte Systeme, klare Richtlinien, militärische Disziplin. Das war das entscheidende: Disziplin. Zu wissen, wohin man gehörte. Was man dafür tun und worauf man verzichten musste. Den Körper stählen, den Verstand schärfen. Kritik üben, klar doch, falls sie denn angebracht war. Aber vor allem geerdet bleiben, dem Vaterland verpflichtet. Patriot. Amerikaner.