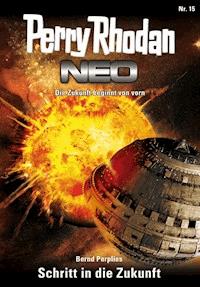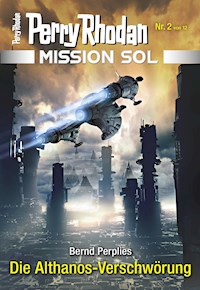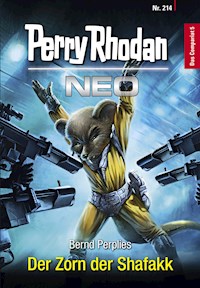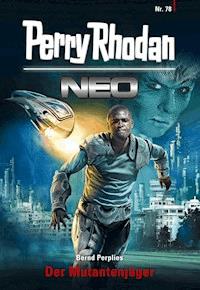
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden gestoßen ist. Im November 2037 ist die Erde kaum wiederzuerkennen. Die Erkenntnis, dass die Menschheit nur eine von unzähligen intelligenten Spezies ist, hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Spaltung in Nationen ist überwunden. Ferne Welten sind in greifbare Nähe gerückt. Eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen. Doch sie kommt zu einem jähen Ende - das muss Perry Rhodan feststellen, als er von einer beinahe einjährigen Odyssee zwischen den Sternen zurückkehrt. Das Große Imperium hat das irdische Sonnensystem annektiert, die Erde ist zu einem Protektorat Arkons geworden. Aber die Menschen legen die Hände nicht in den Schoß. In der Operation Greyout zerschlagen sie die Datenbasis, auf der die Herrschaft der Arkoniden ruht. Chaos bricht aus - und ein verzweifelter Mutant sucht sein Heil in der Flucht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 78
Der Mutantenjäger
von Bernd Perplies
Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden gestoßen ist. Im November 2037 ist die Erde kaum wiederzuerkennen.
Die Erkenntnis, dass die Menschheit nur eine von unzähligen intelligenten Spezies ist, hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Spaltung in Nationen ist überwunden. Ferne Welten sind in greifbare Nähe gerückt. Eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen.
Doch sie kommt zu einem jähen Ende – das muss Perry Rhodan feststellen, als er von einer beinahe einjährigen Odyssee zwischen den Sternen zurückkehrt. Das Große Imperium hat das irdische Sonnensystem annektiert, die Erde ist zu einem Protektorat Arkons geworden.
Aber die Menschen legen die Hände nicht in den Schoß. In der Operation Greyout zerschlagen sie die Datenbasis, auf der die Herrschaft der Arkoniden ruht. Chaos bricht aus – und ein verzweifelter Mutant sucht sein Heil in der Flucht ...
1.
Hebt die IGITA
25. November 2037, Chetzkel
Im Weltraum, so lautete ein altes Sprichwort, hört dich niemand schreien.
Für die unter Druck stehende Zentrale des Schlachtschiffs AGEDEN galt das allerdings nicht. Diesen Umstand wusste Chetzkel im Augenblick sehr zu schätzen. Wie sonst hätte der Kommandeur der arkonidischen Besatzer seinem Unmut über das Versagen seiner Besatzung Luft machen sollen.
»Es ist mir vollkommen egal«, fauchte er seine Untergebenen an. »Es ist mir egal, ob die Atmosphäre dieses elenden Mondes voller Dunst ist. Es ist mir egal, ob an der Oberfläche ein achtzig Kilometer dicker Eispanzer auf uns wartet. Und es ist mir auch egal, ob die IGITA auf den Grund des darunterliegenden Ozeans gesunken ist.« Er drehte sich langsam um die eigene Achse, damit sich auch wirklich jeder angesprochen fühlte. »Keine weiteren Ausflüchte. Ich will, dass dieses Schiff gehoben wird!« Vor Aufregung tränten seine roten Augen.
Betroffene Gesichter blickten ihn an. Obwohl Chetzkel als harter Anführer galt, vergaß er sich selten dermaßen, dass er laut wurde.
Doch der Reekha war es leid. Die Truppen, die ihm die Imperatrice mitgegeben hatte, um das Larsafsystem zu besetzen, das von den Einheimischen als Solsystem bezeichnet wurde, raubten ihm gelegentlich den letzten Nerv. Die Männer und Frauen unter seinem Kommando waren zu jung oder zu alt, bei vielen handelte es sich um Kolonialarkoniden und Strafversetzte. Sogar einige Nichtarkoniden dienten auf der AGEDEN, dem 800 Meter durchmessenden Kugelraumer, der Chetzkel als Flaggschiff diente. Mit ihm war er zum Saturnmond Titan aufgebrochen, um den dort abgestürzten Schweren Kreuzer IGITA zu bergen.
Chetzkel hatte sich große Mühe gegeben, nur die fähigsten Leute in die Zentrale des Schiffs zu lassen. Einige von ihnen schätzte er mittlerweile, zweien oder dreien vertraute er sogar. Doch selbst diese schienen an ihrer gegenwärtigen Aufgabe zu scheitern.
Bereits wenige Wochen nachdem sein Geschwader wie befohlen die Kontrolle über das Larsafsystem übernommen hatte, war Chetzkel dazu übergegangen, das gesamte Sonnensystem nach Spuren früherer arkonidischer Kolonisation zu durchsuchen. Aus den Geschichtsbüchern, die er zu Rate gezogen hatte, als er ohne jede Erklärung in dieses scheinbar unwichtigste aller Sternensysteme versetzt worden war, wusste er, dass es vor etwa 10.000 Jahren eine Kolonie des Imperiums auf Larsaf III, von seinen Bewohnern auch Erde genannt, gegeben hatte. Atlan da Gonozal, der Sohn des damaligen Imperators Mascaren da Gonozal, hatte dieser Kolonie vorgestanden.
Dieser Umstand hatte ihn noch misstrauischer gemacht als das gegenwärtige Interesse von Emthon V. an Larsaf und seinen Planeten. Was hatte der Sohn des Imperators hier vor 10.000 Jahren getrieben? Und war sein Unterfangen von Erfolg gekrönt gewesen, oder hatten die Methans ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht?
In der Schiffsdatenbank zu Larsaf gab es nur einen knappen Eintrag. Ihm zufolge war die Kolonie im Krieg vollständig ausgelöscht worden. Um daher Antworten auf seine Fragen zu erhalten, hatte Chetzkel Aufklärer von Planet zu Planet geschickt. Zugleich hatte er alle Informationen analysieren lassen, die er im planetaren Datennetz der Menschen zum Thema Arkoniden hatte finden können.
Die Menschen mochten einige Schwächen haben, doch eines konnte man ihnen nicht vorwerfen: mangelnde Neugierde. Etwa ein Jahr war seit dem Erstkontakt mit der auf dem Mond von Larsaf III gestrandeten AETRON unter der Verräterin Thora da Zoltral vergangen. In der Zeit hatten sie nicht nur eine Station auf Larsaf II, auch Venus genannt, gefunden, sondern auch ein Raumschiffwrack unter dem Eispanzer des Saturnmonds Titan.
Darüber hinaus musste eine weitere arkonidische Zuflucht in Form einer Unterwasserkuppel am Grunde des Atlantischen Ozeans existiert haben. Chetzkel hatte die Anlage in den ersten Stunden der Invasion vernichten lassen, da er mit einer Festung gerechnet hatte. Ein Trugschluss, für den ihn Fürsorger Satrak gerügt hatte, doch der Reekha war nach wie vor davon überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Ein Soldat, der zögerte, überlebte nicht lange.
Die Venuszuflucht diente den Menschen mittlerweile als Orbitalstation, die in einem Orbit oberhalb der Welthauptstadt Terrania schwebte. Das Raumschiffwrack der IGITA dagegen, ein Schiff, das vermutlich zu Atlans Geschwader gehört hatte und von den angreifenden Methans zerstört worden war, lag noch immer an seiner Absturzstelle. Die Menschen besaßen einfach nicht die Möglichkeiten, um es zu bergen. Außerdem hatte sich ihr Interesse an dem Wrack offenbar in Grenzen gehalten. Funktionierende arkonidische Technologie reizte sie mehr.
Anders als den Reekha.
»Also«, beendete er die Stille, die sich nach seiner Tirade in der kreisrunden Zentrale breitgemacht hatte. »Ich will nicht hören, welche Probleme die Bergung der IGITA mit sich bringt, sondern welche Lösungen Ihnen einfallen, um den Kreuzer zu heben.«
Die Operation hatte sich als unerwartet herausfordernd erwiesen. Aufgrund der hohen Dichte und Masse der Atmosphäre war es praktisch unmöglich, vom Orbit aus mit Thermalstrahlern oder Desintegratorgeschützen zu arbeiten. Zu viel ihrer Wirkungskraft ging dabei verloren.
Nach ein paar Probeläufen hatten die Ingenieure der AGEDEN aus Angst vor einer Überlastung der Energiesysteme von diesem Vorgehen dringend abgeraten. Immerhin galt es, einen dreihundert Meter durchmessenden Tunnel in den achtzig Kilometer dicken Eismantel des Monds zu brennen. Die dazu benötigte Energie, so hatten sie vorgerechnet, bewegte sich in gefährlichen Größenordnungen – vor allem, wenn die Bohrung in der von Chetzkel gewünschten Schnelle bewerkstelligt werden musste. Zwar war das Schlachtschiff theoretisch in der Lage, mit seinen mehreren Kernfusionsreaktoren die benötigte Leistung zu erbringen, doch die meisten Leitungen und Waffensysteme waren für Punktbelastungen konstruiert, nicht für hochenergetischen Dauerstress.
Außerdem war Chetzkels Flaggschiff, genau wie seine Mannschaft, keineswegs erste Wahl. Es hatte schon eine Menge Dienstjahre auf dem metallenen Buckel. Seine Kabel und Leitungen waren alles andere als in fabrikneuem Zustand. Chetzkel liebte dieses Schiff, es war sein erstes Kommando dieser Größenordnung – aber ihm war bewusst, dass die AGEDEN ihre Grenzen hatte.
Diese auszutesten, mochte in einem Notfall angebracht sein. Fürsorger Satrak würde allerdings kaum Verständnis dafür aufbringen, wenn Chetzkel ihre ohnehin geringe Militärpräsenz im Larsafsystem schwächte, indem er sein Flaggschiff beschädigte, während er einem Privatprojekt nachging. Für gewöhnlich scherte sich der Reekha wenig darum, was dieser Zivilist von ihm dachte, dieser Nichtarkonide, der den Oberbefehl über die Besatzung von Larsaf III hatte. Aber er wollte nicht das Risiko eingehen, Satrak im Spiel um die Gunst der Mächtigen Arkons die Trumpfkarte in die Hand geben, ein Schlachtschiff bei der Bergung eines Wracks ruiniert zu haben.
Die Lösung wäre gewesen, die AGEDEN auf Titan zu landen zu lassen. Dann hätten sie die Waffen direkt über der Oberfläche zum Einsatz bringen können. Allerdings hatte sein Pilot Mertal, der wegen mehrfacher Insubordination auf den Larsaf-Einsatz geschickt worden war, davon abgeraten.
Die schweren Turbulenzen in der oberen Troposphäre stellten für einen Brocken wie das Schlachtschiff noch das geringere Problem dar. Vielmehr fürchtete der Veteran an den Steuerinstrumenten, dass die Oberfläche unter einer oder gar mehreren der Teleskoplandestützen einbrechen könnte. Der Eispanzer in der Zielzone war keine massive Schicht, sondern bestand ihren Sensoren zufolge aus porösem Wassereis und Seen aus flüssigem Methan, unter dem sich zum Teil Hohlräume befanden.
An diesem Punkt war Chetzkel der Geduldsfaden gerissen.
»Reekha«, meldete sich einer seiner Untergebenen, ein Orbton namens Saprest, der die Navigation bediente. »Vielleicht sollten wir versuchen, die AGEDEN bis auf eine Schiffslänge an die Mondoberfläche heranzubringen und sie dann mit den Antigravtriebwerken zu stabilisieren. Wenn wir aus so geringer Höhe die Desintegratorgeschütze einsetzen, dürften sich die atmosphärischen Störungen nicht mehr auswirken.«
»Selbst wenn es uns gelingt, einen Schacht zu brennen, werden wir die IGITA mit dem Traktorstrahl nicht heben können«, wandte Barrkin da Ariga von der Feuerleitkontrolle ein. »Das Schiff liegt zu tief im Meer. Durch die Wassermassen kommen wir nicht durch.«
»Und wenn wir den Schacht so weit verbreitern, dass wir mit der AGEDEN bis zur Wasseroberfläche absinken können?«, schlug Mertal an der Steuerkontrolle vor. »Dann wäre der Streuverlust geringer.«
Da Ariga schnaubte. »Haben Sie mal durchgerechnet, wie viel Energie es kostet, einen etwa zweieinhalbtausend Meter breiten Schacht achtzig Kilometer tief in die Eiskruste zu brennen?«
»Entschuldigung?«, meldete sich eine Frau mit mädchenhaft heller Stimme hinter Chetzkel zu Wort. »Warum wollen Sie das Schiff unbedingt hochziehen? Ich hätte da vielleicht eine Idee, wie man es anders machen könnte.«
Unvermittelt trat Stille in der Zentrale ein.
Chetzkel musste grinsen, was angesichts seines Schlangengebisses gemeinhin als furcht Einflößend empfunden wurde. Die Stimme gehörte seiner neuen Begleiterin Mia, einer jungen Menschenfrau, auf die er vor einigen Tagen in der Stadt Berlin gestoßen war. Obwohl die meisten seiner Leute Chetzkel achteten und bedingungslos hinter ihm standen, waren sie von seiner jüngsten Trophäe nicht sehr begeistert.
Als er sie erstmals mit in die Zentrale gebracht hatte, damit sie die spektakuläre Bergung der IGITA an seiner Seite verfolgen konnte, war ihr daher eine Atmosphäre der Ablehnung entgegengeschlagen. Dass sie es nun auch noch wagte, sich in die Operation einzumischen, brachte den Fusionsreaktor metaphorisch gesprochen in die kritische Zone.
Der Reekha drehte sich zu der Sprecherin um. »Tatsächlich, Mia? Dann heraus damit! Ich bin gespannt, welche Methode dir vorschwebt, die all meine Leute nicht bedacht haben.«
Mia duckte sich unter seinem grimmig belustigten Tonfall. Wie es schien, merkte sie erst jetzt, was für eine Dreistigkeit sie sich als Zivilistin an Bord eines Kriegsschiffs herausgenommen hatte – und plötzlich hatte sie Angst vor der eigenen Courage.
Aber die Katze würde sich behaupten. Mia, die ihren schlanken Körper nach dem Vorbild einer Raubtierart ihrer Heimat modellierte – augmentieren nannte sie das –, mochte rasch verängstigt sein. Ebenso rasch allerdings erwachten ihr Trotz und der Wille, sich zu behaupten. So viel hatte er, obwohl sie einander erst seit Kurzem kannten, bereits bemerkt.
Im Grunde hatte ihn zunächst nur ihr Körper gereizt. Die Dreiundzwanzigjährige ähnelte kaum noch einem Menschen. Ihre ursprünglich rosig glatte Haut zierte die nahezu lückenlose Ganzkörpertätowierung einer Fellzeichnung. Den Haaransatz hatte sie spitz nach vorne ziehen lassen, Tasthaare zierten ihr Gesicht, und auf den Fingernägeln saßen Krallenaufsätze.
Letztere stellten ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, und Chetzkel hatte darüber nachgedacht, sie ihr abnehmen zu lassen. Andererseits gefiel es ihm, eine potenziell gefährliche Frau an seiner Seite zu haben – eine, die ihn wahrscheinlich gehasst hätte, wenn ihr klar gewesen wäre, dass der Reekha ihren Begleiter Paul, einen fehlgeleiteten Terra-Police-Anwärter, kaltblütig ermordet hatte.
Glücklicherweise kannte sie die Wahrheit nicht. Sie glaubte, Chetzkel habe Paul aus Notwehr erschießen müssen, weil dieser ihn angegriffen hatte. Mia selbst hatte zu dem Zeitpunkt, als Chetzkel sie mit einem der Ausbilder der Terra Police namens Nahor in einem Lagerhaus fand, gerade in einer mobilen OP-Einheit gelegen. Offensichtlich hatte ihr Begleiter heimlich Mias Augen augmentieren wollen. Sie war blind gewesen und hatte unter Medikamenteneinfluss gestanden, als es zum Kampf zwischen Chetzkel, Nahor, Paul und dem Mutanten John Marshall gekommen war.
Marshall, der Chetzkels eigentliches Ziel gewesen war, hatte Dank des Einsatzes seiner Paragabe fliehen können. Paul war zu Tode gekommen. Mia aber, das hilflose Kätzchen in der OP-Einheit, hatte der Reekha aus einer spontanen Laune heraus mitgenommen.
Offiziell galt Fraternisierung mit den Unterworfenen als verpönt. Ein ungewöhnliches Phänomen war sie allerdings nicht. Zahlreiche Menschen suchten die Nähe der mächtigen Arkoniden, und diese genossen die Bewunderung der Einheimischen. Außerdem sah die Katze Mia ohnehin kaum noch wie ein Mensch aus – womit sie Chetzkel glich, der Dank seiner Schlangenhaut, der gespaltenen Zunge und den Fangzähnen auch nur noch wenig Ähnlichkeit mit einem Arkoniden hatte.
Vielleicht war der Umstand, dass ihr Erscheinungsbild sie beide zu Außenseitern machte, der wahre Grund dafür gewesen, warum er Mia haben wollte. Noch zierte sie sich, trauerte wohl ihrem lächerlichen, plumpen Menschengefährten nach. Aber Chetzkel würde sie schon bald von seinen Qualitäten überzeugt haben, dessen war er sich sicher. Alles, was sie brauchte, war eine starke Hand. Und die konnte er ihr bieten.
»Nun?«, hakte er nach, als Mia ihn kleinlaut anblickte. »Du hattest eine Idee. Dann lass uns daran teilhaben. Immerhin habe ich nach Lösungsansätzen gefragt.«
»Ich habe mal einen Film gesehen, in einem Programmkino in Berlin ...«, begann Mia zögernd.
Chetzkel hatte keine Ahnung, wovon sie redete, aber er gab ihr ein wenig Zeit, sich zu erklären.
»Der Film hieß Hebt die Titanic oder so«, fuhr sie fort. »War ziemlich schlecht. Eigentlich hat er mich auch gar nicht interessiert. Paul ...« Sie stockte kurz. »Also, Paul wollte den Film sehen. Er stand eine Zeit lang auf so Retro-Zeug. Frag mich nicht, warum.« Sie blinzelte mehrfach. Ihre Stimme hatte einen leicht gepressten Tonfall angenommen.
»Zur Sache, Kätzchen!«, forderte Chetzkel sie auf. Dass Mia mitten in seiner Zentrale zu trauern anfing, konnte er nicht gebrauchen. Glücklicherweise würden die meisten Mitglieder seiner Mannschaft den Umstand, dass ihre Augen feucht wurden, als Aufregung missverstehen.
Die junge Frau fuhr sich mit dem Handrücken übers Gesicht. »Ja, sofort. Also in dem Film wollen diese Typen ein riesiges Schiff bergen, das im Ozean versunken ist. Es ist viel zu groß und zu schwer, um es mit Kränen hinaufzuziehen. Also fahren sie mit U-Booten in die Tiefe und befestigen so viele Schwimmkörper an dem Schiff, bis es von selbst auftaucht.«
»Schwimmkörper?«, wiederholte Barrkin da Ariga verwirrt.
»So mit Gas befüllte Ballons, die leichter sind als Wasser«, erklärte Mia.
»Reekha, der Gedanke ist gar nicht so dumm«, meldete sich Jakkat zu Wort, ein kräftiger Mehandor, der die Maschinen der AGEDEN im Blick behielt. »Wir haben Ersatz-Antigravprojektoren im Lager, die wir mit mobilen Reparaturplattformen hinunter zur IGITA bringen könnten. Wenn wir drei oder vier davon an dem Schweren Kreuzer befestigen und sie aus den Reaktoren der Plattformen mit Energie speisen, sollte es möglich sein, das Schiff damit bis zur Wasseroberfläche zu heben. Danach können die Traktorstrahlen der AGEDEN übernehmen.«
»Die IGITA liegt fast siebentausend Meter tief im Ozean«, gab da Ariga zu bedenken. »Halten unsere MoReps diesem Druck stand?«
»Die Positronik soll das berechnen«, befahl Chetzkel.
»Die Druckbelastung für mobile Reparaturplattformen ist unbedenklich«, verkündete der Bordrechner der AGEDEN.
»Wenn wir Antigravprojektoren an der IGITA befestigen, könnten wir sie dann nicht auch bis zu dem Kryovulkan schleppen, durch den die beiden menschlichen Expeditionen ins Mondinnere vorgedrungen sind?«, warf Mertal ein. »Das würde es uns ersparen, einen Schacht zu bohren.«
Chetzkel hatte allen an dieser Operation beteiligten Offizieren die Informationen zur Verfügung gestellt, die er in den irdischen Datennetzen gefunden hatte. Dazu hatten auch sehr eigenwillige Berichte von zwei Forschungsgruppen gehört, die anscheinend zur IGITA vorgedrungen waren. Eigenwillig waren die Informationen deshalb, weil die eine Forschungsgruppe offenbar aus drei Jugendlichen, die andere aus einem Arzt, einem Historiker und einem unbekannten Fremdwesen mit dem lachhaften Namen Gucky bestanden hatte. Dazu kam, dass einige Angaben – etwa diesen Kryovulkan betreffend – sehr widersprüchlich gewesen waren. Chetzkel war nahe dran gewesen, beide Berichte als nicht sehr gut erfundene Unterhaltungsgeschichten abzutun. Dann aber hatte er sich entschieden, ihnen nachzugehen. Da sie ihn wirklich zu dem Wrack des Schweren Kreuzers geführt hatten, musste zumindest ein Funken Wahrheit in ihnen stecken.
»Existiert der Vulkan noch, Arona?«, fragte Chetzkel die Arkonidin an der Ortungsstation.
»Ja, die in den Expeditionsberichten erwähnte Formation gibt es noch, Reekha«, erwidert diese, nachdem sie ihre Instrumente befragt hatte. »Der Vulkan ist teilweise überfroren, aber er ließe sich vergleichsweise leicht freilegen und erweitern.«
»Eine unterseeische Schleppoperation des Schweren Kreuzers IGITA von ihrem Absturzort bis zu dem Kryovulkan wird nicht empfohlen«, wandte die Positronik ein. »Die Distanz beträgt 586 Kilometer. Bei einem angemessenen Zustand des Schiffs berechne ich eine Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent, dass der Rumpf unter der Belastung zerbrechen wird.«
Mit einem Nicken nahm Chetzkel die Warnung zur Kenntnis. »Dann bleiben wir beim ursprünglichen Plan. Wir sinken auf eintausend Meter in der Atmosphäre ab und bohren uns mit den Desintegratoren durch den Eismantel. Gleichzeitig schicken wir MoReps in die Tiefe und befestigen Antigravprojektoren an der IGITA. Die Antigraveinheiten sollen den Kreuzer bis zur Wasseroberfläche heben, danach übernehmen wir mit den Traktorstrahlen. Außerdem schleusen wir, nachdem wir den Schacht gebohrt haben, fünf Leka-Disken aus. Diese sollen in den Schacht fliegen und in fünf Teilabschnitten die Stabilität kontrollieren. Noch Fragen?«
Niemand meldete sich.
»Dann los!«
Die Operation dauerte mehrere Stunden, und obwohl sie einen soliden Plan hatten, erwies sie sich als technische Herausforderung.
Zum einen waren die Bordgeschütze der AGEDEN nicht dafür gemacht, kilometerlange Tunnel zu bohren. Es bedurfte einiges an Anpassung und Feingefühl, um bei dem Vorstoß in den Tiefozean nicht den halben Mond zu verwüsten.
Zum anderen stellte sich heraus, dass der Kreuzer in einem wirklich schlechtem Zustand war. Es fiel den Bergungsmannschaften der mobilen Reparaturplattformen schwer, Stellen zu finden, an denen ein Anbringen der Antigraveinheiten möglich war. Immerhin mussten diese Sektionen stabil genug sein, das Gewicht des kompletten Schiffs gegen den vorherrschenden Wasserdruck in die Höhe zu stemmen.
Doch schließlich war es so weit.
»Die MoRep-Kommandanten melden, dass die IGITA bereit ist«, verkündete die Funkerin Evshra Schantool, eine Frau, deren Disziplinarvermerksliste ungefähr so lang war wie ihr silbernes Haar.
»Sehr gut«, sagte Chetzkel. »Jakkat?«
»Der Schacht ist weiterhin stabil«, beantwortete der Mehandor die unausgesprochene Frage.
Chetzkel straffte sich. Ein großer Moment stand ihnen bevor.
»Dann hebt die IGITA!«, befahl er.
Funksprüche füllten umgehend die Zentrale, Meldungen der verschiedenen Kommandanten, deren Reparaturplattformen unter Wasser am Schweren Kreuzer arbeiteten. Gleichzeitig tauchten Bilder der Schiffskameras im großen Holo in der Mitte der Zentrale auf.
Sie zeigten den Zweihundertmeterkoloss, der im trüben, eiskalten Wasser des Tiefozeans auf einer unebenen Schicht Hochdruckeis ruhte. Lichtfinger scharf gebündelter Scheinwerfer strichen über den pockennarbigen, von Kampfspuren gezeichneten Rumpf, an dem vier große, glänzende Kästen angebracht worden waren, in denen die Antigraveinheiten steckten.
Unter der IGITA begann das Wasser zu wabern. Ein dumpfes, metallenes Stöhnen, das von den Außenmikrofonen der MoReps aufgefangen wurde, drang an Chetzkels Ohren. Teile des Rumpfs rissen auf und ließen den Reekha fürchten, die Mission könne fehlschlagen.
Doch dann setzte sich das Wrack behäbig in Bewegung. Meter für Meter wurde es von den Antigraveinheiten, die von den MoReps mit Energie versorgt wurden, in die Höhe getragen, der Wasseroberfläche entgegen.
»Sechstausend Tiefenmeter«, meldete Arona an der Ortungsstation.
»Aufstieg stabil«, fügte Jakkat hinzu.
»Zehntausend Jahre lag dieses Schiff unter dem Eis«, murmelte da Ariga. »Unglaublich.«
Aus den Augenwinkeln sah Chetzkel, dass auch Mia von den Ereignissen, die sich im Holo abspielten, in den Bann geschlagen worden war. Jede Scheu vergessend, war sie direkt neben ihn getreten. Ihre Tasthaare zitterten leicht, während sie mit großen Augen auf das Wrack und die kleinen Reparaturplattformen starrte, die es umschwirrten wie Pladok-Fische einen riesigen Balagauron.
»Beeindruckend, nicht wahr?«, sagte er leise.
»Ja«, pflichtete sie ihm andächtig bei. Einen Moment lang schien die Last der vergangenen Tage, der Tod ihres Gefährten und die Entführung durch Chetzkel vergessen zu sein. Der Reekha glaubte vielmehr, so etwas wie Verstehen in ihren Katzenaugen zu erkennen. Mia schien zu begreifen, dass er ihr einen Gefallen getan hatte, als er sie aus ihrem bedeutungslosen Leben geholt hatte. An der Seite des Arkoniden stand ihr das ganze Universum offen! Eine Verlockung, der eine neugierige Katze wie sie niemals würde widerstehen können.
Seite an Seite sahen und hörten sie, wie die IGITA im Tiefozean von Titan aufstieg. Meldungen gingen hin und her. Antigravparameter wurden nachjustiert, der Aufstiegsschacht durchs Eis immer wieder von den Thermostrahlern der Leka-Disken geglättet.
»Fünfhundert Meter bis zur Wasseroberfläche«, sagte Arona. »Verstärkte Strömungen in diesem Bereich.«
»Befehlen Sie den beiden unteren Leka-Disken im Schacht, hinunterzufliegen und die IGITA mit ihren Schutzschirmen zu stabilisieren!«, befahl Chetzkel. »Traktorstrahlkontrolle: bereithalten!«
»Traktorstrahlprojektoren einsatzbereit«, antwortete Barrkin da Ariga. Seine Finger glitten über die Holofelder vor ihm. »Höchstmögliche Fokussierung.«
»Schantool, schicken Sie die Leka-Disken aus dem Schacht, damit sie die Erfassung nicht stören«, wandte sich Chetzkel an seine Funkerin.
»Ja, Reekha«, bestätigte diese und befahl allen Raumfahrzeugen der AGEDEN die sofortige Rückkehr zum Mutterschiff.
»Schacht geräumt«, verkündete sie wenig später.
»Die IGITA taucht auf«, meldete Arona.
»Traktorstrahl!«, rief Chetzkel.
Da Ariga gab die entsprechenden Befehle in seine Konsole ein. »Hab sie.«
Im Holo war zu sehen, wie ein kurzer Ruck durch die IGITA verlief. Einige Außenaufbauten brachen ab und versanken im Meer. Gleichzeitig jedoch erhob sich der Zweihundertmeterkreuzer aus seinem eisigen Grab und stieg den langen Schacht hinauf, den Chetzkels Leute für ihn gebohrt hatten. Ströme von Wasser rannen an dem metallenen Rumpf herab.
Es war ein Moment von erhabener Schönheit, selbst für jemanden wie Chetzkel, der schon Hunderte von Raumschiffen in jedwedem erdenklichen Zustand gesehen hatte. Doch ein zehntausend Jahre altes Wrack aus einem Tiefozean unter dem Eispanzer eines fernen Mondes zu bergen – das gehörte selbst für ihn nicht zum Alltag.
»Welche Geheimnisse es wohl birgt?«, fragte Mia an seiner Seite, als hätte sie seine Gedanken gelesen.
»Wir werden es bald erfahren«, antwortete Chetzkel mit zufriedenem Lächeln. Oh, ja, fügte er in Gedanken hinzu,
2.
Auf der Flucht
25. November 2037, Ras Tschubai
LÄRM! DONNERN, KRACHEN, HEULEN, PFEIFEN, DRÖHNEN! EINE ALLES ZERSCHMETTERNDE, SINNE BETÄUBENDE, WAHNSINNIG MACHENDE KAKOPHONIE! ÜBERALL! EINFACH ÜBERALL!
Ras Tschubai hockte auf dem heruntergeklappten Deckel der Flughafentoilette und krümmte sich vor Schmerzen. Die etwa ein mal zwei Meter messende Kabine, die zu einer sanitären Einrichtung des provisorischen neuen Terrania-Airport gehörte, hatte nur dünne Pressholzwände. Sie dämpften das allgegenwärtige Getöse ebenso wenig wie seine kräftigen Hände, mit denen Tschubai sich die Ohren zuhielt.
Wäre der Krach auf das laute Plätschern des Urinstrahls drei Kabinen weiter, das Lachen der zwei Männer im Vorraum und das Rauschen des Handtrockners beschränkt gewesen, hätte Tschubai ihn vielleicht ertragen können.
Doch er hörte noch mehr, unendlich viel mehr. Er vernahm die Lautsprecheransagen überall im Transitbereich, die den Reisenden ihre Flüge zuwiesen. Er hörte die Stampede Hunderter Füße, die den indoktrinierten Massen gehörten – Polizisten, Politikern und Verwaltungsbeamten –, die Woche für Woche nach Terrania einflogen, um sich im Stardust Tower und dem neu errichteten Gouverneurspalast auf die neue Linie der arkonidischen Herrscher einschwören zu lassen. Dazu gesellten sich das Surren der Räder ihrer Rollkoffer, die gerufenen Befehle arkonidischer Ordner und das Durcheinander zahlloser Stimmen, die sich in gleichem Maße über Belangloses wie Pikantes, Alltägliches und Privates unterhielten.
»... Wusstest du, dass Carlos seine Frau betrügt? Er hat sie mit der englischen Schlampe aus ...«
»... finde, wir sollten diese neuen Konzepte zur effektiveren Informationsbündelung, die uns der Fürsorger vorgestellt hat, sofort umsetzen ...«
»... hat die Terra Police Schneider und Bergström festgenommenen und ...«
»... Ich hoffe, die haben nicht vor, diese Veranstaltungen regelmäßig zu wiederholen, sonst ...«
»... Ihren Ausweis, bitte ...«
Im Hintergrund dröhnten und rauschten die Triebwerke der wartenden Maschinen an den Gates, deren Lärm anschwoll, wenn sie sich in Bewegung setzten, zur Startbahn hinüberrollten und sich dort mit brüllenden Turbinen in den kalten, klaren Novemberhimmel über der Wüste Gobi erhoben. Und noch weiter entfernt grollte ein Heer von Baumaschinen, das die Trümmer des völlig zerstörten Terranias beseitigte und den Neuaufbau betrieb, Arbeiter schrien durcheinander, Roboter marschierten mit stampfenden Schritten durch die Straßen, Gleiter schwirrten durch die Luft.
Das alles vermengte sich in Ras Tschubais Ohren zu einem gewaltigen Rauschen, als stünde er direkt unter einem Wasserfall oder eher noch neben einer startenden Flüssigtreibstoffrakete. Es war kaum auszuhalten.
Und es gab nichts, was Tschubai dagegen tun konnte. Ohrstöpsel, um den Kopf gebundene Kissen, Wachspfropfen – nichts verschaffte ihm nennenswerte Linderung, wenn er diese Anfälle hatte.
Die einzige wirksame Möglichkeit war, sich mit einer guten Dosis Schlaftabletten ins Reich der Träume zu schicken. Dort herrschte zuverlässig Stille. Aber Tschubai hatte keine Tabletten bei sich, und der provisorische, neue Flughafen von Terrania, den die Arkoniden direkt am Rand der Trümmerwüste hochgezogen hatten, bot noch keinerlei Annehmlichkeiten wie Duty-Free-Shops oder eine Apotheke.
Der einzige Lichtblick in seinem gegenwärtigen Zustand war, dass der Anfall vorübergehen würde. Die Lärmfolter, der er seit einigen Monaten ausgesetzt war, dauerte für gewöhnlich nicht lange an; einige Minuten lang wurde er mit allen Geräuschen bombardiert, die vom winzigsten Insekt bis zum größten Kugelraumer im Umkreis von etwa fünf Kilometern erzeugt wurden. Und entweder verlor er dabei irgendwann das Bewusstsein, weil sein überforderter Geist es nicht länger aushielt, oder sein Gehör setzte einfach aus, um sich im Laufe einiger weiterer Minuten langsam wieder zu regenerieren.
Und das alles nur wegen dieses verdammten Virus!
Im Frühjahr hatte ein Virus die irdischen Mutanten attackiert, eingeschleppt über den unwissentlich infizierten Naat Sayoaard. Das Virus, das von Sergh da Teffron, der »rechten Hand« des damaligen arkonidischen Regenten, eingesetzt worden war, hatte gezielt die Junk-DNS der Mutanten angegriffen und manipuliert. Mit verheerenden Folgen: Die Paragaben der Mutanten waren außer Kontrolle geraten. Tausende waren weltweit gestorben – darunter viele Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal von ihrem speziellen Talent geahnt hatten –, und das Lakeside Institute, die Heimat der Mutanten in der Nähe Terranias, war komplett zerstört worden.
Schließlich hatte man ein Anti-Virus herstellen können, doch der Schaden in den Mutanten war nicht wiedergutzumachen gewesen. Ihre Gaben waren versiegt – oder hatten sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Tschubai hatte miterleben müssen, wie ihm seine Fähigkeit zu teleportieren, die er nach all der Übung endlich gemeistert hatte, zunehmend entglitt, bis er gar nicht mehr dazu imstande gewesen war.
Stattdessen war die Welt lauter und lauter geworden, mal schleichend, mal schubweise, bis er buchstäblich alles um sich herum hörte – ein Zustand, der ihn beinahe in den Wahnsinn getrieben hätte.
Vielleicht kommt das ja noch, dachte der hochgewachsene Sudanese düster.
»Terra Police, öffnen Sie die Tür!«, schrie ihn eine Männerstimme an, und Tschubai zuckte zusammen. Während er sich nach wie vor die Ohren zuhielt, beugte er sich ungelenk nach vorne und schielte unter der Kabinentür hindurch. Dabei verrutschte seine falsche Brille, die er ebenso zur Tarnung trug wie den Bart, den er sich seit drei Wochen wachsen ließ.
Kein Mensch war zu sehen, und er begriff, dass der Sprecher sich irgendwo anders im Flughafen, vielleicht sogar an einem Ort in den Straßen von Terrania aufhielt.
Erleichtert richtete er sich wieder auf und schob die Brille den Nasenrücken hoch. Sein Herz hämmerte wie wild in seiner Brust, seit der jüngste Anfall begonnen hatte. Das Getöse, das ihn umspülte, trieb seinen Pulsschlag in die Höhe und sorgte dafür, dass ihm der Schweiß ausbrach. Es war wie ein grausamer Drogentrip, und mehr als einmal hatte Tschubai sich gefragt, ob dieser Lärm ihn womöglich umbringen konnte.
Ein gewaltiges Rauschen tilgte einen Großteil der Stimmen um ihn herum. Entweder hatte direkt neben ihm jemand die Toilettenspülung betätigt, oder auf der Startbahn des Flughafens war eine besonders große Maschine abgehoben. Die Arkoniden unter Fürsorger Satrak, dem Gouverneur des Imperiums, fertigten ihre neuen Diener wie am Fließband ab. Da brauchte es große Transportkapazitäten, um die menschlichen Helfershelfer in alle vier Himmelsrichtungen nach Hause zu fliegen.
Tschubai war keiner von ihnen. Genau genommen befand er sich auf der Flucht, und er nutzte die strömenden Massen willfähriger Menschen aus aller Herren Länder, um aus Terrania zu verschwinden, wo der Boden für ihn zu heiß geworden war.