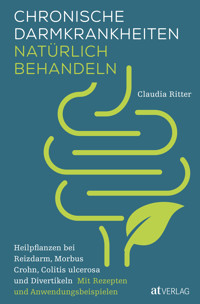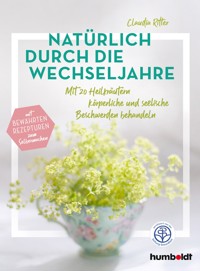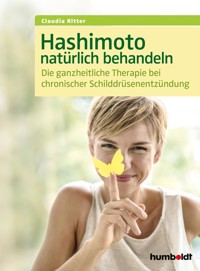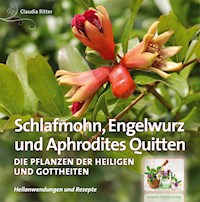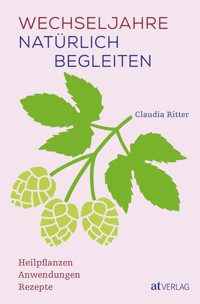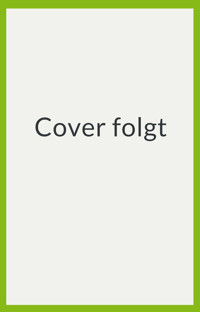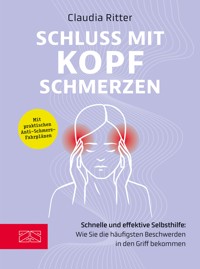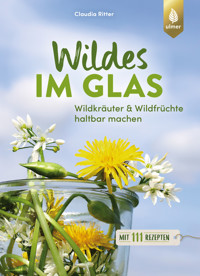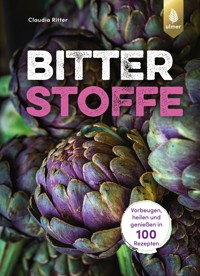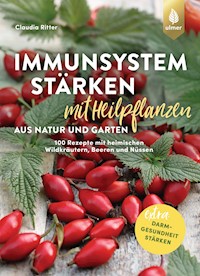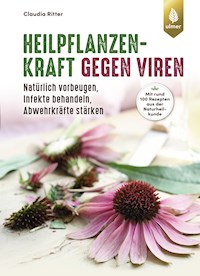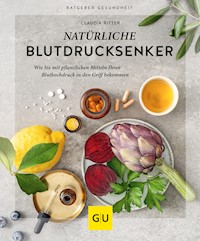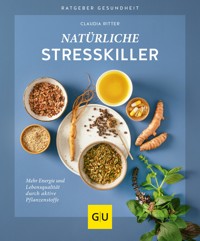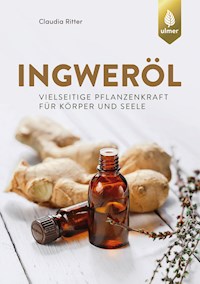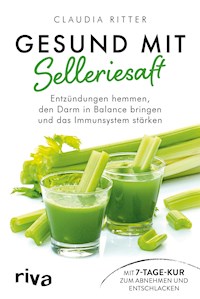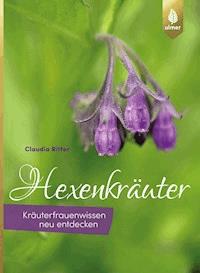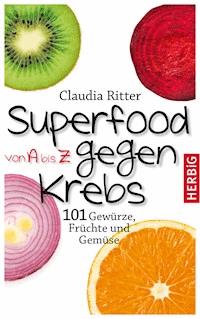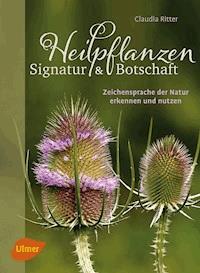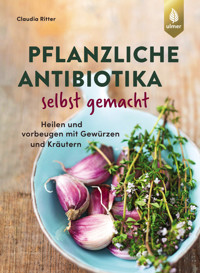
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Immer wieder führen konventionelle Antibiotika zu Resistenzen oder Unverträglichkeiten. Häufig können Sie die Behandlung vermeiden und beginnende Krankheiten mit pflanzlichen Antibiotika behandeln. Die wirksamen Kräuter und Gewürze werden meist ohne Nebenwirkungen vertragen und stärken durch ihre Vitalstoffe das Immunsystem. Die Heilpraktikerin Claudia Ritter erläutert, wann der Einsatz pflanzlicher Antibiotika sinnvoll ist, erklärt deren Wirkungsweise, Möglichkeiten und Grenzen und liefert eine Fülle an Heilrezepten. Darüber hinaus gibt die Autorin Hinweise und Virus- und Pilzerkrankungen. 45 Porträts der wichtigsten antibiotisch wirkenden Gewürze und Kräuter machen das Buch zu einem Fundus für die Hausapotheke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Claudia Ritter
PFLANZLICHE ANTIBIOTIKA
selbst gemacht
Heilen und vorbeugen mit Gewürzen und Kräutern
Inhalt
Konventionelle und pflanzliche Antibiotika
Antibiotika in der Medizin
Pflanzliche Antibiotika
Konventionelle Therapie oder Eigenbehandlung?
Die wichtigsten Inhaltsstoffe
Qualität ist das A und O
Antibiotika aus Gewürzen herstellen
Die wichtigsten Erreger im Überblick
Beschwerden mit Pflanzen behandeln
INDIKATIONEN UND REZEPTE
Bronchitis
Candida-Infektion
Durchfall
Furunkel und Abszesse
Fußpilz
Grippaler Infekt und Influenza
Harnwegsinfekte
Herpes-Entzündungen
Husten
Lungenentzündung
Magenschleimhaut-Entzündung
Mandelentzündung
Mittelohrentzündung
Nasennebenhöhlen-Entzündung
Schnupfen
Zahnschmerzen und Mundgeruch
VORBEUGEN
Schutz vor Hepatitis
Schutz vor Reisedurchfall und Lebensmittelvergiftungen
Schutz vor widerstandsfähigen (multiresistenten) Keimen
Kurzporträts der Gewürze und Kräuter
SERVICE
Literatur
Die Zeit ist reif
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
als Heilpraktikerin ein Buch zum Thema pflanzliche Antibiotika zu schreiben, wäre vor mehreren Jahrzehnten noch undenkbar gewesen. Aber vieles ist im Moment im Wandel und die Zeit ist reif für dieses Buch. Sie gehören vermutlich zur Patientengruppe, die nicht bei jedem Infekt den Körper mit handelsüblichen Antibiotika belasten möchte. Eine sinnvolle Alternative bieten pflanzliche Antibiotika. Sie sind wirksam und sanft, belasten den Organismus weit weniger und zudem sind Resistenzen unbekannt. Verdrängen werden pflanzliche Antibiotika die herkömmlichen Arzneimittel nicht. Bei schweren Infektionen sind konventionelle Medikamente nach wie vor unverzichtbar. Bei leichteren Erkrankungen sind aber die pflanzlichen Helfer für mich das Mittel der Wahl. Zudem stärkt der regelmäßige Verzehr aller hier vorgestellten Gewürze das Immunsystem, so dass viele Krankheiten erst gar nicht entstehen. Für mich ist Prävention ohnehin die intelligenteste Art der „Therapie“, aber natürlich lässt sich nicht jede Erkrankung verhindern. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie antibiotisch wirksame Kräuter und Würzkräuter verwenden können. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zubereiten und vor allem viel Erfolg.
Konventionelle und pflanzliche Antibiotika
Antibiotika in der Medizin
Wenn sich der Körper gegen eindringende Keime nicht mehr selbst wehren kann, sind Antibiotika das Mittel der Wahl. Es stellt sich jedoch die Frage, ob jede Infektion mit herkömmlichen Mitteln behandelt werden muss. Gibt es nicht auch pflanzliche Alternativen?
HERKÖMMLICHE ANTIBIOTIKA
Antibiotika sind Medikamente, die Bakterien abtöten oder deren Wachstum aufhalten. Durch einen Zufall entdeckte ein Forscher das Penicillin – ein Antibiotikum, das als Wunderwaffe gegen Bakterienerkrankungen eingesetzt werden konnte. Doch entwickelten viele Bakterienstämme in der Folge Resistenzen und die antibiotischen Medikamente verloren viel von ihrer einstigen Wirkung.
Die Entdeckung des Penicillins
Ende der 1920er Jahre entdeckte der schottische Bakteriologe Alexander Fleming bei einem Experiment durch einen Zufall Schimmelpilze der Gattung Penicillium, die sich auf einer Agarplatte angesiedelt hatten, auf der er Staphylokokken-Kulturen gezüchtet hatte. In der Umgebung des Pilzes wuchsen keine Bakterien mehr und Fleming deutete richtig, dass er eine antibakteriell wirkende Substanz gefunden hatte.
Eine medizinische Revolution
Was im nächsten Jahrzehnt an Entwicklung folgte, kann man getrost als medizinische Revolution bezeichnen. Der Krieg gegen die Bakterien hatte begonnen. Ab den 1940er Jahren galten Penicillin und die Folgemittel als Wunderwaffe gegen alle Infektionskrankheiten. Man behandelte erfolgreich die Syphilis, stark infizierte Kriegsverletzungen, Lungenentzündungen, Hirnhautentzündungen und viele andere, bisher tödlich verlaufende Erkrankungen. Weil sie zunächst sicher und bequem anzuwenden waren, verordnete man sie vor allem seit den 1960er Jahren auch gegen harmlose Infekte und bisweilen auch bei viralen Erkrankungen (gegen die sie definitiv nichts nützen).
Bakterien sind „intelligent“
Doch die Bakterien wehrten sich gegen die neuen Medikamente. Bakterien gibt es seit etwa 3 Milliarden Jahren auf der Erde und es wird sie vermutlich auch noch geben, wenn keine Menschen die Erde mehr besiedeln. Wie viele Arten es gibt, weiß niemand so genau. Im Design sind sie eher langweilig – es gibt nur Kugeln, Stäbchen und schraubenförmige. Sie sind überall zu finden und nur ein kleiner Teil verursacht Krankheiten. Das Milieu, auf das sie treffen, das heißt die biologische Umgebung, ist von enormer Wichtigkeit: Bei einem gut funktionierenden Immunsystem können nur noch stark ansteckende Keime Krankheiten verursachen.
Unter günstigen Voraussetzungen können sich Bakterien alle 20 bis 40 Minuten teilen, das heißt neue „Kinder“ produzieren, die sich den veränderten Lebensbedingungen anpassen können. Im Vergleich dazu braucht der Mensch etwa 40 Wochen, um neue Nachkommen zu gebären – unser Anpassungspotienzial ist also viel geringer. In dieser Hinsicht sind uns die winzigen Einzeller meilenweit voraus und das zeigen sie uns auch, indem sie in immer kürzeren Abständen sogenannte Resistenzen gegen die einstigen Wunderwaffen bilden. Die Angst vor dem „superbug“ – das heißt vor dem Zeitpunkt, ab wann Antibiotika gegen keinen Erreger mehr wirksam sind, ist begründet. Es stellt sich also die Frage nach Alternativen.
Penicillinpilz, der in Petrischalen heranwächst.
Pflanzliche Antibiotika
Streng genommen gibt es keine „pflanzlichen Antibiotika“. Aber es gibt jede Menge Pflanzen, die Substanzen mit antibiotischer Wirkung haben. Wie die Mittel aus der Apotheke können sie die Vermehrung der Keime hemmen beziehungsweise sie ganz abtöten.
Antibiotisch wirksame Stoffe aus Pflanzen haben einen großen Vorteil: Sie sind nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren, Pilze oder Parasiten effizient.
„Grüne“ Antibiotika in der Antike
Wenngleich Bakterien oder Viren in der Menschheitsgeschichte lange Zeit unbekannt waren, werden seit Jahrtausenden antimikrobiell wirksame Arzneipflanzen in allen Kulturen der Welt verwendet. Vom Alten Ägypten über die Antike und das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert bedienten sich Mediziner oder Kräuterkundige aus dem Heilschatz der Natur – natürlich regional ganz unterschiedlich. Zwiebeln und Knoblauch waren bei uns ein günstiges und effektives Heilmittel bei Infektionen, in Amerika war die scharfe Chilischote der Bakterienkiller schlechthin und in den warmen tropischen und subtropischen Ländern beobachteten die Menschen beispielsweise, dass durch die Zugabe von Gewürzen wie Pfeffer Lebensmittel länger haltbar sind. So schützte man sich vor Lebensmittelvergiftungen und dem Ausbreiten von Seuchen und Epidemien.
Pflanzenstoffe wirken antimikrobiell
Es gibt eine Vielzahl von Pflanzen, die antibiotische oder besser gesagt antimikrobielle Stoffe bilden – denn sie wirken im Gegensatz zu den konventionellen Mitteln in der Regel nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren, Pilze und/ oder Parasiten. Die Pflanzen bilden diese Stoffe, um sich vor Fressfeinden oder Schädlingen zu schützen.
In diesem Buch habe ich mich lediglich auf Kräuter und Gewürze konzentriert, es gibt aber noch weitere pflanzliche Vertreter mit diesen Eigenschaften. Anders als die chemisch hergestellten Medikamente wirken diese komplexen Heilmittel deshalb vorteilhaft auf den ganzen Körper, weil sie nicht nur ihr antibiotisches Potenzial entfalten, sondern aufgrund der Vielzahl an bioaktiven Substanzen (dazu zählen Mineralien, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe) auch zur Steigerung der Abwehrleistung des Körpers beitragen.
Keine Resistenzen bei Pflanzen
Bisher ist es den Schädlingen nicht gelungen, Resistenzen gegen die pflanzliche Medizin zu bilden. Der Grund dafür ist, dass Pflanzen Vielstoffgemische sind. Gegen so ein komplexes Gemisch mit seinen vielen Komponenten anzugehen und dagegen immun zu werden, ist für Mikroorganismen ungleich schwieriger als gegen einen einzelnen Stoff resistent zu werden. So stark wie die chemisch beziehungsweise halbchemisch hergestellten Präparate wirken die pflanzlichen antimikrobiellen Stoffe allerdings nicht, weshalb ihre Domäne leichtere Erkrankungen, die Prävention, Begleittherapie und Nachbehandlung ist.
Knoblauchanbau in alten Zeiten – Knoblauch wurde bei uns schon früh als antibiotisch wirkende Heilpflanze verwendet.
Konventionelle Therapie oder Eigenbehandlung?
Werden herkömmliche Antibiotika sinnvoll und gezielt bei schweren Infektionen verwendet, können sie nach wie vor Menschenleben retten oder Spätschäden vermeiden. Doch nicht jede konventionelle Antibiotikatherapie ist sinnvoll.
WAS SIND ANTIBIOTIKA?
Antibakterielle Medikamente – sogenannte Antibiotika – sind seit Anfang der 1940er Jahre serienmäßig auf dem Markt. Dabei handelt es sich um Substanzen, die das Wachstum von Bakterien (jedoch nicht von Viren) hemmen oder sie abtöten. Sie revolutionierten die Behandlungsmöglichkeiten bei bakteriellen Infektionen und haben sicher einer unzählig großen Zahl an Menschen das Leben gerettet.
Heute sind fast 20 unterschiedlich wirkende Antibiotikaklassen auf dem Markt, darunter Penicilline, Cephalosporine, Sulfonamide, Tetrazykline, Makrolide, Carbapeneme oder Ketolide. Dabei handelt es sich entweder um Natur-Antibiotika, chemisch veränderte Natur-Antibiotika oder um chemisch hergestellte Antibiotika.
Antibiotika, die das Wachstum und die Vermehrung anderer Mikroorganismen hemmen, nennt man Bakteriostatika. Antibiotische Mittel, die Mikroorganismen abtöten können, heißen Bakterizide. Dazu gehören auch die allseits bekannten Penicilline.
Wie wirken sie?
Das Wirkspektrum der Antibiotika besteht beispielsweise darin, Bakterien an der Bildung von Eiweiß und damit an der Vermehrung zu hindern oder sie abzutöten. Andere bewirken, dass Bakterien ihr Erbmaterial nicht mehr kopieren können, wieder andere verhindern den Aufbau der bakteriellen Zellwände oder zerstören ihre Zellmembran.
CHANCEN UND GRENZEN DER KONVENTIONELLEN THERAPIE
Weil Antibiotika zunächst sehr gut wirkten und scheinbar sicher und bequem einzunehmen waren, wurden sie häufig für alle Arten von Infekten verschrieben, angefangen von harmlosen bis hin zu schweren Infektionskrankheiten. Heute stehen sie zunehmend in der Kritik, weil ihr häufiger Gebrauch Nebenwirkungen wie beispielsweise Störungen der Darmflora mit weichen Stühlen oder Durchfall verursacht, und es vermehrt zu Hefepilzinfektionen oder Allergien kommt. Die Medikamente bringen das biologische Gleichgewicht durcheinander, weil sie nicht nur krankmachende Bakterien, sondern auch nützliche und immunstabilisierende Bakterien der Darm- oder Scheidenflora beeinträchtigen. Zudem wird beobachtet, dass vermehrte Antibiotikaeinsätze die Rezidivhäufigkeit, das heißt das Wiederauftreten einer Krankheit, erhöhen.
Viel besorgniserregender ist jedoch die ansteigende Unempfindlichkeit (= Resistenz) der krankmachenden Bakterien. Bakterien entwickeln ständig neue Abwehrmechanismen gegen die pharmazeutischen Antibiotika. Vor allem die in den Krankenhäusern vorkommenden Erreger (= nosokomiale Erreger) verändern sich mit steigender Geschwindigkeit. Einige der antibiotischen Mediamente sind mittlerweile gegen eine Vielzahl Erreger nicht mehr wirksam – man spricht von multiresistenten Erregern und selbst sogenannte Reserveantibiotika bleiben wirkungslos.
Nutzen und Risiken abwägen
Die Antibiotikatherapie wird aus den oben genannten Gründen zunehmend unberechenbarer und schwieriger. Ein sorgsamer Einsatz dieser Arzneimittel ist daher besonders wichtig. Wie bei jeder Medikamenteneinnahme müssen Nutzen und Risiko von Fall zu Fall abgewogen werden, oder anders gesagt: Sie sollten so selten und gezielt wie möglich verwendet werden. Bei schweren bakteriellen Infektionen, wie beispielsweise Lungenentzündungen oder Wundinfektionen mit der Gefahr einer Blutvergiftung, sind konventionelle Antibiotika das Mittel der Wahl und sollten dementsprechend zum Einsatz kommen.
Es ist sinnvoll, zu überlegen, ob eine konventionelle Antibiotikatherapie sein muss.
CHANCEN UND GRENZEN DER EIGENBEHANDLUNG MIT PFLANZEN
Der Verzicht auf konventionelle Medikamente belastet den Körper weniger. Bessern sich aber die Beschwerden nicht, muss eventuell doch ein herkömmliches Mittel eingenommen werden. Wichtig ist zudem, zu wissen, dass auch pflanzliche Mittel falsch angewendet oder dosiert werden können. Vor allem Allergiker und Patienten mit schweren Grunderkrankungen sollten sich vor der Einnahme informieren.
Positive Erfahrungen
Wenn Sie bei einem Infekt statt eines Präparates aus der Apotheke eine selbst zubereitete Arznei verwenden, stärken Sie Ihre gesundheitliche Eigenverantwortung. Bis zu einem gewissen Grad können Sie Ihre Gesundheit mitbestimmen und dafür auch Verantwortung übernehmen. Die positiven Erfahrungen mit solch einer Eigenbehandlung schaffen Selbstvertrauen wie auch ein Vertrauen in die Heilmethode. Zugleich möchte ich aber auch an Ihr Verantwortungsbewusstsein appellieren und gebotene Grenzen klar aufzeigen.
Wägen Sie sorgsam ab, ob pflanzliche Mittel in Ihrer aktuellen Situation das Richtige sind.
Den Arzt konsultieren
Bei unklaren Beschwerden und Symptomen muss ein Arzt oder Heilpraktiker die Ursache klären; für einige ansteckende Krankheiten gibt es spezielle Leitlinien und sie dürfen auch nur von Ärzten behandelt werden. Dies gilt auch, wenn sich nach drei Tagen die Beschwerden nicht bessern oder zurückkehren, Sie heftige Symptome, starke Schmerzen oder hohes Fieber entwickeln, tiefe offene Wunden haben, nach Auslandsaufenthalten plötzlich Beschwerden bekommen oder zu einer besonderen Patientengruppe gehören, wie beispielsweise Senioren, Säuglinge, Schwangere, Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder mit schweren Grunderkrankungen.
Manchmal nicht geeignet
Einige der vorgestellten Rezepte sind oft als begleitende Maßnahme gedacht und beschrieben. Sollten Sie jemals das Gefühl haben, dass eine selbst zubereitete Arznei wirkungslos ist beziehungsweise Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt, setzen Sie das Mittel sofort ab. Sowohl Kräuter und Gewürze als auch daraus hergestellte Arzneimittel können Allergien verursachen.
Möglicherweise haben Sie auch die falsche Pflanzenzubereitung verwendet. Beispielsweise feuern scharfe und heiße Gewürze ein cholerisches Temperament noch mehr an, weshalb sie für diesen Konstitutionstyp ungeeignet sind. Umgekehrt kühlen Pfefferminzzubereitungen den Körper stark, so dass diese nicht zu ständig fröstelnden Menschen passen. Oder das verwendete Pflanzengut war überlagert, zu viel Licht oder Wärme ausgesetzt, so dass es nur noch minderwertige Qualität hatte. Bei einigen Kräutern und Gewürzen gibt es Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Wenn Sie ohnehin schon blutverdünnende Medikamente einnehmen, kann ein regelmäßiger Knoblauchverzehr das Blut so stark verdünnen, dass Wunden stark nachbluten.
Vielleicht sind Pflanzenpräparate auch nicht das Mittel der Wahl. Bei starken Beschwerden oder bei ernsthaften Erkrankungen müssen Sie ohnehin einen Arzt aufsuchen. Detaillierte Hinweise dazu finden Sie im Rezeptteil dieses Buches.
Feurige Chili oder kühle Pfefferminze? Nicht jede Pflanze passt zu jedem Menschen.
Die wichtigsten Inhaltsstoffe
Heute weiß man, dass bestimmte Wirkstoffgruppen für die bakterien-, viren- und pilzhemmende Wirkung verantwortlich sind. Wenngleich diese Stoffe vor allem im Zusammenspiel mit anderen Wirkstoffen erst besonders effektiv sind, sind doch einige von besonderer Bedeutung.
Anis, Fenchel und Kümmel enthalten wertvolle ätherische Öle, die in den ganzen Früchten gut geschützt sind.
Ätherische Öle
Ätherische Öle sind eine Mischung leicht flüchtiger Substanzen, welche häufig den typischen Geruch einer Pflanze ausmachen. Sie wirken entzündungshemmend, auswurffördernd und haben ein sehr breites Wirkspektrum gegen zahlreiche Erreger wie Bakterien, Viren und Pilze. Alle ätherischen Öle wirken mehr oder weniger stark antimikrobiell. Sofern sie umsichtig dosiert werden, ist ihre Wirkung meist effektiv und zugleich schonender als die Medikamente aus der Apotheke. Einige Komponenten der ätherischen Öle sind in Fett löslich. Sie können sich in die Zellmembranen der Mikroorganismen einlagern und deren Energiestoffwechsel hemmen. Ein weiterer Grund für ihr Wirkspektrum ist der pH-Wert. Bei ätherischen Ölen in hoher Qualität ist er leicht sauer; die meisten Bakterien benötigen jedoch ein alkalisches Milieu für ihr Wachstum.
Bei naturreinen Ölen spielt zudem das Zusammenwirken von mehreren hundert Komponenten eine Rolle, deren Wirkweise weitgehend unerforscht ist. In den Pflanzen werden ätherische Öle nur in geringen Mengen in besonderen Speicherorten, den Ölbehältern, konzentriert eingelagert. Sie sind von speziellen Membranen umschlossen, die wenig durchlässig sind für Gase und kaum Verdunstung zulassen. So ist es auch verständlich, dass in unzerkleinerten Pflanzenteilen die Öle wesentlich länger erhalten bleiben als in zerkleinerten, bei denen diese Membranen weitgehend zerstört wurden. Um möglichst viel von diesen heilwirksamen Stoffen zu gewinnen, ist es deshalb wichtig, ganze und unbeschädigte Früchte (Beispiele dafür sind Anis, Kümmel, Fenchel) zu verwenden und sie erst kurz vor der Verwendung anzumörsern.
Lauch- und Senföle
Diese schwefel- oder stickstoffhaltigen Verbindungen riechen und schmecken scharf und sind beispielsweise in den Lauchgewächsen (dazu zählen Bärlauch, Knoblauch, Zwiebeln) oder in Kreuzblütengewächsen wie Meerrettich oder Senf enthalten. Wenn Sie diese Pflanzen schneiden oder zerkauen, beginnt ein chemischer Prozess, der Komponenten der Lauchöle in den wirksamen Stoff Allicin und die der Senföle in Senfölglykoside (die sogenannten Glucosinolate) umwandelt. Das erklärt auch, warum eine Meerrettichwurzel im Gemüsefach nicht scharf riecht, sondern erst nach dem Anschneiden.
Lauch- und Senföle haben antibakterielle, antivirale und pilzhemmende Eigenschaften. Sie binden sich an Eiweiße. Bei Atem- oder Harnwegsinfekten wirken sie besonders gut, weil sie sich in den Ausscheidungsorganen Lunge oder Harnblase anreichern. Durch starkes Erhitzen (ab etwa 55 °C) werden sie allerdings deaktiviert, weshalb hier keine Teezubereitungen in Frage kommen. Es bieten sich also banale kalte Zubereitungen in der Küche oder Tinkturen als geeignete Zubereitungsformen an.
Zwiebeln und Knoblauch stecken voller antibiotischer Inhaltsstoffe.
Immer wieder Genuss
Der regelmäßige Verzehr von Pflanzen, die Lauch- und Senföle enthalten, hilft bei der Vorbeugung von Blasen- oder Atemwegsentzündungen, wobei sicher auch andere bioaktive Stoffe wie Vitamine und Mineralien dazu beitragen.
Scharfstoffe
Scharfstoffe wie Gingerol und Shogaol (Scharfstoffe des Ingwers und Galgants), Capsaicinoide (Scharfstoffe von Chili und Paprika) und Säureamide der Pfeffer-Arten (das bekannteste ist Piperin) wirken gegen eine Reihe von Mikroben und wärmen und durchbluten den Körper. Deshalb sind sie bei Erkältungskrankheiten in der nasskalten Jahreszeit oder im Winter beziehungsweise für ständig fröstelnde Menschen hilfreich. Alle Scharfstoffe führen zu einer vermehrten Durchblutung der Schleimhäute. Zum einen werden so die Ausscheidungsprodukte von Mikroben schneller abtransportiert, zum anderen werden die Mikroben auch direkt geschädigt, da es zu einer kurzfristigen Temperaturerhöhung kommt. Mikroben brauchen unter anderem eine bestimmte Umgebungstemperatur, um sich massenhaft vermehren zu können. Ist sie zu hoch, ist die Vermehrung eingeschränkt. Es gilt also: Das Milieu ist alles. Hitze und Trocknung schaden den Scharfstoffen nicht. Während die Scharfstoffe des Ingwers und Galgants gut wasserlöslich sind und deshalb auch ein heißer Ingwertee gut wirkt, sind die Scharfstoffe von Chili und Pfeffer schlecht wasserlöslich. Die geeigneten Zubereitungsarten sind bei Chili Auszüge in Alkohol oder schlicht und einfach der Verzehr auf einem Butterbrot beziehungsweise die Zugabe zur Salatmarinade, da sich diese Stoffe gut in Fett lösen.
Chili und Ingwer – voller Scharfstoffe, die intensiv wärmen.
Gerbstoffe
Zu den Gerbstoffen wird beispielsweise die Rosmarinsäure gezählt. Sie ist Bestandteil mehrerer Lippenblütengewächse wie Rosmarin oder Melisse. Gerbstoffe zählen zu den Substanzen, die einen unangenehmen Geschmack hinterlassen, jedoch fällen sie Eiweiße aus, „härten“ und verdichten die Haut und Schleimhäute, bilden so eine schützende Membran und entziehen Bakterien und Viren den Nährboden, die sich gerne auf der Haut und den Schleimhäuten ansiedeln. Zudem werden Bakterien und Viren auch direkt geschädigt, indem die Gerbstoffe auch ihnen Eiweißstoffe entziehen. Generell wirken Gerbstoffe zusammenziehend und entzündungshemmend, in hoher Dosierung jedoch schädlich. Innere Anwendungen empfehlen sich bei Durchfall oder Harnwegsinfekten, äußere Anwendung bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum, zur Blutstillung oder zur Wundheilung.
Rosmarin enthält wertvolle Gerbstoffe.
Flavonoide
Flavonoide sind wasserlösliche Pflanzenfarbstoffe und zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen. Sie kommen vor allem in Blüten, Blättern und Schalen vor. Flavonoide sind lichtempfindlich und werden teilweise durch Erhitzen zerstört. Inzwischen sind mehrere tausend Verbindungen bekannt.
Petersilie – der Klassiker unter den Küchenkräutern enthält eine gute Menge Flavonoide.
Das Wissen über die Flavonoide ist noch relativ jung und ihr Potenzial ist noch lange nicht erforscht. Das vorrangige Wirkspektrum liegt darin, freie Radikale zu neutralisieren, jedoch sind für einzelne Flavonoide bereits keimhemmende Eigenschaften bestätigt. Bei Gewürzen und Würzkräutern stehen andere mikrobielle Stoffe im Vordergrund, Flavonoide wirken hier unterstützend.
Qualität ist das A und O
Nur was heil ist, kann heilen, so lautet ein Sprichwort. Achten Sie also schon beim Einkauf auf gute Qualität und lagern Sie Ihre Gewürze und Kräuter fachgerecht. Nur so können die Pflanzen ihr volles heilkräftiges Potenzial zur Verfügung stellen.
Es lohnt sich, gerade bei der Nutzung als Heilmittel, beim Einkauf auf Bioware bester Qualität zu setzen.
DER EINKAUF
Grundsätzlich haben Sie beim Kauf von Gewürzen und Würzkräutern die Wahl zwischen Produkten aus konventionellem oder biologischem Anbau. Und schließlich können Sie Gewürzdrogen in der Apotheke erwerben, die spezielle Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.
Konventioneller versus biologischer Anbau
Die Preisunterschiede zwischen konventionell erzeugter Ware und Bioprodukten sind teilweise deshalb so hoch, weil der Aufwand ihrer Erzeugung höher ist. Beim konventionellen Anbau werden Pestizide und chemische Dünger eingesetzt oder aus Gründen der Haltbarmachung gar ionisierende Strahlen. Bei Kräutern und Gewürzen aus biologischem Anbau ist das nicht der Fall. Diese Ware hat damit wesentliche Vorteile für Sie, geben Sie Bioprodukten darum den Vorzug. Zunächst einmal schmeckt man es einfach: Bioprodukte beeindrucken oft mit einem ganz besonderen Geschmackserlebnis auf der Zunge. Zudem ist der Gehalt an bioaktiven Stoffen, Antioxidantien oder Vitaminen oft deutlich höher als bei konventionellen Gewürzen. Eine Sicherheit vor Pestizidbelastungen gibt es nur im biologischen Anbau, zumal viele der Kräuter und Gewürze vor der Verarbeitung nicht gewaschen werden. Und die Haltbarmachung durch ionisierende Strahlen verbietet sich durch die Richtlinien einiger Anbauverbände, wie der EU-Bioverordnung.