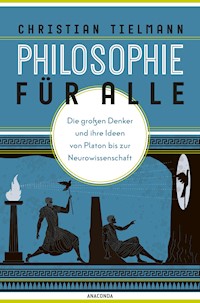
Philosophie für alle. Die großen Denker und ihre Ideen von Platon bis zur Neurowissenschaft E-Book
Christian Tielmann
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Große Philosophie muss nicht unverständlich sein! Unter diesem Motto widmet sich Christian Tielmann den Werken von 20 bedeutenden Denkern der europäischen Philosophie. In klarer Sprache, unterhaltsam und sachkundig erschließt er auch dem philosophischen Laien ihre bahnbrechenden Ideen und zeigt Widersprüche und Zusammenhänge auf. So werden 2500 Jahre Philosophiegeschichte lebendig, von Platon und Aristoteles über Descartes und Hume bis zu Wittgenstein, Sartre und Quine. Zusätzlich weisen touristische Tipps den Weg zu Archiven und Museen.
- Für den kleinen Bildungshunger zwischendurch
- Der ganze Kosmos der abendländischen Philosophie gut verdaulich zusammengefasst
- Mit touristischen Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Museen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christian Tielmann
Philosophiefür alle
Die großen Denker und ihre Ideenvon Platon bis zur Neurowissenschaft
Anaconda
Dieser Band erschien zuerst 2009 unter dem Titel
Meilensteine der Philosophie bei Anaconda in Köln.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-641-30316-7
© 2023 by Anaconda Verlag,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Shutterstock/delcarmat
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: Roland Poferl Print-Design, Köln
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Vorwort
1.Er traute seinen Augen kaum
Platon
2.Der Viel-Denker
Aristoteles
3.Wenn drei sich streiten
Der Universalienstreit
4.Ein Actionfilm und jede Menge Zweifel
René Descartes
5.Lang lebe der König! Denn alle Menschen sind Egoisten
Thomas Hobbes
6.Durchblick ohne Fenster: Monaden
Gottfried Wilhelm Leibniz
7.Die Macht der Gewohnheit
David Hume.
8.Freiheit, Gleichheit und Verfolgungswahn
Jean-Jacques Rousseau.
9.Die Revolution des Denkens
Immanuel Kant.
10.Unterwegs zur Wahrheit
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
11.Geschichte ist aller Gesellschaft Anfang
Karl Marx und Friedrich Engels.
12.Zum Verzweifeln
Sören Kierkegaard.
13.Der Seiltänzer
Friedrich Nietzsche
14.Fragen und andere Krankheiten der Philosophie
Ludwig Wittgenstein.
15.Philosophie und Neue Musik
Theodor W. Adorno
16.Verurteilt zur Freiheit – lebenslänglich
Jean-Paul Sartre
17.Ein hoppelnder Meilenstein
W.V.O. Quine.
18.Revolution und Fortschritt in den Naturwissenschaften
Thomas S. Kuhn.
19.Der Archäologe
Michel Foucault
20.Wie mein Gehirn mir das Rauchen abgewöhnt hat
Hirnforscher und Philosophen über Willensfreiheit.
Literaturverzeichnis
Vorwort
Als Kim Landgraf mich fragte, ob ich ein philosophiehistorisches Buch schreiben wolle, das auch ohne philosophische Vorbildung verständlich wäre, wusste ich ziemlich genau, wie dieses Buch nicht aussehen sollte. Ich wollte keine Philosophiegeschichte schreiben, wie ich sie kannte, nämlich einen Text, der philosophische Positionen darstellt, aber nicht für oder gegen sie argumentiert. Solche Philosophiegeschichten fand ich als Student langweilig, und ich bewundere die Leute, die es a) schaffen, ein solches Buch durchzulesen, und b) hinterher auch noch wissen, was drin stand. Ich gehe in diesem Buch anders vor: Ich nehme in den einzelnen Kapiteln jeweils ein konkretes philosophisches Problem und argumentiere für (und manchmal auch gegen) die Lösungen, die der jeweilige Philosoph vorgeschlagen hat. Nur in dieser Auseinandersetzung wird Philosophiegeschichte für mich (und hoffentlich auch für die Leser) lebendig. Die Auswahl, die ich für dieses Buch treffen musste, ist daher zweifach eingeschränkt: Ich musste erstens entscheiden, welche Denker und zweitens welche konkreten Probleme aufgenommen werden. Ich habe mich dabei um eine doppelte (historische und thematische) Ausgewogenheit bemüht. Dass die in diesem Buch versammelten Denker nicht alle Meilensteine der Philosophie sind, versteht sich von selbst.
Man muss dieses Buch nicht von vorne nach hinten lesen. Die Kapitel sind so selbstständig formuliert, dass man loslesen kann, wo immer man will. Wo es Verweise auf andere Kapitel gibt, sind diese im Text kenntlich gemacht. In manchen Zitaten gibt es Zusätze, die in eckigen Klammern stehen. Diese Zusätze sind von mir und stehen nicht im Original.
Für Ihre Hilfe an sehr verschiedenen Baustellen des Textes danke ich: Rebecca Axthelm, Andre Enthöfer, Nikolai Jaeger, Michael Kober, Jürgen Mehnert, Stephanie und David Mintert, Alexander Prehn, Helga Reese, Thomas Roth, Julia Schuster, Georg Tielmann, Jasna Zagorc und immer wieder Kai Kilian. Ohne Kim Landgraf und Hansjörg Kohl vom Anaconda Verlag wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben – und dass sie so geduldig auf seine Fertigstellung warten würden, hätten die beiden vermutlich selbst kaum für möglich gehalten … Danke!
Iris Hennig kann ich kaum genug danken. Ich probiere es dennoch: Herzlichen Dank sage ich für die kritische Lektüre, die zahlreichen Tipps, die ständige Gesprächsbereitschaft und nicht zuletzt für die Geduld im Leben mit einem Ehemann im Ausnahmezustand.
Für mich bleibt die Hoffnung, dass dieses Buch nicht nur seine Leserinnen und Leser finden möge, sondern dass die Leserinnen und Leser in diesem Buch weitere (viel lesenswertere) Bücher finden werden, ohne zuvor einzuschlafen.
Köln, im Februar 2009
Christian Tielmann
Kapitel 1
Er traute seinen Augen kaum
Platon
Um Platon (*427 v. Chr. in Athen; † um 348/347 v. Chr. ebd.) kommt niemand herum, der sich mit Philosophie befasst. Er ist der berühmteste Schüler seines nicht minder berühmten Lehrers Sokrates und hat einige Gedanken seines Lehrers sowie jede Menge eigene Gedanken aufgeschrieben. Das Werk Platons ist umfangreich: Er hat über Staatsphilosophie und Ethik, über Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie und auch über Ästhetik geschrieben. Der Kern seiner Philosophie ist die Ideenlehre. In die Ideenlehre wird oft mit Platons Höhlengleichnis eingeführt. Aber das Höhlengleichnis selbst wird erst verständlich, wenn man die Ideenlehre zumindest in groben Zügen kennt. Ich werde daher im Folgenden ohne Rückgriff auf das Höhlengleichnis in die Ideenlehre einführen.
Platons Ideenlehre
Die Richtigkeit der platonischen Ideenlehre konnte bisher niemand restlos beweisen. Möglicherweise lässt sie sich nicht beweisen, und das werfen ihr ihre Kritiker (allen voran die Empiristen) vor. Wie sieht diese Lehre aus?
Zwei Schwierigkeiten will ich schon im Vorfeld aus dem Weg räumen, um Missverständnisse weiträumig zu umschiffen.
1. Schwierigkeit: »Theorie« oder »Lehre«? Oder: Platons Texte
Die Ideenlehre ist keine Theorie in dem Sinne, in dem die Relativitätstheorie eine Theorie ist, und noch nicht mal die (einzige) Lehre Platons. Die Schwierigkeit erwächst aus der Textsorte, in der uns seine Philosophie überliefert ist. Erfreulich ist, dass Platon überhaupt etwas geschrieben hat (das hat sein Lehrer Sokrates rundweg abgelehnt, daher ist die sokratische Philosophie auch noch schwerer zu fassen als die platonische). Allerdings sind die Texte, die wir von Platon haben, in einer wichtigen Hinsicht wissenschaftlich unbefriedigend: Die entscheidenden Schriften sind keine Traktate, sondern Dialoge. Diese Dialoge sind zwar (zumindest in Teilen) so pointiert formuliert, dass sie sich sogar als Theaterstücke aufführen lassen (auch wenn man sicherlich kürzen muss, um die Zuschauer am Einschlafen zu hindern), sie haben aber den offensichtlichen Nachteil, den jedes literarische Werk hat: Die Meinung des Autors steht (wenn überhaupt) zwischen den Zeilen, und selbst Platon-Experten sind sich an manchen Stellen uneins darüber, ob ein Dialogpartner gerade Platons Meinung wiedergibt oder nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass einer der wichtigsten Dialogpartner Platons Lehrer Sokrates ist. Das ist noch verwirrender, weil wir an manchen Stellen nicht wissen, ob wir es mit sokratischer oder platonischer Philosophie zu tun haben. Angesichts dieser Schwierigkeiten mit dem Text wird deutlich, inwiefern man nicht von einer »Theorie der Ideen« sprechen kann: Eine Theorie muss ja von einem Theoretiker aufgestellt und formuliert werden. Genau das hat Platon aber nicht gemacht. Es hat sich daher in Fachkreisen eingebürgert, von Platons »Ideenlehre« zu sprechen. Auch dieser Ausdruck kann etwas Falsches suggerieren, denn es macht Schwierigkeiten, aus Platons philosophischem Werk (immerhin 34 Dialoge, von denen einige vermutlich nicht von Platon stammen, und 13 Briefe, zum Teil vermutlich ebenfalls gefälscht), eine klare und eindeutige Lehrmeinung in Sachen Ideen zu rekonstruieren. Der Grund: Platon hat seine Meinung im Laufe seines Schaffens geändert. Was ich im Folgenden als »Ideenlehre« beschreibe, ist eine Darstellung der Ideenlehre, wie wir sie in der mittleren Schaffensphase Platons finden können (dazu gehören an zentraler Stelle die Dialoge Phaidon, Politeia, dt. »Der Staat«, und Symposion, dt. »Das Gastmahl«).
2. Schwierigkeit: Platons Anti-Terminologie
Wenn ein Künstler sagt: »Ich habe eine spitzenmäßige Idee!«, dann meint er damit, dass er einen guten Einfall für ein Kunstwerk hat. Gerade diese im Deutschen heute völlig geläufige Bedeutung des Wortes »Idee« ist aber nicht gemeint, wenn wir von platonischen »Ideen« sprechen. Das Wort »Ideal« kommt dem, was Platon meint, wenn er von Ideen spricht, in mancher Hinsicht näher, aber es hat sich eingebürgert, von »platonischen Ideen« zu sprechen. Da dies ein terminus technicus der Philosophie geworden ist, kann man sich darüber ärgern oder nicht, es ist jedenfalls zweckmäßig, den Ausdruck zu verwenden, weil dann alle wissen, wovon man spricht.
Als wäre das nicht schon verwirrend genug, hat es Platon allerdings tunlichst vermieden, nur ein Wort (z.B. griech. idea) als terminus technicus für die Ideen zu reservieren. Ganz im Gegenteil sind bei ihm eine Vielzahl von Ausdrücken und Umschreibungen zu finden, mit denen er die Ideen bezeichnet. Folgende Wörter können bei Platon »Idee« bedeuten: idea (Gestalt, Beschaffenheit, Urbild, Idee), eidos (Form, Urbild, Idee, Begriff), morphê (Gestalt, von dem Zufälligen und Unvollkommenen befreite Form), je nach Kontext auch genos (Gattung, Art, Klasse), usia (das Sein, Wesen) und andere Ausdrücke. An vielen Stellen ist es nicht nur ein Wort, das die Idee bezeichnet, sondern eine ganze Umschreibung, zum Beispiel »das farblose, gestaltlose, stofflose, wahrhaft seiende Wesen« (Phaidros, 247 c); »jenes Wesen selbst, dem wir das eigentliche Sein zuschreiben« (Phaidon, 78 c); »das Reine, immer Seiende, Unsterbliche und sich stets Gleiche« (Phaidon, 79 d). Bestimmte Ideen, wie zum Beispiel die Idee des Schönen, werden entsprechend umschrieben als »das Schöne selbst« (Phaidon, 78 d; Symposion, 210 e) usw.
Was soll dieses Verwirrspiel? Genau das Gegenteil von Verwirrung: Mit diesen Umschreibungen und dieser Anti-Terminologie zwingt Platon seine Leser immer wieder aufs Neue, sich vor Augen zu führen, was Ideen sind und welche Merkmale sie auszeichnen.
Was also sind platonische Ideen? Und wozu sollen sie gut sein?
Was sind und wozu überhaupt platonische Ideen?
Im Dialog Phaidon führt Platon seine Ideenlehre auf die für ihn typische Weise scheinbar beiläufig im Gespräch ein.
Platon beschreibt im Phaidon die letzten Stunden des zum Tod durch Giftbecher verurteilten Sokrates. Das Schiff aus Delos liegt im Hafen (darauf musste man warten, ehe ein Todesurteil in Athen vollstreckt werden durfte), Sokrates sitzt im Gefängnis, bekommt einen letzten Besuch von seinen Freunden und schickt seine Frau Xanthippe samt Sohn nach Hause. Im Angesicht des Todes behauptet Sokrates nun, dass wahre Philosophen nach dem Tod streben. Über diese Meinung sind seine Freunde einigermaßen erstaunt (denn Sokrates machte bisher und macht auch jetzt keinen suizidalen Eindruck). Er will (und soll) seine Meinung besser erklären. Zunächst fragt Sokrates, was der Tod sei, und alle sind sich darin einig, dass er nichts anderes sei als die Trennung von Leib und Seele. Das liest sich bei Platon so:
[Sokrates spricht:] [G]lauben wir wohl, dass der Tod etwas sei?
– Allerdings, fiel Simmias ein.
– Und wohl etwas anderes als die Trennung der Seele von dem Leibe? Und dass das heiße tot sein, wenn abgesondert von der Seele der Leib für sich allein ist und auch die Seele abgesondert von dem Leibe für sich allein ist. Oder sollte wohl der Tod etwas anderes sein als dieses?
– Nein, sondern eben dieses.
[Phaidon, 64 c]*
Dass ein lebendiger Mensch nichts anderes als eine Verbindung von Leib und Seele ist, steht für Platons Sokrates hier außer Frage (zumindest herrscht unter den Dialogpartnern Sokrates und Simmias darüber schönste Einigkeit und auch von den anderen Freunden zweifelt niemand daran). Platon setzt die Existenz des Leibes und der Seele darüber hinaus nicht nur in ihrer Verbindung, sondern auch jeweils einzeln voraus: Der Leib allein ohne Seele ist ein Leichnam; für die Seele, wenn sie vom Leib getrennt ist, haben wir kein eigenes Wort. Die Überzeugung, dass Leib und Seele auch unabhängig voneinander existieren können, kann man als Platons »Leib-Seele-Dualismus« bezeichnen. (Die Gegenposition heißt »Monismus«. Monisten sprechen der Seele eine von der Verbindung mit dem Leib unabhängige Existenz ab.) Auf den hier skizzierten Leib-Seele-Dualismus werden wir gleich zurückkommen. Dass die Seele nach dem Tod weiter existiert (sprich: unsterblich ist), wie Platon annimmt, ist auch für die alten Griechen keine Selbstverständlichkeit gewesen. Diese heikle Frage spricht im Phaidon (69 e) der Dialogpartner Kebes an, und Sokrates müht sich auf den folgenden Seiten nach Kräften, zu beweisen, dass die Seele unsterblich sei.
Zurück zur Situation im Phaidon: Der zum Tode verurteilte Sokrates fragt seine Freunde, was denn den wahren Philosophen eher interessiere: die Dinge des Leibes (gutes Essen und Trinken, schicke Kleidung, Sex usw.) oder die der Seele (Erkenntnis, richtige Einsicht, Weisheit). Die Antwort überrascht kaum: Die Liebe zur Weisheit, das Streben nach der richtigen Einsicht und die Erkenntnis der Wahrheit sind die Anliegen eines Philosophen. Nun schlägt Platon mit seinem Leib-Seele-Dualismus zu: Sein Sokrates formuliert massiven Zweifel daran, dass der Leib ein brauchbares Hilfsmittel sei, wenn es darum geht, zur richtigen Einsicht zu gelangen. »Richtige Einsicht« heißt hier: die Dinge (das Leben, die Welt, einfach alles) so zu sehen, wie sie sind, und nicht so, wie sie nur zu sein scheinen (möglicherweise aber nicht sind).
[Sokrates spricht:] Wie aber nun mit dem Erwerb der richtigen Einsicht selbst, ist dabei der Leib im Wege oder nicht, wenn ihn jemand bei dem Streben danach zum Gefährten mit aufnimmt? Ich meine so, gewähren wohl Gesicht[ssinn] und Gehör den Menschen einige Wahrheit? Oder singen uns selbst die Dichter das immer vor, dass wir nichts genau hören noch sehen? Und doch, wenn unter den Wahrnehmungen, die dem Leibe angehören, diese nicht genau sind und sicher: dann die anderen wohl gar nicht; denn alle sind ja wohl schlechter als diese; oder dünken sie dich das nicht? – Freilich, sagte er [Simmias].
[Phaidon, 65 a–b]
Platon teilt die fünf Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) in zwei Gruppen ein: Der Sehsinn und das Gehör sind schon zweifelhaft, Riechen, Schmecken und Tasten sind für ihn hingegen völlig indiskutabel. Diese Einteilung scheint (zumindest auf den ersten Blick) willkürlich zu sein. Denn wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob dieser Wein besser sei als jener, können Geruchs- und Geschmackssinn hervorragende Gefährten auf der Suche nach der Wahrheit sein – allemal besser als das Gehör, das zu dieser Frage ja gar nichts beitragen kann! Ähnliches gilt (z.B. bei der Bewertung der Qualität eines Tuches) vom Tastsinn. Aber Platon rechtfertigt diese unterschiedliche Bewertung der Sinne nicht, sodass uns nichts weiter übrig bleibt, als sie einfach hinzunehmen. Der Mann traute seinen Augen und Ohren kaum, aber seine Nase, seine Zunge und seine Haut hielt er offenbar für notorische Lügner …
Was hat Platon am Sehen und Hören als Hilfsmittel auf dem Weg zur Wahrheit auszusetzen? Wenn man zum Beispiel die Wahrheit über die aktuelle Wetterlage für den Ort, an dem man sich gerade aufhält, erfahren will, ist es doch ein guter Weg zur Wahrheit, einfach die Augen zu öffnen und aus dem Fenster zu schauen. Wenn wir sehen, dass es regnet, dann wissen wir, wie es um das Wetter bestellt ist. Also hätten wir, so könnte man meinen, dank des Sehsinns Erkenntnis gewonnen und wüssten die Wahrheit über diesen kleinen Ausschnitt der Welt.
Platon hätte gegen dieses Beispiel Einwände: Die Frage, ob es regnet, ist keine philosophische Frage, und es ging ja gerade darum, ob die Sinne hilfreich für einen Philosophen sind, der nach (philosophischer) Einsicht strebt. Und auf diese zweite Frage antwortet Platon: Nein, im Gegenteil, die Sinne sind trügerisch, wenn man versucht, sich mit ihrer Hilfe philosophischen Fragen zu nähern. Nun fragt sich natürlich, was Platon mit philosophischer Einsicht (oder auch der Erkenntnis des Wahren) meint.
Der Vorwurf, dass die Sinne trügen können, wiegt hier schwer, und er bringt uns einen Schritt weiter. Wenn ich mich bei einem Urteil (und sei es ein Urteil über eine ganz unphilosophische Frage wie zum Beispiel die nach der aktuellen Wetterlage), das ich aufgrund einer Sinneswahrnehmung (ich sehe den Regen vor dem Fenster) getroffen habe, irre, dann ist der Inhalt dieses Urteils kein Wissen, sondern nur eine (falsche) Meinung. Platon unterscheidet (zu Recht) sehr genau zwischen Wissen und Meinen. Meinungen können richtig oder falsch sein. Wissen hingegen impliziert (für Platon und alle Philosophen nach ihm) die Wahrheit des Gewussten. Peter »weiß« zum Beispiel nur dann, dass Ben Anna liebt, wenn es auch tatsächlich der Fall ist, dass Ben Anna liebt. Wenn Ben Anna nicht liebt, dann meint Peter vielleicht, dass Ben Anna liebt, aber man kann nicht davon sprechen, dass Peter es weiß (denn es ist ja nicht der Fall, dass Ben Anna liebt).
Nun scheint Platon im Zitat oben den Sinneswahrnehmungen generell eine Beteiligung an Erkenntnis abzusprechen, wenn er Sokrates suggestiv fragen lässt: »Gewähren wohl Gesicht[ssinn] und Gehör den Menschen einige Wahrheit? Oder singen uns selbst die Dichter das immer vor, dass wir nichts genau hören noch sehen?« Das scheint die Sinne insgesamt zu diskreditieren und von der Erkenntnis der Wahrheit auszuschließen, frei nach dem Motto: »Wer einmal trügt, dem glaub ich nicht.« Mag ja sein, scheint Platon hier zu sagen, dass man aufgrund seines Sehsinns eine Meinung, möglicherweise auch mal eine wahre, gewinnen kann, aber mehr ist nicht drin: Wissen werden wir nicht unter Beteiligung der Sinne erwerben, schließlich können die Sinne ja trügen. Aber ganz so misstrauisch ist Platon nicht. Und eine so grundlegende Skepsis bezüglich der Sinneswahrnehmung wäre auch ziemlich offensichtlich falsch: Denn wie sollte man ohne die Sinne herausfinden, ob es regnet? (Nur durch Nachdenken kommt man bestimmt nicht darauf!) In einem anderen Dialog spricht Platon Augenzeugen explizit die Möglichkeit zu, etwas zu wissen (und zwar als Augenzeugen gerade aufgrund ihres Sehsinns): »etwas, das nur, wer es selbst gesehen hat, wissen kann, sonst aber keiner …« (Theaitetos, 201 b).
Wie aber steht es um den Nutzen der Sinne (und mithin des Leibes, denn die Sinne – Augen, Ohren, Nase, Riechkolben, Nervenbahnen etc. – gehören ja zum Leib), wenn es um philosophische Fragen geht? Und wie lauten diese philosophischen Fragen überhaupt? Wir müssen folgenden Text ein bisschen gegen den Strich lesen, um eine Antwort zu finden.
[Sokrates spricht:] Wann also trifft die Seele die Wahrheit? Denn wenn sie mit dem Leibe [d.h. mit den Sinnen] versucht, etwas zu betrachten, dann offenbar wird sie von diesem hintergangen.
[Simmias antwortet:] Richtig.
– Wird also nicht in dem Denken, wenn irgendwo, ihr etwas von dem Seienden offenbar.
– Ja.
– Und sie [die Seele] denkt offenbar am besten, wenn nichts von diesem [dem Leib] sie trübt, weder Gehör noch Gesicht noch Schmerz und Lust, sondern sie am meisten ganz für sich ist, den Leib gehen lässt und soweit irgend möglich ohne Gemeinschaft und Verkehr mit ihm dem Seienden nachgeht.
– So ist es.
[Phaidon, 65 b–c]
Das klingt, so radikal wie es hier formuliert wird, schlicht falsch. Denn dann müsste doch ein blinder, tauber, gefühlloser und völlig ignoranter Mensch die besten Voraussetzungen zur Erkenntnis und das Zeug zum Philosophen haben. Und das ist nicht der Fall. Da Platon kein Dummkopf war, wird ihm ein so offensichtlicher Fehler nicht unterlaufen sein. Wie also ist die Stelle zu verstehen?
Zunächst muss man sich den Kontext der Textstelle wieder vor Augen führen: Sokrates ist zum Tode verurteilt. Dass er sich an die (seiner Meinung nach unsterbliche) Seele und alles, was mit dem Denken zu tun hat, klammert und nicht an den Körper (der ja gleich mit dem Trank vergiftet werden soll), ist verständlich. Daher versucht er, selbst die Sinneswahrnehmung als für den Philosophen unergiebig abzutun. Was aber beschäftigt den Philosophen? Er will nicht erkennen, ob es regnet oder nicht. Der Philosoph will, so Platon im Zitat, »das Seiende« erkennen.
Was meint Platon, wenn er von dem »Seienden« spricht?
Hier klingt Platons zweiter Dualismus an. Parallel zum oben genannten Leib-Seele-Dualismus vertritt Platon eine Zwei-Welten-Theorie. Die Dinge, an denen man sich, sehr grob gesprochen, eine blutige Nase holen kann (Tische, Stühle, Hunde, Nachbars Faust), gehören zum Bereich des Werdens und Vergehens. Dieser ganze Bereich, den man als die »empirisch wahrnehmbare Welt« umschreiben kann, ist (nach Platons Meinung) philosophisch kolossal uninteressant (und im Angesicht des Todes sowieso eine einzige Enttäuschung – selbst wer eine schöne Frau geheiratet hat, mit der er grandiosen Sex hatte, hat von beiden nichts mehr, wenn der Giftbecher kommt). Demgegenüber gibt es auch noch die Welt der Ideen, die, laut Platon, nicht geworden, sondern unvergänglich im Ideenhimmel zu Hause sind. In diesem Sinne ist »das Sein« (das, was unvergänglich existiert) immer vom »Werden und Vergehen« (das, was vergänglich ist, d.h. nur für einen gewissen Zeitraum existiert) zu unterscheiden. Zum »Sein« gehören für Platon also keine Tische, Stühle, Steine und auch nicht Nachbars Fäuste. Zum Sein gehören aber die Ideen.
Jetzt kommen wir nicht mehr um eine Antwort auf die Frage herum: Was sind Ideen? Was zeichnet sie aus? Im Phaidon beantwortet Platon diese Fragen, in dem er Beispiele für Ideen gibt.
[Sokrates spricht:] Wie nun hiermit, o Simmias? Sagen wir, dass das Gerechte etwas sei oder nichts?
– Wir behaupten es freilich, beim Zeus.
– Und nicht auch das Schöne und Gute?
– Wie sollte es nicht?
– Hast du nun wohl schon jemals hiervon das mindeste mit Augen gesehen?
– Keineswegs, sprach er.
– Oder mit sonst einer Wahrnehmung, die mittels des Leibes erfolgt, es getroffen? Ich meine aber alles dieses, Größe, Gesundheit, Stärke und, mit einem Worte, von allem insgesamt das Wesen, was jegliches wirklich ist; wird etwa mittels des Leibes hiervon das eigentlich Wahre geschaut, oder verhält es sich so, wer von uns am meisten und genauesten es darauf anlegt, jegliches selbst unmittelbar zu denken, was er untersucht, der kommt auch am nächsten daran, jegliches zu erkennen?
– Allerdings.
[Phaidon, 65 d–e]
Platon bezeichnet in diesem Abschnitt die Ideen als »das Wesen, was jegliches wirklich ist«. Und das legt nahe, dass es auch noch etwas gibt, was jegliches zu sein scheint, aber in Wahrheit nicht ist. – Doch der Reihe nach.
Platon gibt uns hier insgesamt sechs Beispiele für Ideen: Die Idee der Gerechtigkeit, die Idee des Schönen, die Idee des Guten, die Idee der Größe, die Idee der Gesundheit und die Idee der Stärke. Um deutlich zu machen, was er damit meint, greife ich die Idee der Gerechtigkeit (eine von Platons Lieblingsideen) heraus.
Platons Sokrates (und soweit wir wissen, teilt er dies mit dem historischen Sokrates) liebte Was-ist-Fragen, um zu philosophieren. Auf die Frage: »Was ist eine gerechte Handlung?« kann man relativ leicht antworten, indem man Beispiele gibt (die Urteilssprüche Salomons sind gerecht; Robin Hoods Art, Beute zu verteilen, war gerecht etc.). Wie aber steht es mit einer Antwort auf die Frage: »Was ist Gerechtigkeit?« Da finden wir plötzlich keine Beispiele mehr.
Dass dies kein Spezialproblem der Gerechtigkeit ist, sehen wir, wenn wir dasselbe Spiel mit der Schönheit oder der Größe spielen. Auf die Frage: »Was ist schön?« kann man antworten: »Das da!« und auf Rodins »Der Kuss« zeigen. Auf die Frage: »Was ist groß?« kann man auf den Turm des Ulmer Münsters zeigen und sagen: »Zum Beispiel das da!« Aber auf die Frage »Was ist Schönheit?« und auf die Frage »Was ist Größe?« finden wir nicht so einfach Antworten und erst recht nichts, auf das man als Beispiel zeigen könnte.
Nach Platons Zwei-Welten-Theorie lautet die korrekte Antwort auf die Frage, was Gerechtigkeit sei: »Die Gerechtigkeit ist eine Idee.«
Ebenso sind die Schönheit und die Größe Ideen.
Alle Ideen haben folgende Merkmale: Sie nicht empirisch wahrnehmbar, sie sind unvergänglich und nicht geworden (d.h. sie existieren ewig und von der empirisch wahrnehmbaren Welt unabhängig), und sie können nur denkend erfasst oder »geschaut« werden.
Was aber unterscheidet die Ideen voneinander? Was unterscheidet zum Beispiel die Idee der Schönheit von der Idee der Größe? Eine Analogie zur Mengenlehre finde ich hier hilfreich: Man kann sich die Idee der Schönheit analog zur Menge der schönen Dinge* vorstellen. Mengentheoretisch gesprochen, ist das konkrete schöne Ding ein Element der Menge aller schönen Dinge. Nach der Ideenlehre kann man analog sagen, dass die einzelnen schönen Dinge »Instanzen« (oder »Manifestationen«) der Idee der Schönheit sind oder umgekehrt betrachtet: Die schönen Dinge haben Teil an der Idee der Schönheit.
Nun liegt der Unterschied zwischen der Idee der Schönheit und der Idee der Größe auf der Hand: Nicht alles, was Teil hat an der Idee der Schönheit, hat auch Teil an der Idee der Größe. (Beispiel: Vom Ulmer Münster oder dem Kölner Dom kann man sagen, dass sie sowohl Teil haben an der Idee der Größe als auch an der Idee der Schönheit – der Schornstein der Kölner Müllverbrennungsanlage aber hat Teil an der Idee der Größe, nicht aber an der Idee der Schönheit.)
Gemäß Platons Zwei-Welten-Theorie müssen wir sehr genau unterscheiden zwischen dem Bereich des empirisch Wahrnehmbaren (Stöcke, Steine, Menschen, Tiere, das Ulmer Münster etc.) und dem empirisch nicht wahrnehmbaren Ideenhimmel (die Idee der Gerechtigkeit, die Idee der Schönheit, die Idee der Größe etc.).
Laut Platon ist die Idee das »Wesen, was jegliches wirklich ist«. Das heißt, die Idee der Gerechtigkeit oder die Idee der Schönheit scheinen für ihn irgendwie eher existent zu sein als ihre Instanzen (d.h. die gerechten Handlungen, die schönen Dinge etc.). Das kann auf den ersten (und möglicherweise auch noch auf den zweiten) Blick verwirrend erscheinen. Die (gerechten) Handlungen des Salomon sind doch wunderbar handfest und wirken mithin ziemlich existent: Man kann sie sehen, hören und mit einer Videokamera aufzeichnen. Die Idee der Gerechtigkeit hingegen scheint sich Platon als Konstrukt doch einfach ausgedacht zu haben – zumindest ist ihre Existenz sehr viel schwerer nachweisbar als die der empirisch wahrnehmbaren Gegenstände, Handlungen und Ereignisse!
Aber Platon sieht das genau umgekehrt! Für ihn stellt sich die Sache so dar: Eine Handlung ist etwas extrem Flüchtiges. Kaum hat Salomon seinen Spruch getan, ist die Handlung auch schon vollzogen. Geworden und vergangen. Die Idee der Gerechtigkeit hingegen existiert unabhängig von den Handlungen im Ideenhimmel – und zwar für immer. Sie gehört nicht zum »Werden und Vergehen«, sondern zum Sein. Ebenso verhält es sich mit der Idee des Schönen und den schönen Instanzen (den schönen Dingen), die an dieser Idee teilhaben. Ein Blumenstrauß, der heute vielleicht schön aussieht (er ist eine Instanz der Idee des Schönen bzw. er hat Teil an der Idee des Schönen), ist schon nach ein paar Tagen verwelkt und besitzt den Liebreiz eines Komposthaufens. (Auch der Kölner Dom oder das Ulmer Münster sind geworden und werden eines Tages vergangen sein.) Aber laut Platon ist eben nicht »die Schönheit« vergänglich, sondern nur die jeweilige Instanz (der Blumenstrauß, der Kölner Dom usw.). Und das liegt einzig und allein an der Vergänglichkeit der empirisch wahrnehmbaren Dinge (Blumen, Gebäude etc.). Die Schönheit (die Idee der Schönheit) gibt es aber immer noch, selbst wenn die Blumen längst in ihre Bestandteile zerfallen sind.
Betrachten wir mit diesen Überlegungen im Hinterkopf die Stelle Phaidon, 65 b–c (siehe oben, S. 17) noch einmal, liest sie sich plötzlich anders und gar nicht mehr falsch. Denn Ideen kann man nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Und die Sinne täuschen vielleicht auch über das wahre Sein – wenn man dieses wahre Sein nämlich in den platonischen Ideen sieht, während die Sinne vielleicht nahelegen, dass das wahre Sein im Werden und Vergehen zu suchen ist. Insofern sind die Sinne nach Platons Meinung trügerisch. Es ist (unter anderem) dieser Punkt, den Platon mit dem berühmten Höhlengleichnis (Politeia, 514 a–521 b) illustriert: Die Menschen, die seit ihrer Geburt in der Höhle gefesselt sind, sodass sie nur die Schatten sehen, die die Dinge, die vor der Höhle vorbeigetragen werden, an die Wand der Höhle werfen, halten diese Schatten für die realen Dinge. Das wahre Sein (die Dinge selbst, nicht die Schatten) erkennt nur der Philosoph, der seine Fesseln ablegt, aufsteht und aus der Höhle ins Tageslicht tritt.
Fazit: Um einen Mörder zu überführen baut auch Platon nicht auf Ideenschau, sondern auf Augenzeugenberichte. Aber um eine Idee zu schauen, das heißt, um »das Schöne selbst« zu erkennen, »die Schönheit« oder auch »die Gerechtigkeit« usw., dazu bedarf es, so Platon, des Denkens, nicht des Glotzens.
Sobald die Seele (nach dem Tod) vom Leib (und seinen trügerischen Sinnen) getrennt ist, kann sie sich, so Platons Vorstellung, der Ideenschau voll und ganz hingeben. Und was, so Platon, könnte für einen Philosophen schöner sein?
Kritik
Schon Platons berühmtester Schüler, Aristoteles, hatte an der Ideenlehre seines Lehrers so manches auszusetzen. Der zentrale Kritikpunkt an der Ideenlehre betrifft Platons Überzeugung, dass die Ideen wirklich und abgetrennt von den empirisch wahrnehmbaren Dingen existieren. Diese These betrachtet Aristoteles als die Quelle der meisten Schwierigkeiten, die sich aus der Ideenlehre ergeben:
Ohne das Allgemeine nämlich ist es unmöglich, eine Wissenschaft zu erreichen, doch ist das Abtrennen der Grund jener Schwierigkeiten, die sich hinsichtlich der Ideen ergeben. [Aristoteles: Metaphysik, XIII. Buch (M) 1086 b 5f.]
Eine von den Dingen unabhängige Existenz der Ideen erscheint vielen Philosophen zu radikal, und sie ließ sich bis heute nicht beweisen. Ich komme auf die drei verschiedenen Positionen, die sich zu dieser Frage herauskristallisiert haben, im Kapitel über den mittelalterlichen »Universalienstreit« ausführlicher zu sprechen. Aber auch abgesehen von diesem Streit muss Platons Ideenlehre zum Beispiel die folgenden Probleme aus dem Weg räumen:
1. Aristoteles fragt: Was nützt mir die Ideenschau? Er argumentiert, dass die Ideenlehre (in einigen Fällen) irgendwie nicht das erklärt, was sie zu erklären vorgibt. Die Ideen scheinen Aristoteles überflüssig oder wenig hilfreich zu sein. Denn ein Geiger, der gut geigt, muss nicht erst die Idee des Guten schauen. Der Geiger studiert ja Musik, nicht Philosophie, um gut zu geigen. Nun sagt aber Aristoteles: Wenn man gut handeln kann, ohne die Idee des Guten geschaut zu haben, wozu brauchen wir dann überhaupt noch diese Idee? (Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, 1. Buch, 4. Kapitel, 1097 a)
2. Manche Ideen machen Schwierigkeiten. Peter ist größer als Paul, aber kleiner als Laura. Also hat Peter sowohl Teil an der Idee der Größe als auch an der Idee der Kleinheit. Das aber ist ein Widerspruch. – Dieser Widerspruch entsteht daraus, dass »Größe« ein relativer Begriff ist, den man am besten übersetzt mit »x ist größer als y« bzw. »x ist so groß wie y«. Zu solchen Begriffen (Größe, Gewicht, Geschwindigkeit usw.) müssen Platonisten mehr sagen als das, was wir bisher gesehen haben.
3. Wie können wir nur durch Denken und ganz ohne Wahrnehmung eine Idee »schauen«? Ist das, was Platon »Idee« nennt, nicht eigentlich ein Konstrukt, das seinen Ursprung in der Fülle der empirischen Wahrnehmungen hat? Wir sehen zum Beispiel viele schöne Gegenstände und konstruieren, diese Wahrnehmungen ordnend, einen abstrakten Gegenstand, dem wir den Namen »Idee der Schönheit« geben. Wenn das richtig ist, wäre die Sinneswahrnehmung eine notwendige Voraussetzung für die Ideenschau.
Platons Antwort auf diese Frage lautet: Dass wir die Ideen ohne Rückgriff auf die Sinneswahrnehmungen erkennen können, liegt daran, dass unsere Seele schon vor der Geburt existierte und die Ideen im Ideenhimmel gesehen hat. Das, was sie im Ideenhimmel gesehen hat, vergisst die Seele aber wieder, sobald sie in einen Körper einsperrt wird. Aber sie vergisst es nicht ganz: Man kann sich an die Ideen wieder erinnern, wenn man scharf nachdenkt. Dieses Wieder-Erinnern ist die Ideenschau, die uns zu Lebzeiten möglich ist (wenn wir, wie Philosophen es tun, scharf nachdenken). Nach dem Tod (wenn die Seele wieder vom Leib befreit ist) kann die Seele die Ideen angucken, bis sie in den nächsten Leib gezwängt wird. Wenn man aber ganz scharf nachdenkt, dann kann der Leib nur stören: Wir hören Geräusche, die uns ablenken, der Leib hat Hunger oder Durst oder hält uns mit sonstigen Bedürfnissen vom Denken ab.
Diese Antwort sieht freilich eher wie eine Verschlechterung der platonischen Position aus: Die Existenz von Ideen ist schon schwer nachweisbar, nun aber tischt uns Platon auch noch eine unsterbliche Seele auf, die schon vor unserer Geburt Ideen erkannt hat, um die Ideenlehre zu stützen.
4. Wenn die zwei Welten, die Welt der Ideen und die Welt der empirisch wahrnehmbaren Gegenstände, wirklich unabhängig voneinander existieren, wie Platon meint, was hält die beiden dann überhaupt zusammen? Oder anders gefragt: Gibt es Ideen von allem und jedem? Gibt es eine Idee des Misthaufens, des Drecks, des Feinstaubs? Und gibt es umgekehrt zu jeder Idee auch mindestens eine Instanz? Oder gibt es auch nicht-manifeste Ideen?
Die Frage nach der Idee des Misthaufens diskutiert Platon selbst (mit den Beispielen Kot, Haar, Schmutz) im Dialog Parmenides (130 c–e). Der junge Sokrates weist dort solche Ideen weit von sich, denn die erscheinen ihm lächerlich. Darauf sagt der erfahrene und weise Parmenides, dass Sokrates eben noch jung sei und die Meinung der Vielen zu sehr achte – sprich: Platon nimmt auch für diese Dinge Ideen an; auch wenn es die Banausen (»die Vielen«) belustigt.
Die Frage nach den leeren, nicht manifestierten Ideen muss Platon bejahen: Denn das Werden und Vergehen lässt es zu, dass zum Beispiel alle Tiere einer Tierart aussterben, ohne dass zugleich die entsprechende Idee ausstirbt. (Dass es Ideen geben kann, die noch nicht, nicht mehr oder niemals manifest wurden, braucht uns nicht weiter beunruhigen. Schließlich haben wir auch sprachlich das Phänomen, dass es leere Begriffe gibt, denen kein realer Gegenstand entspricht; zum Beispiel gibt es und gab es nie eine Frau, die eine Hexe war; es gibt und gab nie Einhörner oder Greife; und es gab niemals auch nur einen Menschen, der unter den leeren Nazi-Begriff vom »lebensunwerten Leben« fiel.)
Das Werden und Vergehen ganzer Tierarten wirft für alle Philosophen nach Darwin allerdings die Frage auf, ob die Ideen nicht vielleicht doch selbst geworden sind: Denn gemäß der Evolutionstheorie (die Platon freilich noch nicht kannte) können durch das ständige Spiel von Mutation und Selektion neue Tierarten entstehen (vom Mammut zum Elefant; vom Säbelzahntiger zum Tiger). Das, was da wird, ist dann nicht nur eine Instanz, sondern eine neue Art. Und ist die Tierart nicht dasselbe wie die Idee?
Hier wird es bei Platon unbefriedigend: Nach Platons Meinung ist die Natur von einem Schöpfergott nach dem Vorbild der Ideen geschaffen; die Ideen, die ewig und unvergänglich sind, sind die Urbilder; die Instanzen (die Gegenstände der empirisch wahrnehmbaren Welt) sind die (unvollkommenen) Abbilder. Für Evolution ist in diesem Bild von der Entstehung der Welt kein Platz. Nun ist es freilich unfair, einen antiken Autor mit den Erkenntnissen moderner Wissenschaft aufs Glatteis zu führen. Inhaltlich aber hat Platon hier ein Problem, das moderne Platonisten irgendwie meistern müssen.
Fazit: Wer Platon folgt, muss (über die Existenz der Ideen hinaus) auch noch an die Präexistenz und Unsterblichkeit der Seele, die Wiedergeburt, den Leib-Seele-Dualismus, die Wiedererinnerungslehre und an eine von einem Schöpfergott nach dem Vorbild der Ideen eingerichtete Ordnung der Natur glauben. Es wird kaum verwundern, dass schon Aristoteles nicht bereit war, all diese (bitteren) Pillen ohne Murren zu schlucken.
Für Touristen
Die Reste der von Platon gegründeten Akademie sind in einem Park im Nordwesten Athens zu sehen.
Wer es bunter, aber fiktiver mag, sollte in den Vatikan reisen, um sich Raffaels Fresco »Die Schule von Athen« anzusehen. In der Mitte dieses Bildes diskutieren Platon (mit erhobenem Zeigefinger Richtung Ideenhimmel deutend) und Aristoteles.
* Es ist üblich, Platon-Zitate mit der Stephanus-Paginierung nachzuweisen (Platons Werke in drei Bänden, herausgegeben von Henricus Stephanus, 1578). Die erste Ziffer gibt dabei die Seitenzahl an, die Buchstaben a–e beziehen sich auf die Abschnitte. Brauchbare deutsche Übersetzungen von Platons Werken geben diese Seiten- und Abschnittszahlen mit an.
* Das Wort »Ding« muss man hier ziemlich großzügig lesen: Denn schön können ja nicht nur Gegenstände, sondern auch Melodien, Menschen und Tiere, Landschaften, Theaterstücke und anderes sein. Alles, dem Schönheit zukommen kann, bezeichne ich hier, der Einfachheit halber, als Ding.
Kapitel 2
Der Viel-Denker
Aristoteles
Aristoteles (*384 v. Chr. in Stagira; † 322 v. Chr. in Chalkis) gehört nicht nur zu den Klassikern der Philosophie, er gehört auch zu den Viel-Denkern. Er hat zu vielen großen Themen der Philosophie etwas hinterlassen (darunter gleich drei Bücher zur Ethik und eine Metaphysik, die so inhaltsreich ist, dass man ein ganzes Philosophiestudium ausgehend von diesem Text bestreiten könnte) und auch naturwissenschaftlich geforscht. Vermutlich könnte man jedwede philosophische Arbeit mit irgendeinem Aristoteles-Zitat garnieren. Ferner steht sein Werk, was die Wirkung angeht, dem Werk seines Lehrers Platon in nichts nach. Im Mittelalter wurde er schlicht »der Philosoph« genannt; insbesondere galt die aristotelische Logik als verbindlich, bis sie von der Aussagen- und Prädikatenlogik Gottlob Freges (1848–1925) abgelöst wurde.
Ich greife aus diesem Gedankengebirge ein Thema heraus, das für uns heute ebenso aktuell ist wie für die Griechen zu Aristoteles’ Zeit: das glückliche Leben.
Aristoteles über Glück
In der Nikomachischen Ethik* beschäftigt sich Aristoteles mit der Frage, was Glück sei und was ein glückliches Leben ausmache. Das Wort »Glück« ist dabei nicht im Sinne von »glücklicher Zufall« zu verstehen, sondern im Sinne von »Glückseligkeit« oder »glückliches Leben«.
Die Nikomachische Ethik lässt sich im Großen und Ganzen in drei Teile von sehr unterschiedlicher Länge gliedern. Im ersten Teil (Buch I) arbeitet Aristoteles auf der Basis von handlungstheoretischen Überlegungen eine Grobform dessen heraus, was er für Glück hält. Im zweiten Teil (Buch II bis einschließlich erste Hälfte Buch X) beschäftigt sich Aristoteles mit verschiedenen Tüchtigkeiten des Charakters und des Denkens. Im dritten und letzten Teil (der zweiten Hälfte des X. Buches) befasst er sich mit dem Leben des Philosophen. Ich konzentriere mich im Folgenden auf den ersten Teil.
Aristoteles’ handlungstheoretische Vorüberlegungen
Aristoteles untersucht zunächst (kurz, aber gründlich) Handlungen überhaupt, ehe er auf das Glück zu sprechen kommt. (Warum er das tut, wird später deutlich werden.) Ohne irgendein Vorgeplänkel springt er mit der ihm eigenen Gründlichkeit schon mit den ersten Sätzen direkt in sein Thema.
Jedes praktische Können und jede wissenschaftliche Untersuchung, ebenso alles Handeln und Wählen strebt nach einem Gut, wie allgemein angenommen wird. Daher die richtige Bestimmung von »Gut« als »das Ziel, zu dem alles strebt«. [Nikomachische Ethik, 1094 a]*
Aristoteles zählt vier Arten von Handlungen auf, die für die weitere Untersuchung von Bedeutung sind.
Ich erläutere diese vier Begriffe kurz, denn Aristoteles ist (im Unterschied zu seinem Lehrer Platon) ein Freund von Terminologie.
1. Praktisches Können (techne; in einigen deutschen Ausgaben auch mit »Kunst« übersetzt): Unter praktischem Können ist ganz weit alles das zu verstehen, was eine gewisse Kunstfertigkeit erfordert, um etwas herzustellen. Kochen, Schreinern, Schlachten, Bilder malen, Stücke schreiben, einen Krieg führen. Beim praktischen Können kommt es nicht so sehr auf die Wahrheit einer Theorie, sondern auf die Brauchbarkeit einer Technik an.
2. Wissenschaftliche Untersuchung (methodos/episteme): Die wissenschaftlichen Disziplinen sind zu Aristoteles’ Zeit noch nicht so klar voneinander abgegrenzt wie heute. Alle Untersuchungen, die auf Wahrheit abzielen, fallen hierunter (Mathematik und Astronomie ebenso wie die Philosophie, Biologie oder Physik).
3. Handeln (praxis): Neben den herstellenden Handlungen des praktischen Könnens und den wissenschaftlichen Untersuchungen sieht Aristoteles noch Tätigkeiten, die weder etwas herstellen noch zur Wahrheitsfindung dienen, sondern als Tätigsein Selbstzweck sind, wie zum Beispiel das Spazierengehen. (Auf diesen Unterschied komme ich unten, S. 32, ausführlicher zu sprechen.)
4. Wählen (prohairesis): Man kann Dieses oder Jenes als sein Ziel wählen. Dann kann man entsprechend diesen oder jenen (günstigen oder ungünstigen, kurzen oder langen, schönen oder unbequemen) Weg zu diesem Ziel einschlagen. Das Wählen ist für Aristoteles eine Tätigkeit, die eng mit dem Beraten mit Freunden, Sachverstand und Klugheit zusammenhängt.
All diese Tätigkeiten sind nun, sagt Aristoteles, auf etwas gerichtet, das in irgendeiner Weise gut ist. Im zweiten Satz (»Daher die richtige Bestimmung von ›Gut‹ als ›das Ziel, zu dem alles strebt‹.«) bestimmt er den Begriff »Gut« (agathon) näher. Ein Gutes ist demnach das, was als Ziel vom Handelnden erstrebt wird. Es geht Aristoteles also, wenn er von »Gut« spricht, nicht allein um das sittlich-moralisch Gute. Er fasst seinen Begriff viel weiter: was gut für irgendetwas ist, das ist ein Gutes. Ein scharfes Messer ist ein gutes Messer, ein hervorragender Geiger ein guter Geiger usw.
Aristoteles hat in diesen zwei Sätzen auch schon den Gedanken eingeführt, dass die Handlungen jeweils auf irgendein Ziel (nämlich das jeweilige Gut) gerichtet sind. Dass dies tatsächlich der Fall und ein Unterschied zwischen einer Handlung und einer bloßen Bewegung ist, kann man sich mit folgenden Beispielen rasch klar machen: Wenn ich meinen Finger mit dem Ziel krümme, den Abzug zu drücken, und das mit dem Ziel, die Kugel abzufeuern, und das mit dem Ziel, den Hund meines Nachbarn zu erschießen, dann ist das Krümmen des Fingers Teil einer Handlung. Wenn mein Finger hingegen einfach zuckt, weil ich zuviel Kaffee getrunken habe, dann ist das keine Handlung (ich habe kein Ziel gewählt und krümme den Finger nicht mit der Absicht, irgendein Ziel zu erreichen), sondern eine körperliche Reaktion. (Wenn aufgrund meines nervösen, unwillkürlichen Fingerzuckens der Hund meines Nachbarn zu Tode kommt, ist das ein (mehr oder weniger tragischer) Unfall.)
Aristoteles geht in der Untersuchung der Handlungen einen Schritt weiter, indem er die Art von Zielen betrachtet, auf die Handlungen gerichtet sind.
Dabei zeigt sich aber ein Unterschied zwischen Ziel und Ziel: das eine Mal ist es das reine Tätig-sein (energeia), das andere Mal darüber hinaus das Ergebnis des Tätig-seins: das Werk (ergon). Wo es Ziele über das Tätig-sein hinaus gibt, da ist das Ergebnis naturgemäß wertvoller als das bloße Tätigsein. [Nikomachische Ethik, 1094 a]
Demnach gilt es, zwei Arten von Zielen zu unterscheiden:
1. Das Ziel einer Handlung kann ein Werk (ergon) sein.
Ein Haus ist zum Beispiel das Ziel des Bauens. Unter den Begriff »Werk« fallen für Aristoteles nicht nur Produkte wie Häuser, Geigen, Stühle usw., sondern auch Zustände wie zum Beispiel der Sieg (d.i. der Zustand nach der erfolgreichen Kriegsführung) oder die Gesundheit (Zustand des Körpers nach der erfolgreichen Behandlung durch den Arzt) oder die Ruhe (Zustand im Haus, nachdem ich den Hund meines Nachbarn erschossen habe).
2. Das Ziel einer Handlung kann aber auch ein Tätig-sein (energeia) sein.
Ziel des Spazierengehens ist das Spazierengehen. Das Spazierengehen ist selbst Ziel der Tätigkeit. Mein Sohn singt oft, um des Singens willen: Sein Gesang dient zu nichts und ist selbst das Ziel dieser Handlung.
Nach den Zielen unterscheidet Aristoteles auch die entsprechenden Handlungen, die auf diese Ziele gerichtet sind.
1a) »Poiesis« (Herstellen) nennt er die Handlungen, die um eines Werkes (ergon) willen – sei es Produkt oder Zustand – erfolgen.
2a) »Praxis« nennt er Handlungen, die um ihrer selbst willen erfolgen, bei denen also das Ziel der Handlung das Tätig-sein energeia) selbst ist.
Ferner nimmt Aristoteles bei dieser Einführung seiner handlungstheoretischen Grundbegriffe eine hierarchische Ordnung der Handlungen vor: Im Fall des Herstellens, der poiesis, ist das Werk »wertvoller« als das Tätig-sein. Statt »wertvoller« kann man auch sagen: Es ist erstrebenswerter. Denn um des Werkes willen wird ja die Tätigkeit überhaupt betrieben. (Wer nichts essen will, muss auch nicht kochen; wer keine Hütte braucht, muss auch keine bauen.)
Ob eine Handlung ein Fall von praxis oder ein Fall von poiesis ist, sieht man der Handlung allein nicht an: Man kann ja auch Kochen um des Kochens willen (das Essen, das dabei herauskommt, wäre dann nur ein Abfallprodukt des Tätigseins). Dieses Kochen wäre ein Fall von praxis. Und umgekehrt kann man auch spazierengehen um der Gesundheit willen: dieser Spaziergang wäre ein Fall von poiesis. Es kommt bei der Unterscheidung von Handlungen, die etwas herstellen, und Handlungen, die um ihrer selbst willen erfolgen, offenbar darauf an, mit welcher Absicht der Handelnde etwas tut.
Nun gibt es, so Aristoteles weiter, viele verschiedene Ziele, die Menschen durch ihr Handeln erreichen wollen. Manche Ziele streben wir nur um eines weiteren Zieles willen an, sodass sich Handlungsketten aufbauen, in denen das Ziel der Handlung A um das Ziel der Handlung B willen verfolgt wird. Dabei ist das jeweils höhere Ziel das eigentliche, das »zielhaftere« Ziel: das ist das, worum willen ich das vorherige erstrebt habe. Dreijährige Kinder in der Warum-Phase sind Meister darin, solche Handlungsketten zu entdecken. Der Vater tut etwas und das Kind fragt: K: Warum kaufst Du mir kein Eis?
V: Ich will das Geld sparen.
Der Vater nennt das Ziel (Geld sparen) seiner Handlung (Eisverweigerung).
K: Warum sparst Du soviel Geld?
V: Um mir eine gute Geige zu kaufen.
Der Vater nennt das Ziel (die Geige) seiner Handlung (Sparen).
K: Warum willst Du eine gute Geige kaufen?
V: Damit mein Geigenspiel schöner klingt als mit der alten. Der Vater nennt das Ziel (schöner Klang, gutes Musizieren) des Werkzeugs (Geige). Dabei ist das gute Musizieren, der schöne Klang, dem Vater offenbar wichtiger als das Geld und die Geige: Das Geld und die Geige selbst sind nur Mittel zum Zweck, ein Weg zum Ziel. Das oberste Ziel des Vaters ist aber der schöne Klang. Die Metapher von der Kette trägt dem Umstand Rechnung, dass man, um im Beispiel zu bleiben, nicht behaupten will, dass der Vater dem Sohn kein Eis kauft, damit seine Geige gut klingt.
Aristoteles macht an dieser Stelle einen Zusatz, der Schwierigkeiten in sich birgt:
Hierbei [bei den Handlungsketten] ist es gleichgültig, ob das Tätig-sein selber Ziel des Handelns ist oder etwas darüber hinaus […]. [Nikomachische Ethik, 1094 a]
Dieser Satz klingt wie ein Widerspruch zum Vorherigen: Aristoteles möchte offenbar sagen, dass auch die Handlungen, die um ihrer selbst willen erfolgen (Praxis-Handlungen), in eine Handlungskette eingeordnet werden können – und zwar nicht nur als letzte Handlung, um derentwillen die Kette überhaupt aufgebaut wurde. Aber die Handlungskette ist bestimmt als ein A tun um willen von B, also gerade nicht um seiner selbst willen. Aristoteles will aber hier Handlung A, die um ihrer selbst willen erfolgt, als gerichtet auf Ziel B verstehen. Somit geschieht die Handlung um ihrer selbst und nicht um ihrer selbst willen (und das ist ein Widerspruch).
Um diesen Widerspruch zu vermeiden führt J. L. Ackrill die Unterscheidung zwischen umschließenden Zielen (inclusive end) und dominanten Zielen (dominant end) ein. Ein dominantes Ziel ist das definitiv oberste, in einer Handlungskette letzte, um seiner selbst willen erstrebte Ziel. Dieses »dominiert« die ganze Handlungskette. Ein umschließendes Ziel steht nicht am Ende einer Handlungskette, sondern umfasst mehrere (mindestens zwei) Enden von verschiedenen Handlungsketten: Die Enden der Handlungsketten sind Teilziele, die nur dann, wenn sie alle eingeschlossen werden, das übergeordnete Ziel ergeben.
Ackrill bringt als Beispiel für ein inclusive end das Golfspielen:
Man denke an das Verhältnis vom Einlochen zum Golfspielen oder das vom Golfspielen zu den gelungenen Ferien. Man locht nicht ein, um (mit der Absicht) Golf zu spielen, so wie man einen Schläger kauft, um Golf zu spielen. Und diese Unterscheidung passt zu der zwischen Handlungen, die ein Werk, und solchen, die keines erzeugen. [Ackrill: »Aristotle on Eudaimonia«, S. 19. Übersetzung von mir]
Ich schlage den Ball nicht ins Loch, um Golf zu spielen, sondern das Einlochen ist Golfspielen, es ist ein Bestandteil des Spiels. Ziel des Einlochens ist das Einlochen, aber das Einlochen ist Teil eines übergeordneten Ziels (Golfspielen). Ebenso spiele ich Golf um des Golfspielens willen (das Golfspielen ist selbst Ziel der Handlung, ist ein Fall von praxis), aber das Golfen ist (zumindest für Herrn Ackrill) Teil eines übergeordneten Ziels, nämlich des gelungenen Urlaubs. So ist es möglich, eine Handlung, die Selbstzweckcharakter hat, einem übergeordneten, umfassenden Ziel unterzuordnen, ohne dass die untergeordnete Handlung den Selbstzweckcharakter dadurch verliert. Mit dieser Strukturanalyse im Rücken wird auch die Steigerung der Zielhaftigkeit von Aristoteles verständlich:
1. Stufe telos: Das (einfache) Ziel einer Handlung, das nicht um seiner selbst willen, sondern um eines anderen willen erstrebt wird (z.B. das Haus, als Ziel des Bauens).
2. Stufe telos teleion (das zielhaftere Ziel): Ich nenne diese Stufe »Endziel« (z.B. das behagliche Wohnen, um dessen willen das Haus gebaut und geheizt und gestrichen und möbliert wurde).
3. Stufe telos teloiotaton (d.i. der Superlativ, das zielhafteste Ziel*): Diese Stufe nenne ich »Letztziel«. Gemeint ist das Gut, das nur um seiner selbst willen und nicht auch um eines anderen Zieles willen erstrebt wird (z.B. das glückliche Leben, um dessen willen das behagliche Wohnen und der gute Job und die gelingende Ehe erstrebt werden.)
Mit Aristoteles können wir also in Bezug auf die Ziele zwei Unterscheidungen treffen: den Unterschied zwischen dominierendem Ziel und umfassendem Ziel und den Unterschied zwischen Endziel und Letztziel.
Das glückliche Leben
Nach diesen handlungstheoretischen Vorüberlegungen stellt Aristoteles die Frage, was das oberste für den Menschen durch sein Handeln erreichbare Gut sei. Das muss ein Gut sein, das nur um seiner selbst und nicht auch um eines weiteren Gutes willen erstrebt wird, denn sonst wäre ja dieses weitere Gut das oberste Gut. Diese Frage stellt er gleichsam in die Runde der politisch aktiven Männer Athens, die sich auf dem Marktplatz treffen, um über Politik und den Sinn des Lebens zu plaudern. (Dieses Publikum, die politisch aktiven männlichen Bürger Athens, zu deren Privilegien es zählt, sich nicht um ihr leibliches Wohl sorgen zu müssen (dafür haben sie Frauen und Sklaven), lässt sich aus den Beispielen und den Themenschwerpunkten als die Gruppe rekonstruieren, an die sich die Nikomachische Ethik richtet.)
Welches ist das höchste von alle Gütern, die man durch Handeln erreichen kann?
In seiner Benennung stimmen fast alle überein. »Das Glück« – so sagen die Leute, und so sagen die feineren Geister, wobei gutes Leben und gutes Handeln in eins gesetzt werden mit Glücklichsein. [1095 a]
Doch mit dieser Benennung endet die Einigkeit unter den Menschen auch schon. Denn jeder versteht etwas anderes unter einem glücklichen Leben. Das ist auch Aristoteles klar:
Aber was das Wesen des Glückes sei, darüber ist man unsicher, und die Antwort der Menge lautet anders als die des Denkers. Die Menge stellt sich etwas Handgreifliches und Augenfälliges darunter vor, zum Beispiel Lust, Wohlstand, Ehre: jeder etwas anderes. Bisweilen wechselt sogar ein und derselbe Mensch seine Meinung: wird er krank, so sieht er das Glück in der Gesundheit, ist er arm, dann im Reichtum. [1095 a]
Die Abschätzigkeit, mit der Aristoteles hier die »Vielen« oder die »Leute« behandelt, ist nicht wegzudiskutieren. Aristoteles war kein Sozialdemokrat. Ferner hielt er auch nichts von Leuten (und das können durchaus auch Aristokraten gewesen sein), die ihr Leben ausschließlich Sex and Drugs widmeten. Denn wer nur nach Lust und Lustgewinn strebt, unterscheidet sich in seinem Verhalten kaum von einem Hund oder Esel. (Daraus folgt nicht, dass Aristoteles Enthaltsamkeit predigt. Im Gegenteil: Sex and Drugs sind für ihn durchaus in Ordnung, aber in Maßen und nicht als einzige Beschäftigung – dafür ist das Leben schlicht zu kurz.)
Wenn wir die Wertung weglassen, hat er mit einer Beobachtung sicherlich Recht: Fragt man einen Kranken, was ihm zum Glück fehle, so wird er antworten: Gesundheit. Und ebenso steht es mit anderen Mängeln. Aristoteles tut das nicht als falsch ab; der Kranke hat ja Recht: Gesundheit ist das Ziel, das er erstrebt, und sie erscheint ihm sicherlich als das höchste Gut. Aber, so argumentiert Aristoteles weiter, es sind ja nicht alle Menschen, die gesund sind, automatisch glücklich. Also scheint Gesundheit nur ein Ziel zu sein, das zum Glück dazugehört, nicht aber das Glück selbst.
Nehmen wir die handlungstheoretischen Unterscheidungen von oben hinzu, so können wir mit Aristoteles sagen: Gesundheit, Wohlstand und vielleicht sogar Ehre sind für viele Menschen Endziele, das Glück aber ist ein Letztziel, das diese Endziele umfasst. Daraus lässt sich ein lebenspraktischer Tipp von Aristoteles ableiten: Wenn das Glück in einem mehrere Endziele umfassenden Letztziel zu suchen ist, dann sollte man sich überlegen, welche Endziele zum Glück gehören. Das heißt, Aristoteles versteht unter einem glücklichen, gelingenden Leben ein Leben nach dem Motto: »Dieses brauche ich und jenes darf nicht fehlen und ein Drittes muss auch dabei sein.« (Ich zum Beispiel brauche Gesundheit und Zeit zum Philosophieren und eine gute, gelingende Ehe und einen Beruf, in dem ich meine Fähigkeiten einbringen kann und Anerkennung von Sachverständigen finde.) Die jeweiligen Ziele (Gesundheit, Philosophieren, gelingende Ehe, Anerkennung im Beruf) sind Endziele, die um ihrer selbst und um des Glückes willen erstrebt werden. Diesen Lebens- und Glücksentwurf, der mehrere um ihrer selbst und des Glückes willen erstrebte Ziele zulässt und das Glück selbst als umschließendes Ziel (inclusive end) auffasst, nenne ich »aristotelisch«.
Es gibt auch einen Gegenentwurf: Der Asket oder Mystiker, der seine körperlichen und sozialen Bedürfnisse auf ein Minimum reduziert, um allein in einer einzigen Tätigkeit (in der Meditation, der Gottesschau, im Philosophieren oder Ähnlichem) sein Lebensglück sieht, führt ein nicht-aristotelisches Leben. Diesen Lebensentwurf und Glücksbegriff nenne ich »asketisch«. Aristoteles bestreitet nicht, dass der asketische Lebensentwurf ebenfalls zu einem gelingenden, glücklichen Leben führen kann.
Dass das Glück, ob asketisch oder aristotelisch verstanden, das Ziel ist, nach dem die Menschen streben, ist zwar richtig, aber jetzt wissen wir noch immer nicht, was ein glückliches Leben ausmacht. Aristoteles tastet sich weiter vor:
Vielleicht ist aber die Gleichsetzung von Glück und oberstem Gut nur ein Gemeinplatz, und es wird eine noch deutlichere Antwort auf die Frage nach seinem Wesen gewünscht. Dem kann entsprochen werden, indem man zu erfassen sucht, welches die dem Menschen eigentümliche Leistung ist. [1097 b]
Aristoteles schlägt hier folgenden Weg ein, um die Untersuchung voranzutreiben: Wir fragen nach dem guten Leben und dem guten Handeln, denn das hatte er, im Einklang mit der vorherrschenden Meinung, mit dem Glück gleichgesetzt. Wir kennen den Gebrauch des Wortes »gut« aus anderen Zusammenhängen: Wir sprechen vom guten Messer, guten Auge oder der guten Geige.





























