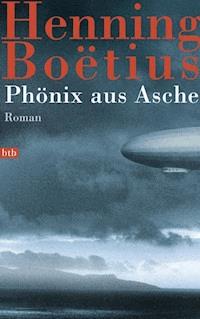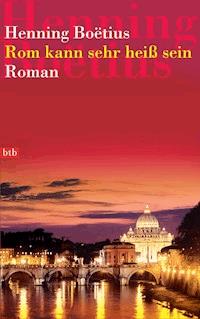Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Rom, Sommer 1947
Winter 1948
1
Copyright
Buch
Als im Mai 1937 das Luftschiff Hindenburg in Lakehurst bei New York in einem spektakulären Feuerball explodiert, ist dies wie ein Fanal des Untergangs der »Alten Welt« in den Feuerstürmen des nahenden Krieges. Nicht nur der Traum von einer friedlichen, grenzüberschreitenden Luftschiffahrt stirbt in den Flammen; auch zahlreiche Passagiere fallen dem Feuer zum Opfer, Liebende werden auseinander gerissen, Lebenspläne vernichtet.
Zehn Jahre später klingelt der schwedische Journalist und Schriftsteller Birger Lund an einer Wohnungstür in Rom. Er will zu Marta, jener Frau, die er damals an Bord der »Hindenburg« getroffen und in die er sich Hals über Kopf verliebt hatte. Nach ihrem Wiedersehen stellt sich zwischen den beiden bald wieder die alte Vertrautheit und Nähe ein. Doch Lund treibt es schon nach kurzer Zeit von neuem fort. Er hat nur ein Ziel: Er muss die wahre Ursache des Unglücks herausfinden, denn die offiziellen Erklärungen vermögen ihn nicht im Geringsten zu überzeugen.
Auf einer Insel in der Nordsee findet Lund schließlich Edmund Boysen, den Mann, der bei der Explosion der »Hindenburg« am Höhenruder stand. In einem langen Gespräch, in dem der verschlossene Boysen Lund seine außergewöhnliche Lebensgeschichte anvertraut, gelingt es den beiden grundverschiedenen Männern, dem Geheimnis der Katastrophe auf die Spur zu kommen. Nach all den Jahren kann Lund endlich wieder seinen Seelenfrieden finden und aufbrechen in ein neues Leben - vielleicht an der Seite von Marta, der Geliebten von einst.
Autor
Henning Boëtius, geboren 1939, lebt in Berlin. Er ist Autor zahlreicher, von der Kritik hochgelobter Romanbiographien und der Kriminalromane um den holländischen Inspektor Piet Hieronymus. Mit seinem erzählerischen Meisterwerk »Phönix aus Asche« gelang ihm der Durchbruch auch als literarischer Autor.
Henning Boëtius bei btb
Ich ist ein anderer. Das Leben des Arthur Rimbaud (72189) Der Gnom. Ein Lichtenberg-Roman (72408) · Lauras Bildnis. Roman (72803) · Schönheit der Verwilderung. Roman (72830) Undines Tod. Roman (72225)
Die Piet-Hieronymus-Romane:
Joiken. Roman (72548) · Das Rubinhalsband. Roman (72639) Der Walmann. Roman (72332)
Meinem Vater Eduard Boëtius gewidmet, dem Mann, der während der Katastrophe am
Höhenruder des ›Hindenburg‹ stand.
Erster Teil
Rom, Sommer 1947
Nie würde er ihren Gesichtsausdruck vergessen, als sich die Tür auf sein Klingeln hin öffnete, nachdem er die ausladende Marmortreppe bis in den vierten Stock emporgestiegen war. Die meisten Leute erschraken, wenn sie sein Gesicht sahen, und wirkten gleich darauf verlegen, weil sie sich ihre Reaktion nicht anmerken lassen wollten, ertappt bei Gefühlen zwischen Mitleid und Abscheu. Nicht so Marta. Die Freude in ihrem Angesicht war echt. Sie beruhte auf der Tatsache, dass sie ihn sofort erkannt hatte. Ein Wunder beinahe, denn er hatte, kurz nachdem die Narben der Gesichtsoperation verheilt waren, mehrfach getestet, ob man ihn wieder erkannte. Jedes Mal mit negativem Ergebnis. So war er damals nach New York gefahren und hatte einen alten Freund besucht, einen schwedischen Journalisten, der für das gleiche Blatt arbeitete wie er zuvor. Er hatte sich unter einem Vorwand und unter falschem Namen angemeldet und jener Berufskollege, mit dem er einst so manches Bier getrunken hatte, hatte keinerlei Verdacht geschöpft.
»Woran hast du mich erkannt?«, fragte er.
»Das war nicht schwer. Du hast eine einmalige Körperhaltung, Birger. Das ist mir damals schon aufgefallen, als ich dich auf der Gangway zum ersten Mal wahrnahm. Du bist auf eine stürmische Art zurückhaltend. Jemand voller Ungeduld, der zögert. Eine Art kühner Zweifler, du weißt, was ich meine?«
Er nickte. »Du beobachtest zu gut, Marta. Ich könnte dir nie etwas vormachen. Bedauerlicherweise. Denn ein solches Talent steht der Liebe im Wege. Aber leider bin ich nicht kühn. Nur der Zweifler stimmt. Wahrscheinlich hast du mich an meinen wie immer ungeputzten Schuhen erkannt.«
Sie lächelte wie jemand, der gerne verzeiht, und bat ihn mit einer fast zärtlichen Geste der Hand in die Wohnung hinein. Auch Birger Lund war ein guter Beobachter. Und so bemerkte er sehr schnell, dass diese wenigen Zimmer mit ihrem Inventar ein vollkommener Spiegel der Persönlichkeit ihrer Eigentümerin waren.
Martas Wohnung lag im obersten Stock eines auf dem höchsten Punkt Roms gelegenen Stadthauses in der Via San Martino ai Monti, nicht weit vom Bahnhof Termini. Einige Fenster gingen auf die beiden Kuppeln von Santa Maria Maggiore hinaus, die wie die Brüste einer auf dem Rücken schwimmenden Riesin aus dem Meer uralter, von Tauben besiedelter Schindeldächer ragten.
Wände und Installationen der Zimmer waren in einem trostlosen Zustand, der Verputz blasig, voller brauner Wasserflecken, an wenigen Stellen notdürftig ausgebessert. Kostbare Möbel, venezianische Schränkchen, erlesene Bilder, Grafiken zumeist, Ballerinen, Akte, auch abstrakte Motive, russische Suprematisten, standen in scharfem Kontrast zu dem heruntergekommenen Ambiente oder bildeten vielmehr mit ihm eine eigenartige Symbiose. Die Kunstwerke und Möbel liehen sich vom Zustand der Wände eine Patina, die ihre Wirkung steigerte, und gaben als Gegengeschenk dem Verfall eine interessante grafische Ausstrahlung zurück. So ist auch Marta, dachte Lund. Sie eint Widersprüche in sich, die normalerweise zu keinem Frieden bereit sind. Ihm war aufgefallen, dass ihr Gesicht deutlich älter geworden war, während sich ihr schlanker Körper in den zehn Jahren, die sie sich nicht gesehen hatten, verjüngt zu haben schien. Ein Mädchenkörper mit dem Kopf einer alten Frau, kein unangenehmer Kontrast, wie er fand, sondern auf eine faszinierende Weise miteinander harmonierend, so als seien Jugend und Alter dem Zwang des Nacheinanders enthoben und friedlich in anziehender Gleichzeitigkeit vereint.
»Ich habe natürlich gedacht, dass du tot bist! Die Zeitungen haben darüber berichtet. Du warst bei den Opfern, hieß es. So stark verbrannt, dass du der Letzte warst, den man identifizieren konnte.«
»Ich bin nie im eigentlichen Sinne identifiziert worden. Das Ganze war pure Mathematik. Die Anzahl der Passagiere plus die Anzahl der Besatzungsmitglieder minus der Anzahl der Überlebenden, minus der Anzahl der identifizierten Leichen. Ein Name blieb übrig, Birger Lund. Und einige verkohlte Knochen. Also war es nur logisch, dass man sie in den Sarg tat, den man nach Schweden an meinen Bruder schickte. Die Rechnung hatte jedoch einen Haken. Sie stimmte nur für den Fall, dass außer den offiziell registrierten Personen nicht noch jemand an Bord war. Ein Unbekannter, ein blinder Passagier.«
»Das ist doch unmöglich, Birger! Ein Luftschiff ist eine sehr überschaubare Welt.«
»Das ist nicht wahr. Hast du nie von dieser unglaublichen Geschichte gehört? Ein Junge hat sich während der ersten Atlantiküberquerung des berühmten Luftschiffkapitäns Eckener mit dem ›Grafen Zeppelin‹ auf der Rückreise als blinder Passagier eingeschmuggelt und mußte dann seine Überfahrt als Küchenjunge verdienen. Außerdem waren bei unserer Unglücksfahrt bei weitem nicht alle Kammern belegt. Ich glaube übrigens, sie haben ungefähr dort, wo meine Kammer gelegen hatte, tatsächlich menschliche Überreste gefunden und unter meinem Namen bestattet. Schwärzliche Aschereste, kleine Flocken, gewichtslos, ein paar Knochen, aus denen das Mark verschwunden war. Hieroglyphen einer Existenz, die mir durchaus angemessen ist.«
»Und die fiktiven Memoiren der Königin Christine von Schweden? Dein Roman? Wie hast du ihn noch genannt? War es nicht ›Rose aus Asche‹?«
»Ja. Ein prophetischer Titel. Ich bin froh, dass das Manuskript mit verbrannt ist, wenn auch auf eine ziemlich pathetische Art.«
»Immer noch der liebe Zyniker, Birger. Hast du das Projekt aufgegeben?«
»Ja. Man sollte sich kein Leben ausdenken, das einmal wirklich war. Das ist Blasphemie. Ich habe in den letzten zehn Jahren keine Zeile geschrieben, weil es mich Kraft genug gekostet hat, meine eigene Vergangenheit zu entziffern. Übrigens eine ziemlich langweilige Geschichte.«
Später saßen sie am Fenster und tranken Wein in kleinen Schlucken. »Rom ist eine Stadt, die atmet«, sagte Marta. »Du brauchst eine Weile, um es wahrzunehmen. Die Brust eines Schläfers, die sich fast unmerklich hebt und senkt, weil er so tief schläft und dabei süße Träume hat. Rom schläft tief und träumt von seiner glorreichen Vergangenheit. Es lächelt dabei unwillkürlich, du siehst es, wenn du ganz früh aufstehst und auf den Monte Gianicolo gehst. In der Morgendämmerung lächelt die Stadt. Sie weiß, dass sie ein ewiges Licht hütet. Sie schützt es mit der hohlen Hand der Wirklichkeit. Ich glaube, wenn du glücklich sein willst, musst du lernen, dir Dinge vorzustellen, die wirklicher sind als die Wirklichkeit.« Sie sah ihren Gast an mit einem Lächeln, das ihm vorkam wie jenes geheimnisvolle Lächeln, von dem sie gerade geredet hatte.
»Ich werde dir bald die Wunden der Metropole zeigen«, sagte Marta. »Die Ruinen, das, was man das antike Rom nennt. Alles, was vom alten Gesicht der Stadt übrig geblieben ist, Wunden, deinen vergleichbar. Sie sind schön. Und sie heilen nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Das führt dazu, dass sie dem neuen Gesicht der Stadt ihren Ausdruck aufzwingen. Was machen übrigens deine seelischen Wunden? Denkst du nicht immer noch an deine Söhne? An deine Frau?«
»Das stimmt. Es vergeht kein Tag ohne das Treibgut der Erinnerungen. Aber ich will sie nicht wieder sehen. Um keinen Preis. Alles, was wir miteinander zu tun haben, ist die Vergangenheit. Eine Brücke über einen Fluss macht keinen Sinn mehr, wenn das eine Ufer verschwunden ist.«
Marta legte die Hand auf Olsens Unterarm. »Du bist immer noch in den Tod verliebt?«
»Ich war nie in ihn verliebt. Er ist hässlich und langweilig.«
»Ich meine nicht in deinen, sondern in den dieser schwedischen Königin. Übrigens ist Christines Sterbezimmer im Palazzo Corsini wieder zugänglich. Die Deckenmalereien sind bemerkenswert. Wenn die Sterbende sie im Blick hatte, muss sie sich im Paradies der Farben gewähnt haben.«
»Oder in der Hölle der Formen. Aber sie wird unter einem Baldachin gelegen haben.«
Er war müde wie schon seit langem nicht mehr. Eine graue Müdigkeit, die nicht der Anstrengung, sondern der Leere entsprang. Tiefe Erschöpfung war der passende Ausdruck. Sein Blick fiel auf ein helles Rechteck an der Wand. Dort musste ein Bild gehangen haben. Marta war seinem Blick gefolgt.
»Weißt du, was dort war? Ein Foto von dir, das ich mit meiner Leica gemacht habe, kurz nachdem du mir den Eisberg gezeigt hattest. Ich habe es erst gestern abgenommen, weil es mich zu oft zwang, an dich zu denken. Ist das nun Zufall? Oder die Ahnung, dass ich es bald mit einem anderen Gesicht zu tun haben würde, einer fremden Maske, hinter der das Hirn vermutlich immer noch die gleichen Gedanken hegt?«
Später lag er im schmalen Bett und schloss die Augen. Nun war die ganze Welt ein weißer Bilderschatten. Als Marta neben ihn schlüpfte, war es, als ob dieser Schatten einen farbigen Rand bekam, eine prismatische Brechung, so immateriell und schön wie ein Regenbogen.
Am nächsten Tag begann Marta, ihm Rom zu erklären. »Es ist keine Stadt, sondern ein Raumschiff, mit dem du durch die Zeiten reisen kannst. Unter Umständen begegnest du einem Imperator, der heute als Kellner arbeitet. Du kannst dir Rom auch als eine Art Mühlstein vorstellen, der sich um seinen Mittelpunkt dreht und dabei alles Korn fein mahlt, das Korn deiner Gefühle, deiner Ansichten, deiner Hoffnungen und deiner Erinnerungen. Mittelpunkt und Drehachse ist das Kolosseum. Der Schwerpunkt, von dem alle Kraftlinien wie Speichen ausgehen, die dieses Chaos aus Häusern, Straßen, Menschen zusammenhalten. Ich bin einmal ohne aufzublicken durch die Stadt gelaufen, mit den Händen tastend wie eine Blinde, und ich bin schließlich an diesem Bauwerk gelandet. Wie ein Span aus Eisen, der vom Magneten eingefangen wird. Du musst dich ihm ohne all die Gedanken nähern, die dir deine Schulbildung vermutlich verpasst hat, also ohne diese falschen Bilder von Gladiatorenkämpfen, von blutrünstigen Bestien, die angeblich auf arme Christen losgelassen wurden. Du musst nur die Hand ausstrecken und die Steine anfassen, dann fühlst du, dass du in die Zeit eintauchst wie in einen stillen Teich. Ein Wasser, kühl, moorig. All diese gelebten Schicksale mit ihren Träumen, die Großtaten der Herrscher, die Kümmernisse der Ohnmächtigen, die Lust der Paare, die Illusionen und enttäuschten Hoffnungen haben dieses Lethewasser erzeugt. Tauch ein die Hand, den Arm, mein Freund, und du wirst erfrischt und neugeboren wiederkehren in deine Gegenwart.«
Sie verband ihm die Augen und führte ihn durch die Stadt. Die Leute machten respektvoll Platz. In der Nähe des Kolosseums ließ sie seine Hand los. Und wirklich, er fand den Weg jetzt allein, spürte die Gravitation des Bauwerks wie ein Wünschelrutengänger eine Wasserader. Als er an der mächtigen Steinwand lehnte, sie mit den Händen betastete, fühlte er sich ruhig und zufrieden wie schon lange nicht mehr. Marta war neben ihm und hörte ihm zu.
»Eigentlich bin ich damals vor zehn Jahren wirklich gestorben. Verbrannt, meine Asche in alle Winde zerstreut. Ich habe das Krematorium hinter mir, das Fegefeuer, die Hölle, ganz wie du willst. Mein zweites Leben, wenn es denn je stattfindet, wird nichts zu tun haben mit meinem ersten. Die Erinnerungen, die ich an meine Kinder habe, an meine Familie, meine Frau, meinen Bruder, sie sind seltsam blass und verwaschen. Ruinierte Fresken der Vergangenheit. Man müsste sie mühsam restaurieren, wobei die Gefahr besteht, dass man sie stark verfälscht.«
Ihren Vorschlag, das Sterbezimmer der Christine von Schweden zu besichtigen, lehnte er ab. »Es ist zu früh, Marta«, sagte er. »Du weißt, dass sie in den letzten Tagen und Nächten ihres Lebens ständig die Hand ihres Freundes, des Kardinals Azzolini, gehalten hat. Er muss höllische Angst gehabt haben, dass der Tod durch diese Berührung Eingang fände in seinen Leib. Sie wollte ihn mitnehmen, zweifellos.«
Am nächsten Tag wurde er krank. Er hatte Schmerzen im Gesicht. Als ob hinter seinem neuen Gesicht das alte wuchs. Eine Maske hinter der Maske, die sie zu sprengen drohte. Es begann mit einem dumpfen Schmerz, dem Gefühl, dass sich Wasser hinter der Stirn und den Wangen sammelte. Der Druck wurde immer schlimmer. Die Gesichtshaut rötete sich, wurde glänzend, spannte, ein Kürbiskopf mit ausgeschnittenen Augenlöchern wie für Haloween gemacht, ein Ballon, der aufgeblasen wird bis zum Moment des Platzens. Er stand vor dem Spiegel und hatte eine Nadel in der Hand, mit der er am liebsten in diesen Ballon gestochen hätte. Mit einem Knall das ganze aufgeblähte Monstrum an Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen in kleine, schrumplige Fetzen zerplatzen lassen. Marta holte einen Arzt, der kühlende Umschläge verordnete und ein starkes Schmerzmittel. »Sie haben die Gicht«, sagte der Mann, »aber rätselhafter Weise nicht im Fuß, wie es sich gehört, sondern im Kopf.«
Als es nicht besser wurde, fuhren sie mit dem Zug zu einem der kleinen Badeorte an der Pontinischen Küste. Hoch auf dem Felsen lag der weiß gekalkte Ort. Eine Kindervision aus Stein. Es gab mehr Katzen hier als Einwohner. Die Fischer schienen mit dem Flicken ihrer Netze die Stunden und Tage wie einen Schwarm seltener Fische fangen zu wollen. Alte Männer, für die der gerade zu Ende gegangene Krieg ein Gerücht geblieben war. Unterhalb des Dorfes direkt am Meer ein Hotel. Nur wenige Gäste. Marta und Lund saßen stundenlang im großen, hellen Speisesaal und sahen auf das Meer hinaus. Die Vorhänge bauschten sich wie Segel im Wind, wenn jemand die Tür zur Terrasse öffnete. Irgendwo spielte ein Grammofon Opernmelodien. Marta hielt seine Hand manchmal so sanft, dass er ihre Finger nicht anders spürte als seine eigenen, so, als seien ihre Hände zu einem Doppelglied verschmolzen. In solchen Momenten, die für Olsen den Charakter des Vergehens völlig verloren hatten, glaubte er, seine Person löse sich auf wie ein Klumpen Lehm im Wasser. Die Konturen wurden weicher, verschwanden schließlich ganz, nur noch Trübung, Schlieren waren übrig. Wenn ich jetzt aufstehe und zur Tür hinausgehe, werde ich im Seewind trocknen und ein anderer sein, dachte er. Er traute sich diesen Schritt noch nicht zu. Erst gegen Abend, als die Sonne tief stand und lauter kleine Silbermünzen lässig auf den blauen Spieltisch des Meeres warf, ging er hinaus und legte sich in den Sand, ein Handtuch über das brennende Gesicht gebreitet, das Marta hin und wieder aus einer Flasche Mineralwasser befeuchtete. »Was gibt es hier eigentlich zu gewinnen«, sagte er laut und deutete aufs Meer, »sein Einsatz scheint mir viel zu hoch zu sein, all diese kostbaren Lichtreflexe, die kann es doch nicht einfach nur an uns verschenken.« Marta lächelte auf ihre typische Weise. Sphinxhaft. Jemand, der es genießt, die Lösung eines Rätsels für sich zu behalten.
»Glaubst du, dass es wieder irgendwann Krieg geben wird?«, fragte Lund. Marta lächelte immer noch ihr Sphinxlächeln. »Wir sind schon mittendrin«, sagte sie. »Auch wenn keine Bomben fallen, ihre Flugbahnen sind alle schon längst gezogen, siehst du, dort zum Beispiel.« Er zog das Handtuch vorsichtig vom Gesicht und folgte der Geste ihres ausgestreckten Armes. Sie deutete nach Norden, wo der Himmel in der untergehenden Sonne wie Feuer brannte.
Es gab Tage, an denen er sich das Gesicht nicht kühlen musste. Er lag auf dem Liegestuhl und überließ sich ungeschützt dem leichten Nieselregen. Es war mild, und der Horizont war nicht zu erkennen, auch die Insel nicht, die an klaren Tagen eine markante und zugleich geheimnisvolle Silhouette zeigte und dadurch den Wunsch erweckte, mit einem Boot dorthin zu fahren. Marta saß unter dem Sonnenschirm und las ihm aus einem Buch vor. Es handelte von Menschen am Meer. Was sie sagten und taten war merkwürdig blass und verschwommen, als sei es schon vergangen, ehe es geschah oder ausgesprochen war. Die Sprache des Textes war dabei ruhig und gelassen wie die eines älteren, illusionslosen Mannes, voller Erfahrung und Distanz. Lund gefiel es, wie sich die Sätze mit dem Geräusch der Wellen verbanden. »Es ist von einem meiner Lieblingsautoren. Er hat diesen Text während des Krieges geschrieben. Ein so ruhiges, stilles Werk! Vielleicht, weil er die Gewalt um sich nicht anders ertrug. Die Faschisten mochten ihn nicht. Sie haben ihn nach Kalabrien verbannt.«
»Wie alt war er damals?«
»Dreiunddreißig.«
»Ich finde, er klingt uralt, wie jemand, der das Leben belächelt, weil er es fast schon hinter sich hat.«
»Könnte es nicht sein, dass es Menschen gibt, die rückwärts leben, die von hinten anfangen? Bei ihrem Tod?«
»Das wäre auf jeden Fall der umständlichste Weg, sich seiner Geburt zu nähern. Es kommt mir fast vor, dass auch ich zu diesen Unglücklich-Glücklichen gehöre.«
»Wir sollten reisen«, sagte Marta eines Morgens, als er schon fast wieder ganz gesund war. Sie stand in der Tür mit einer Tüte voller Prospekte. »Was hältst du von Australien oder Kanada? Oder den Aleuten? Aber erst musst du mir erzählen, was mit dir geschehen ist. Damals, nach dem Unglück. Als du tot warst und dennoch am Leben.«
»Wie soll ich etwas beschreiben, dessen Wesen ich nicht kenne. Fakten werden nichtssagend, wenn man sie auf keine Person beziehen kann, die man kennt.«
»Du weichst aus, Birger, oder soll ich dich lieber mit deinem neuen Namen nennen. Per Olsen?«
»Woher weißt du?«
»Ich habe in deine Jacke gegriffen und deine Papiere herausgezogen. So einfach ist es, dir auf die Schliche zu kommen! Die Fälschung ist gut. Wie bist du an sie gekommen?«
»Per Olsen hat es wirklich gegeben. Ein norwegischer Seemann, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Der Pass ist echt. Zufällig hatte er meine Statur. Das Gesicht war nach dem Unfall sowieso kein Problem mehr.«
Er schwieg plötzlich, während draußen ein Regenschauer den Strand dunkel färbte und Windböen an den blauen Pilzen der Schirme zerrten. »Ich möchte darüber nicht reden. Es nimmt mir die Kraft, der Sache auf den Grund zu gehen.«
Lund wurde von Tag zu Tag schweigsamer. Marta vermied es, ihn nach seinen Gefühlen, Gedanken oder gar Plänen zu fragen. Sie saßen nebeneinander in ihren Liegestühlen. Marta las, er starrte aufs Wasser. Die Tage waren jetzt makellos. Der Himmel schien sich im Meer zu spiegeln und das Meer im Himmel. Dort, wo sich beide berührten wie zwei Bilder, die eine Figur wirft, wenn sie sich an einen Spiegel lehnt, schwamm die Insel. Birger kam es vor, als ob sie leicht hin und her schwoite wie ein Schiff, das in einer Strömung vor Anker liegt. Die Sehnsucht, sie zu besuchen, wuchs in ihm. Marta schien dies zu spüren. »Wir können hinfahren«, sagte sie. »Es ist nur eine Tagesreise.«
»Es gibt noch eine andere Insel, die mich brennend interessiert«, sagte Lund. »Man sieht sie nicht von hier aus. Sie liegt hinter dem Horizont.«
In Rom zurück, schien Lund verändert. Er lachte viel und fuhr tagsüber mit den Bussen in der Stadt herum, die Linien scheinbar ziellos wechselnd. »Ich danke dir, Marta, dass du dich um mich gekümmert hast«, sagte er schließlich eines Morgens. »Rom ist wirklich schön. Es wimmelt hier von Augenblicken, deshalb nennt man es zu Recht die ›Ewige Stadt‹.«
Marta sah ihm zu, wie er seinen Koffer packte. »Ich werde zur Insel fahren«, sagte er. »Aber allein. Es ist übrigens die andere Insel. Die hinter dem Horizont.«
»Du willst sie herausfinden? Die Ursache? Du glaubst nicht, dass die offiziellen Erklärungen stimmen?«
»So ist es. Ich habe noch nie einen größeren Unsinn gelesen als den Bericht der Untersuchungskommission nach der Katastrophe. Die Erklärungen sind unlogisch, widersprüchlich. Ich vermute, dass sie von der wahren Ursache ablenken sollen. Es ist ein politisches Papier.«
»Du suchst eine einfache Erklärung? Eine Erklärung, die mit dem Lundschen Gesetz vereinbar ist?«
Er lachte. »Dass du dich daran noch erinnern kannst!«
»Ich sehe den Eisberg unter uns noch ganz deutlich vor mir, als du mir das Lundsche Gesetz anhand der Ermordung Caesars erklärt hast! Es lautet: ›Je größer die Katastrophe, desto einfacher ihre Ursache.‹ Gilt dieses Gesetz auch für Beziehungen?«
Er nahm sie in die Arme und hielt sie vorsichtig eine Weile fest, so wie man etwas Dünnschaliges und darum sehr Kostbares hält.
»In der Umkehrung durchaus«, sagte er. »Je einfacher die Gefühle, umso größer die daraus folgende Katastrophe.«
Sie atmete erleichtert auf. »Dann stehen uns noch harmonische Tage bevor, Birger. Wenn wir uns überhaupt je wieder sehen. Meine Gefühle für dich sind nämlich ziemlich kompliziert!«
Sie gingen zum Bahnhof. Er war eine einzige Baustelle. Die starren Seitenflügel, die noch unter Mussolini entstanden waren, wirkten wie Gefängnismauern, in denen man den Freiheitsdrang zahlloser Menschen eingesperrt hatte. Die Bahnhofshalle mit dem wellenförmigen Dach war der Gefängnishof, von hier aus fanden die Ausbrüche statt.
Im Bahnhofsrestaurant machte Marta einen letzten Versuch, ihn umzustimmen. »Wir haben viel über die Liebe gesprochen auf dem ›Hindenburg‹. Im Rauchersalon zum Beispiel, direkt vor einem seltsamen Bild. Es war Teil der Wanddekoration.«
»Im Raucherzimmer! Ja, jetzt entsinne ich mich. Du meinst das Luftschiff von Francesco Lana. Liebe, welch ungenaues Wort. Undefinierbar wie die Gefühle, die es bezeichnet. Wann wird aus Zuneigung Liebe? Vielleicht eine Frage der Entfernung. Wie bei einer Wolke, deren Form man nicht wahrnimmt, wenn man in ihr steckt. Ich muss damals närrisch gewesen sein. Vielleicht lag es an diesem verrückten Luftschiff auf dem Bild. Es hing, soweit ich mich entsinne, an fünf luftleeren Kugeln, fuhr unter Segeln wie ein richtiges Schiff und wurde zusätzlich mit großen Vogelschwingen gerudert. Ich würde mich sofort dieser Luftbarke anvertrauen und dich bitten mitzukommen. Aber leider ist die Fantasie nur in der Fantasie real.«
Sie ergriff seine Hand und blickte ihn an. »Wollen wir es nicht doch versuchen? Vielleicht, nachdem wir uns auf einer langen Reise um die Welt geprüft haben?«
»Marta, es geht nicht. Ich muss tun, was ich vorhabe. Um meines neuen Lebens willen. Wenn man hinausgeht ins Freie, schließt man die Tür hinter sich ab, verstehst du. Ich werde erst eine Zukunft haben, wenn ich über eine Vergangenheit verfüge, die ich begreife. Ich ertrage es nicht, dass mich etwas aus der Bahn geworfen hat, das ganz offensichtlich mehr war als ein bloßer Zufall. Ich will die Hintergründe kennen von diesem angeblichen Unfall.«
Der Abschied war filmreif. Als er sich aus ihrer Umarmung löste, schien es Marta, dass sich Birger Lund in einen Fremden mit Namen Per Olsen verwandelte. Sie spürte förmlich, wie jede einzelne Faser seines Körpers eine verblüffende Wandlung durchmachte. »Kommst du wieder?«, rief sie in die Dampfwolke, in die die Lokomotive den Bahnsteig hüllte. Er antwortete nicht. »Und als wer kommst du zurück? Als Lund oder als Olsen? Oder gar als beide?« Ihre Stimme versank in dem Zischen, das die Anfahrt des Zuges begleitete.
Er fuhr nach Frankfurt. Die deutschen Züge waren dreckig und überfüllt. Als Olsen im Hauptbahnhof ankam, sah er, welche Zerstörung der Krieg angerichtet hatte. Was sich seinen Augen darbot, war das Werk eines grausamen Künstlers. Die vielen stehen gebliebenen Kamine, offensichtlich statisch die stabilste Partie eines Hauses, glichen Stelen des Unheils, Säulen einer von vulkanischer Asche verschütteten und wieder ausgegrabenen Stadt. Wie sollte hier je wieder normales Leben möglich sein? Die zahllosen leeren Fenster in den Fassaden erinnerten an frisch ausgehobene Gräber. Überall zwischen den Trümmern wuchs Grün, Pflanzen, die offensichtlich das Biotop einer in Asche gesunkenen Zivilisation mit ihrer ungeheuren Lebenskraft eroberten.
Zwischen den hohen Mauerresten eines Hauses übte eine Truppe von Trapezkünstlern. Ein Seil war gespannt, und ein Mann und eine Frau balancierten darüber. Als Olsen vor den Trümmern des Gebäudes am Bahnhofsplatz stand, in dem sich einst die Büroräume der Deutschen Zeppelinreederei befunden hatten, kam er sich selbst vor wie ein Mitglied eines Zirkus, in dem alles umgekehrt verlief als gewöhnlich. Die komischen Handlungen des Clowns stürzten das Publikum in tiefe Trauer. Der Dompteur sprang zur Peitsche des Tigers durch einen Flammenring, und der Zauberkünstler holte einen schwarzen Zylinder aus einem weißen Kaninchen, das dabei starb. Der Seiltänzer aber verlor den Halt, schwirrte wie eine Taube zur Spitze des Zirkuszeltes und verschwand dort durch eine kleine Öffnung.
Gegen Abend, als der Bahnhofsplatz fast leer von Menschen war, kroch Olsen unbemerkt durch eine der Fensterhöhlen in die Ruine und begann, im Schutt herumzuwühlen. Die Steine rochen immer noch verbrannt. Ein großer stählerner Schreibtisch stand fast unversehrt zwischen wuchernden Brennnesseln unter den herabhängenden Eisenträgern einer geborstenen Decke. Olsen begann, die klemmenden Schubladen mit einem Brecheisen aufzustemmen. Schwarze Asche stäubte. Als Olsen die Taschenlampe anknipste, leuchtete ein glänzender Gegenstand auf. Länglich und rund. Die leere Hülse eines Lippenstiftes. Olsen roch an ihr. Den schwachen Parfümgeruch bildete er sich vermutlich ein. Stecknadeln in einem Heuhaufen riechen nicht.
Später rollte er seinen amerikanischen Armeeschlafsack aus und kroch hinein. Zwischen den Lücken im Dach erblickte er einen kostbaren Baldachin aus dunkelblauem Samt mit aufgestickten goldenen Sternbildern.
Er fuhr nach Berlin. Die Stadt glich einem zerstörten Termitenbau. Überall krochen Menschen herum wie Insekten, bewegten anscheinend planlos dies und das mit der Hand, fuhren es mit der Schubkarre umher. So sah es aus, wenn winzige Ameisen mit aberwitziger Geduld und perverser Zielstrebigkeit viel zu große Gegenstände durch einen Dschungel von Grashalmen schleppten. Irgendwo Musik. Sie kam von oben. Ein junger Mann spielte Klavier im dritten Stock eines Hauses, dessen Außenwand fehlte. Es war Sommer, und die von Asche reichlich gedüngte Natur explodierte auch hier zwischen den Trümmern in wahren Orgien der Fruchtbarkeit. Unkraut ist das Prinzip des Überlebens, dachte Olsen. Ein mörderisches Prinzip. Es tötet die Eleganz, die Schönheit, vielleicht sogar das Glück. Aber es bildet die Voraussetzung dafür, dass neues Leben entsteht.
Er fragte sich durch. Dabei fiel ihm eine Art kollektive Gedächtnislosigkeit der Menschen auf. Als hätten alle mit einem Schlag ihr Erinnerungsvermögen eingebüßt. Jedenfalls galt dies für die großen Zusammenhänge. Umso genauer erinnerte man sich an Kleinigkeiten. Wo die Marmeladengläser im zerbombten Keller gestanden hatten, konnte man sagen, aber niemand wollte sich daran erinnern, wo das Luftfahrtministerium gelegen hatte. Die meisten schienen den Namen Göring nie im Leben gehört zu haben. Offenbar schien diese Gedächtnisschwäche den Lebensgeistern zugute zu kommen.
Er brachte viel Zeit damit zu, nach Spuren zu forschen. Er grub in verschiedenen Trümmergrundstücken, ohne recht zu wissen, was er suchte. Er hatte einfach nur das Bedürfnis danach, so wie ein blinder Goldgräber, der von seiner Leidenschaft nicht lassen kann. Einmal stieß er zufällig auf ein angesengtes Exemplar der ›Berliner Illustrierten Zeitung‹ vom 20. Mai 1937. Auf der Titelseite das Foto des neugekrönten Königs Georg IV., umgeben von Adligen, die ihm nach dem Krönungsakt in der Westminster-Abtei in London huldigten. Georg IV. sah aus wie Buster Keaton, der den König spielt. Todtraurig und stumm. Die verkörperte Hoffnungslosigkeit als das andere Prinzip neben der Gedächtnisschwäche, das dem Überlebenswillen hilfreich zur Seite stand. Hoffnungslosigkeit kann die Lebensgeister auf eine Weise paralysieren, dass man sich viel besser im Dschungel der Ereignisse zurechtfindet, dachte Lund.
Erst auf Seite zwei und drei der Zeitschrift die Katastrophe von Lakehurst. Das war ungewöhnlich. Bei allen Zeitungen im Ausland war es genau umgekehrt gewesen. Ein Versuch der Nazis, das Thema herunterzuspielen? Olsens Staunen wuchs, als er auf den nächsten Seiten Bilder von Scheiterhaufen sah mit der Unterschrift ›Der Winter brennt‹. Es ging um ein Frühlingsfest, die Austreibungsfeuer des Winters. War das Verbrennen des Luftschiffs auch ein solches Austreibungsfeuer gewesen?
Auf der letzten Seite illustrierte Witze von abgrundtiefer Dummheit. Der Tanz der Scheuerfrauen. Fünf gleich gekleidete dicke Frauen in Tanzpose. Unterschrift: ›Noch vierzehn Tage Training, und wir können dem Chef unsere Nummer vorführen!‹ Das Absinken der Pointen ist ein sicheres Indiz für einen nahenden Krieg, dachte Olsen.
Er gab auf und löste eine Fahrkarte nach Hamburg. »Der Mann am Höhenruder. The Elevatorman«, flüsterte er. »Vielleicht kann er mir weiterhelfen.« Wie so oft in letzter Zeit holte er jenes Zeitungsfoto aus seiner Jackentasche, das er für eine wichtige Spur hielt. Es zeigte Überlebende der Crew kurz nach der Katastrophe, aufgestellt wie zu einem Klassenfoto. Einige der Männer steckten in zu großen Anzügen, wahrscheinlich Geschenke der Amerikaner, weil ihre Kleidung mit dem Schiff verbrannt war. Andere trugen Khakizeug. Nur wenige hatten ihre Uniform an. Die Männer hatten Durchschnittsgesichter. Man sah ihnen nicht an, was sie Stunden zuvor durchgemacht hatten. Es hätten auch die Mitglieder eines Betriebsausfluges sein können. Nur einer fiel heraus durch sein Gesicht und seine Körperhaltung. Olsen hatte herausgefunden, wer es war. Der Mann hieß Edmund Boysen, war damals siebenundzwanzig Jahre alt, stammte von einer Nordseeinsel und war Navigator auf dem ›Hindenburg‹ gewesen. In den Zeitungen wurde er als ›Elevatorman‹ bezeichnet. Schon das war ein kleines Rätsel, denn eigentlich hatte ein Offizier am Höhenruder nichts zu suchen. Der Mann sah auffallend gut aus. Wie ein Filmschauspieler. Sein maskenhaftes Gesicht wirkte verschlossen, voller dunkler, nach innen gewandter Energie. Seine dichten, dunklen Haare waren vorbildlich gescheitelt. Er trug Uniform. Hemd und Krawatte machten einen eleganten Eindruck. Seine Körperhaltung wirkte steif und sperrig, fast provozierend korrekt. So sieht jemand aus, der etwas zu verbergen hat, dachte Olsen. Er vermutete, dass sich Boysen wieder in seiner Heimat befand, falls er den Krieg überlebt hatte und nicht irgendwo in Gefangenschaft war. Nach einem Weltuntergang wie diesem Krieg würde sich ein Insulaner auf seine begrenzte Inselwelt zurückziehen, mutmaßte Olsen. Die Chancen standen gut, ihn dort anzutreffen. Doch gestand er sich ein, dass dieser Strohhalm viel zu schwach war, um sich ernsthaft an ihn zu klammern.
In einer Mischung aus Trotz und Hilflosigkeit griff Olsen sein altes Projekt wieder auf. Die fiktiven Memoiren der Königin Christine. Er gab ihnen jetzt die Form eines Tagebuches, das in Wahrheit sein eigenes war.
Winter 1948
1
»Sie werden sie nicht für eine Insel halten. Eher für eine Wolkenbank am westlichen Horizont. Eine schwerelose Erscheinung mit Konturen, die an den Rändern zerfließen. Für eine Insel scheint ihr die Schwere zu fehlen, die feste Verbindung mit der Erdkruste. So empfindet fast jeder, der sie zum ersten Mal zu Gesicht bekommt.«
Der Mann beugte sich nach diesen Worten über die Reling, spuckte ins Wasser und sah dem winzigen weißen Schaumfleck nach, der schnell an der mit Seetang bewachsenen Bordwand entlang nach hinten zog, wo ihn das Schraubenwasser verschlang.
»Es kann sein, dass Sie sie für eine Fata Morgana halten, für eine Vision, etwas Geträumtes, eine Luftspiegelung, aber ich sage Ihnen, es ist eine Insel. Das begreift man allerdings erst, wenn man sie betritt. Dann versteht man auch, dass man schwer definieren kann, was eine Insel eigentlich ist. Ein Stück Festland, vollständig von Wasser umgeben. So armselig kann eine Definition sein. Nein, eine Insel ist viel mehr. Jedenfalls eine Insel wie diese. Sie ist eine Welt für sich. Auf ihr herrschen andere Gesetze als überall sonst. Ich möchte sogar behaupten, dass der Himmel über einer solchen Insel anders ist. Es ist ein Inselhimmel. Auch wenn es die gleichen Wolken sein mögen, die übers Meer dorthin ziehen. Ich sage Ihnen, der gleiche Himmel mit den gleichen Wolken über dem Festland hat eine völlig andere Stimmung. Sie werden mich begreifen, wenn Sie erst auf der Insel sind. Man meint, der Himmel über ihr sei weniger weit, weniger tief. Er gleicht einer gläsernen Schale, die über sie gestülpt worden ist.«
Der Mann deutete mit einer ausholenden Bewegung des Armes nach Westen, dorthin, wo sich der Himmel rot zu färben begann. »Da liegt sie. Sehen Sie sie?«
Alles, was Olsen ausmachte, war eine feine Linie zwischen einer lila verfärbten Wolkenbank und dem grün irisierenden Meer. Als habe da jemand den Horizont mit einem Bleistift nachgezogen. Das Schiff hielt nicht genau Kurs auf diese Erscheinung. Es folgte vielmehr den Krümmungen eines Fahrwassers, das rote und grüne Tonnen markierten.
»Leben dort eigentlich viele Menschen?«, fragte Olsen den Mann, der daraufhin spöttisch lächelte.
»Menschen? Wie man es nimmt«, sagte er. »Der Zahl nach sind es wenig, doch auf der Insel kommt es dir vor, als ob es zu viele sind.«
Wieder spuckte er ins Wasser und beobachtete den Schaumfleck. »Wir sind langsamer geworden, fahren nur noch halbe Kraft. Wahrscheinlich haben wir wenig Wasser unter dem Kiel. Es ist kein Spaß, hier draußen festzusitzen und auf die Flut zu warten.«
Olsen konnte inzwischen Einzelheiten unterscheiden. Schwärzliche Verdickungen einer Linie, die Häuser oder Bäume sein mochten. Ein Leuchtturm und eine Windmühle schienen die höchsten Erhebungen zu bilden.
»Wie lange wollen Sie bleiben?«, fragte der Mann neben ihm.
»Ich weiß es noch nicht. Vielleicht fahre ich morgen schon wieder zurück. Es hängt davon ab, ob ich finde, was ich suche.«
»Morgen?«, lachte der andere. »Morgen fährt kein Schiff. Das Nächste geht erst in drei Tagen. So ist es im Winter. Im Sommer ist die Verbindung besser.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich würde mich an Ihrer Stelle gleich um ein Zimmer kümmern. Die meisten Hotels sind im Winter geschlossen. Versuchen Sie es mal im ›Fährmann‹, gleich am Hafen. Was suchen Sie überhaupt dort in dieser unwirtlichen Jahreszeit? Vielleicht eine Stellung? Das können Sie sich gleich aus dem Kopf schlagen. Sie werden keine finden. Die halten zusammen wie Pech und Schwefel.«
Auch Olsen spuckte jetzt ins Wasser und sah dem Schaumfleck nach. Sie fuhren wieder schneller. »Ich suche den Elevatorman«, sagte er. Der andere nickte und schwieg. Offenbar hatte er kein Interesse daran, sich diese seltsame Auskunft erläutern zu lassen.
Als Olsen wieder aufsah, war die Insel plötzlich riesengroß. Sie verdeckte mit ihren Häusern und einer langen, kahlen Allee den ganzen Horizont. Dann glitten sie in die Hafeneinfahrt, und Olsen starrte in den schwarzen, sich verengenden Abgrund zwischen Kaimauer und Bordwand. Etwas Helles trieb dort unten, bewegte die Gliedmaßen im Rhythmus der schwappenden Wellen. Winzige, gespreizte Arme und Beine. Es war dunkel inzwischen. Der Mann neben Olsen zog eine Taschenlampe aus dem Mantel und richtete ihren Strahl auf das Ding. »Eine tote Ratte«, sagte er. »Sie ist weiß. Vielleicht ein Albino. Vielleicht auch nur gebleicht vom Salzwasser. Passen Sie gut auf sich auf.«
Er stieß Olsen mit der Lampe in die Rippen, packte seinen Koffer, ging über die ausgebrachte Gangway an Land und verschwand zwischen den Schuppen der Hafenanlage.
Der Wind hatte sich verändert. Er blies jetzt heftiger aus Osten, fegte Schwärze von dort herbei, die sich auf alles legte, auf die Gegenstände genauso wie auf das Gemüt.
Olsen packte seinen Seesack und betrat nun ebenfalls die Gangway. An ihrem Ende stand ein Mann in Uniform und nahm Olsen die Fahrkarte ab. »Was wollen Sie hier?«, fragte er in einem wenig freundlichen Ton. »Ich?« Olsen wäre am liebsten nicht auf die Frage eingegangen, aber der andere hatte ihn am Jackenärmel gepackt. »Natürlich Sie, oder gibt es noch jemand anderen hier?«
»Ich möchte hier vielleicht eine Weile bleiben, vielleicht auch nicht«, sagte Olsen. Der Schirm der Uniformmütze des Mannes glänzte wie die Schneide einer Sichel. Erstaunlicherweise schien ihn die vage Auskunft Olsens zufrieden gestellt zu haben. Er ließ ihn los, trat zur Seite und tippte mit dem Finger an den Mützenschirm.
Olsen sah sich um. Vom Wind getriebene Regentropfen schraffierten die Dunkelheit unterhalb einer Laterne. Ein wasserglänzender Weg führte am Hafenbecken entlang zum Ort. Schauer fegten vom Meer herüber und rissen an den Kronen der Bäume, die den Weg flankierten. Myriaden Graupelkörner tanzten auf dem Pflaster. Das Heulen des Sturmes erinnerte an eine menschliche Stimme, die eine blinde Wut daran hindert, sich verständlich zu artikulieren. Hinter der Steinbalustrade, die den Weg zum Strand hin schützte, sah Olsen das Meer. Es war schwarz wie Teer. Doch dort, wo es der kreisende Finger des Leuchtturms streifte, sah man, wie es die weißen Gebisse seiner Wellen bleckte.
Der Weg mündete in einen Platz am Ende des Hafenbeckens. Hier, zwischen hohen, dunklen Gebäuden war ein wenig Windschatten. Olsen stellte seinen Seesack ab und rieb sich die von Salzluft zu Tränen gereizten Augen. Ganz in seiner Nähe befand sich die den anderen Gebäuden vorgelagerte Fassade eines Hauses, dessen Giebel und Türmchen ihm ein fast vornehmes Aussehen verliehen hätten, wären da nicht die mit Holzbrettern vernagelten Fenster gewesen und die Risse im Mauerwerk. Über dem Eingang schwankte eine nackte Glühbirne und beleuchtete ein ebenfalls in rostigen Ösen schwankendes Schild mit der Inschrift ›Zum Fährmann‹. Olsen drückte auf einen Messingknopf neben der Tür. Doch nichts geschah. Noch einmal drückte er, diesmal länger, und lauschte dem schrillen Ton der Klingel, der aus dem Inneren des Hauses drang und sogar das Pfeifen des Windes zu übertönen vermochte. Wieder nichts. Als Olsen die Klinke anfasste, gab sie nach. Sie sprang auf, als risse jemand von innen an ihr, doch es war nur der Wind, der gegen das Türblatt drückte und Olsen mitsamt seinem Seesack unsanft hineinschob in einen kaum erleuchteten Flur, den ein roter, abgewetzter Läufer durchzog. In einer Nische brannte eine kleine Lampe mit einem bräunlich angesengten Pergamentschirm. Auf dem Tresen daneben der Hinweis ›Rezeption‹. Wieder eine Klingel, eine Tischklingel diesmal, von der eine verdrillte Leitung zur Fußleiste führte. Olsen lauschte. Der Sturm war hier drinnen zu einem monotonen Klagegesang gedämpft. Irgendwo schlug ein Laden. Und dann war da noch etwas: ein auf und ab schwellendes Summen ferner Klänge, die an Stimmen, an Gesang, an Musik erinnerten, verzerrt und unverständlich.
Es kostete Olsen einige Überwindung, den Klingelknopf zu betätigen. Diesmal war kein Schrillen zu hören. Es blieb ihm nichts anderes übrig: Er musste tiefer in den Flur hinein, der ihm wie ein Schlund vorkam. Die Wände mit den hässlich geblümten Tapeten schienen sich kaum merklich zu bewegen wie in einer beständigen Peristaltik, die ihn immer tiefer hineinsog. Zugleich wuchs sein Wunsch, wieder umzukehren, aber der Gedanke an die nasskalte Nacht draußen trieb ihn weiter. In diesem Moment erlosch das Flurlicht. Olsen tastete nach der Wand, die feucht war und pelzig, als bedeckten sie feinste Härchen von Schimmelpilz. Vor ihm ein Lichtstreif unter der Tür. Der Stimmenlärm dahinter jetzt lauter, anschwellend. Schlagermusik, Gelächter. Olsen glaubte, einzelne Wörter zu verstehen, die jedoch keinen zusammenhängenden Sinn ergaben. Am deutlichsten war ein Name: Stella.
Als Olsen die Tür erreicht hatte, klopfte er. Erst zögernd, dann stärker. Irgendjemand brüllte: »Herein, wenn’s kein Schneider ist.«
Wildes Gelächter erscholl. »Du heißt doch selber Schneider, du Idiot!«
Licht blendete ihn so, dass er nichts sah, nachdem er die Tür geöffnet hatte. Umso deutlicher vernahm er das erneute Gelächter und Rufe wie »Wer ist denn das?« - »Der sieht ja komisch aus.« Dann, wie bei der Entwicklung eines Papierbildes in der Fotoschale, bildeten sich vor Olsens Augen Konturen im Weiß. Sie wuchsen zusammen zu dem Anblick eines großen Zimmers mit zahlreichen Tischen und Stühlen, auf denen Leute saßen, Gläser vor sich auf Tischdecken, die mit Wachsblumensträußen dekoriert waren. Das helle Licht kam von einem großen Steuerrad an der Decke, dessen Speichen und Felge zahlreiche elektrische Birnen zierten. Auch Wandlampen brannten und verströmten gleißende Helligkeit.
Die meisten Menschen saßen um einen großen runden Tisch, auf dem keine Decke lag. Ein gewaltiger Messingaschenbecher in seiner Mitte mit einem Bügel, in den das Wort ›Stammtisch‹ eingraviert war. Es waren alles Männer, die meisten korpulent, die Gesichter gerötet. Sie trugen Anzüge, die Hemden offen, die Schlipsknoten gelockert. Einige hatten die Jacken abgelegt und über die Stuhllehnen gebreitet. Viele rauchten, Zigarren, Zigarillos, Zigaretten spickten den Aschenbecher. Die Biergläser voll, halb voll, uringelb, der Schaum blasig, Tabakrauch aus den Mündern wie Geschützqualm dringend. Auf dem Tisch stand eine Frau. Sie war blond, hatte ein hübsches Gesicht von auffallend blassem Teint, sehr blaue Augen, makellose Zähne. Sie tanzte zwischen den Gläsern mit nackten Füßen, drehte sich puppenhaft steif zu den Rhythmen, die aus einer großen Musiktruhe kamen, in deren erleuchtetem Inneren sich eine schwarze Grammofonplatte drehte. Offenbar war sie defekt, denn jetzt ertönte immer das gleiche kurze Musikintervall, das Fragment eines Schlagers: »die rote So... die rote So... die rote So...« Dies schien das Interesse der Männer von Olsen abzulenken. Jemand begann zu grölen, und die anderen stimmten ein »rote So... rote So... rote So...«
Die Tänzerin hob den Rock, so dass der mit schwarzen Spitzen besetzte Strumpfhaltergürtel sichtbar wurde, den sie als einzige Unterwäsche trug. Einer der Männer nahm seine Zigarre aus dem Mund und steckte der Tänzerin das nasse Ende zwischen die Schenkel. Alle johlten und klatschten, bis auf Olsen, der sich zur Wand zurückgezogen hatte. Von hier aus sah er, wie eine zweite weibliche Person erschien. Sie war mit einem Geschirrhandtuch bewaffnet und schlug damit auf die Männer ein, die lachend zurückwichen. »Ihr Schweine, ihr miesen Schweine!«, schrie sie. Ihre Haare waren feuerrot, Locken, von einem Samtband durchzogen, Lippen und Augen stark geschminkt. Dennoch wirkte sie sehr jung. Sie trug eine weiße Kellnerinnenschürze auf einem schwarzen, hautengen Kleid, das ihre Figur betonte. »Nimm dich zusammen, Stella«, sagte die Tänzerin. Sie nahm die Zigarre, sog an ihr, blies Rauchringe von sich und sprang vom Tisch herab. »Die Jungs sind in Ordnung, sie wollen nur ihren Spaß haben, kann man ihnen das bei solchen Ehefrauen verdenken?«
»Stella, jetzt bist du dran«, schrie jemand. »Zieh dich aus. Wir wollen deine Möpse sehen.« Stella drohte mit dem Handtuch. Dann rannte sie hinaus und schlug die Tür hinter sich zu.
Die Tänzerin, offenbar die Wirtin, ging auf Olsen zu. »Wir sind ein anständiges Haus«, sagte sie. »Auch wenn der Anschein manchmal trügt. Haben Sie vielleicht Feuer, junger Mann?« Sie drehte die Zigarre, die ausgegangen war, zwischen den Fingern hin und her und steckte sie in den Mund. Olsen klopfte seine Taschen ab, als erwarte er von dort das charakteristische Geräusch loser Hölzer in einer Streichholzschachtel. In Wahrheit wusste er um die Vergeblichkeit seines Bemühens. »Er hat kein Feuer, der junge Mann«, sagte die Wirtin mit doppeldeutiger Betonung. »Vielleicht, weil er schon mal in einem drin war.«
Olsen wusste, dass die vielen Operationen sein Gesicht nicht wieder zu dem gemacht hatten, was man ein menschliches Antlitz nannte. Immer noch war es ihm selber merkwürdig, sich in einem Spiegel zu sehen. Ein Vertrauter mit einem fremden Gesicht. Eine Maske aus Haut und Narben, die manchmal juckte und brannte, so dass er sie am liebsten heruntergerissen hätte.
»Da, Maria, nimm mein Feuer«, eine behaarte Hand hielt ihr ein großes, aufschnappendes Sturmfeuerzeug hin. Maria sog so stark an der Zigarre, dass eine Qualmwolke ihr Gesicht verhüllte. Es war still inzwischen, und so war Maria sehr deutlich zu vernehmen, als sie nun rief: »Stella, komm rein. Wir haben einen neuen Gast, der bedient werden will.«
Stella erschien. Diesmal wirkte sie betont ruhig und gelassen. Sie schien ihre Frisur geordnet und ihre Lippen nachgezogen zu haben. Olsen bemerkte, während Stella auf ihn zuging, dass sie ein junges Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit war. Sie knickste und fragte: »Was darf ich Ihnen bringen?«
»Ein Bier und einen Korn«, sagte Olsen. Dann setzte er sich auf den freien Stuhl, den jemand an den Stammtisch gezogen hatte. Die defekte Platte drehte sich immer noch. »Roso, roso«, klang es jetzt. Jemand stand auf vom Tisch und hüpfte zur Musiktruhe. Ein Einbeiniger, der sich auch ohne Krücken, die er bei seinem Platz gelassen hatte, äußerst geschickt zu bewegen verstand. Er hob den Tonarm hoch und legte ihn behutsam in seine Lagerung. »Die Caprifischer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren«, sagte er. Dann holte er eine neue Platte aus dem untersten Fach der Truhe und legte sie auf. Flotte Musik erklang, Trompete, Schlagzeug, Klarinette, Posaune. »Verdammte Negermusik«, sagte jemand neben Olsen.
Stella kam und stellte Bier und Schnaps vor ihn auf den Tisch. Olsens Nachbar versuchte, der Bedienung in den Po zu kneifen. Sie gab ihm einen Klaps auf die Wange. Olsen roch ihr Parfüm, süß und billig. Der Mann wandte sich ihm zu. Sein Gesicht war flach wie ein Kuchenteller. Olsen sah in Augen, die künstlich wirkten als gehörten sie einem präparierten Tier. »Suchst du vielleicht Arbeit?«, sagte sein Nachbar. Olsen zuckte mit den Schultern und kippte den Korn. Ein anderer schrie mit überschnappender Stimme: »Ich geb ’ne Runde aus, für alle. Stella, schenk ’ne Runde aus, auch für den mit dem Frankensteingesicht. Ich wüsste ’ne Arbeit für ihn. Kinderschreck.«
Die Wirtin kam mit einem Tablett voller eisbereifter Schnapsgläser. Alle tranken und knallten die leeren Gläser auf die Tischplatte. »Na, nun raus mit der Sprache«, sagte der Mann, der die Runde ausgegeben hatte. »Wir sind neugierig hier, müssen Sie wissen. Wer im Winter auf die Insel kommt, muss einen besonderen Grund haben. Oder er ist nicht ganz richtig im Kopf.«
»Vielleicht suche ich Arbeit. Aber erst will ich mich ein wenig umsehen. Ich bin gerne im Winter am Meer.«
»Er will sich umsehen, er ist gerne im Winter am Meer«, echote der Mann. Während Olsen dasaß und trank, gelang es ihm zum ersten Mal, die Gesichter seiner Zechkumpane näher in Augenschein zu nehmen. Zunächst hatte er sie für eng verwandt gehalten, denn die Ähnlichkeit zwischen ihnen war erheblich. Fast alle Köpfe ein wenig zu groß, alle Hälse zu kurz, alle Bäuche zu dick, trotz der schlechten Zeiten. Nur was den Haarwuchs anbelangte, unterschieden sie sich stärker. Da gab es den vollsten Wuchs neben Halb- und Totalglatzen, da gab es weißblonde, gescheitelte Haare, die wie eine Badekappe anlagen, neben grau melierten Locken und fettigen, schwarzen Strähnen. Nein, so ähnlich waren sie sich gar nicht. Es gab sogar auch hagere, dünne Gestalten darunter, von denen jedoch der Eindruck der Leibesfülle ausging, ausgelöst durch ihr Auftreten, durch ein vorgerecktes Kinn, eine resonanzreiche Stimme oder durch Accessoires wie einen dicken, goldenen Siegelring, eine Uhrkette oder einen besonders breiten Schlips. Zweifellos vereinte etwas alle diese Männer. Und tatsächlich, sie waren, wie Olsen bald von seinem Nebenmann erfuhr, Mitglieder einer Loge und hier zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammengekommen, um den Gedanken des Dienens an der Gemeinschaft zu zelebrieren, wie es ihre Vereinigung satzungsgemäß vorsah. Und obwohl sie Insulaner waren, fühlten sie sich verbunden mit all den anderen Vereinsmitgliedern, die weltweit die Idee des Dienens an der Gemeinschaft ebenso zelebrierten, über Länder, Grenzen, Rassen hinweg. War dies vielleicht das Geheimnis ihrer Fröhlichkeit? Berauschte sie jene Allgegenwart der Idee des Gemeinsinns und des sie tragenden Vereins vielleicht stärker als all die Schnäpse und Biere?
Olsen ertappte sich plötzlich bei dem Wunsch, einer der ihren zu sein, aber schämte sich dieses Gedankens sofort und starrte für eine Weile stumm in sein halb geleertes Bierglas. Er sah erst wieder auf, als er erneut angesprochen wurde. »He, Sie da«, sagte eine Stimme ihm direkt gegenüber. Es war ein schmallippiger Mann mit einem Feuermal, das die ganze linke Gesichtshälfte bedeckte, so dass er zweigeteilt aussah, der Kopf gespalten von einem Henkersbeil und wieder zusammengewachsen. »Machen Sie Urlaub, oder suchen Sie Arbeit? Wir haben nichts gegen Fremde, aber wir mögen sie nicht.« Der Mann lachte und bewies durch eine Reihe von Goldzähnen, dass er zu Recht dieser Loge der erfolgreichen Geschäftsleute angehörte. Er reichte Olsen eine kleine, kalte, fischige Hand über den Tisch und ließ sie von dem Angesprochenen schütteln. »Wissen Sie«, fuhr der Mann fort, »es gibt einige Leute auf der Insel, die hier nicht geboren wurden. Sie werden nie zu echten Einheimischen, auch wenn sie noch so lange hier leben. Man muss hier geboren sein, verstehen Sie! Und nicht nur das, es genügt nicht, verstehen Sie! Das gilt auch für den Vater, für den Großvater, verstehen Sie! Ich würde sagen, mindestens drei Generationen sind nötig, um ein echter Insulaner zu werden.« Er hob sein Glas und prostete Olsen zu.
Der Mann neben ihm mischte sich ein: »Karl, es sind mindestens vier Generationen. Bei dir sind es nur drei. Du weißt, dass du noch kein echter bist«.
Das Feuermal des so Angeredeten flammte noch roter. »Emil, du solltest lieber die Klappe halten. Deine Mutter ist eine Zugereiste. Du wirst immer nur ein halber Insulaner sein, und das ist weniger als gar keiner«.
»Und du? Dass du auch nur halb bist, sieht man dir doch an. Maria, sieht Karl nicht aus wie eine halbe Rothaut? Du kannst dich mit dem Fremden zusammentun. Ihr könnt auf dem Jahrmarkt im Panoptikum auftreten.«
Die Wirtin ging auf den Mann mit dem Feuermal zu und küsste ihn auf die angesprochene Stelle. »Ich mag Indianer«, sagte sie. »Solange sie einen Marterpfahl haben.«
Wieherndes Gelächter wogte in der Runde. Olsen befiel ein Gefühl abgrundtiefer Einsamkeit. Er mochte diese Leute nicht, und sie mochten vermutlich ihn ebenso wenig. Aber das war nicht der eigentliche Grund für seine Gemütsverfassung. Vielleicht hing es damit zusammen, dass hier offensichtlich die Uhren stehen geblieben waren während des Krieges. Vor- und Nachkriegszeit gingen ineinander über.
Olsen erhob sich und stellte sich an die Wand, das halb volle Bierglas in der Hand. So fühlte er sich besser. Warum fragte er die Leute nicht nach dem Mann, den er suchte? Boysen hatte sich bestimmt auf die Insel zurückgezogen wie ein Tier in seinen Bau.
Inzwischen war die Runde am Tisch in einem Stadium, das sie wohl als Höhepunkt des Dienstes am Allgemeinwohl empfanden. Alle waren Brüder, auch die Schwestern, auch die Feinde, auch die Fremden. Jeder schlug jedem voll aggressiver Sympathie auf die Schulter, lallte betrunkenes Zeug, verschüttete Bier und Schnaps und Ekel erregendes Wohlwollen. Nur die Wirtin schien einigermaßen nüchtern geblieben zu sein. Immer wieder kam sie mit einem großen Lappen und wischte Vergossenes auf. Irgendjemand sah plötzlich Olsen an der Wand stehen. »Du da«, brüllte er, »du gehörst standrechtlich erschossen, wenn du nicht sofort an unseren Tisch zurückkommst.«
Als Olsen sich in Bewegung setzte, um dem Wunsch nachzukommen, sah er plötzlich das Bild, das in einer dunklen Ecke des Raumes hing. Er schrak zusammen und begann, an seinem Verstand zu zweifeln. Zweifellos war es die Luftbarke des Mönches Lana aus dem Rauchsalon des ›Hindenburg‹! Er trat näher. Natürlich konnte es nur eine Kopie sein. Er erkannte die Einzelheiten wieder, die fünf Vakuumkugeln, die Segel, die Vogelschwingenruder, die vier Fenster im Schiffsrumpf. Nur etwas war neu. Den Rumpf des Luftschiffes verdeckte halb ein großer, blauer Schirm, ähnlich geformt wie ein Regenschirm. Von seinen zehn Ecken verliefen Seile zum Mast. Die Absicht war klar: diese Vorrichtung sollte die Insassen der Luftbarke bei einem Absturz vor dem Schlimmsten bewahren. Der Schirm würde in einem solchen Fall nach oben schwingen und die Fahrt abbremsen wie ein Fallschirm.
»Er interessiert sich für das Bild, Maria«, rief jemand. Andere stimmten ein, bis der ganze Tisch durcheinander redete. »Verdammt neugierig, unser Monster.« »Er sollte seine Nase lieber in eigene Angelegenheiten stecken.« Maria stellte sich zwischen Olsen und das Bild. »Setzen Sie sich lieber«, sagte sie ruhig. »Sie merken doch, die Leute hier sind empfindlich, wenn es um ihre Sachen geht.«
»Ich interessiere mich für Kunstwerke dieser Qualität«, sagte Olsen. »Könnte ich das Bild eventuell kaufen?«
»Niemals. Es gehört hierher und nirgendwo sonst hin.«
Olsen setzte sich. Das Interesse der Zecher hatte sich inzwischen von ihm abgewandt, denn Stella war wiedergekommen. Sie griffen nach ihr, versuchten einer nach dem anderen, sie auf den Schoß zu ziehen. Geschickt entwand sich das Mädchen ihnen. Im allgemeinen Tumult stand Olsen auf und bat die Wirtin um ein Zimmer. »Wir haben um diese Jahreszeit immer geschlossen«, sagte Maria. »Aber für Sie will ich eine Ausnahme machen. Stella, bring den Herrn nach oben. Dritter Stock, die Abseite. Du weißt schon.«
Das Treppenlicht war schwach. Olsen kam es jedoch vor, dass Stellas Haarschopf ein eigenes Licht ausstrahlte. Sie ging voran, und Olsen starrte auf ihre wohl proportionierten Waden, ihren herzförmigen Hintern. Auch er war betrunken, voller wilder Bilder und zugleich ein Ertrinkender in einem Meer von Traurigkeit. Stella schloss eine Kammer auf. Ein schmales Bett mit einer Pferdedecke. Eine Porzellanschüssel mit einer leeren Wasserkanne, ein Stuhl, das war alles. Es gab offenbar auch keine Heizung.
»Am besten behalten Sie die Klamotten an,« sagte sie. Aber Olsen schien sie gar nicht zu hören. Er packte sie an den Schultern, zog sie näher, so nahe, dass sich die Konturen ihres Gesichtes in seinem Blick verloren. »Sag schon, wer hat das Bild gemalt. Ist es jemand von hier?«
Stella ließ es geschehen, dass er sie anfasste. »Ich weiß nicht genau«, flüsterte sie. »Ich glaube, es ist von einer Malerin, die hier auf der Insel lebt.«
Als Olsen sie losließ, schlang sie mit einer plötzlichen, schnellen Bewegung ihre Arme um seinen Nacken und küsste ihn. Er
btb Taschenbücher erscheinen im Goldmann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
1. Auflage Genehmigte Taschenbuchausgabe Juni 2002
Copyright © 2000 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin KR · Herstellung: Augustin Wiesbeck Made in Germany
eISBN 3-89480-566-1
www.btb-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de