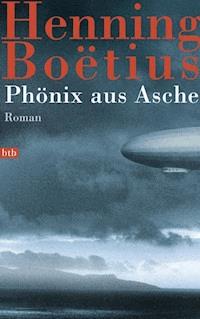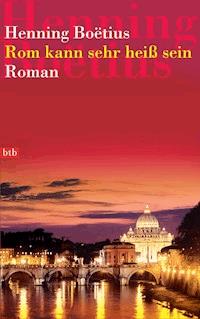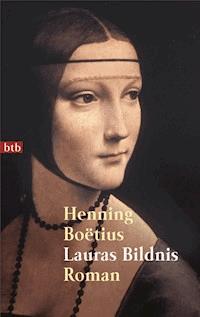6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Piet Hieronymus Reihe
- Sprache: Deutsch
Eigentlich geht der holländische Kriminalinspektor Piet Hieronymus nach Amerika, um einen spurlos verschwundenen Immobilienhändler ausfindig zu machen. Doch die Suche von San Francisco aus entlang der Pazifikküste bis zur kanadischen Grenze wird schon bald zu einer Jagd nach einem geheimnisvollen Mörder. Dessen Totemzeichen, der Killerwal, markiert die Fähre, auf der ihm Hieronymus bis in das Indianerreservat der Quileute folgt. Dabei gerät er immer stärker in den Bann des Mörders – eines mit magischen Kräften begabten Menschen, der sich Gutty Floy nennt. Guttys Intelligenz und Brutalität, sein gleichzeitig anziehendes und abstoßendes Wesen, sein Engagement für das Leben der Wale und die Erforschung ihrer Sprache, vor allem aber sein indianisches Selbstbewußtsein verstören Hieronymus zutiefst. Langsam verschieben sich die Perspektiven, bis er sich selbst in der Rolle des Gejagten wiederfindet….
Die Piet-Hieronymus-Romane
Joiken
Blendwerk
Der Walmann
Das Rubinhalsband
Rom kann sehr heiß sein
Berliner Lust
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Eigentlich geht der holländische Kriminalinspektor Piet Hieronymus nach Amerika, um einen spurlos verschwundenen Immobilienhändler ausfindig zu machen. Doch die Suche von San Francisco aus entlang der Pazifikküste bis zur kanadischen Grenze wird schon bald zu einer Jagd nach einem geheimnisvollen Mörder, dessen Totemzeichen, der Killerwal, die Fährte markiert, auf der ihm Hieronymus bis in das Indianerreservat der Quileute folgt. Dabei gerät er immer stärker in den Bann des Mörders – eines mit magischen Kräften begabten Menschen, der sich Gutty Floy nennt. Guttys Intelligenz und Brutalität, sein gleichzeitig anziehendes und abstoßendes Wesen, sein Engagement für das Leben der Wale und die Erforschung ihrer Sprache, vor allem aber sein indianisches Selbstbewußtsein verstören Hieronymus zutiefst. Langsam verschieben sich die Perspektiven, bis er sich selbst in der Rolle des Gejagten wiederfindet. ..
Autor
Henning Boëtius, geboren 1939, promovierte über Hans Henny Jahnn und leitete anschließend die Herausgabe der historisch-kritischen Brentano-Edition. Seit 1984 arbeitet er als Musiker, Goldschmied, Maler und freier Schriftsteller. Neben seinen Romanen mit dem holländischen Kriminalinspektor Piet Hieronymus begründeten vor allem seine Romanbiographien über literarische Außenseiter wie Johann Christian Günther. J. M. R. Lenz. Petrarca und der sehr erfolgreiche Lichtenberg-Roman »Der Gnom« seinen Ruf. Nach seinem historischen Kriminalroman »Undines Tod«, der im Berlin des 19. Jahrhunderts spielt, erschien soeben im btb-Hardcover sein neuer, in Schottland angesiedelter Roman »Das Rubinhalsband«.
Henning Boëtius bei btb
Ich bin ein anderer. Das Leben des Arthur Rimbaud (72189) Undines Tod. Roman (btb-Hardcover 75002)
Inhaltsverzeichnis
MEINEM VATER DEM EHEMALIGEN WALFÄNGER EDUARD BOETIUS.
Wir lieben die Stille wir lassen Mäuse spielen und wenn der Wind in den Wäldern rauscht fürchten wir uns nicht.
Indianerhäuptling an den Gouverneur vonPennsylvania 1796(aus: T. C. McLuhan, ... wie der Hauch des Büffels,Hamburg 1979)
1
Vor mir lag eine unscheinbare Mappe. Ein Name stand auf dem Einband. Während ich ihn flüsternd aussprach, ging mein Blick zum Fenster. In diesem Moment sank draußen eine Feder herab, eine ungewöhnlich große, weiße Vogelfeder mit braunen Streifen. Sie kreiselte im Wind, ehe sie aus meinem Blickfeld verschwand.
Ich erhob mich, öffnete die Fensterflügel und sah zum Himmel hinauf. Er war schmutzigweiß und wäßrig, der Bauch eines gewaltigen Schwimmvogels, der auf dem Tümpel des Lebens trieb. Pool of life, der Tümpel des Lebens. Der deutsche Psychoanalytiker C. G. Jung hatte einst von Liverpool als Tümpel des Lebens geträumt. »Suijkerbuijk«, flüsterte ich erneut. »Bist du im Tümpel des Lebens einfach untergegangen, vielleicht weil du vergessen hast, dein Federkleid zu fetten?«
Ich schlug das Deckblatt zur Seite und blickte in das Gesicht eines Mannes, von dem ich nicht viel mehr wußte als den Namen, das Alter und ein paar Lebensumstände, die alle sehr normal klangen. Suijkerbuijk war das, was man einen gutaussehenden Mann nennt. Die Haare dicht, der Stirnansatz niedrig, die Augen weit genug von der Nasenwurzel entfernt, um ein denkendes Hirn dahinter zu vermuten. Der Mund voll und doch männlich. ›Möwenmund‹ würde meine Mutter zu solchen leicht geschwungenen Lippen sagen. Suijkerbuijk erinnerte ein wenig an jene Schaufensterpuppen, die dem Ideal des virilen amerikanischen Mannes italienischer Herkunft nachempfunden sind. Auch die Detektive in amerikanischen Filmen sehen oft so aus.
Minjheer Franz Suijkerbuijk war spurlos verschwunden. Zuletzt war er auf dem Balkon eines amerikanischen Luxushotels gesehen worden. Von dort schien er sich tatsächlich wie ein Vogel entfernt zu haben, von der Brüstung aus, ohne Spuren zu hinterlassen.
Das Telefon schrillte. Ohne abzuheben wußte ich, wer es war. Eine mir allzu vertraute Stimme steckte in dieser Leitung und verlangte gebieterisch danach, aus der Muschel in mein Ohr zu dringen. Der heilige Geist meiner Mutter. Um diese Zeit, so kurz vor Dienstschluß, konnte es nur sie sein.
»Kommst du noch einmal vorbei, ehe du abreist?« fragte sie. »Wer weiß, ob wir uns noch einmal wiedersehen, mein Sohn. Es geht mir nicht gut in letzter Zeit. Das Haus wächst mir über den Kopf. Du kannst bei der Gelegenheit mal nach dem Wasserhahn über der Spüle sehen. Er tropft.«
»Welche Reise?« fragte ich verwirrt. »Ich weiß von keiner Reise, Mutter. Aber ich komm’ natürlich trotzdem. Also bis nachher.«
Sie hatte aufgelegt, und ich hatte zuletzt mit dem Besetztzeichen geredet, ohne dies als ungewöhnlich zu empfinden. Gespräche mit meiner Mutter waren nie etwas Normales.
Wieder klingelte es. Diesmal war es mein Chef. »Du bist ja noch da«, sagte er und hustete ins Telefon. Ich glaubte förmlich, den Qualm seiner Zigarette zu riechen. »Es sind noch zehn Minuten bis Dienstschluß«, erwiderte ich. »Wenn man nicht aufpaßt, kann das eine kleine Ewigkeit sein.«
»Dann komm eben noch mal auf einen Sprung rüber. Und bring die Akte ›Suijkerbuijk‹ mit.« Er legte auf. Eine feine Schliere Zigarettenrauch schien aus dem Hörer zu quellen.
Ehe ich ging, ließ ich noch einmal die wenigen bekannten Fakten dieses Falles Revue passieren. Suijkerbuijk lebte in Leeuwarden. Achtunddreißig Jahre jung. Frührentner wegen einer dubiosen Krankheit. Gleichgewichtsstörungen. Früher Angestellter bei Philips. Spezialität: Entwicklung von Lautsprechern. Heirat mit einer Amerikanerin in Las Vegas. Flitterwochen in Kalifornien. Vor zwei Wochen spurlos verschwunden in Mendocino. Nachts auf den Balkon gegangen, um Sterne zu beobachten, wie seine Frau zu Protokoll gegeben hatte. Nicht wieder ins Zimmer zurückgekehrt. Keine Spuren. Tatsächlich wie ein Vogel auf Nimmerwiedersehen davongeflogen.
Die Zusammenarbeit mit Interpol war wie üblich schwerfällig. Unverbindliche Formulierungen verbargen nur unvollkommen, daß die Polizei drüben nicht weiterkam. Zehn Zimmer des Hotels gingen auf den Balkon hinaus. Alle waren belegt gewesen. Niemand hatte etwas bemerkt. Die ganze Gegend war inspiziert worden, natürlich auch das Ufer. Taucher hatten die kleinen Buchten und Höhlen ohne Ergebnis abgesucht.
Ich ging zu meinem Chef. Wie immer saß er unter einer Glocke von Zigarettenqualm und starrte in eine Akte, von der böse Zungen behaupteten, es sei immer die gleiche, ebenso wie das Gerücht ging, daß er des öfteren in dieser Haltung an seinem Schreibtisch übernachtete.
»Na, wieder auf den Beinen?« sagte er und streckte mir eine offene Packung Zigaretten entgegen, aus der einige weiße Orgelpfeifen hervorragten. Es gehörte zu seinen Scherzen, seine Untergebenen mit diesen Worten zu begrüßen, auch wenn sie sich bester Gesundheit erfreuten.
Ich warf ihm ein Blatt auf den Tisch, auf dem ich die wichtigsten Punkte des Falles Suijkerbuijk zusammengestellt hatte. Er überflog es.
»Interessanter Fall. Ich wußte, daß du anbeißt. Hier ist noch mehr.« Er reichte mir das Schriftstück, das vor ihm lag. Es war tatsächlich ein neues Dossier zum Fall Suijkerbuijk.
»Hier.« Er tippte auf ein Blatt aus dem Stapel. »Das könnte ein Anhaltspunkt sein.«
Er reichte mir den Bogen. Er war mehrfach gefaltet. Ich schlug ihn auf. Im ersten Moment dachte ich, es sei ein Stadtplan. Ein Netz von Linien, Symbolen, Kreisen, Dreiecken bedeckte das Papier.
»Was ist das?«
»Ein Schaltplan. Unsere Experten für solche Sachen sind sich nicht schlüssig, wozu das Ding nütze sein soll. Unser Minjheer Suijkerbuijk hatte ein Labor im Keller seiner Wohnung. Es sieht aus wie bei einem Hobbybastler. Wir haben uns anfangs nichts dabei gedacht, deshalb steht auch nichts davon in den Akten. Außerdem gibt es da ein Aquarium. Es war in Betrieb, als wir die Wohnung vorige Woche durchsuchten. Die Lampen brannten, die Pumpe arbeitete, das Wasser war in Ordnung, auch die automatische Fütteranlage. Aber sämtliche Fische waren tot. Sie trieben mit den Bäuchen nach oben an der Oberfläche. Wir haben einige Fische im Labor untersuchen lassen. Kein Gift. Aber bei allen waren die Schwimmblasen geplatzt. Ich möchte, daß du hinfährst und dir die Sache einmal ansiehst.«
»Ich verstehe nicht viel von Technik. Mein einziges Hobby ist die Selbstanalyse.«
Er bleckte seine nikotingelben Zähne und röchelte ein Raucherlachen. »Piet, du bist ein Komiker«, sagte er. »Leute von deiner Naivität sind fabelhafte Seismographen für kleine Unterwasserbeben. Fahr hin und sieh dich um. Denk nicht nach, grübel nicht, sieh dich einfach um. Weißt du, wie man die größten Pilze findet? Indem man geistig weggetreten ist, indem man wie ein Halbblinder durch den Wald stolpert.«
Ich verstaute die Akte und das Dossier in meiner Fahrradtasche und fuhr zu meiner Mutter. Die Gartenpforte war verschlossen, und ich mußte über den Zaun klettern. Das war ungewöhnlich. Ebenso daß die Haustür halb offen stand. »Mutter«, rief ich im Flur. »Ist alles in Ordnung?« Stille. Nur das Geräusch von Tropfen aus der Küche, mit dieser folternden Regelmäßigkeit, die Zeit zu einem Ding macht. Ich ging ins Wohnzimmer.
Sie saß im Ohrenstuhl und hatte die Augen geschlossen. Das Bild einer Toten mit wächserner Haut. »Mutter«, flüsterte ich, »ist dir nicht gut?«
Keine Reaktion. Ihre Hände lagen schlaff auf der Lehne. Ich trat näher, streichelte über ihre Stirn, den grauen Haaransatz. Ihre Haut war kalt und feucht. Plötzlich verzog sich ihr Mund. Sie lächelte und schlug die Augen auf. »Ach, tut das gut, Piet, wenn mich mein eigener Sohn berührt. Hab ich dich erschreckt, mein Junge? Du solltest dich an den Anblick deiner toten Mutter gewöhnen. Dann ist es dir nachher nicht mehr so schwer, wenn Ernst aus dem Spiel geworden ist.«
»Mutter, ich finde dein Verhalten geschmacklos.« Meine Stimme hörte sich unnatürlich hoch an. Ich war wirklich empört, gemessen daran, daß ich ein notorisch friedfertiger Mensch bin.
»Schwatz nicht. Hol uns lieber was zu trinken. Ich habe dir ,etwas Wichtiges zu sagen.«
Wir tranken ihren Lieblingssherry, und Mutter rauchte. Das war ebenfalls ungewöhnlich, denn sie haßte den Geruch von Zigarettenqualm. Sie hielt die Zigarette weit weg von sich und blies den Rauch durch einen Spalt des angekippten Fensters.
»Ich werde es aufgeben. Wenn du von deiner Reise zurück bist, werde ich nicht mehr hier sein.«
»Du meinst das Haus? Dein Haus? Deinen Garten, den du so liebst? Wenn es dir zuviel wird, nimm doch eine Hilfe.«
Sie lachte. »Kannst du dir jemanden vorstellen, der hier Ordnung schafft?« Sie zeigte auf die Zimmereinrichtung, in der alle Dinge, seitdem ich zurückdenken kann, einen festen Platz hatten. Unverrückbar, wie in einem Hologramm.
»Ich gehe ins Altersheim. Es soll ein sehr gutes in unserem Land geben. Die ganze Zeit dudeln sie da Musik. So was wie eine Therapie. Man wird ganz friedlich dabei, so daß man ohne zu mucken ins Gras beißen kann.« Sie lachte wieder und drückte die Zigarette in einem Kaktustopf aus. »Nein, mein Sohn. Mein Entschluß ist unwiderruflich. Ich mache dir Platz. Wenn du von deiner Reise zurück bist, kannst du hier einziehen. Du wohnst sowieso zu eng. Dann brauchst du auch dein Fahrrad nicht mehr ins Zimmer zu nehmen. Du kannst sogar heiraten, soviel Platz hast du dann.«
»Welche Reise meinst du eigentlich, Mutter? Es stimmt, ich fahre nach Leeuwarden, aber das ist doch keine richtige Reise. Ich bin höchstens einen Tag weg.«
»Leeuwarden? In dieses Kuhdorf? Nein, ich meine eine richtige Reise, lieber Sohn. Du weißt, daß man bei jeder Reise einen inneren Fluß überquert? Es ist immer, als ob man ein wenig stirbt, wenn man reist.
Vielleicht bin ich deshalb so lange in diesem Haus geblieben. Das war wohl sehr feige von mir. Aber jetzt ist Schluß damit. Reparierst du den Wasserhahn? Es ist schließlich bald deiner.«
Sie lehnte sich zurück und schloß die Augen. Alle Farbe schien wieder aus ihrem Gesicht zu weichen. Ich wußte, es hatte keinen Zweck zu widersprechen.
Ich begab mich in die Küche und beseitigte mit wenigen Handgriffen das ekelhafte Tropfgeräusch. Dann ging ich mit dem seltsamen Gefühl, daß meine Mutter eine mir immer noch völlig fremde Frau war.
2
Ich fuhr mit dem Zug nach Leeuwarden. Dabei kam ich durch Gegenden, die knapp unterhalb der Meereshöhe liegen. ›Depression‹ nennt man diese geologische Situation im Englischen. Ich fand es immer tröstlich, in solchen Depressionen zu sein. Virtuelles Ertrunkensein tut gut, wenn man sich immer noch als Landstreckenschwimmer begreift, der Ziele erreichen möchte, die seine Kräfte übersteigen. Eine Frau zum Beispiel, mit der man tatsächlich bis ans Ende zu leben vermag. Eine Geliebte für immer. In der letzten Zeit vermied ich es, in die einschlägigen Lokale zu gehen, wo wenigstens die Chance bestand, mit dem weiblichen Geschlecht in Kontakt zu bleiben. Ich war offenbar auf dem besten Weg, ein waschechter Bachelor zu werden.
Als ich in Leeuwarden ankam, regnete es heftig. Die Spiegelungen der Häuser in den Grachten waren übersät mit Einschußlöchern aus Regenschrot.
Ich hatte einen Durchsuchungsbefehl und die Erlaubnis, das Siegel der Wohnung von Suijkerbuijk aufzubrechen.
Auf den ersten Blick war das einzig Auffällige die wirklich hervorragende Musikanlage. Unser Klient war anspruchsvoll auf diesem Gebiet. Röhrenmonoblöcke von Leak. Ein alter Garrad 301 als Plattenspieler. Ein vermutlich getuntes CD-Spitzenlaufwerk von Sony. Englische Monitorboxen. Eine gewaltige Sammlung erstklassiger Schallplatten und CDs, ganze Türme davon, ein akustisches Manhattan sozusagen. Sein Musikgeschmack war genauso exquisit. Klassik und Psychedelisches. Der komplette Glen Gould, Jan Gabarek. Außerdem jede Menge Geräuschplatten. Meeresrauschen, Vogelstimmen, Walgesang. Ich kenne diese Gourmets der Klangwelten, und ich teile ihre Obsession. Es sind Jäger, die abends bei einem Glas guten Rotweins auf der Lauer nach dem großartigen, einmaligen, sinnstiftenden Klangerlebnis sind.
Alles andere wirkte recht steril. Die Einrichtung eines Yuppies mit ethnologischen Interessen, die Bilder, schöne Landschaften zumeist, wobei das häufigste Motiv Flußmündungen waren, ein paar attraktive Masken, die indianischer Herkunft zu sein schienen.
Ich versuchte es mit dem Pilzblick. Suggerierte mir, so gut es ging, es sei meine Wohnung, setzte mich in verschiedene Sessel, ging ins Bad, wusch mir die Hände, brachte mit einiger Mühe die Stereoanlage zum Laufen, legte eine CD ein: »Le Chant des Baleines. Songs from the Deep«. Die Wirkung war schauerlich. Winseln, Klagen, Zwitschern überall, in jedem Raum, aus verborgenen Lautsprechern dringend. Es ging einem durch und durch. Ich schloß die Augen und sank immer tiefer in diese Unterwasserwelt, ein Ertrunkener auf der Reise zum Meeresboden.
Selbst auf der Toilette war diese quälende Sphärenmusik zu hören. Der kleine Raum war blau gestrichen, meeresblau. Die Illusion zu tauchen war perfekt.
Minjheer Suijkerbuijk hatte auch eine Vorliebe für Wandsprüche. Auf der Toilettentür stand:
Gutty Floy is my name
and terra is my nation,
empty space is my dwelling place
and death my destination.
Das Wortspiel der letzten Zeile gefiel mir, und allmählich wuchs meine Überzeugung, daß der Bewohner dieser Räume bei aller Normalität seines Äußeren ein Exzentriker war.
Ich sah mir die kleine Bibliothek an. Sind Bücher nicht oft ein aufschlußreicher Spiegel für ihren Besitzer? Dieser Spiegel hier jedoch schien blind zu sein. Da gab es viel Unverbindliches, Bestseller zumeist, wie »Die Bucht« von James A. Michener. Das einzige Buch, das mir auffiel, war ein deutscher Roman. »Der Erwählte« von Thomas Mann. Er paßte nicht hierher. Ich zog ihn heraus und blätterte darin. Es war ein Blindband. Die unbedruckten Seiten waren eng beschrieben. Vielleicht ein Tagebuch? Auf dem Deckblatt standen zwei Buchstaben. G. E War das vielleicht dein Tagebuch, Gutty Floy? Ich legte es auf den Couchtisch und ging in den Keller. Auch hier blaugrüne Wände, Unterwasserlicht aus in die Wand eingelassenen Bullaugen. Und dann eine Vielzahl von rätselhaften Armaturen. Kapitän Nemos Brücke.
Aus überdimensionierten Boxen dröhnten immer noch Walgesänge, deprimierende Geräusche, die an Rülpser und das Knarren von Türen erinnerten. Und mitten im Raum stand das Aquarium, von dem mein Chef erzählt hatte. Es war leer. An den Glaswänden Dinge, die wie Bierdeckel aussahen, flache Quadrate, die mit irgendwelchen elektronischen Geräten verkabelt waren. An der Tischzarge etliche Schalter. Ich betätigte mehrere von ihnen. Plötzlich schrie ein Kind hinter mir. Ich fuhr herum und erblickte in einem Regal eine kleine Plastikfigur, eine Puppe. Sie war rot, und aus dem geöffneten, zahnlosen Mund kamen schrille Laute. Sie schienen nicht gänzlich unartikuliert zu sein. Ich mühte mich zu verstehen. »Killatoc« so ähnlich klang es immer wieder. »Killatoc.«
Ich wußte nicht, was ich suchte. Mir kam es vor, als triebe ich durch Tangwälder. Dann wieder streiften mich Nesselfäden riesiger Quallen. Ein wenig entsprach das meinem Lebensgefühl in letzter Zeit. Auf eine schmerzliche Art von den Verhältnissen überspült.
Dann aber entdeckte ich etwas, das meine Lebensgeister sofort belebte. In einem Nebenraum Regale voller Weinflaschen. Auch wenn ich kein großer Kenner bin – diese Etiketten, auf denen sich die Worte »Grand Cru Classe« wiederholten, redeten eine deutliche Sprache. Hier waren Geld und erlesener Geschmack eine höchst trinkbare Fusion eingegangen. Ich nahm eine der Flaschen an mich und tauchte auf ins Parterre, öffnete die Fenster und ließ diesen verregneten Leeuwardener Tag alle Unterwassergeister vertreiben. Dann ging ich in die Küche, versorgte mich mit einem Glas und einem Korkenzieher.
Ich las in Gutty Floys Tagebuch und trank Saint Emilion Grand Cru Classe in kleinen Schlucken, die ich zerkaute, bis das Tannin, dieses dunkelrote Adstringens, meine aufgeregten Magennerven beruhigte und mir allmählich zu dämmern begann, daß ich eine Spur aufgenommen hatte, die bei aller Undeutlichkeit doch in eine bestimmte Richtung wies, in die Neue Welt, wie wir Europäer heute noch sagen.
Als ich gegen Abend die Wohnung verließ, hatte ich eine zweite Flasche fast ausgetrunken, eine Menge Walgesänge gehört und außerdem den Kopf voll von Geschichten aus Gutty Floys Tagebuch. Es war englisch geschrieben und eigentlich kein richtiges Tagebuch. Lauter Märchen oder Traumprotokolle. Ich nahm es mit. Dieser Name »Gutty Floy« hatte von mir Besitz ergriffen. Ständig wiederholte ich den Spruch »Gutty Floy is my name/ and terra is my nation ...«
Als ich am nächsten Tag meinem Chef Bericht erstattete und dabei die Dürftigkeit des Ergebnisses meiner Recherche beklagte, winkte er ab. »Killatoc«, murmelte er. »Das klingt gar nicht so schlecht. Piet. Du fährst auf jeden Fall hin. Du kannst jetzt deine Pilze auf der anderen Seite der Welt weitersuchen. Die sollen dort tolle Wälder haben. Aber bring mir gefälligst echte Luckies mit.«
Ich mußte ihn ziemlich dümmlich angesehen haben, denn er lachte lauthals und schlug mir auf die Schulter. »Was? Du warst noch nie in Amerika? Dann wird es aber Zeit, mein Lieber. Ein Expsychologe wie du muß einfach mal dagewesen sein. Du wirst begeistert sein. So viele prächtig funktionierende Psychopathen gibt es nirgendwo sonst. Es ist die größte Klapsmühle des Erdballs, und das Wunderbare daran ist die Tatsache, daß sie immer noch hervorragend arbeitet. Überhaupt nicht veraltet. Ob Elvis, Kevin Costner oder Michael Jackson. Dort gibt es sogar echte Indianer, die im Film glaubhaft Indianer spielen.«
Während er weiterredete, schob er mir ein Kuvert über den Tisch. Darin steckten ein Flugticket, mehrere Adressen und eine Liste, die sich als englisches Glossar so wichtiger Fachausdrücke wie ›Holster‹ für Pistolenhalfter erwies.
3
Genau vierundzwanzig Stunden vor dem Abflug begann ich, Bourbon zu trinken. Wasser der Dunkelheit, wie es die Indianer nennen. Nicht, weil ich damit meine wachsende Unruhe bekämpfen wollte – schließlich würde ich mehr als vierzehn Stunden in über 10000 Meter Höhe verbringen –, auch nicht, weil mich die vagen Dimensionen dieses Falles beunruhigten. Beides hätte ich lieber mit einem anderen Getränk beschwichtigt. Ich trank vielmehr dieses seifig-süßliche Getränk, weil es charakteristisch für das Land sein sollte, in das ich fahren würde.
Bourbon schmeckt mir nicht. Er hat die Eigenschaft, in jeden Winkel des Körpers zu dringen, von den Haarspitzen bis zu den Fußsohlen. Er macht nicht allein betrunken durch seinen Alkoholgehalt, sondern auch durch seine geschmackliche Penetranz. Er kann durchaus Ekelgefühle erzeugen, und zugleich schleicht er sich durch seine Duftstoffe in alles ein, was den Moment des Trinkens umgibt. Das macht süchtig. Man kann nicht aufhören.
Ich trank und trank. Der Himmel wurde rötlichbraun, die Wände meines kahlen Zimmers verloren ihre Reinheit, meine Gedanken verloren ihre Konturen. Ich wußte, spätestens nach dem fünften Glas wurde man vom Teufel geritten, und der Teufel war ein Cowboy. Ähnlich stellte ich mir Amerika vor, seine Wirkung auf das Gemüt: War man erst einmal da, durchdrang dieses Land alles mit seiner Weite, machte heimat- und orientierungslos, blind wie eine Motte auf dem Lampenschirm, nachdem das Licht ausgegangen ist.
Amerika, genauer gesagt, die USA: ein Land von geradezu perverser Größe für einen Holländer, eine fremde Welt, deren kulturelle, politische und ethnische Botschaften ich bislang nur aus Filmen, Büchern, Schnellimbissen und Soldatensendern kannte.
Es gab eine Zeit, in der es schick war, Amerikaner und ihr Land abzulehnen. Diese Zeit war vorbei. Vielleicht waren wir in Europa inzwischen alle so amerikanisiert, daß uns sogar unsere Vorurteile abhanden gekommen waren. Amerika war allgegenwärtig wie Jack Daniels nach dem zweiten Schluck. Und es war zugleich so weit weg, daß man sich wie Kolumbus fühlen konnte, wenn man hinfuhr. War es nicht immer noch eine geographische Täuschung? Ein falsches Indien? Der grandiose Irrtum eines naiven Entdeckers? Disneyland war seine Hauptprovinz und das Weiße Haus eine Sahnetorte, mit der ein überdimensionaler Komiker die Welt bewarf.
Die letzten Stunden vor meinem Abflug verbrachte ich in meinem Büro. Ein schmales Zimmer, das nicht mehr als einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein spartanisches Klappbett beherbergt. Ich habe an meinem Arbeitsplatz absichtlich unsere nationale Sucht nach Grünpflanzen und Fensterbrettnippes unterdrückt. Einziger Zierat ist ein anatomisches Poster, ein Skelett, auf dem sämtliche Knochen des Menschen festgehalten und durchnumeriert sind. Ich sehe es oft an, um mir Ruhe zu verschaffen, wenn mich Gedanken oder Probleme bedrängen. Aber jetzt hatten diese Knochen die Farbe von Whisky, und außerdem tanzten sie Boogie-Woogie.
Meine Aufgabe bei der Groninger Kripo ist es, Fälle von in Not geratenen Landsleuten zu bearbeiten. Zumeist ist es Papierkram. Hin und wieder sind glücklicherweise auch weite Reisen nötig, um an Ort und Stelle einzugreifen. Aber eine Dienstreise nach Amerika, damit hätte ich in meinen kühnsten Alpträumen nicht gerechnet.
Ich lag also auf meiner Pritsche, die Augen halb geschlossen, die Ohren halb dem Summen der Stadt zugewandt, halb jenem ewigen inneren Monolog, der Fragen und Antworten nach dem Leben und der Liebe durcheinanderschüttelt wie Glassplitter in einem dunklen Kaleidoskop. Ich habe es mir angewöhnt, mein eigener Psychiater zu sein, hier hin und wieder zu liegen und mir einzubilden, zugleich außerhalb meines Blickwinkels hinter mir zu sitzen, um mir anzuhören, was mir so an wahllosen Gedanken in den Kopf kommt. Beide sind wir mittelmäßig, Patient und Arzt, beide könnten wir ohne weiteres die Plätze tauschen, ohne daß sich etwas ändern würde. Das ist ein gutes Gefühl, denn es verschafft einem die für dieses Leben so nötige sanfte Resignation. Diesmal aber hörte ich nichts außer einer schrillen Kinderstimme: »Killatoc, Killatoc ...«
Ich rief meine Mutter an. »Tropft es noch?« fragte ich. Sie verneinte. Ich hörte sie leise atmen, als erwarte sie mehr von mir. »Ich fliege morgen nach Amerika.«
»Siehst du«, sagte sie, »ich habe es geahnt. Du fliegst also nach Amerika. Das wird dich jünger machen, mein Sohn. Nach Westen fliegst du mit der Zeit. Wenn du nach Rußland fliegst, wirst du älter. Das erklärt vollkommen ausreichend den Unterschied zwischen beiden Völkern, findest du nicht?«
»Du hast recht, Mutter, wie immer. Überleg dir das noch mal mit dem Haus.« Besetztzeichen. Sie hatte wieder einmal zu früh aufgelegt.
4
Anderntags saß ich im Flugzeug. Meine Mutter hatte mir einen kleinen Reisebeutel gepackt. »Aber erst in Amerika aufmachen«, hatte sie gesagt.
Fliegen ist eine Qual für mich. Ich habe Höhenangst. Unter dieser dünnwandigen Blechdose 10000 Meter Leere zu wissen, wölbt meinen Adrenalinspiegel so sehr, daß sich alles darin verzerrt.
Dummerweise hatte ich in einem Anfall von Kühnheit, von indianischem Mut sozusagen, einen Fensterplatz gebucht, und der lag auch noch über der Tragfläche, deren Wippen mir den permanenten Vorgeschmack von Ikarus’ Ende vermittelte.
Es gab nur zwei Fixpunkte, die mich einigermaßen von meiner Todesnot abzulenken vermochten: die Knie meiner Nachbarin und die Lektüre in Gutty Floys Traumbuch. Ich hoffte, daß sie irgendeine Spur enthielten. Das war die Witterung, die ich aufgenommen hatte.
Wir flogen die meiste Zeit über einer geschlossenen Wolkendecke. Sie sah weiß Gott wenig seriös aus, eher wie eine gewaltige, in sich zusammensackende Bierblume. Da meine Nachbarin eben gesagt hatte, ich solle nicht immer auf ihre Beine starren und überhaupt ihr nicht so auf den Pelz rücken – die flugzeugunfreundliche Länge meiner Beine schien für sie kein Argument zu sein –, blieb mir nichts anderes übrig, als weiter in Gutty Floys Träumen zu lesen. Mich der Flut dieser Bilder zu überlassen. Ich versuchte sie zu deuten, zu lesen, wie man einen verschlüsselten Text liest, immer auf der Lauer nach Hinweisen, die das Geheimnis des Codes verraten. Natürlich wußte ich, daß dies kaum der richtige Weg war. Träume sind keine Rätsel, die dem Verstand aufgegeben werden. Der von mir als Schriftsteller so hoch geschätzte Dr. Freud war mit seinen Traumdeutungen einem grundsätzlichen Irrtum aufgesessen. Träume sind kein codiertes Leben. Es ist genau umgekehrt. Sie sind der Klartext. Das Leben ist die verschlüsselte Botschaft. Das Beste, was ich je über Träume gelesen habe, stammt übrigens von einem amerikanischen Schriftsteller: »Der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind, wurde von den Sinnen gesammelt und im Gedächtnis gespeichert wie Eichhörnchen Nüsse horten.« Träume sind also nichts anderes als präzise Erinnerungen ohne Konzept. Wirklichkeit, wie sie im Wachzustand niemals erfahren wird, weil dann bereits die Verfälschung durch das Leben eingesetzt hat.
Eine von den Geschichten gefiel mir so gut, daß ich sie mir halblaut vorlas:
»Mir träumte, die Erde war dünn, und der Baum auf ihr hatte keinen Platz für seine Wurzeln. Ein Sperling setzte sich auf seinen höchsten Ast, und der Baum stürzte um. Seine Wurzeln rissen ein Loch in die Erde, und von dort strömte ein sanfter Wind, der Wind des Lebens, der den Duft von Sommerwiesen heraufbrachte. Mir träumte, daß Tiefer Mond sich über den Rand der Öffnung beugte und den Halt verlor. Sie stürzte in den Himmel hinab, immer tiefer, dem warmen Südwind entgegen. Alles war blau um sie, so weit das Auge reichte, und sie hatte Angst, am Grunde des Himmels zu zerschmettern. Da erblickte sie einen weißen Vogel. Auch der Vogel erblickte sie. Er flog eine Weile neben ihr und fragte: ›Fürchtest du dich, so zu fallen?‹ ›Ja‹, sagte Tiefer Mond, ›ich fürchte mich.‹
Der Vogel verwandelte sich in einen Mann mit schwarzen Haaren und starken Armen, der sie umfing. ›Ich werde dich retten‹, sagte der Mann, ›hab keine Angst.‹ Da er keine Flügel mehr hatte, fiel er jedoch selbst. Und je tiefer er fiel, um so mehr fürchtete er sich. Da ließ er Tiefer Mond los und bewegte seine Arme, bis sie Federn bekamen. Dann flog er davon. Tiefer Mond aber stürzte weiter in die blaue Schlucht des Himmels.«
Ich klappte das Buch zu und starrte auf die Leinwand an der Stirnseite der Kabine, auf der ein amerikanischer Videofilm lief. Ohne Ton, denn ich hatte keinen Kopfhörer. Die Bilder waren unscharf, darin glichen sie fatal der Wirklichkeit.
Irgendwann versuchte ich zu schlafen. Wider Erwarten mußte es mir gelungen sein, denn ich war plötzlich in Gutty Floys Traum. Ich fiel und fiel durch blaue Tiefe. Neben mir tauchte ein Vogel mit weißen Schwingen auf. Er kam immer näher, sein scharfer Schnabel öffnete sich, er begann, nach mir zu hacken.
Ich wachte davon auf, daß meine Nachbarin ihren Ellbogen in meine Rippen boxte. »Ich bin kein Kissen«, zischte sie. »Schlafen Sie gefälligst nach der anderen Seite, und schnarchen Sie nicht so.«
Zehn Stunden waren wir schon geflogen. Ich starrte auf die Tragfläche, die kupferfarben glänzte im Licht der tiefstehenden Sonne. Das Reisepäckchen meiner Mutter fiel mir ein. Es ließ sich nur schwer öffnen. Als ich die Plastikfolie mit meinem Taschenmesser aufschnitt, stank es bestialisch. Alter Münster, mein Lieblingskäse. Ich mußte die Stewardess bitten, diese Geruchsbombe zu entsorgen.
Dann kam die Nacht. Die Dunkelheit wirkte stofflich, und ich fühlte mich sicherer, so eingekapselt von Finsternis. Wie naiv man doch reagiert. Wir waren inzwischen über dem anderen Kontinent. Er war dünn besiedelt. Man sah es an den seltenen, kleinen Sternbildern dort unten, Ansammlungen von Lichtpunkten, meistens in Kreuzform. Nester, die wahrscheinlich aus nur einer Haupt- und einer Querstraße bestanden. Durch die eine lief der Held, die Hand nur wenige Zentimeter vom Revolvergriff entfernt, die andere kam der Bösewicht herauf. Seine Finger bogen sich schon um die Waffe. An der Kreuzung würden sie aufeinandertreffen.
Meine Nachbarin war eingeschlafen. Ihr Kopf ruhte an meiner Schulter. Ich wagte nicht, mich zu bewegen, zog nur das kleine Rollo vor dem Fenster zu, als verleihe dies der Situation mehr Intimität.
Wir landeten eine Stunde vor Mitternacht auf dem San Francisco International Airport. Auf meiner Armbanduhr war bereits der nächste Morgen angebrochen. Ich hatte sie nicht verstellt, vielleicht, um einen letzten Kontakt zur Alten Welt zu halten. Jetzt kroch von dort die Müdigkeit in mich.
Ich hasse Flughäfen. Sie kommen mir vor wie Schlachthöfe, in denen Menschen wie Vieh behandelt werden. Man bewegt sich auf Rollbändern, mit einem unsichtbaren Fleischerhaken im Nacken, wird kontrolliert wie bei einer Trichinenbeschau, muß endlos in Schlangen warten, bis man an der Reihe ist, das Bolzenschußgerät aufgesetzt zu bekommen. Man muß anscheinend das Privileg, unerhörte Distanzen in kürzester Zeit zurücklegen zu dürfen, durch solche hinterhältigen Prozeduren büßen. Am schlimmsten ist es vor dem Gepäckförderband, auf dem die Koffer und Taschen vorbeiziehen wie arme Seelen, die ihre Menschenschatten werfen. Ich muß mich jedesmal überwinden, mein eigenes Gepäck zu ergreifen. Lieber lasse ich es zweimal die Runde machen. Immer befürchte ich, der Koffer sei so schwer, daß er mich aufs Band ziehen und ich in dieser Schleuse zur Unterwelt für immer verschwinden könnte.
Doch schließlich stand ich da mit meinem Koffer. Verloren und schüchtern. Es war dieses Auswanderergefühl, wie ich heute glaube. Vor dem Informationsschalter fiel mir kein Wort der Landessprache ein. Es war peinlich. Die Dame hinter dem Fenster mit der offenen Luke sprach mich auf deutsch an. Sie riet mir, mit einem Shuttlebus zum nächsten Motel zu fahren. Es sei schon zu spät für den Weg in die zehn Meilen entfernte Stadt, vor allem, da ich unverzeihlicherweise kein Hotel gebucht hätte.
Eine halbe Stunde später fand ich mich auf dem durchgesessenen Sofa eines schäbig möblierten, großen Zimmers vor einem alten Fernseher wieder. Ich hatte plötzlich eine ganze Wohnung mit Bad, Schlaf-, Wohnzimmer und Küche für mich. Die breite Glasfront ging auf eine Reihe von Müllcontainern. Alles war heruntergekommen und dennoch komfortabel. Übertrieben groß und in eigenartigen Winkeln gestellt. Ein Environment von Claes Oldenburg. Godot hätte sich hier wohl gefühlt, vor diesem blutroten Blumenmeer auf der Tapete, in diesen gewaltigen, nachtschwarzen Skailedersesseln, auf denen weiße Kunstfelldecken lagen, in diesem riesigen, wie ein schlaffes Trampolin nachgebenden Bett mit den Kunstfaserbezügen und den gelben Rüschen am Rand.
Ich duschte. Die schweren Armaturen hätten in das Raumschiff Enterprise gepaßt. War dieser Raum typisch für das Land? Mangel und Verschwendung so nah beieinander? Unglaublich solide Wasserhähne, ein Herd, der einer Großküche gut gestanden hätte, Steckdosen und wie provisorisch verlegte Leitungen, die einen europäischen Installateur die Stellung gekostet hätten, Topfblumen, die aus Cellulose oder aus Wachs zu sein schienen, obwohl sie echt waren, unerbittlich grün und orange, und von Staub bedeckt, der klinisch steril wirkte.
Es roch nach Desinfektionsmitteln. Über die Scheibe des Fernsehers kroch eine Fliege, genau über die Nase des Moderators, der von einem Krieg erzählte, als handele es sich um ein Haarwuchsmittel, während in der eingeblendeten Werbung ein Glatzkopf im Stile eines Kriegsberichterstatters von einem Haarwuchsmittel redete. Ja, ich war zweifellos in einer anderen Welt. Sie war häßlich und großzügig zugleich.
Ich trank zollfreien Bourbon vom Flugzeug. Hier schmeckte er völlig anders, fast richtig gut. Dann griff ich wieder zu Gutty Floys Traumbuch. Leise las ich mir vor, während aus dem angrenzenden Apartment die rauhen Stimmen und die Revolverschüsse irgendeines Westerns zu hören waren.
»Ich habe geträumt, im Bauch von Tiefer Mond zu sein. Mein Bruder war bei mir. Wir unterhielten uns. ›Laß uns auf dem üblichen Weg hinausgehen‹, sagte er, ›damit wir unserer Mutter nicht weh tun.‹ Ich aber war ungeduldig und wollte auf dem schnellsten Wege hinaus. Ich sah ein Licht unter ihrem linken Arm. ›Dort geht es hinaus‹, sagte ich. ›Komm mir nach!‹ Aber mein Bruder wollte nicht folgen, um unsere Mutter nicht zu verletzen. ›Wir wollen warten,‹ sagte er, ›bis sie uns auf dem natürlichen Wege hinausläßt.‹ Aber ich hörte nicht auf ihn. Ich stieß mich mit den Beinen ab und kletterte nach oben. Tiefer Mond schrie auf vor Schmerzen. Aber es kümmerte mich nicht. Ich kroch an ihrem Herzen vorbei, das laut und schnell in ihrer Brust schlug. Dann hatte ich die Öffnung in ihrer Achselhöhle erreicht, aber sie war zu eng. Ich mußte sie weiter machen. Also nahm ich mein Messer.«
Ich konnte nicht mehr. Die Augen fielen mir zu. Ich schob meinen Koffer vor die dünne Sperrholztür, deren Beschläge ebenso billig waren wie die Armaturen im Badezimmer teuer, und zog mich aus. Als ich ins Bett sank, hatte ich wieder das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, aber diesmal kam kein Vogel, der mich nicht schlafen ließ.
5
Meine biologische Uhr und die Ortszeit klafften neun Stunden auseinander. Die Folge waren Idiosynkrasien, Überempfindlichkeit der Netzhaut. Das Tageslicht zum Beispiel. Es war dem Nachthimmel übermalt in opaken Farben, ein quälendes Blau, glasiert und eingebrannt von der Sonne. In mir war Abend, draußen vor den Busfenstern gleißender Morgen. Die Temperatur bereits 70° Fahrenheit. Die Umrechnungsformel hatte ich mir eingeprägt. Minus 32 mal 5 geteilt durch 9. Also 38 mal 5, macht 190, geteilt durch 9, ergab ungefähr 21 ° Celsius. 85° sollten es heute werden. Wieder rechnete ich. Es war fast ein physischer Schmerz, in meiner Verfassung mit solchen Zahlen im Kopf zu balancieren, aber er hielt mich wenigstens wach. Fast 30° Celsius sollten es also noch werden, Hochsommer im Oktober.
Wir spülten in einer Strömung von Blech in Richtung Stadt. San Francisco, eine Legende für meine Generation, die noch von der ausklingenden Hippiebewegung berührt worden war. Dem Hörensagen nach eine der schönsten Metropolen der Welt. Für mich, der ich in den frühen Siebzigern an der Kiesgrube Gitarre gespielt hatte, zwischen den Joints und den Heineken-Dosen, und weil ich die Harmonien von »It never rains in southern California« mühsam auswendig gelernt hatte, war diese Stadt immer noch ein Ort uneingestandener innerer Sehnsucht. Das Mekka der Illusionen von einer friedlichen Menschheit.
Wir fuhren an pastellfarbenen Häuserreihen vorbei, Zuckerwerk in der Sonne, gewelltes Spielbrett einer überbelichteten Stadt, die Autos wie No-Steine darin verstreut, immer wieder mit dem Lineal gezogene Schneisen, die Streets und Avenues, die meisten ohne Namen, nur mit Nummer versehen, rechtwinklig zueinander, die Häuser zu Blocks geordnet, kein Labyrinth, sondern ein übersichtliches Arrangement, nach »downtown« hin steil in die Höhe wachsend die Stalagmiten der Hochhäuser. Ich hatte den Stadtplan aufgefaltet auf den Knien.
Bei der Cityhall stieg ich aus. Hier mußte das Zentrum sein. Als ich mich umsah, war ich enttäuscht. Es gab kaum Menschen. Die Umgebung wirkte wie eine Fiktion, eine Fatamorgana im Flimmern der heißen Studioluft. Die breite van Ness Avenue schnurgerade wie der Andreasgraben, die Cityhall ein klassizistischer Bau mit Kuppel und Säulen, Petersdom in Disneyland, die Bürgersteige leergefegt, nicht einmal Dreck, nur weißer Sonnenstaub, eine Stadt ohne Stadt, Niemandsstadt, menschenleer, die Autos zogen wie Jahrmarkts-Skooter vorüber, ohne Insassen, nur von geheimnisvollen elektrischen Impulsen unter dem Asphalt dirigiert.
Ich war inzwischen wieder des Englischen mächtig und fragte nach dem House of Justice. Jemand nahm mir den Stadtplan aus der Hand und malte eine Linie und ein Kreuz hinein. Amerikaner schienen enorm praktische Leute zu sein.
Obwohl mein Koffer ziemlich schwer war, entschloß ich mich zu laufen. Die Gegend wurde immer finsterer, ebenso wie die Gesichter der Passanten, die nun zahlreicher wurden. Spießrutenlaufen an dubiosen Existenzen vorbei.