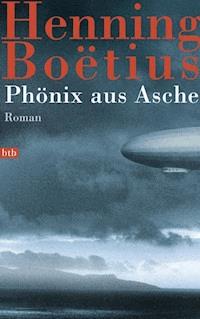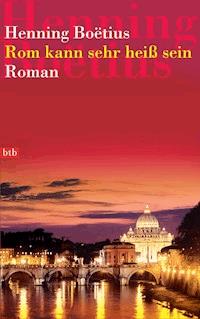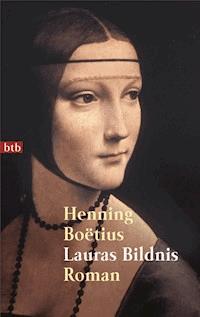2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Henning Boëtius‘ außergewöhnliche Romanbiographie über den Gnom, der „Göthe“ morden wollte: Georg Christoph Lichtenberg, 1741-1799, war sicher einer der brillantesten und witzigsten Köpfe der Aufklärung – und ohne Zweifel hatte er das schärfste Mundwerk seiner Zeit. Als Aphoristiker und Kunstkritiker ist er daher auch heute noch berühmt. Dass er allerdings auch ein hervorragender Naturwissenschaftler war, ist weitaus weniger bekannt. Henning Boëtius begleitet seinen buckligen Helden, den Pfarrerssohn, Göttinger Studiosus, Aristokratenerzieher und Professor der Mathematik, in Salons und Gelehrtenzirkel, ins englische Königshaus, in wissenschaftliche Kabinette und Universitäten. Er erzählt von Liaisons, ehelichen Pflichten, Himmelsbeobachtungen , physikalischen Experimenten und Entdeckerfreuden, von spöttischer Gesellschaftskritik und dem Mut, die Sache der Aufklärung voranzutreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Georg Christoph Lichtenberg gilt heute unangefochten als einer der Vordenker und Köpfe der Aufklärung. Henning Boëtius wählt ihn zum Mittelpunkt seines erzählerischen Interesses. Er begleitet seinen buckligen Helden, den Pfarrerssohn, Darmstädter Gymnasiasten, Göttinger Studiosus, Aristokratenerzieher und Professor der Mathematik in Salons und Gelehrtenzirkel, ins englische Königshaus, in wissenschaftliche Kabinette und Universitäten. Er erzählt von Liaisons, ehelichen Pflichten, Himmelsbeobachtungen, physikalischen Experimenten und Entdeckerfreuden, von spötterischer Gesellschaftskritik, genialen Geistesblitzen, alkoholischen Ausschweifungen, sexuellen Anfechtungen und dem Mut, die Sache der Aufklärung voranzubringen. Lichtenberg, verwachsen, von Krankheiten geplagt, seelischen Schwankungen unterworfen und exzentrischen Marotten frönend, ist für Boëtius der brillanteste und witzigste Geist seiner Zeit. Die Sympathien des Erzählers liegen – auch in den dunklen Lebensphasen seines Helden – ganz auf Seiten Lichtenbergs.
Autor
Henning Boëtius, geboren 1939, promovierte 1966 über Hanns Henny Jahnn. Ab 1967 leitete er die Redaktion der kritisch-historischen Clemens-Brentano-Edition. Seit 1979 freier Schriftsteller; u. a. Publikationen über Brentano und J. M. Lenz. Außerdem Autor mehrerer Fantasy-Romane. Besonderes Interesse erregte sein letztes Buch »Schönheit der Verwilderung«, Lebensroman des schlesischen Vaganten und Dichters Johann Christian Günther.
In einer so zusammengesetzten Maschine, als diese Welt, spielen wir, dünkt mich, aller unsrer kleinen Mitwirkungen ungeachtet, was die Hauptsache betrifft immer in einer Lotterie.
G. Chr. Lichtenberg, Sudelbücher Heft F, 846
Inhaltsverzeichnis
I. Die Gartentreppe 1742 - 1763
Georgs Abschied von Mutter und Schwester war still und ohne äußere Anzeichen einer heftigen Gemütsbewegung verlaufen. Auch von Bellos, seinem Hund, hatte er Abschied genommen, als würde er gerade nur in die Stadt gehen wollen.
Der aber hatte sich nicht täuschen lassen. Bellos war in wilden Sprüngen hinter der Kutsche hergelaufen und hatte Anstalten gemacht, nach den Fesseln der Pferde zu schnappen. Erst als ihn die Peitsche des Kutschers traf, gab er auf.
Nun rollten sie auf der Poststraße nach Norden. Georg hatte einen der außengelegenen Plätze ergattert und sah zu der offenen Seite der Kutsche hinaus. Um einen besseren Blick zu haben, hatte er ungeniert vor den Augen der Mitreisenden die große Decke mehrmals zusammengefaltet und unter sich auf seinen Sitz gelegt.
Die Decke war ein Abschiedsgeschenk seiner Mutter. Sie hatte nichts gesagt. Nicht einmal »Damit du nicht frierst«. »Vielleicht ist es ein Abschied auf immer«, dachte er. »Das würde seine Wortlosigkeit am besten erklären.«
Es war ein schöner Maitag. Obwohl die Sonne schien, kam es ihm vor, als gäbe es draußen keine Schatten.
Noch etwas anderes war höchst eigenartig: Die Bäume und Hecken im Vordergrund flossen, wie zu erwarten, gegen die Fahrtrichtung vorbei, und zwar um so schneller, je näher sie dem Betrachter waren. Die im Hintergrund liegenden Merkmale der Landschaft jedoch schienen sich mit der Kutsche vorwärts zu bewegen, und das um so schneller, je weiter sie entfernt waren. Die Gegenläufigkeit der beiden Bewegungen legte den Schluß nahe, daß es irgendwo zwischen Vorder- und Hintergrund eine Stelle geben mußte, wo die Dinge stillstanden.
»Es wäre interessant, diese Stelle zu berechnen«, sagte er laut. Mit sich selbst zu sprechen, war eine Angewohnheit von ihm, wenn er einen schwierigen Gedanken dachte.
Natürlich war es Unsinn, denn sie fuhren ja vorwärts durch die Landschaft und ließen alles in ihr Stück für Stück hinter sich.
Aber die Augen täuschten eine andere Wirklichkeit vor. Zum erstenmal hatte er dies erfahren, als er kaum älter als fünf Jahre war.
Es war an einem Wintertag gewesen. Sein Vater hatte ihn auf einen Spaziergang vor die Stadt mitgenommen. Dies war ein seltenes Ereignis, denn sein Vater hatte fast nie Zeit. Georg war daher aufgeregt und bereit, alles, was es zu sehen gab, für ein Wunder zu halten.
Es schneite stark. Sein Vater legte den Kopf zurück und sah den Flocken entgegen. Der Sohn ahmte dies nach.
»Was siehst du?« fragte sein Vater.
»Den Schnee. Die Flocken kommen aus dem Himmel.«
»Sieh es dir genau an. Von wo kommen die Flocken?«
»Sie kommen alle aus der gleichen Stelle.«
Der Vater hatte ihn gelobt und dann aufgefordert, nun den Schneefall von der Seite zu betrachten und seine Eindrücke zu schildern.
Da sah er ganz deutlich, daß die Flocken gar nicht aus einem Punkt herausfielen, sondern in parallelen Linien zu Boden schwebten. Kaum blickte er jedoch wieder zum Himmel empor, wirkten die Flocken wieder wie feine, weiße Blütenblätter, die im Kreis aus einem Punkt herauswuchsen und nach allen Seiten auseinanderstoben.
»Es ist eine Frage der Blickrichtung«, sagte sein Vater. »Das eine ist so wahr wie das andere.«
Diese Erklärung hatte sich Georg tief eingeprägt. Heute fragte er sich, ob die eigenartige Frömmigkeit seines Vaters auch eine Folge der Blickrichtung gewesen war. Wenn man das Gesicht hob und in den Himmel sah, war Gott im Zentrum, wenn man ihn jedoch von der Seite betrachtete, löste er sich in das Nebeneinander einzelner Teile der Schöpfung auf. Sein Vater hatte die Sterne über alles geliebt. Sie waren das Schneegestöber des Nachthimmels, das aus dem göttlichen Zentrum fiel. Auf der Erde gab es Menschen, zwischen denen kein Zusammenhang bestand, wenn man sie von der Seite betrachtete.
»Es wäre interessant, diese Stelle zu berechnen«, sagte er laut.
»Mit Verlaub, um welche Stelle handelt es sich, mein Herr, die Sie so gerne berechnen wollen?«
Georg blickte den Fragenden von der Seite an. Man saß in dem engen Wagen sehr nahe beieinander. Georg sah lauter Einzelheiten, das samtbesetzte Revers eines Rocks, einen großporigen Nasenflügel, die dicken Finger einer Hand, von der die schweren goldenen Ringe offensichtlich aus Gründen der Sicherheit entfernt worden waren. Die tiefen Kerben im Fleisch waren deutlich zu sehen.
»Die Stelle, wo zwischen zwei gegenläufigen Bewegungen Ruhe herrscht. Sehen Sie, da draußen!« Georg deutete in die Landschaft. Der Mann riß die Augen auf. Dann schüttelte er den Kopf: »Ich sehe nichts, mein junger Herr.«
Aber Georg sah. Er sah, daß dem Menschen drei Backenzähne fehlten, daß er es versäumt hatte, sich den Schlaf aus den Augen zu wischen und daß sein Schweiß Puder von der Morgentoilette im Kinngrübchen zusammengeschwemmt hatte.
Sie fuhren in einem der modernen Sechssitzer, die neuerdings von der Thurn und Taxisschen Reichspost eingesetzt wurden. Diese Wagen wurden von drei Pferden gezogen. Sie hatten ein festes Verdeck aus gewachstem Leinen und offene Seiten. Es gab zwei Bänke mit je drei Sitzplätzen. Beide Bänke waren in Fahrtrichtung installiert. Die Federung war nicht verbessert, jedoch hatten die Bänke jetzt gepolsterte Rücken und Seitenlehnen, so daß man die Stöße der Räder auf den holprigen Wegen ein wenig besser ertrug.
Die Reisegeschwindigkeit war trotz der neuen Wagen die alte geblieben: eine Meile pro Stunde, ein ehernes Gesetz bei den Postillionen. Unterschreitungen wurden durch kräftige Geldbußen geahndet. Schneller aber ging es nicht, solange die Wege so schlecht waren. Doch selbst auf chaussierten Straßen hielten sich die Kutscher an dieses Tempo.
Es war inzwischen schwül geworden. Am Himmel türmten sich Wolken mit dunklen Unterseiten, die bedrohlich in die Höhe quollen. Bald hörte man auch den ersten Donner.
Die meisten Passagiere hätten das heraufziehende Gewitter sicher lieber in einem Gasthaus abgewartet. Der Postillion begnügte sich jedoch damit, die Leinenrollos an den offenen Wagenseiten herabzulassen.
Es wurde finster. So erging es gefangenen Vögeln, über deren Käfig man ein Tuch legt, um sie stumm zu machen oder zum Einschlafen zu bewegen.
In diesem Fall waren die Folgen der Maßnahme jedoch gegenteilig: Angst und Unruhe breiteten sich unter den Passagieren aus. Da half es auch nichts, daß Georgs Nachbar den beiden Damen erklärte, daß Blitze selten in fahrende Kutschen einzuschlagen pflegten und die Gefahr höchstens vom Scheuen der Pferde ausgehen würde.
Endlich begann es zu regnen. Der Lärm der Tropfen auf dem Verdeck übertönte bald das schwächer werdende Gewitter.
Die Insassen beruhigten sich allmählich. Auch von Georg wich die Angst, die ihn jedesmal bei Gewitter befiel. Er lehnte sich in die Polster zurück und dachte an früher. Unscharf und blaß tauchten Bilder auf wie in der künstlichen Nacht einer Camera obscura.
Irgend etwas war damals geschehen. Es hatte mit warm und kalt zu tun, auch mit hell und dunkel. Er spürte die Erinnerung wie einen leichten Druck unter der Schädeldecke. Aber diesmal stellten sich keine Bilder dazu ein.
Er wußte, daß man schwache Sterne nur wahrnehmen kann, wenn man leicht an ihnen vorbeisieht. Daher versuchte er an andere Erlebnisse mit Licht- und Wärmekontrasten zu denken.
Die früheste Erinnerung, die ihm einfiel, war noch aus den drei ersten Lebensjahren, die sie in Oberramstadt verbracht hatten.
Die Welt war damals nicht größer als ein Hügel, auf dem Kirche und Pfarrhaus lagen. Ihr Rand lag am Fuß des Hügels. Daher bestand die Gefahr, daß man hinunterrutschte und auf Nimmerwiedersehen verschwand.
Vom Rand der Welt hörte er jeden Tag ein dumpfes und regelmäßiges Dröhnen. Nur an Feiertagen fehlte es, was ihnen einen besonderen Frieden verlieh. Das Dröhnen hatte ihm damals wohl Angst gemacht. Wer wußte, was hinter dem Rand der Welt geschah.
Sein Vater trug ihn eines Tages auf den Schultern den Hügel hinunter. Sie kamen in ein großes Haus, das ganz erfüllt war von Lärm und Hitze. Georg sah ein helles Loch, aus dem Funken sprühten und etwas riesiges Schwarzes, das sich hob und senkte. Er wußte nicht, was den Lärm machte: das Helle oder das Dunkle. Er preßte sich so fest es ging an den Hals des Vaters und vergrub das Gesicht in dessen Haar. Dann begann er zu schreien. Sein offener, feuchter Mund schrie in den Haaren seines Vaters. Danach verschwand die Angst.
Kurze Zeit später zogen sie nach Darmstadt, wo sein Vater erster Stadtprediger geworden war. Hier fehlte das Dröhnen, von dem er später begriff, daß es von einem mit Wasserkraft betriebenen Eisenhammer herrührte.
Das Gewitter und auch der Regen waren vorbei. Die Kutsche hielt. Die Rollos wurden hochgewickelt und festgeschnürt.
Das Licht blendete Georg, und er schloß die Augen. Er hörte, wie sein Nachbar sagte: »Ich habe jemanden gekannt, der vom Blitz getroffen wurde. Alles was ihm dabei passierte, war ein Malheur mit seinem Ehering. Er schmolz nämlich, und das ganze Gold floß in den Dreck. Seine Frau hat sich später von ihm scheiden lassen.« Der Mann lachte. Georg aber dachte an ein anderes Erlebnis, das ebenfalls mit warm und kalt zu tun hatte.
Er war damals wohl acht Jahre alt gewesen.
Seine Schwester hatte ihm wie jeden Abend ein heißes Bad bereitet und sah ihm beim Auskleiden zu. Sie war schon über dreißig und unverheiratet. Er hielt sie für seine Mutter, als er noch kleiner war. Er hatte zwei Mütter und einen halben Vater, so selten, wie er ihn zu Gesicht bekam.
Als er aus dem Hemd schlüpfte und sich reckte und bog, spürte er die Blicke der Schwester. Er wußte, es war schön für sie, ihn so zu betrachten, und darum ließ er sich Zeit. Das Wasser im Zuber war so heiß, daß er es im ersten Augenblick für eiskalt hielt. Man konnte sich darin täuschen, dies war ihm schon aufgefallen. Lauwarmes Wasser hingegen erkannte man immer.
Lange blieb er nun stehen und wartete, daß sich das Wasser abkühlte. Gerade als er sich setzen wollte, stieß die Schwester einen Schrei aus und rannte davon.
Gewöhnlich blieb sie da und half ihm beim Waschen. Ihm war nicht wohl zumute, und er blieb stocksteif in der Wanne sitzen. Schließlich glaubte er, im Wasser eingefroren zu sein wie in einem großen Klumpen Eis.
Seine Schwester kam endlich mit einem großen, angewärmten Tuch zurück. Sie legte es um ihn und rieb Rücken und Brust vorsichtiger als sonst. Er fror sehr und klapperte mit den Zähnen. Dann tupfte sie seine Schenkel und sein Glied ab und rubbelte ihm anschließend zärtlich den Kopf.
Als er wieder sehen konnte, bemerkte er seine Eltern in der Tür. Sie starrten ihn wie ein völlig fremdes Wesen an. Ihm wurde angst.
Am nächsten Tag kam ein Arzt. Georg mußte sich nackt ausziehen. Dann wurde er untersucht, abgeklopft und von allen Seiten begutachtet.
Der Arzt sagte zur Mutter: »Wie alt waren Sie bei der Geburt dieses Kindes?«
»Fünfundvierzig«, sagte die Mutter. Er erinnerte sich noch genau an den ängstlichen Klang ihrer Stimme.
»Die wievielte Schwangerschaft war es?«
»Die siebzehnte.«
»War es die letzte?«
»Ja«, sagte seine Mutter.
»Wann kam der Kleine zur Welt?«
»Um fünf Uhr nachmittags«, sagte der Vater.
»Es war Sonntag. Das Kind war so schwach, daß ich sogleich eine Nottaufe vornahm.«
»Ich meine den Monat, in welchem Monat kam es zur Welt«, sagte der Arzt.
»Im Juli.«
Er entsann sich genau an jedes Wort. Ihm kam es vor, daß alle viel zu langsam redeten und außerdem unnatürlich laut, als stünden sie auf freiem Feld sehr weit voneinander entfernt.
»Er ist also ein Sommerkind«, sagte der Arzt und wiegte den Kopf. »Sommerkinder haben diese Krankheit besonders oft. Man weiß nicht, woran es liegt. Es gibt Kollegen, die glauben, daß es mit der Sonne zu tun hat. Sommerkinder werden gewöhnlich erst ausgewickelt, wenn es Winter ist.«
Dann war der Arzt auf ihn zugekommen und hatte mit ihm gesprochen. Seine Stimme hatte dabei geklungen, als käme sie hinter irgendwelchen Bergen hervor.
»Der junge Herr wird einen Buckel bekommen. Einen hier und einen dort.«
Er hatte ihm bei diesen Worten auf die Brust und auf den Rücken getippt.
»Es liegt daran, daß die Wirbelsäule nicht richtig fest geworden ist. Sie ist wie eine Schraube gekrümmt, und das wird ganz allmählich den Brustkorb drehen, bis die Rippen nach vorne und nach hinten zeigen.«
Dann wandte sich der Arzt zum Vater, und nun klang seine Stimme ganz nahe, als ob sie in Georgs eigener Kehle entstand.
»Es gibt kein Mittel dagegen. Der kleine Mann wird seine Last tragen müssen. Aber es ist keine tödliche Krankheit. Er kann, wenn er sich richtig verhält, wenn er gesund lebt und in allem Maß hält, sogar ein halbes Jahrhundert alt werden.«
Dann ging der Arzt.
Es wurde nie wieder darüber gesprochen.
Selbst er dachte nicht mehr daran.
Als das Leiden in den nächsten Monaten immer deutlicher sichtbar wurde, hatten alle so getan, als gehöre es sich so, als sei dies genauso selbstverständlich wie das Reifen des Korns auf den Feldern.
Jahre später erst hatte er die Schwester gefragt, was sie damals so erschreckt habe, als sie ihm beim Baden zusah.
Sie habe für einen Moment den Eindruck gehabt, hieß es, daß sich in Georgs Körper ein zweiter Mensch bewegte, so als wolle er gewaltsam heraus und drehe und wende sich dabei in seiner Hülle.
An diesem Abend schlief Georg zum erstenmal seit langer Zeit wieder in einem fremden Bett. Sie waren zehn Stunden gefahren und demnach zehn Meilen nach Norden vorangekommen.
Lange konnte er nicht einschlafen. Immer noch versuchte er, jene Erinnerung aufzuspüren, die sich bisher nur als leichter Druck gegen die Schädeldecke äußerte. Es gelang nicht. Also beschäftigte er sich bald mit Bildern, die leichter zugänglich waren.
Zum Beispiel mit dem Dachboden des Graupnerschen Hauses.
Graupner, der Hofkapellmeister, war Georgs Onkel. Er hatte mit ihm häufiger zu tun als mit dem eigenen Vater. Er selbst war damals neun Jahre alt. Onkel Graupner ging auf die Siebzig zu. Er vertonte die vielen Kantaten und geistlichen Lieder seines Vaters, er besorgte die Opern und Singspiele, die dem Landesherrn genausoviel Vergnügen bereiteten wie die Jagd mit der Hundemeute.
Graupner hatte eine Art, sich gleich einem Baum im Wind zu bewegen. Die Hände und Arme schwankten wie Zweige und Blätter, sein Oberkörper bog sich vor und zurück, und die weißen Haare hatten immer etwas Verwehtes, wenn er die Perücke abnahm. Wahrscheinlich kam alles vom Dirigieren.
Immer hörte man Musik im Graupnerschen Hause. Georg war am liebsten auf dem Speicher unterm Dach. Dort klangen die Stimmen und Instrumente fern und unwirklich. Sie erinnerten an Leierkastenmusik. Am schönsten aber war der Blick aus den Dachgauben. Hier konnte er über den Rand der Welt hinaussehen.
Georg traute sich auch nachts auf den knisternden und seufzenden Boden, auf dem die Mäuse ihr Tanzfest feierten.
Einmal sah er in der Nacht eine bunte Staubwolke am Himmel. Sein Vater sagte, es könne durchaus ein Nordlicht gewesen sein. Was ein Nordlicht eigentlich sei, konnte er Georg nicht sagen. Er entsann sich noch, wie enttäuscht er war, denn er glaubte, sein Vater würde alle Geheimnisse des Himmels kennen.
In dieser Zeit wurde sein Vater schwer krank. Es hieß, er habe sich überarbeitet. Er war ja nicht nur Superintendent und höchster Kirchenbeamter des Landes. Er baute auch in einem fort Gotteshäuser. Dies war seine größte Leidenschaft.
Georg wurde in das Graupnersche Haus ausquartiert. Er schlief nun in einem fremden Bett.
Eines Abends ging er auf den Speicher und deponierte einen Zettel, auf dem in seiner besten Schönschrift die Frage stand: »Was ist das Nordlicht?«
Am nächsten Morgen schlich Georg ganz früh die steile Treppe hoch. Als er den Dachboden betrat, sah er zu seinem Schreck, daß mit dem Zettel etwas geschehen sein mußte. Er lag noch genauso auf dem Stuhl in der Gaube, der sein Observatorium war.
Aber die Schrift war ausgelöscht. Das Blatt war leer.
Er hatte damals die Tür zugeworfen, war die Treppen hinuntergestolpert und verwirrt nach Hause gerannt. Hier fand er stumme und in Tränen aufgelöste Menschen vor. Sein Vater war gerade gestorben.
Er durfte den Toten sehen. Er lag mit gefalteten Händen und offenen Augen da. Man hatte schon zweimal versucht, die Augen zuzudrücken, und immer wieder waren sie aufgegangen.
Georg zeigte am wenigsten Trauer von der ganzen Familie. Er entsann sich später, daß ihm der Tod des Vaters unwirklich vorgekommen war, so als sei auch er eine Frage des Blickwinkels.
Er wohnte noch eine Weile im Graupnerschen Hause. Seine älteren Brüder zeigten nach dem Tod des Vaters wenig Interesse an den kostbaren physikalischen und astronomischen Apparaten, die er ihnen so nach und nach zusammengekauft hatte. Das meiste davon kam nun in Georgs Besitz. Es war ein unermeßlicher Reichtum.
Das Teleskop schaffte er auf den Graupnerschen Speicher. Dabei fand er den Zettel wieder. Er mußte sich überwinden, ihn in die Hand zu nehmen. Als er ihn umdrehte, entdeckte er auf der Rückseite seine Schrift.
Hatte der Wind ihn umgedreht? Dies war wohl möglich, denn es war zugig hier oben. Doch hätte der Zettel dabei nicht vom Stuhl fallen müssen?
Die Sache war nicht geheuer, und er gruselte sich noch immer. Aber er begann damals ernsthaft zu versuchen, mit Hilfe der geerbten Instrumente, dem Mikroskop, der Elektrisiermaschine, der Camera obscura, dem Leuchtstein und dem Fernrohr der Natur auf die Schliche zu kommen.
Am nächsten Morgen ging es weiter gen Norden. Als Georg seinen Platz einnahm, stellte er fest, daß ein neuer Passagier neben ihm saß. Es war eine junge Frau.
Nun wünschte er sich nichts mehr als schlechtes Wetter, damit der Wagen verdunkelt würde. So hatte er immer geliebt: die eigene Person mußte unsichtbar bleiben. Der Gegenstand seiner Liebe durfte nicht einmal etwas ahnen.
Seine erste große Liebe war der Sohn des Schneiders Schmidt gewesen. Er war der Primus der Stadtschule. Georg entwickelte viel Phantasie und Findigkeit, diesen Jungen heimlich zu beobachten. Er kletterte auf Mauern, in Bäume, versteckte sich in Nischen und lauerte hinter Türen und Häuserecken. Kein Tag verging, an dem sich sein Geliebter nicht im Netz seiner Blicke verfing. Wenn er mit anderen Schülern sprach, brachte Georg zuweilen das Gespräch auf den jungen Schmidt. Auch dies gehörte zu den Möglichkeiten, den Geliebten zu besitzen, ohne daß der die mindeste Kenntnis davon erhielt.
Bei einer solchen Gelegenheit erfuhr Georg, daß der Schmidt seinen Namen erwähnt habe.
Im ersten Augenblick durchströmte ihn ein Glücksgefühl so stark, daß ihm das Blut ins Gesicht schoß und er sich schnell bücken mußte, damit niemand etwas bemerkte.
Er griff nach seiner Schultasche und ging.
Auf dem Nachhauseweg wich das Glücksgefühl einer tiefen Bestürzung. Er mußte sich verraten haben. Sein Geliebter wußte nun Bescheid.
Die Liebe war vorbei. Am nächsten Tag ging er dem jungen Schmidt auf dem Schulhof entgegen. Da sah er, daß es ein häßlicher Knabe mit dicken, roten Backen und einer stumpfen, kleinen Nase war.
Mit zehn Jahren wechselte Georg von der Stadtschule aufs Gymnasium. Er war inzwischen ein guter Schüler und ein großer Possenreißer dazu. Niemand schien seinen Buckel zu bemerken. Er hatte es wohl verstanden, ihn durch sein heiteres Wesen unsichtbar zu machen.
Georgs nächste große Liebe war die Tochter des Tischlers Weyland. Es war ein dunkelhaariges Mädchen mit ruhigen, schönen Augen.
Das Auffälligste waren ihre Lippen, die die Form eines Herzens hatten, das zu lachen versuchte. Georgs Schulweg führte am Haus der Weylands vorbei. Immer wenn er durch die Fenster im Parterre sah, war die Familie beim Essen. So war es morgens, und so war es mittags, wenn er nach Hause ging. Alle hatten sie einen Löffel im Mund oder kauten und verzogen das Gesicht dabei. Nur die Tochter hatte den Löffel in der Hand, um ihn zum Mund zu führen oder zum Teller. Ihre Lippen waren geschlossen. Die Schönheit ihres Mundes wurde durch keine Bewegung gestört.
So ging es eine ganze Weile. Doch einmal ertappte er sie dabei, wie sie gerade den Löffel ableckte. Er sah ihre Zunge und einige ihrer Zähne. Es war ein furchtbarer Anblick. Seine Liebe war dahin, und er änderte seinen Schulweg.
Den ganzen Tag über vermied Georg es, seine Nachbarin anzusehen. Er blickte entweder auf den Hinterkopf seines Vordermannes, zu Boden oder zur Wagenseite hinaus in die Landschaft. Das Schaukeln des Wagens machte es jedoch unmöglich, Berührungen zu vermeiden. Sein linkes Knie stieß immer wieder gegen den Stoff ihres Rockes, der plissiert und so weich war, daß er nicht ahnen konnte, ob sie die Berührung überhaupt spürte.
Ihn aber versetzte sie in eine Erregung, die seine Erinnerungen an Schärfe und Deutlichkeit gewinnen ließen.
Es war jetzt fünf Jahre her, daß er die Oberprima mit Auszeichnung abgeschlossen hatte und in die Selekta aufgenommen worden war. In dieser Klasse sammelte sich die Elite der Schule, um sich auf das Studium an einer Universität vorzubereiten. Er sah alle vierzehn Gesichter der anderen Selektaner wieder vor sich, die er oft während des Unterrichts in sein Heft gekritzelt hatte. Er liebte es, die Gemüts- und Verstandeskräfte eines Menschen mit krakeligen Strichen einzufangen.
Hauptbeschäftigung der Selektaner war es, die Kunst des Disputierens zu erlernen. Da sie zusammen mit den Primanern in einem Raum unterrichtet wurden, nahmen sie jedoch auch am gewöhnlichen Pensum teil.
Zwischen Primanern und Selektanern gab es oft Streitereien. Es ging zuweilen in den Pausen sehr stürmisch zu. Während einer dieser Schlachten hatte er ein Erlebnis, das ihm jetzt wieder vor Augen stand.
Er war auf einen Tisch geklettert und wehrte sich mit Fußtritten gegen die Attacken eines Schülers, den er vorher mit einer Hand voll Löschsand beworfen hatte. Dabei streifte sein Blick zufällig die Wandtafel und blieb an einem Turm untereinanderstehender Wörter hängen. Es war das Wort »domus« in allen seinen zehn grammatikalischen Formen.
Wie der Blitz durchfuhr ihn ein Gedanke: Selbstmord. Selbstmord war eine legitime und moralisch gerechtfertigte Tat und wurde zu Unrecht von Kirche und Obrigkeit als strafwürdiges Vergehen angesehen. Doch was hatte dies mit »domus« zu tun? Er nahm sich vor, seine Gedanken über den Selbstmord schriftlich niederzulegen, und erhielt auch sogleich die Gelegenheit dazu. Rektor Wenck stellte den Selektanern noch am gleichen Tag die Aufgabe, eine selbstgewählte Behauptung so geschickt wie möglich zu vertreten.
Georg schrieb eine Verteidigungsrede des Selbstmordes. Er nannte sie ›domus vitae‹ ›Das Haus des Lebens‹.
Rektor Wenck ließ ihn am Tag, nachdem er sie abgegeben hatte, zu sich kommen und widerlegte Georgs Argumentation Punkt für Punkt. Den Aufsatz gab er ihm nicht wieder zurück. Georg hatte seinen Wortlaut jedoch so gut behalten, daß er ihn auch jetzt auf dem Wege nach Göttingen noch memorieren konnte.
»Man tut dem Leben zuviel Ehre an, wenn man den Tod durch die eigene Hand als unehrenhaft, ja als strafwürdig und sündhaft verurteilt. Der Umgang der Menschen miteinander widerlegt die verbreitete Meinung, im Leben des Einzelnen einen hohen Wert zu sehen.
Doch wäre dieses Argument für den Selbstmord allein nicht ausreichend. Eine zweite Überlegung vermag ihm jedoch zur Seite zu stehen: Unsere Eltern, unsere Lehrer, die Sittengesetze, die Regeln und Erfordernisse des Staates und der Kirche formen uns von Geburt an. Auch wir selbst sind dazu aufgerufen, bei der Arbeit, einen ansehnlichen und nützlichen Menschen aus uns zu machen, nach Kräften mitzuhelfen. Wir können diese Arbeit mit der eines Bildhauers vergleichen, der aus einem formlosen Lehmklumpen eine schöne Gestalt schaffen möchte.
Mißlingt diese Arbeit jedoch, ist es dann nicht das Recht des Bildhauers, sein Werk zu vernichten? So verhält sich der Staat, wenn er einen Verbrecher zu Tode befördert. Da wir selbst zumindest ab einem gewissen Alter unser eigener Bildhauer sind, sollten wir ebenso das Recht haben, die Statue zu zerstören, wenn sie mißlungen ist!
Für diejenigen, die sich immer noch nicht überzeugen lassen, füge ich ein drittes Argument hinzu.
Es ist ein alter Gedanke, den menschlichen Leib mit einem Haus zu vergleichen, in dem die Seele vorübergehend Wohnung bezogen hat. Ich sage ›vorübergehend ‹, denn die Seele soll im Gegensatz zum Leib unsterblich sein.
Vertiefen wir dieses Bild: Das Haus hat Fenster. Unsere Augen, aus denen die Seele und ihr treuer Begleiter, der Verstand, hinaussehen, wann immer es ihnen beliebt.
Es hat auch dunkle Winkel und Räume, in denen die Seele sich verkriechen kann, wenn ihr danach zumute ist.
Da sind Bilder in einem solchen Haus, die wir Träume nennen. Es muß aber auch eine Tür geben, durch die man hinaus kann. Häuser ohne Türen sind Gefängnisse.
Was ist nun aber die Tür? Ist es der Mund? Sind es die Ohren? Nein! Beides sind Läden, die man öffnen kann, um sich mit Passanten und Besuchern zu verständigen. Türen sind es nicht.
Es gibt nur eine Tür an diesem Haus. Das ist der Tod. Welche Tür aber verdient diesen Namen, wenn sie der Bewohner nicht auch von innen öffnen kann?
Krankheiten, Unglücke, Kriege können die Tür von außen öffnen. Es muß jedoch erlaubt sein, daß die Seele sich selbst entschließt, ihrem Freiheitsdrang nachzugeben, und das Haus aus freien Stücken verläßt. Natürlich fällt die Tür unweigerlich hinter ihr ins Schloß, so daß es keine Rückkehr mehr gibt. Wer aber weiß denn, ob es draußen im Freien nicht schöner ist als drinnen!«
Was sind dies für eigenartige Gedanken, dachte Georg. Selbstmord aus Lebenslust!
Nun war es endlich soweit. Er war dabei, wenigstens das Haus seiner Jugend zu verlassen. Die letzten Jahre in Darmstadt waren quälend gewesen. Dreimal hatte er die Selekta erfolgreich durchlaufen. Da sie zum großen Teil gemeinsam mit Unter- und Oberprima unterrichtet wurden, bedeutete dies: fünf Jahre immer den gleichen Stoff, die gleichen Vokabeln, die gleichen Zahlen und antiken Gottheiten! Die Stadt wurde ihm verleidet davon. Er konnte schließlich jeden Pflasterstein und jedes Nachbarsgesicht herunterdeklinieren.
Warum studierte er eigentlich nicht wie seine Brüder? Es lag nur zum Teil daran, daß das Geld im Hause zu knapp war, um noch einen Studenten zu finanzieren. Es lag viel eher an ihm selbst. Er wollte partout nicht an der einzigen hessischen Universität, in Gießen, studieren. Es gab eigentlich keinen vernünftigen Grund für diese Haltung.
Allerdings hatte er schon als Selektaner ein Buch in die Hand bekommen, das ihn sofort außerordentlich faszinierte. Es war 1758 erschienen und hatte den trockenen Titel »Anfangsgründe der Mathematik«. Sein Autor war ein gewisser Kästner, Professor der Mathematik in Göttingen.
Georg bettelte bei seiner Mutter so lange, bis sie ihm das Buch kaufte. Er verschlang es wie einen Roman, dessen Helden Zahlen und dessen Handlung Rechenoperationen waren.
Die Null zum Beispiel hatte eine höchst zwielichtige Rolle. Es gab auch strahlende Helden wie die Primzahlen, die sich durch keine andere Zahl teilen ließen.
Endlich begann er etwas vom Leben zu begreifen.
Die vielen Experimente, die er mit den physikalischen Apparaten durchgeführt hatte, waren Spiel gewesen. Sie hatten ihm nichts erklärt. Er war zum Beispiel dem Rätsel des Nordlichtes nicht auf die Spur gekommen. Doch mit den Zahlen war es anders. Hier, so kam es ihm vor, war vielleicht endlich fester Boden, von dem aus man die Natur und den Menschen beobachten konnte. War er nicht selbst eine Null? Wenn er sich zwischen zwei Spiegeln von der Seite betrachtete, kamen ihm die beiden Höcker auf Brust und Rücken wie die beiden Bögen einer Null vor.
Die Lehrer wurden dieses seltsamen Schülers, der mit seinen viereinhalb Fuß nicht größer war als ein Zehnjähriger, allmählich überdrüssig. Sie konnten ihm nichts mehr beibringen, und von ihm zu lernen, trauten sie sich nicht.
Schließlich gelang es Wenck, ihn von der Schule wegzuloben. Georg selbst ignorierte die vielen Komplimente. Er wußte, daß er über Anfangsgründe bislang nicht hinausgekommen war.
Georg durfte die letzte Rede der Abschlußfeier halten, mit der das zweite Semester des Jahres 1761 endete. Ihr Thema war das Verhältnis von Wissenschaft und Dichtkunst. Da seine Mutter und seine Schwester anwesend waren, hatte sich Georg erlaubt, eine Zusammenfassung seiner lateinisch gehaltenen Rede in deutscher Sprache anzufügen:
»Es herrscht gemeinhin die Neigung, in Wissenschaft und Dichtung grundverschiedene Geschwister menschlichen Geistes zu sehen. Es heißt, die Wissenschaft halte es vornehmlich mit der Wahrheit, während die Dichtkunst mehr dem Schönen zugeneigt sei.
Die eine gebe vor, sich mit der Wirklichkeit erkennend zu befassen, die andere pflege die Einbildungskraft, um sich eigene Welten zu erträumen.
Dieser Gegensatz ist künstlicher Natur. Ihn zu behaupten, verrät eine schlechte Eigenschaft des Menschen, miteinander verwandte Verschiedenheiten zu Gegensätzen zu erklären.
Ich behaupte, daß Wissenschaft und Dichtung Zwillingsgeschwister sind. Sie sind sich nicht nur ähnlich, sie sind auch an einer Stelle miteinander verwachsen, so daß sie immer gemeinsam auftreten müssen.
Sie haben die gleichen Eltern. Liebe und Phantasie ist die Mutter. Ihr Charakter ist Weichheit, Fließen und Bewegung. Ihre Stimme ist das Wort. Der Vater ist das Gesetz, die Regel, die strenge Form, die Beständigkeit durch das Maß. Seine Stimme ist die Zahl.
Beide Geschwister tragen diese unterschiedlichen Erbteile in sich. Sie betonen nur jeweils das eine und verbergen das andere, ohne es ganz verleugnen zu können.
Die Wissenschaft kommt nicht ohne Liebe zu den Dingen und ohne Einbildungskraft aus. Oft genug muß sie phantastische Brücken zwischen einzelnen Phänomenen und Beobachtungen schlagen. Und bei aller Neigung zu Träumen und bildhaften Phantasien muß die Dichtung die Fähigkeit zur festen Form entwickeln. Sie muß sich sogar oft genauer um die einzelnen Elemente der Wirklichkeit kümmern als die Wissenschaft, will sie dem Schicksal entgehen, nur Täuschung und Wahnbild zu sein.
Dichtung ist ebenso Erkenntnis wie Wissenschaft Imagination. Beide dienen sie der Erforschung des Lebens, das Träume genauso umfaßt wie den festen Boden, auf dem wir uns bewegen, und die Himmelskörper über uns.«
Es wurde anhaltend applaudiert. Dann ging Georg mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Hause.
Als er am Herd bei den dampfenden Suppentöpfen saß und seiner Mutter und Schwester beim stummen Hantieren zusah, kam er sich wie einer jener Gaukler und Betrüger vor, die die Menschen auf Jahrmärkten mit ihren Tricks und Sensationen unterhielten. Sein bester Trick war, sich lebendig zu begraben.
Es dauerte noch fast zwei Jahre, bis endlich etwas geschah.
»Es liegt nicht an mir«, hatte er sich immer wieder gesagt. »Es liegt an der Politik. Es liegt an diesem Preußenfriedrich, den sie den Großen nennen.« Er haßte Politik, weil sie sich zwischen Kästner und ihn stellte.
Friedrich der Große hatte sich auf wechselnden Schlachtfeldern mit der ganzen übrigen Welt angelegt. Der Krieg ging ins siebente Jahr, wahrscheinlich weil es nichts zu verlieren und zu gewinnen gab. Es war ein Krieg wie ein Pendel. Einmal angestoßen, schwankten Siege und Niederlagen zwischen den Parteien hin und her. Dies maß auch die Zeit, die Georg hinter dem Ofen verbrachte.
Er hatte inzwischen alle Jahreszeiten zu seinem Winter erklärt und kam sich wie ein Igel vor, der sich im eigenen Buckel zusammenrollt.
Göttingen war mehrmals von französischen Truppen besetzt worden, da es zum Herrschaftsgebiet des englischen Königs, des einzigen Verbündeten des Preußenkönigs, gehörte.
Georg stilisierte sich zum Kriegsveteranen. Er lebte wie ein Emeritus in seiner Küchenuniversität und las die »Anfangsgründe«, während das Suppenfleisch garte.
Wunderbarerweise beendete Georg diesen Zustand ein halbes Jahr vor dem Ende des Siebenjährigen Krieges.
Er verfaßte für seine schreibunkundige Mutter einen Brief an den Landesfürsten, in dem er sein diplomatisches Geschick und seine in der Schule erlernte Fähigkeit, in Höflichkeitsfloskeln zu schwelgen, unter Beweis stellte.
In diesem Brief war nicht nur vom elfjährigen mühseligen Witwenstand der Mutter die Rede, von den großen Kosten, die durch das Studium der älteren Söhne entstanden waren, von der hervorragenden Begabung des jüngsten Sohnes, die nach dem Zeugnis seiner Lehrer eine Förderung verdienten. Die Rede war auch von Georgs festem Vorsatz, dem Vaterland dereinst auf dem Felde der gemeinen und höheren Mathematik nützlich werden zu wollen. Die Zahlen waren es, die dem siebzehnten Kind des verstorbenen Superintendenten zu einer Neugeburt verhelfen sollten. Der Schlußabsatz des Briefes lautete:
»Ich erkühne mich dahero, Ew. Hochfürstliche Durchlaucht hierdurch demüthigst anzuflehen, Höchstdieselben geruhen, die Studia ersagten meines jüngsten Sohnes durch die erforderliche Universitätskosten gnädigst zu unterstützen, dagegen aber die demüthigste Versicherung in hohen Gnaden anzunehmen, das Höchstdero Diensten mein Sohn demnächst alleine sich weihen, ich aber in tiefster Danknehmigkeit ersterben werde.«
Der Krieg war, wie gesagt, noch nicht zu Ende. Doch Georg fühlte in der Küchenecke den Frieden, ehe er ein halbes Jahr später am 15. Februar 1763 tatsächlich geschlossen wurde.
Um diese Zeit kam auch das gnädige Bewilligungsschreiben, in dem dem hoffnungsvollen Sohn der Stadt ein Stipendium von mäßigen hundert Gulden jährlich für die Dauer von vier Semestern bewilligt wurde. Die gleiche Summe sollte aus der landgräflichen Kabinettskasse fließen.
Die Zusage enthielt keinerlei Bedingungen, was den Studienort anging. Der Weg nach Göttingen zu Kästner war frei.
Als zusätzlicher Obulus wurden dreißig Gulden Reisegeld bewilligt. Der Betrag stammte von einem Pfarrer, der ihn als Dispens an die Staatskasse hatte zahlen müssen, um sich dadurch das Recht zu einer Heirat mit seiner Kusine zu erwirken.
»So ist es richtig«, dachte Georg. »Meine erste größere Bewegung auf diesem Erdball wird von einer Liebe finanziert, die halb verboten ist, weil sie in der Familie bleibt.«
Wieder schwankte die Kutsche. Dies gab ihm erneut Gelegenheit, seine Nachbarin mit dem linken Knie zu berühren. Es war ein schönes Gefühl. Es war zugleich ein wenig schmerzhaft. Hatte es nicht auch etwas mit warm und kalt, mit hell und dunkel zu tun? Wieder spürte er die Nähe dieser Erinnerung. Sie war fast greifbar nahe.
Er schloß die Augen und traute sich noch einmal, das Mädchen neben sich zu berühren, obwohl die Fahrt jetzt über einen guten Weg verlief und der Wagen ganz ruhig dahinglitt.
Ihm fielen plötzlich Zahlen ein, ungerade Zahlen.
»Die Treppe«, flüsterte er. »Wie habe ich sie vergessen können! Es muß vor meinem dritten Lebensjahr gewesen sein.«
Jetzt sah er sie deutlich vor sich.
Ein Teil der Treppe lag in der Sonne, ein Teil im Schatten.
Die Trennungslinie zwischen hell und dunkel teilte auch warm und kalt.
Er hockte still vor der untersten Stufe. Dann begann er, die Treppe entlang der gezackten Grenze zwischen Schatten und Licht emporzukriechen. Unter der einen Hand und dem einen Knie war es warm. Die andere Seite fühlte sich kühl an. Es war, als sei er mitten durchgeteilt.
Oben erhob er sich und stolperte auf unsicheren Beinen in die grünen Schatten hinein. Er verschwand auf einem schmalen Weg zwischen hohen Büschen.
Er hatte keine Vorstellung von einer Richtung oder einem Ziel.
Die Zweige und Blätter lenkten ihn mit kleinen Berührungen. Immer tiefer verlor er sich in den grünen Schatten, auf denen einzelne kleine Sonnenflecken umherkrochen. Er gab sich Mühe, keinen von ihnen totzutreten.
Er landete wieder vor der Treppe aus rotem Gestein.
Da ihm der Sinn für die Krümmung des Gartenweges fehlte, wunderte er sich, daß es die gleiche Treppe war.
Er wiederholte das Spiel, das er mit der Treppe spielte. Er rutschte auf allen Vieren die Trennungslinie zwischen Licht und Schatten empor.
Dann tauchte er in grüne Schatten und lief so lange vor sich hin, bis er wieder vor seiner Treppe landete. Er hatte bei diesem Spiel etwas Merkwürdiges herausgefunden.
Das eine Knie tat stärker weh als das andere. Es blutete auch. Es war das warme Knie.
Der Schmerz war angenehm süß. Er war ein Teil des Spiels, das er erfunden hatte. Wenn er mit dem warmen, blutenden Knie auf der untersten Stufe begann, hörte er mit ihm später auf der obersten auf. Er konnte so schon zu Beginn des Spiels das warme oder das kalte Knie bevorzugen.
Dies war ein Wunder, denn er wechselte doch die Knie Stufe für Stufe. Erst war das eine, dann war das andere dran. Und doch konnte er sich am Anfang schon für das Ende entscheiden.
Er zog das warme Knie vor. Es war schön, daß es weh tat. Das Blut trocknete auf dem roten Gestein und bildete winzige schwarze Schatten. Er erhob sich und stolperte in den Gartenweg hinein.
»Dies ist doch ein feiner Beweis«, dachte er, nachdem er die Augen wieder geöffnet hatte und in die Landschaft sah, »daß die Mathematik etwas mit dem Leben zu tun hat. Es war eine Treppe mit einer ungeraden Anzahl von Stufen. Ich habe damals, ohne es zu wissen, ein Rätsel gelöst. Es gibt Bedingungen, bei denen der Wechsel der Verhältnisse der Möglichkeit nicht im Wege steht, sich schon früh für ein Später zu entscheiden. Dies ist wahrscheinlich eine solche Stelle, wo etwas stillsteht, obwohl sich sonst alles vorwärts und rückwärts bewegt.«
Es befriedigte ihn, endlich dieses Erinnerungsrätsel gelöst zu haben. Er war erschöpft und legte den Kopf auf die Seitenlehne.
Er erwachte erst, als es bereits dämmerte. Die Kutsche stand vor einer Poststation. Niemand war zu sehen. Man hatte ihn allein in seinem gepolsterten Sitz schlafen lassen.
Er ging in den Raum für Passagiere. Es würde ihm jetzt nichts ausmachen, sich zu diesem Mädchen an den Tisch zu setzen und ihr die Geschichte von der Gartentreppe zu erzählen.
Sie war jedoch nicht da. Als sie am nächsten Tag weiterfuhren, hatte ein anderer Mensch den Platz neben Georg eingenommen.
II. Die Kunst der Pinik 1763 - 1767
Als Georg mit seinen schweren Koffern die Kutsche verlassen hatte und mitten auf dem Marktplatz stand, ergriff ihn eine solche Erregung, daß er nach Atem rang und sich auf einen seiner Koffer setzen mußte.
Er war in einer fremden Welt. Doch war ihr dies auf den ersten Blick nicht anzusehen, und das machte es noch aufregender für ihn.
Die Straßen waren hier auch nicht breiter als in Darmstadt und die Häuser nicht höher. Manche hatten Strohdächer, aber sonst sah alles nach einer normalen Stadt aus.
Doch irgend etwas war anders. Er hörte ein Lärmen, dessen Ursache er nicht sofort verstand.
Wind fuhr durch die Straßen und wirbelte allerlei Unrat auf. Sogar ein weißes Blatt Papier wehte vorbei.
Das hätte es in Darmstadt nie gegeben: Kostbares Papier, das wie Abfall herumlag.
Der Lärm kam zweifellos von den vielen Menschen. Er sah eine erstaunliche Menge elegant gekleideter Burschen, die lautstark auftraten und sich in den verschiedensten deutschen Dialekten Grobheiten und Komplimente zuriefen. Viele trugen Degen an den Hüften.
»Dies sind also die Soldaten des Geistes«, dachte Georg. »Die berüchtigten Studenten. Und ich soll nun zu ihnen gehören!«
Er kam sich wie ein Bauernlümmel vor, der mit offenem Maul und dummen Augen in die Welt glotzte. Darum erhob er sich und schleppte seine Koffer in das Gebäude der Poststation, wo er sie zur Aufbewahrung gab.
Er mischte sich tapfer in das Treiben der Stadt. Ein solches Gewimmel hatte er in Darmstadt nicht einmal bei der Kirmes gesehen. Es gab zahllose fliegende Händler und Marktschreier, die die Studenten zu übertönen versuchten. Es gab Frauen mit großen Weidenkörben voller Geschirr oder Gemüse auf dem Rücken. Männer, die ihren Laden voller Flaschen und Gläser vor dem Bauch trugen und ohne Unterlaß ihre Waren in einer Sprache feilboten, die wohl eine Art Deutsch war, jedoch völlig anders klang. Ein Mann mit einem Pferdewagen, dessen Ladung eine Plane bedeckte, schrie ohne Pause »Sohlt! Sohlt! Sohlt!«
»Um Schuhsohlen wird es wohl kaum gehen«, dachte Georg und blieb stehen, um den Vorgang näher in Augenschein zu nehmen.
Ein Mann trat hinzu, steckte die Finger unter die Plane, führte sie zum Mund und leckte sie ab. Er nickte zustimmend, worauf der Eigentümer des Fuhrwerks die Plane zur Seite schlug und mit einem Scheffel weißes, körniges Salz abwog.
Überall an den Häuserwänden lehnten Männer. In offenen Fenstern sah man Frauen, die ihre Arme auf die Simse stützten und das Treiben ebenso unbeteiligt betrachteten wie die Männer. Das waren also die Einheimischen.
Die Göttinger hatten nicht den besten Ruf. Sie galten als rückständig und fremdenfeindlich. In dieser Haltung waren sie durch die französischen Besetzungen der letzten Jahre noch bestärkt worden. Außerdem schienen viele die ausländischen Studenten für eine Art Besatzerarmee zu halten, von der sie zwar gute Geschäfte erwarten konnten, jedoch in ihrer bürgerlichen Ruhe erheblich gestört wurden.
Bis zum Abend lief Georg die meisten Straßen ab. Viele mehrfach, da er sich immer wieder verirrte. Als schließlich die Dämmerung hereinbrach – langsamer und auch später, als er es von zu Hause gewohnt war – , umrundete er die Stadt auf dem sie umgebenden Wall.
Innen drängten sich die verwinkelten Dächer. Draußen dehnten sich Wiesen und Felder, in denen nur wenige Gebäude und Wäldchen lagen.
Die Stadt mit ihrem Lärm, der auch jetzt noch nicht nachließ, lag wie in einem Suppenteller, der auf einem flachen, grünen Tischtuch stand.
Als Georg wieder in die Gassen hinunterstieg, empfand er zum erstenmal so etwas wie ein Gefühl der Geborgenheit.
Die erste Nacht verbrachte er in einem billigen Quartier für Durchreisende auf einem Sack Stroh. Lange konnte er nicht einschlafen, weil Geräusche seine Phantasie beschäftigten.
Er hörte Mäuse rascheln und das Schnarchen fremder Männer, hörte Hundegebell, Stiefelschritte und den Gesang Betrunkener.
Am nächsten Tag mietete er eine Bude im Haus des Stadtschreibers Horn in der Jüdenstraße.
Es war ein teures Quartier. Georg fühlte sich jedoch nicht in der Lage, sich auf eine längere Suche nach einem billigeren Zimmer zu begeben. Es strengte ihn an, nun ein neuer Mensch werden zu sollen. Jedoch stellte sich bei ihm keinerlei Heimweh ein. Eher kam er sich vor wie Robinson, der nun daranging, sich mit den wenigen Mitteln, die er aus seiner alten Welt gerettet hatte, ein neues Zuhause zu schaffen.
Das Haus des Stadtschreibers bestand nicht aus Fachwerk, sondern aus massivem Stein. Steuerrechtlich gehörte es damit in die oberste Klasse, was auch die hohe Miete erklärte.
Georgs Zimmer war klein, jedoch gut möbliert. Er packte seine Koffer aus und verwahrte seine Schätze in einem Schrank. Er hatte die ganze Sammlung seiner physikalischen Apparate mitgenommen.
Auf den Hocker neben sein Bett legte er Kästners Einführung in die Mathematik, als sei es die Bibel. Dann zog er die Vorhänge zu und legte sich angezogen auf sein Bett.
Es war noch hellichter Tag, aber er fand, daß er für heute genug getan hatte.
Wieder lauschte er den Straßengeräuschen. Sie kamen ihm nun schon vertrauter vor.
Nach Einbruch der Dunkelheit warf die Straßenbeleuchtung einen schmalen Lichtbalken zwischen den Vorhängen hindurch ins Zimmer.
Wie schon seit seiner Kindheit dachte er sich zum Einschlafen einen grausamen Mord aus. Diese Angewohnheit wollte er auch in Göttingen beibehalten, doch diesmal mißglückte ihm seine Freveltat. Er dämmerte einfach in einen Traum hinüber. Er träumte, daß er viele Jahre wie tot im Bett gelegen hatte und sich nun erhob.
Dabei blieb sein Buckel zurück.
Er lag auf der Matratze wie ein Korb. Gern hätte er gewußt, ob er etwas enthielt. Aber er traute sich nicht, noch einmal umzukehren.
Während er mit schnellen Schritten davoneilte, tat ihm sein verlassener Buckel leid.
In den zwei folgenden Wochen bis zu seiner Immatrikulation als Student der Mathematik und Physik besichtigte Georg die sieben Kirchen, die dreizehn Garküchen, in denen man billig zu essen bekam, die vielen Weinstuben und Branntweinschenken, die Läden, das Collegiengebäude der Universität, die Bibliothek, die Walltürme, die zur alten Stadtbefestigung gehörten und durch die moderne Kriegstechnik nutzlos geworden waren.Er besuchte auch die Vergnügungslokale vor der Stadt, die sich jetzt im Frühling zu füllen begannen.
Ihm fiel auf, wie viele Mädchen es überall gab.
Es wimmelte von Aufwarterinnen, Mägden und Mamsellen. Offenbar zog das Studentenleben ein Heer von Bauerndirnen in die Stadt.
Georg erfuhr, daß drei von ihnen soviel wie ein einziger Diener kosteten und daß sie im übrigen williger und vielseitiger zu Diensten wären.
Bei seinen Entdeckungsreisen kam Georg auch in den Stadtteil, der »Klein-Paris« genannt wurde. Hier, im Süden der Stadt, lebten die Ärmsten der Armen in Bretterbuden, die wie Schwalbennester an der Innenseite der alten Stadtmauer klebten. Der Gestank in dieser Straße war unerträglich. Überall lag Hunde- und Menschenkot.
Er sah ein Mädchen in einer kaum mannshohen Tür einer der Bretterbuden lehnen. Sie hob den Rock bis über die Hüften, als Georg vorbeischlich. Sie war nackt darunter bis auf einen länglichen Gegenstand, der von ihren Schenkeln baumelte.
Er nahm all seinen Mut zusammen und trat näher. Nun erkannte er, daß es eine der berühmten Göttinger Mettwürste war, die das Mädchen sich umgebunden hatte.
»Sie ist umsonst«, sagte sie und deutete auf die Wurst. »Sie ist umsonst, wenn du zu mir kommst.«
Dann brach sie in Gelächter aus, und er sah, daß sie trotz ihrer Jugend keine Zähne mehr im Mund hatte.
Er flüchtete weiter und kam an einer Ansammlung von Leuten vorbei, die wie ein Bienenschwarm einen Menschen einhüllte. Man sah nur seinen Kopf, mit dem er alle überragte.
Der Mann schien Geldstücke zu verteilen, wie Brotstücke an einen Schwarm Enten.
Er hatte eine hohe, fliehende Stirn und eine vogelschnabelartige Nase. Da er eine Perücke trug, mußte er eine vornehme Person sein.
Georg fiel der spöttische Mund des Mannes auf. Hin und wieder sagte er etwas, das die Menge mit brüllendem Gelächter quittierte.
Einige Tage verbrachte Georg auf seinem Zimmer. Er war unfähig zu lesen oder auch nur nachzudenken.
Während draußen randaliert und flaniert wurde, während die Schenken sich füllten und die verbotenen Glücksspiele begannen, während sich die anständigen Bürger in ihren Privaträumen hinter Mauern und zugezogenen Gardinen verbarrikadierten, lag Georg auf seinem Bett in einem Zustand zwischen Hoffen und Bangen.
Zweifellos stand er am Beginn eines aufregenden Experimentes, das sich niemals würde wiederholen lassen.
Er mußte ein neuer Mensch werden. Aber wurde man dies nicht von alleine? Was konnte er selbst dazu tun?
Ihn bedrückte, daß er so wenig Sehnsucht nach seinem Elternhaus hatte. Er liebte seine Mutter und seine Schwester. Aber es fiel ihm mit jeder Stunde schwerer, sie sich als wirkliche Personen vorzustellen. Als einziges Wesen aus seiner alten Umgebung hätte er gerne »Bellos« hier gehabt.
Was war dies für eine Welt, in der er sich nun zurechtfinden sollte?
Ein Blick aus dem Fenster genügte, um ihm mindestens drei Gattungen von Menschen beiderlei Geschlechts vor Augen zu führen.
Da gab es erstens die Bürger der Stadt. Diese Gruppe konnte man, wie es die Steuer tat, ebenfalls in drei Sorten einteilen, in Arme, in Vermögende und in Reiche.
Sie alle hatten das Bürgerrecht, und die meisten zahlten Steuern und gingen ihren Berufen nach.
Da gab es Schmiede, Drechsler, Radmacher, Schneider, Apotheker, Bader, Buchbinder, Kammerjäger, Schornsteinfeger, Totengräber, Musikanten, Gärtner, Pergamentmacher, Bäcker, Schwertfeger, Schieferdecker, Weißbinder, Fenstermacher, Färber, Handschuhmacher, Seiler, Schuster, Tuchmacher, Seifensieder, Fabrikanten, Polizisten, Torwärter, Schweinehirten, Wirte, Schlachter, Pfarrer, Strumpfweber, Feldscher, Chirurgen, Lohgerber, Steinmetze, Postmeister, Ofensetzer, Köche, Graveure, Lichterzieher, Knopfmacher, Buchhändler, Tanzmeister, Portraitmaler, Friseure, Täschner, Wollkratzer und wer weiß noch was für meist handwerkliche Professionen.
Wie die vielen Zahnräder einer komplizierten Uhr griffen sie ineinander. Die kleinen drehten sich schneller, die großen langsam, aber keines war überflüssig. Wies nun ein einziges schadhafte Zähne auf, konnte die ganze Uhr stehenbleiben.
Das Pendel aber waren die Jahre, von denen gute mit schlechten wechselten, und die Zeiger zeigten jeweils den Grad des Wohlstandes an.
Georg kam es vor, als lebten in Göttingen viel mehr Menschen als in Darmstadt. Dies stimmte nicht. Die Zahlen hielten sich in etwa die Waage. Jedoch steckte der siebentausendköpfige Menschenhaufen hier in einem viel engeren Anzug. Die Einwohnerzahl Göttingens hatte sich im letzten halben Jahrhundert verdoppelt. Wohnungen waren knapp und teuer, da die Bautätigkeit mit dieser Entwicklung nicht Schritt hielt.
Die Gründung der Universität im Jahre 1734 hatte das ihre zu diesem Zustand beigetragen. Seitdem der erste Professor für Philosophie und Physik in einem ehemaligen Kornlager mit seinen Vorlesungen begonnen hatte, wurden die Bürger der Stadt von zwei ständig wachsenden Armeen innerhalb ihrer Mauern belagert: Das eine waren die nun bereits über siebenhundert Studenten, samt dem Lehrpersonal und den Dienst- und Handwerksleuten, die zum akademischen Betrieb gehörten. Das andere waren die Bettler, Dirnen, Tagelöhner und Kriminellen, die vom neuen Wohlstand der Stadt angezogen wurden wie die Bienen vom Blütenstaub.
Beide Armeen genossen keine Stadtrechte. Sie hatten jedoch den größten Einfluß auf das Leben und Treiben am Ort. Wer studieren konnte, war zumeist Kind wohlhabender Eltern. Nicht nur die Mieten, nicht nur die Perückenmacher und Buchbinder, nicht nur die Hörgelder forderten ihren Tribut. Auch andere, weniger edle Bedürfnisse der Studiosi trugen zur Zirkulation des Geldes bei, das hier bei weitem reißender durch die Börsen strömte als in Georgs Heimatstadt.
Georg hatte nur ein einziges Buch, seinen Kästner, aus Darmstadt mitgebracht. Er entschloß sich deshalb, einen Antiquar aufzusuchen. Man empfahl ihm eine Adresse in der Gotmarstraße.
Hier traf er einen Menschenauflauf an, der den Zugang zum Laden versperrte.
Er konnte durch die Mauer der Leute nichts erkennen, aber den Rufen, dem Lärm und den Kommentaren entnahm er, daß hier eine ernsthafte und gründliche Prügelei im Gange war.
Als die Scharwache erschien, lichtete sich der Zuschauerkreis, und er sah, wie ein großer Mensch auf zwei Kerlen hockte. Obwohl sie um sich schlugen, drückte er beide mit seinen Knien auf das Pflaster. Nach einem kurzen Palaver mit den Scharwächtern kam es zum Friedensschluß.
Die beiden Besiegten entfernten sich in einem Zustand, der ihnen wenig Ansehen verlieh. »Es ist erstaunlich, wie ein geschwollenes Auge und eine aufgeplatzte Lippe die Reputation eines Menschen zu schwächen vermögen«, dachte Georg.
Der Sieger aber betrat hoch erhobenen Hauptes den Laden. Auf seinem breiten Rücken hingen Stroh- und Kotreste wie Orden, die nur die Gosse verleiht.
Daß er humpelte, schien nicht an den Folgen der Schlacht zu liegen, sondern an einer Unregelmäßigkeit seines Körperbaus. Georg sah, daß das eine Bein des Mannes seine volle Länge nur mit Hilfe eines anderthalb Hände breiten Holzklotzes erreichte, der ihm als Schuhsohle diente.
»Wenn dieser Rüpel und Gewaltmensch ein Buch kaufen will, muß es schon ziemlich weit gekommen sein mit der Bildung in dieser Stadt«, dachte er und folgte ihm in das Ladeninnere.
Hier war es überraschend dunkel. Es roch wie in einer Kneipe oder einem Branntweinlager.
Die Dunkelheit rührte daher, daß das ganze Fenster bis zur Decke mit Büchern wie mit Ziegelsteinen vermauert war. Auch Wände und Tische waren mit Büchern bedeckt.
Aus dem höllenschwarzen Hintergrund kamen Geräusche. Eine Flasche wurde geöffnet; etwas stieß an ein Glas. Schließlich näherten sich Schritte, die sich wie der Hufschlag des Teufels anhörten. Es war der Mann, der die Schlägerei siegreich für sich entschieden hatte.
Er hatte die Flasche und zwei gefüllte Gläser dabei. Er stellte sie auf einem Bücherturm ab und zog einen Band aus der Büchermauer am Fenster, so daß ein Balken Sonnenlicht in die Höhle drang.
»Wir haben einen Sieg zu feiern«, sagte er.
Georg hatte noch nie ein so wildes Gesicht gesehen, in dem grobe Züge, schlecht vernarbte Wunden und die Spuren der Trunksucht mit den physiognomischen Merkmalen der Nachdenklichkeit und Menschenliebe ineinanderflossen.
»Ich habe zwei Banausen gelehrt«, fuhr der Mann fort, »daß der Kauf von Büchern etwas mit ihrem Inhalt zu tun hat. Sie wollten für einen Shakespeare weniger zahlen als für einen Haller! Wir gerieten darüber in Streit. Hier liegen die Bücher noch. Es handelt sich um eine schlechte Übersetzung des Leardramas und um einen ledergebundenen Band der Hallerschen Gedichte.
Ja, es ist wahr, Haller hat viel für unsere Stadt getan. Er hat nicht nur die reformierte Kirche gebaut. Er hat nicht nur die Ausstattung der Anatomie gefördert. Er hat auch den Tod seiner geliebten Frau besungen. Sie starb kurz nachdem dieser große Schweizer Arzt und Dichter der Alpen hier seinen Lehrstuhl angetreten hatte. Es war ein Schlagloch vor dem Groner Tor. Sie saß auf der Seite, auf die die Kutsche stürzte, nachdem das Rad gebrochen war. Sie brach sich die Wirbelsäule. Die Bücherkiste, die sie im Wageninneren verstaut hatten, war auf sie gefallen. Vornehmlich Bände des guten Ehemannes, eigene Werke, eine ganze Auflage seiner Schweizerischen Gedichte. Trinken wir auf den Sieg!«
Sie leerten die Gläser. Georg kam sich vor wie in einem Hörsaal. Offensichtlich war dies ein Mann der schönen Literatur, was man ihm weiß Gott nicht ansah.
»Gleich nach dem Ableben seiner geliebten Mariane, die er in seinen Gedichten sonst Doris nannte, ließ er eine Trauerode drucken. Hier haben wir den Text. Doch nehmen wir zuerst einen auf den Tod.«
Nachdem die Gläser leer waren und Georg das Brennen des Fusels bis in den Magen spürte, hob der andere Flasche und Gläser von einem Buch und quartierte sie auf das danebenliegende um. »Auf Shakespeare stehen sie besser«, sagte er. Dann schlug er den anderen Band auf und begann, übertrieben laut vorzulesen. Georg wurde fast übel von dem penetranten Schnapsgeruch, der ihn dabei anwehte.
»Soll ich von deinem Tode singen?
O Mariane, welch ein Lied,
Wann Seufzer mit den Worten ringen
Und ein Begriff den andern flieht!
Die Lust, die ich an dir empfunden,
Vergrößert jetzund meine Not;
Ich öffne meines Herzens Wunden
Und fühle nochmals deinen Tod.
Ich überspringe jetzt vierzehn weitere Strophen, die ähnlich mittelmäßig sind, und lese die letzte, nachdem wir ein Glas auf die Liebe getrunken haben.«
Den Schnaps im Leibe, fühlte Georg es gewaltig in sich steigen und quellen, während der Rezitator mit tremolierender Stimme fortfuhr:
»Vollkommenste, die ich auf Erden
So stark und doch nicht gnug geliebt!
Wie liebenswürdig wirst du werden,
Nun dich ein himmlisch Licht umgibt.
Mich überfällt ein brünstigs Hoffen,
O sprich zu meinem Wunsch nicht nein!
O halt die Arme für mich offen!
Ich eile, ewig dein zu sein!«
Es entstand eine längere Pause, in der nur der schnelle Atem des einen und der langsame des anderen zu hören waren.
»Nun, die Sache ist die«, schrie der Gastgeber plötzlich in höchster Wut, wobei Georg nur deshalb keine Angst bekam, weil er dazu schon zu betrunken war. »Die verdammte, zum Himmel vor Ungerechtigkeit stinkende Sache ist die.«
Er senkte die Stimme und flüsterte nun fast. »Haller lebt noch in seiner Heimat. Er hat sein Schlagloch noch nicht gefunden, und seine geliebte Mariane muß warten. Das Unglück liegt nun siebenundzwanzig Jahre zurück. Von Eile kann also keine Rede sein. Und darum habe ich diese Burschen verprügelt. Sie haben sich nämlich mit einer Literatur einlassen wollen, die nur Schaum ist, der entsteht, wenn man in den Wahrheiten des Lebens allzu heftig herumrührt.«
Georg betrachtete die Myriaden von Staubteilchen, wie sie im Lichtbalken, der vom Fenster hereinfiel, durcheinanderwirbelten. Im Schatten verschwanden sie genauso schlagartig, wie sie im Licht aus dem Nichts zu entstehen schienen. »Mit uns Menschen geht es genauso«, dachte er. »Wir kommen und gehen und sind nur im Licht zu sehen, aber wir existieren gleichwohl vorher und nachher. Und wer weiß, ob wir nicht wieder einmal in den Lichtstrahl geraten.«
Seine Gedanken waren in Wirklichkeit trunkener und ungenauer, aber sie kamen ihm selbst wie saubere Lettern einer guten Druckschrift vor.
Plötzlich verlor er den Boden unter den Füßen.
Er glitt durch den Raum und geriet dabei in den Lichtstrahl, der ihn wie ein Blitzschlag traf. Er schloß die Augen und ließ sich weiter treiben. Als es wieder dunkel um ihn wurde, glaubte er, nun endlich ohnmächtig zu sein.
Der Mann, der ihn wie ein Kleinkind auf den Armen trug, roch nach Fusel und Schweiß und Erde. Er war jetzt Gottvater mit einem Teufelsfuß. Georg war ein buckliger Christus. Klein und häßlich und müde und trunken wurde er hinter dem Vorhang in einen alten Ledersessel gelegt und schlief ein.
Als er erwachte, sah er im Licht einer Kerze seinen neuen Freund über einen Herd gebeugt. Es roch nach Kaffee und gebratenem Fleisch. An einem Tisch war gedeckt, und bald saßen sie beide dort, tranken und aßen.
»Du hast den ganzen Tag verschlafen«, sagte der Antiquarius. »Der Schnaps muß in dir recht wenig Platz gefunden haben, um sich fein zu verteilen. Ich bin da besser dran, obwohl ich meine, etwas weniger zu vertragen, seitdem mir dieses Stück aus dem Schenkelknochen fehlt. Es hat mich mindestens den Platz für zwei Gläser gekostet.«
Kaffee und Braten wirkten Wunder. Georg wurde munter und begann, ausführlich von seinem Leben, von seinen Plänen und von seiner Liebe zu den fernsten und kleinsten Dingen zu erzählen.
»Es gibt so viele Rätsel, die ich lösen möchte. Ich will wissen, was ein Nordlicht ist. Ich will auch wissen, ob es einen Weg gibt, der zufrieden macht. Gibt es zum Beispiel eine ausgewogene Mischung von Abenteuer- und Philisterdasein, die wir als den rechten Mittelweg empfinden könnten?«
»Gott hat den Menschen symmetrisch geschaffen«, setzte der andere das philosophische Kaffeegespräch fort. »Er besteht von vorne gesehen aus zwei gleichen Hälften. Nur das Herz hat er ausgenommen. Es befindet sich bekanntlich seitlich verrückt auf der linken Seite. Wenn sich also zwei Liebende umarmen, berühren sie sich überall in einer vierfachen Symmetrie, nur an den Herzen nicht. Das sollte zu denken geben. Die Liebe zwischen Mann und Frau scheidet demnach aus. Da ich selber meine Frau zu lieben vorgebe und es vielleicht auch wirklich tue, muß ich sie immer prügeln. Es scheint mir die einzige, verdammte Zärtlichkeit zu sein, die ehrlich ist. Übrigens siehst du mit deinem Buckel auf der Brust so aus, als herrschten bei dir andere Symmetrieverhältnisse. Vielleicht ist das Herz bei dir ja in die Mitte gerückt. Wenn ich recht mit dieser Annahme habe, wirst du mehr als eine Frau zur gleichen Zeit lieben können.«
Georg konnte es nicht verhindern, daß es zum Kaffee wieder Schnaps gab. Das warme Gefühl in ihm begann erneut wie aus einem Quelltopf zu steigen.
»Zu dem Stelzfuß bin ich gekommen, als ich mit meinem damaligen Geschäft Schiffbruch erlitt. Ich war Glasverkäufer wie mein Bruder, der jetzt statt meiner diesen Beruf hier ausübt.
Mein Laden war ein großer Weidenkorb, den ich vor dem Bauch trug. Er war voll mit Gläsern, Vasen und Schalen aller Art. Natürlich verstellte mir dieser Laden den Blick vor die Füße, und so kam es, daß ich eines Tages über selbige stolperte und wie ein entwurzelter Baum in meine Auslagen fiel.
Ich spürte es beinahe wie eine heftige Liebkosung, als mir die Scherben Gesicht und Arme zerschnitten. Das Blut lief mir in die Augen, und so sah ich die Welt durch einen roten Vorhang. Die Leute, die um mich herumstanden, sahen aus, als bluteten sie stärker als ich. Ja. So gefielen sie mir beinahe besser. Sie sahen aus wie abgestochene Schweine. Und ich wußte plötzlich, daß ich sie bislang nicht gründlich genug verachtet hatte. Dieser Gedanke sollte mich auf die Beine bringen. Aber es ging nicht. Mein eines Bein war gebrochen.
Die Chirurgen brachten mich beinahe um. Erst wuchs es falsch zusammen, so daß mein einer Fuß immer woanders hinwollte als der andere. Dann sägten sie mir ein Stück Knochen heraus in der Hoffnung, daß ich am Wundfieber stürbe. Aber ich wurde wieder gesund. Wahrscheinlich wirkte mein Haß wie ein weiser Arzt, der die richtigen Kuren verschrieb.
Später bin ich auf diese Ware hier umgestiegen. Ich dachte, gebrauchte Bücher sind weniger nutzlos als neue. Man braucht sie nämlich weder binden noch aufschneiden. Es stehen außerdem noch genug Aufschneidereien in ihnen.«
Der Mann redete sich wieder in Zorn. Dazu trank er ein Glas Fusel nach dem anderen. Georg wurde es allmählich doch ein wenig angst. Einem solchen Kerl war kaum standzuhalten.
»Ich habe mir auch eingebildet, die alten Autoren wären besser als die neuen. Dabei stimmt das nur für Shakespeare. Ansonsten haben sie genauso geschwollenes Zeug verzapft wie heute ein Wieland, ein Haller und wie sie alle heißen. Halt. Einen guten gab es noch. Einen armen Schlucker namens Günther. Er hat Gedichte gemacht wie Morgenrot.«
Er schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Oder wie Abendrot. Je nachdem , wann ich sie lese, geht die Sonne in meinem Kopf auf oder unter. Er war ein Säufer. Das hat ihn vor allzuviel Vernunft und Dummheit bewahrt. Trinken wir auf ihn!«
Georg hielt abwehrend die Hand über sein Glas, aber sein Gastgeber kannte keine Gnade.