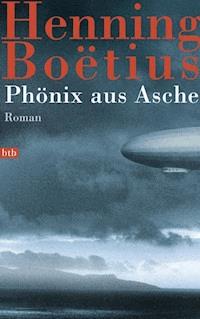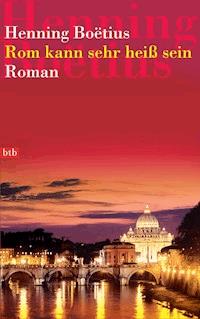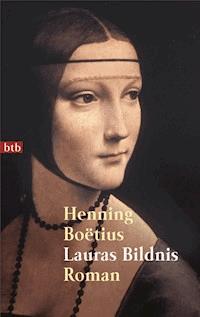Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Henning Boëtius bei btb
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Copyright
btb
Buch
Piet Hieronymus, Auslandsermittler der holländischen Kriminalpolizei, ist wieder unterwegs. Diesmal sind es private Angelegenheiten, die ihn in eine thüringische Kleinstadt führen. Dorthin hatte es einen Landsmann und alten Weggefährten einst der Liebe wegen verschlagen. Nun betreibt er eine Buchhandlung an diesem düsteren, hinterwäldlerischen Ort, in einer für ihn immer noch fremden Welt. Als er eine Morddrohung erhält, fühlt er sich seines Lebens nicht mehr sicher. Hieronymus geht den Drohungen nach, und mehr und mehr entpuppt sich die Kleinstadt als ein Ort, an dem Feindseligkeit nur notdürftig verborgen hinter bizarren Maskeraden lauert. Da gibt es einen Schauspieler, der den letzten deutschen Kaiser zu imitieren versteht; einen Maler, der Totenköpfe malt und selbst nicht mehr lange zu leben hat; einen Archivar, der hinter seinem jovialen Wesen dämonische Züge verbirgt. Und dann gibt es ein Mädchen, das zu wenig, und eines, das zu viel Hemmungen in der Liebe hat. Für Piet Hieronymus wird seine Winterreise nach Thüringen zu einer Erfahrung der ganz besonderen Art...
Autor
Henning Boëtius, geboren 1939, lebt in Berlin. Er ist Autor zahlreicher, von der Kritik hochgelobter Romanbiographien und der Kriminalromane um den holländischen Inspektor Piet Hieronymus. Mit seinem erzählerischen Meisterwerk »Phönix aus Asche« gelang ihm der Durchbruch auch als literarischer Autor.
Henning Boëtius bei btb
Der Gnom: Ein Lichtenberg-Roman (72408) · Ich ist ein anderer. Das Leben des Arthur Rimbaud (72189) · Lauras Bildnis. Roman (72803) · Phönix aus Asche. Roman (72967) · Schönheit der Verwilderung. Roman (72830) · Tod in Weimar (72900) · Undines Tod. Roman (72225) · Die Piet-Hieronymus-Romane: Joiken (72548) · Das Rubinhalsband (72639) · Der Walmann (72332)
Erstes Kapitel
Ich glaube nicht an Zufälle, aber ich halte auch nicht viel von der Vorsehung. Es muß etwas dazwischen geben, etwas, das Willkür und Schicksal auf rätselhafte Weise miteinander verknüpft. Die wahren Überraschungen des Lebens kommen zuweilen dabei heraus. Begebenheiten, die wie Schauspieler auf ein Stichwort hin genau im richtigen Moment aus den Kulissen auf die Bühne unseres Daseins treten, um ihren unvermeidlichen Auftritt zu absolvieren. Wie anders ist es zu erklären, daß meine Mutter mir zum ersten Advent dieses Jahres »Die Winterreise« schenkte, eine Schallplatte mit deutschem Gesang, voller Dunkelheit der Wörter und Süße der Melodien, und daß ich kurz danach tatsächlich eine Winterreise nach Deutschland antreten mußte, keine dienstliche Reise übrigens, sondern eine private, die zu unternehmen ich mich wegen des brieflichen Hilferufes eines Landsmannes genötigt sah.
Meine Mutter schenkt mir, seit ich erwachsen bin, immer etwas zum ersten Advent, dafür nie etwas zu Nikolaus. Zur Begründung sagt sie: »Zuneigung kann man nicht in der Stunde der Erfüllung zeigen, immer nur in der Stunde der Verheißung.«
Als ich sie fragte, was sich hinter dieser Lebensregel verberge, erklärte sie: »Du müßtest dich eigentlich noch gut daran erinnern, lieber Sohn. An deine Wunschkatastrophen. Du hast dir zum Nikolaustag immer ein ganz besonderes Geschenk gewünscht, eine Kinderschreibmaschine, ein Akkordeon, einen ferngelenkten Panzer. Wir haben dir jedesmal den Wunsch erfüllt, aber immer warst du dann nach der ersten kurzen Freude enttäuscht. Es war eben einfach der falsche Zeitpunkt zum Schenken. Der 6. Dezember, das ist doch kein Datum für private Geschenke. Immer der gleiche Tag, ich bitte dich. Und dann dieser häßliche alte Mann! Vorfreude ist die schönste Freude, mein lieber Sohn. Glaub mir, der erste Advent ist einfach ideal. Man soll Geschenke in die Strömung der Erwartung werfen, solange sie noch stark und frisch ist.«
Meine Mutter sagt viel so schöne Sätze in letzter Zeit. Als ich sie darauf ansprach, meinte sie, es liege an ihrem nahenden Tod. Es seien alles Schlußworte des Lebens, die sie ausprobiere. Sie lachte und zeigte ihre ebenmäßigen, künstlichen Zähne. Und sie duldet keinen Widerspruch. »Red nicht so dummes Zeug«, sagt sie jedesmal barsch mit ihrer herrischen Stimme, wenn ich auf ihre gute Gesundheit und ihr rüstiges Aussehen anspiele. »Wenn man wie ich mit einem Bein im Grab steht, dann gleicht man einem Flamingo, der sich aus Versehen auf einem Sumpf niedergelassen hat.« Sie hat wieder eines dieser letzten Worte gefunden, und ich muß mich geschlagen geben.
Ich reise gerne, und dennoch fällt es mir jedesmal nicht leicht, den ersten Schritt zu tun. Nervosität befällt mich bei Reisebeginn, ich leide an Kurzatmigkeit und Pulsrasen. Vielleicht hängt es mit einem berühmten Kinderlied zusammen, das meine frühesten Lebensjahre begleitet hat. Meine Mutter sang es mir oft vor mit ihrer schönen Altstimme. Ein deutsches Kinderlied übrigens. »Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist gar wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr...«
Spätestens ab dieser Zeile ist es vorbei mit dem Wohlgemutsein. Schuldgefühle, Reisefieber, Trennungsangst stellen sich ein und überschatten den Aufbruch.
Vor jeder meiner Reisen gibt mir meine Mutter eine Abschiedsaudienz in ihrer schönen Villa mit den großen Rhododendronbüschen davor, der weißen Fahnenstange und dem kunstvoll verwilderten Garten hinter dem Haus, den sie trotz ihres Alters mit großer Beharrlichkeit pflegt. Diese Abschiede sind ein Ritual. Immer haben sie den Charakter von Endgültigkeit, unsere kleinen Beerdigungen, in denen wir beide wohl jedesmal die Hoffnung begraben, einander zu verstehen.
Während meiner letzten Reise hatte meine Mutter eine Herzattacke. Seitdem ist sie aufgeblüht. Sie hat jetzt rote Bäckchen und sieht wie ein kleines Mädchen aus, das sich in die Puppe verwandelt hat, mit der sie am liebsten spielt. Wie gewöhnlich gab sie mir auch diesmal Anweisungen, wie ich mich zu verhalten hätte. Sie war nicht von der fixen Idee abzubringen, daß ich es mit lauter Russen zu tun bekäme. »Die Russen sind grausam«, sagte sie. »Aber sie verstehen etwas von Tee. Ich rate dir, mein Sohn, dich auf nichts anderes mit ihnen einzulassen als auf Teetrinken.« - »Ich fahre nach Ostdeutschland, Mutter«, hatte ich erwidert, »dort gibt es vermutlich kaum mehr Russen als hier, jedenfalls nicht nach der Wende.«
Ihre tiefe Stimme, die so gar nicht zu ihrem gebrechlichen Körper paßt, klang zornig, als sie antwortete: »Das ist typisch für dich, die Dinge zu verharmlosen. Ich sage dir noch einmal, es sind Russen, die allermeisten jedenfalls. Russen können sich gut verstellen. Aber du erkennst sie an ihrem düsteren Blick. Russen gucken immer, als ob sie jemanden umgebracht hätten, und viele haben es auch.«
Ich wußte, es war zwecklos, ihr zu widersprechen. Ich bedankte mich also für ihre Ratschläge und ging, wie immer zugleich enttäuscht und von Liebe bewegt.
Wie viele meiner Landsleute verspüre ich zu Deutschland so etwas wie eine treue Haßliebe. Ich bewundere die deutsche Kultur, die Sprache, in der sich so vieles zwischen den Zeilen sagen läßt, vor allem aber verehre ich die Musik. Die Lieder zum Beispiel. Kein anderes Land hat Lieder hervorgebracht wie das »Heideröslein«, so duftend, so sanft. Aber ich fürchte auch die Dornen, die Gewalttätigkeit, die in jener unklaren Mischung aus Begabung und Untertanengeist schlummert.
Diesmal würde ich also in den Osten dieser Nation reisen, die sich erst vor kurzem aus einer schizophrenen Doppelexistenz verabschiedet hatte. Vereinigungen sollten etwas höchst Erotisches sein, etwas, das wärmt und stark macht. In diesem Fall jedoch schien es sich, wie ich den Berichten der Medien entnahm, um eine Kernfusion zu handeln, die keine Energie freisetzte, sondern in großen Mengen verbrauchte.
Ich kannte bisher nur die ehemalige Bundesrepublik. Ich hatte dort einige Male meinen Urlaub verbracht, am Rhein zumeist, zu dem wir Niederländer eine seltsam verbissene Liebe verspüren. Vielleicht, weil sein trübes Wasser zuletzt durch unsere Wiesen strömt mit seiner heimlichen Botschaft von Weinbergen, Märchen und schon auf der Höhe von Basel verlorengegangenem Gletschergrün.
Auch jetzt hatte ich mich zu einem kleinen Umweg über den Rheingau entschlossen, obwohl der Brief meines Freundes recht bedrohlich geklungen hatte. Doch Hilferufe dieser Art sollten nicht zu übereiltem Handeln verleiten, sonst wird man von der in ihnen zumeist enthaltenen guten Portion Hysterie angesteckt.
Als die Weinhänge des großen Vaters Rhein auftauchten mit all ihren wie Dekorationen wirkenden Spielzeugruinen, setzte ich mich in das Zugrestaurant und bestellte ein Viertel Weißen. Die Landschaft wirkte melancholisch in ihren ockerund blaugrauen Tönen, die mich an Bilder von Braque erinnerten. Ein wohliges Gefühl überkam mich in der Wärme des Speisewagens bei der sich in der Scheibe spiegelnden Tischlampe mit ihrem gelben Röckchen. Es war noch einer jener alten Waggons, die von der gastronomischen Idee eines rollenden Kellerrestaurants geprägt sind, eine Atmosphäre, in dem man Züricher Kalbsgeschnetzeltes essen muß.
Eigentlich ist es ein Jammer, dachte ich, während ich das zweite Fläschchen bestellte und eine Portion Kalbsgeschnetzeltes, daß es den Namen Bundesrepublik nicht mehr gibt. Er hatte so etwas charmant Provisorisches, im Gegensatz zu »Deutschland«, diesem schwerblütigen Wort, das mit seiner geschichtlichen Tiefe, seinem dunklen Klang nach Wäldern, Wagner und Kant bei den Angehörigen eines kleinen Kaufmannsvolks fast zwangsläufig eine von Staunen und Mißtrauen marmorierte Bewunderung erwecken muß, denn wir haben solche Waren in unseren von Gewürzen, Fischen, Tulpenzwiebeln und Tomaten gefüllten Kellern nicht zu bieten. Gäbe es nur einen einzigen Weinberg in den Niederlanden, ich glaube, die Situation sähe völlig anders aus.
In Aßmannshausen ging ich in dasselbe Hotel wie vor zwei Jahren. Damals war ich mit meiner letzten Freundin Ingrid dort gewesen, im Frühling. Ich nahm das gleiche Doppelzimmer, obwohl ich natürlich wußte, daß dies eine theatralische Geste war: ein leeres Bett neben sich als Liebeserklärung an jene ominöse Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, die wir immer wieder vergeblich mit anderen zu teilen suchen. Ich ging auch in dasselbe Lokal und bestellte wieder Wildschweinsülze. Mit Remouladensoße und Bratkartoffeln. Es war keine Nostalgie. Nicht einmal Sentimentalität. Es war der Versuch eines mittelmäßigen Kriminalisten, endlich zu begreifen, wie es zu jener Untat gekommen war, die Ingrid und ich damals Liebe genannt hatten.
Mit der Liebe ist es jedoch wie mit allen Geheimnissen: sie existieren nur so lange, wie man sich selber eines ist. Ich war weit entfernt davon, traurig zu sein. Ingrid war nur noch ein Bild mit den Eigenschaften eines polizeilich erstellten Phantomfotos. Eine Montage aus einzelnen Bildpartien, Frisur, Stirn, Augen, Nase, Mund, Kinn. Alles einzeln verändert und zuletzt per Knopfdruck zu einem scheinbar Ganzen gemacht.
Ich nestelte den Brief aus meiner Jackentasche, den mir Dick vor wenigen Tagen geschrieben hatte. Ein Brief aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die nach allem, was ich wußte, weder richtig deutsch noch demokratisch noch republikanisch gewesen war. Eher ein undefinierbares Konglomerat aus internationalen Interessenkonflikten und den neurotischen Potentialen ihrer Opfer.
Das Kuvert war aufgerissen und wieder zugeklebt worden. Dick hatte in einer großen, fahrigen Handschrift folgendes geschrieben:
»Lieber Piet, alter Kumpel, entsinnst Du Dich noch an die großen Zeiten auf meiner alten Dschunke, als wir im fieberverseuchten Delta des Bathangari lagen, in einem Tropenregen aus Genever, und die Affen um uns herum wie verrückte, rote Teufel durch die Wipfel turnten? Ich weiß, daß du diese Zeit nicht vergessen hast und Deinen alten Dick auch nicht, der jetzt in großen Schwierigkeiten steckt und Dich bitten muß, ihm aus der Patsche zu helfen. Ich werde Dir sagen, worum es geht, aber Du mußt schon deinen Kopf bemühen, um alles zu verstehen. Da es nicht auszuschließen ist, daß man den Brief öffnet - du weißt, sie haben hier große Übung in solchen Sachen -, werde ich manches nur andeuten.
Einige Jahre nachdem wir uns aus den Augen verloren, habe ich eine Buchhändlerin kennengelernt. Sie war ganz anders als die Mädchen, die ich sonst hatte. Sie war mir geistig überlegen, Piet, und das hat mich verrückt gemacht nach ihr. Sie war schön und belesen, aber sie hatte kein Herz. Ich habe mein Schiff aufgegeben, weil sie es wollte, und dann haben wir in Breda einen Buchladen aufgemacht. Ich habe schon immer gerne gelesen, und daher schien mir mein Schritt logisch zu sein. Aber ich bin dann überhaupt nicht mehr zum Lesen gekommen. Denn ich habe die Finanzen machen müssen, den ganzen Papierkrieg, weißt Du. Und sie stand im Laden und hat verkauft. Sie konnte jedes Buch an jeden loswerden, wenn sie wollte. Eine Weile ging es uns gut. Dann hat sie eine Liebschaft mit diesem Kerl aus Amsterdam angefangen, unserem Steuerberater. Ich hätte es nie herausbekommen, so gut konnte sie schauspielern. Aber einmal bin ich zu früh von einer Reise zurückgekommen. Sie hatten es sich in unserem Bett bequem gemacht. Da bin ich durchgedreht. Und dann war es vorbei. Der feine Kerl hatte es verstanden, mir die ganzen Schulden anzudrehen.
Es war im Jahr der Wende, wie man hier sagt. Und da hatte ich die Idee, ich mache bei denen im Osten einen Buchladen auf. Ich bildete mir ein, inzwischen von diesem Geschäft’ne Menge zu verstehen, und ich dachte, die haben so lange geistig auf dem trockenen gesessen, daß sie jetzt wie die Verrückten lesen werden. All das, was vorher verboten war. Die Idee war auch gut, aber die Wirklichkeit war anders. Sie hatten kein Geld, und sie hatten vielleicht auch Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten. Ihnen war zu lange eingetrichtert worden, daß aus dem Westen nur dekadentes Zeug kommt. Zuerst ging wieder alles ganz gut. Du weißt, daß ich seit meiner Zeit als Seemann so gut Deutsch spreche, daß mich jeder Hamburger für einen Landsmann hält. Hier ist es fast eine Fremdsprache, wenn man Hochdeutsch mit norddeutschem Akzent redet.
Aber das war nicht das eigentliche Problem. Das Problem war, daß die Leute hier so eine komische Art haben, daß ich nicht weiß, was mit ihnen los ist. Ich kann ihnen nichts verkaufen. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe mich auch nicht mehr. Es ist wie eine Krankheit, eine ansteckende. Du weißt, daß ich schon immer ein großer Träumer war, ein professioneller, würde ich sogar sagen. Und das heißt, daß ich ebensogut die Wirklichkeit erkenne, wie ich träumen kann. Das eine geht nicht ohne das andere. Hier aber fließt es ineinander, die Träume und die Realität. Ich kann sie nicht mehr unterscheiden. Es ist die Welt des Deutschlings!
Alles ist wie ein schlechtes Theaterstück. Wenn mir jemand die Hand gibt, ist es gespielt. Sollte mich jemand erschlagen, wäre es eine Realität, die ich für ausgedacht halten könnte. Ich habe Angst, Piet. Wenn man Sein und Schein nicht mehr unterscheiden kann, ist man verrückt geworden, stimmt’s? Komm, mein Freund, alter Kumpel, hol mich zurück auf den Boden der Tatsachen oder, wenn es Dir lieber ist, in den Himmel der Phantastereien.
Du wirst Dich fragen, warum ich nicht einfach hier abhaue. Ich habe mein ganzes Geld in diesen Laden investiert. Und ich habe ein Mädchen kennengelernt, für das ich Verantwortung trage. Aber das ist es nicht. Ich kann nicht weg, weil ich Sein und Schein nicht mehr unterscheiden kann. Wenn ich mich in den Zug setzte, würde ich vielleicht nur im Kreis fahren, um meine Wahnidee herum.
Ich rechne fest mit Dir, Piet. Du läßt mich doch nicht im Stich? Telefonisch kannst du mich nicht erreichen. Sie haben mir den Anschluß abgeklemmt. Aber Du findest mich ganz leicht. Entweder im Laden am Marktplatz oder in meinem Haus, drei Kilometer außerhalb im Wald, Am weißen Berg, so heißt die Straße, Nummer zehn, oder aber im Leichenschauhaus.
Dein alter Kumpel Dick.«
Ich muß zugeben, daß ich immer noch einigermaßen verwirrt war, obwohl ich den Brief schon mehrfach gelesen hatte. Ich wußte nicht, was ich damit anfangen sollte. Vor allem verstand ich nicht, was Dick mit »Deutschling« meinte. Und dennoch war das Gefühl von Mal zu Mal stärker geworden, daß es sich um einen echten Hilferuf handelte.
Ich bestellte noch ein Viertel Höllenberg, und während ich in kleinen Schlucken trank, dachte ich an die Zeit zurück, in der ich Dick Kuyper, wenn auch nur flüchtig, gekannt hatte.
Ich war damals noch Psychologe gewesen und hatte einen Urlaub in Südholland verbracht, weil ich glaubte, ich müsse den Massenexodus meiner Landsleute nicht mitmachen, die Jahr für Jahr unser flaches, enges Land verlassen, mit der Hoffnung, sich in weniger überschaubaren Gebieten aus den Augen zu verlieren.
Ich angelte damals ziemlich viel, wahrscheinlich, um meine Ängste vor dem Töten zappelnder, glitschiger Fischleiber zu bezwingen. Dick Kuyper war der stolze Besitzer eines ehemaligen Flußschiffes, mit dem er Touristen zum Angeln vor die Schelde fuhr. Der gewaltige Laderaum war zu einer einzigen großen Bar umgebaut. Zahllose Barhocker, alle am Boden verschraubt. In der Mitte ein großer Billardtisch. Die besondere Atmosphäre entstand durch exotische Pflanzen, Palmen, Bambus, Rotang. Dick hatte einen kleinen Regenwald installiert, den er bei Bedarf mit Quecksilberdampflampen beleuchtete und aus feinen Wasserdüsen besprühte. Es gab sogar eine Windmaschine für den Monsun und als besondere Attraktion einen riesigen, ausgestopften Orang Utan, der zwischen künstlichen Lianen hing und sanft hin und her schaukelte, wenn Dicks Boot auf der Schelde unterwegs war. An den Wänden des Laderaums waren echte Bullaugen installiert, hinter denen die Silhouette einer großen Insel zu sehen war. Ein koloriertes Großfoto von Sumatra. Ein sogenanntes Pleorama. So nannte man im 19. Jahrhundert optische Einrichtungen, die die Vorbeifahrt an Küsten simulieren. Per Knopfdruck von der Bar aus ließ es sich in schwankende Bewegungen versetzen. Der Effekt war überzeugend. Man konnte tatsächlich glauben, vor jener tropischen Insel zu kreuzen. Die Fahrten dauerten nie sehr lange. Bald lag das Schiff wieder fest im Hafen vertäut und diente als Privatkneipe. Eine Konzession hatte Dick nicht, auch keine Liegeerlaubnis, wahrscheinlich weil er die Gebühren nicht zahlte. Deshalb mußte er immer an anderen Kähnen festmachen, über die seine Gäste hinweg an Land turnten, wenn sie dazu spät in der Nacht überhaupt noch in der Lage waren.
Dick hatte drei hervorstechende Eigenschaften: Er war der beste Billardspieler, den ich je erlebt hatte, er verfügte über Bärenkräfte bei einem kindlich-freundlichen Gemüt, und er hatte den Tick, sich väterlich um gefallene Mädchen zu kümmern. Er hatte damals als Barfrau, Geliebte und Schiffsjungen ein höchstens sechzehnjähriges Mädchen an Bord, das er auf dem Strich aufgelesen hatte. Sie tyrannisierte ihn, er schlug sie, heulte dann fürchterlich und versöhnte sich wieder mit ihr. Es war ziemlich anstrengend, mit beiden zu tun zu haben. Wenn Gäste sich an die Kleine heranmachten, wurde Dick fuchsteufelswild. Er hatte einen enormen Brustkasten und kurze, dicke Arme, die wegen ihrer gewaltigen Bizepse immer ein wenig vom Körper abstanden. Dick machte damals gutes Geld und gab es sofort wieder aus. Sein Traum war, mit seiner schwimmenden Bar nach Sumatra zu fahren. Er hatte sich den Kurs genau überlegt. Immer die Küste entlang, denn er hatte nur das Binnenschifferpatent. Natürlich kam es nie dazu. Sein Ziel erreichte er immer nur nach zahllosen Genevern in seinen berauschten Träumen.
Ich ging ins Hotel zurück und legte mich in ein Bett, das leicht zu schwanken schien wie einst Dicks Schute, wenn auf dem Meer draußen Sturm war und kleine Sekundärwellen bis ins Hafenbecken ausschwärmten. Ich nahm das Buch zur Hand, das Dick seinem Brief beigelegt hatte. Die berühmte Märchensammlung der Brüder Grimm. Mein Freund hatte im Inhaltsverzeichnis einen Märchentitel mit Kugelschreiber umrandet, und diesen Text las ich jetzt vor dem Einschlafen. Er hieß: »Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.«
Zweites Kapitel
Der Himmel dieses Tages war weiß und prall wie ein Kissen der Frau Holle, das die faule Pechmarie nicht schütteln mochte, um die Federn stieben zu lassen. Irgendwann fuhren wir über die ehemalige Grenze. Ich hatte etwas von der Mauer gehört, von Selbstschußanlagen, Wachttürmen, Minenfeldern. Nun war das meiste davon entfernt. Aber die Grenze war dadurch nicht verschwunden. Ein Streifen Niemandsland, der, wie mir schien, unendlich tief in die Erde hinabreichte und genauso weit in den Himmel darüber. Es war, als verlöre an dieser Stelle alles ein wenig von seiner Farbe, von seiner genauen Gestalt. Etwas Diffuses ging von den Gräsern und Bäumen aus, die hier wuchsen, wie auf einer verwackelten Fotografie. Der Zug fuhr plötzlich sehr langsam. Auch das alte Geräusch von Rädern auf nicht verschweißten Schienen war plötzlich wieder da. Dieses rhythmische Klacken, das in meiner frühsten Kindheit für mich die Erfahrung Zugfahren geprägt hatte.
Ich mußte umsteigen. Auch hier auf dem Bahnsteig war man in einer anderen Zeit. Immer noch Vorkriegszeit, die auf den rostbraunen Schwellen lag und hinter den blinden Fenstern der Bahnwärterhäuschen hockte. Die Stimme aus dem Lautsprecher gehörte keiner bekannten Landessprache an. Das war kein Deutsch, sondern ein unverständliches, aggressives Stöhnen aus dem Souffleurkasten der Geschichte.
Dann saß ich in einem anderen Zug. Ich versuchte, ein Bild von der Landschaft zu bekommen. Es war kaum möglich, denn die Fensterscheiben waren so verschmutzt, daß alles draußen in einem trüben Braun versank, selbst das Blau des sonnigen Himmels. Wir fuhren in einer Art Sichtgefängnis, und nur weil ich mir einen Fleck freirieb, erspähte ich überhaupt etwas von der Außenwelt.
Es ging einen Fluß entlang, an dessen Ufer nun andere Ruinen die Dekoration bildeten. Verbeulte Kühlschränke, Autoleichen, Rollen von nie genutztem Stacheldraht.
Einmal mußte ich umsteigen in einer mittelgroßen Stadt. Hier herrschte Nebel. Auf dem Bahnhofsvorplatz war ein kleiner Weihnachtsmarkt. Drei bis vier Würstchenbuden, ein Verkaufsstand für ärmliche Kleidung, eine Kindereisenbahn, die sich, auf echten Schienen ratternd, zu aus einem Lautsprecher plärrenden Weihnachtsliedern im Kreise drehte. Es gab nur einen Fahrgast: ein ungefähr dreijähriges Kind, das in einem offenen Güterwagen saß und sich mit blaugefrorenen Händen an den Wagenseiten festhielt. Es lächelte ein verzückt blödes Lächeln. Das Christkind, das auf eine verrückte Welt zurückgekommen war, um zu verkündigen, daß es hier nichts mehr zu erlösen gab.
Weiter ging es, tiefer in dieses Land am Ende der Welt, wo die Hyperboreer lebten, ein heiliges Volk, dem ein tausendjähriges Leben beschieden war, das weder Krieg noch Streit kannte, weder Krankheiten noch Siechtum. Die Hyperboreer starben, so hieß es, eines freiwilligen, raschen Todes, wenn sie das ewige Glücklichsein satt hatten. Ich sah mich um. Viele Menschen waren im Wagen, aber sie sprachen nicht miteinander. Sie glichen Vieh, das man transportiert, und es gibt nur einen einzigen Grund, Vieh zu transportieren: es zu schlachten. Wenn dies die Hyperboreer waren, dann hatten sich alle Merkmale der Legende ins Gegenteil verkehrt.
Niemand beachtete mich. Und allmählich wurde ich angesteckt von der nämlichen Gleichgültigkeit. Auch ich schaukelte bald mit Kopf und Gliedern, weil mich eine Schlaffheit überkam, die den mechanischen Stößen der Fahrt willenlos ausgeliefert war.
Einmal stieg ein Mensch ein, der sich deutlich von den anderen unterschied. Er trug einen teuren Kaschmirmantel und eine Jockeymütze. Seinen schwarzen Diplomatenkoffer hielt er krampfhaft fest, während er lautstark auf die Langsamkeit des Zuges schimpfte, den Dreck, die Tatsache, daß es kein Wasser auf den Klos gab. Auch jetzt reagierte niemand. Es war, als brülle er in eine Leere, die vollkommener war als seine theatralische Wut.
Schließlich fuhren wir in einen Tunnel. Es wurde schlagartig dunkel, und da die Innenbeleuchtung des Zuges ausgeschaltet war oder nicht funktionierte, entstand die gespenstische Stimmung einer Höllenfahrt ins Innere der Erde. Genauso plötzlich wurde es wieder hell, genauer gesagt, Dämmerung spendete bleigraues Licht, in dem die Gestalten der Mitreisenden nur noch undeutlich zu erkennen waren. Wir fuhren an einem großen See vorbei, den eine dünne Eisdecke still und tief wirken ließ. Ich nahm einen verwaschenen, weißen Fleck wahr und rieb an der Scheibe. Es war ein Schwan, der auf einem kleinen, eisfreien Loch mitten im See schwamm. Gleich darauf hielten wir. Ich war am Ziel.
Ich ging auf dem Perron hin und her, blickte in die Gesichter, bis ich ihn plötzlich sah. Ja, kein Zweifel, er war es, Dick Kuyper, in einem blauen Rollkragenpullover, immer noch seemännisch aussehend, mit seinen breiten Schultern, dem schwarzen Backenbart. Ich ging auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. Er packte sie und hielt sie fest mit einem Griff, wie ihn ein Ertrinkender am Dollbord eines Bootes haben mag. »Komm«, sagte er, »laß uns schnell zum Auto. Es ist besser, die Leute fangen nicht an, über dich nachzudenken, und darüber, warum ich dich hier abhole.«
Er nahm meinen Koffer und eilte voran. Wir gingen durch dunkle Straßen, in denen es kaum erleuchtete Fenster gab, geschweige denn Laternen. Wir querten eine Brücke. Ihr Geländer war von Steinfiguren flankiert. Regen und Wind hatten die Gesichter zernarbt, die schwarzen Münder verzogen und die Augen zerfressen. Doch eine der Statuen schien in gutem Zustand. Als ich an ihr vorbeiging, spürte ich, daß sie lebte. Es war eine tief verschleierte Frau. Sie drehte den Kopf, als würde sie uns nachsehen.
Wir gingen eine steile Lehmböschung hinab zu dem rauschenden Fluß. Noch hatte ich nicht viel mehr von der Umgebung wahrgenommen als einen beißenden, brenzligen Geruch, der meine Schleimhäute reizte. Über uns in dem verdämmernden Himmelslicht sah ich ein schloßähnliches Gebäude, dessen Fenstern ein unglaubwürdig helles, fast festlich wirkendes Licht entströmte.
Dann waren wir bei seinem Auto. Dick öffnete die Tür und schob mich hinein. Ich mußte mich einknicken wie ein Taschenmesser, was sowohl an meiner außergewöhnlichen Körpergröße lag als auch an der erstaunlichen Kleinheit und Enge des Fahrzeugs. Auch Dick, der einen Kopf kleiner war als ich, mußte sich krümmen wie ein Wurm. »Ist dies einer dieser berühmt-berüchtigten Trabbis?« fragte ich. Er nickte. »Ja, diese rollenden Käfige, die man dem Völkchen hier verordnet hat, um die Selbsttäuschung einer Fortbewegung zu erwecken. Sie stinken nicht nur bestialisch, sie haben auch etwas Niederdrückendes an sich, ich meine, etwas, das dir jeden Mut raubt, größere Entfernungen überbrücken zu wollen, eine Art Drohung aus Blech, keine Republikflucht zu begehen. Man fährt in diesen Dingern immer in Demutshaltung.«
Dick gab einen verächtlichen Schnauber von sich und ließ den Motor an, eine Prozedur, die ziemlich umständlich zu sein schien, denn es dauerte lange, bis eine permanente Vibration und vereinzelte, heftige Stöße die Annahme nahelegten, daß wir uns nun fortbewegten. Sehen konnte ich absolut nichts. Die Scheinwerfer waren zu schwach, um der trüben Unwirklichkeit draußen auch nur die mindeste Kontur abzugewinnen.
»Wer war die Frau auf der Brücke?« fragte ich. »Kennst du sie?«
»Es war bestimmt eine von denen. Es gibt hier jede Menge davon«, sagte Dick. Er wandte so unwillig den Kopf ab und drehte am Knopf des Radios, daß ich mich nicht getraute, weitere Fragen zu stellen. Ich starrte auf die kleine, schaukelnde Puppe, die als Maskottchen vom Innenspiegel herabhing. Ein Orang Utan mit rotbraunem Fell und kleinen, stechend blickenden Glasaugen.
Dicks Wohnung war kalt, die Fenster mit Eisblumen bedeckt, die das Licht der einzigen Straßenlaterne draußen in Kristallschauern brachen. Dick ließ die Rolläden herunter, ehe er Licht machte. Während er sich am Ofen zu schaffen machte, hatte ich Zeit genug, mir die Einrichtung anzusehen. Unzweifelhaft war sie von dem Versuch geprägt, etwas von Dicks Heimat in diese Welt hinüberzuretten. Die Wände der kleinen Kochnische waren mit Delfter Kacheln aus Plastik beklebt. An den Wänden hingen Fotos von Zierikzee, von seinem Schiff, eine Weltkarte, auf der mit rotem Filzstift eine in Küstennähe verlaufende Linie von der Schelde über Gibraltar durch den Suezkanal bis nach Sumatra eingezeichnet war.
Überall standen Topfpflanzen herum. Sie verliehen dem Raum etwas vom Flair einer Provinzgärtnerei. Wir Holländer lieben Topfpflanzen, wahrscheinlich eine Marotte aus der Kolonialzeit, als die Heimkehrer ihre Fensterbänke mit Trophäen tropischer Regenwälder und Palmenstrände verzierten.
Dick sah meinen Blick: »Die Pflanzen hab ich von verschiedenen Leuten, die sie wiederum von anderen haben, die vor der Wende abgehauen sind. Die botanische Hinterlassenschaft von Republikflüchtlingen, verstehst du. Es gibt einen richtigen Dschungel davon, verteilt auf die Haushalte von zurückgebliebenen Freunden. Eine Art verborgenes Sumatra in Ostdeutschland.«
Er kam mit zwei langstieligen Genevergläsern zum Tisch und schenkte aus einer Tonflasche ein. Es war »Oude de Kuyper«, er trank aus kindlicher Eitelkeit immer diese Marke. Dann ließ er sich in einen schäbigen Sessel fallen, dessen Armlehnen aus braunem Skaileder aufgeplatzt waren und häßliche Schaumstoffwülste freigaben. »Ich habe Angst, Piet. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich richtige Angst. Ich bin froh, daß du gekommen bist. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin!«
Er seufzte schwer und hob das randvoll geschenkte Schnapsglas an den Mund. Seine Hand zitterte so, daß Tropfen den Stiel herabrannen.
Ich schwieg. Schweigen ist schon lange meine bevorzugte Methode, Leute zum Reden zu bringen. Es kommt allerdings darauf an, wie man schweigt, Es muß ein Schweigen von höchstem Interesse, von freundschaftlicher Neugier sein, eine Stille voller Hilfsbereitschaft und Anteilnahme. Ich hatte offenbar ein Talent zu diesem Verhalten, das mir schon die Ausübung meines früheren Berufes als Psychotherapeut erleichtert hatte, aber auch meiner jetzigen Tätigkeit als Verhörspezialist bei der Groninger Mordkommission dienlich war.
Diesmal allerdings war ich privat hier, und Dick war ein Freund, doch das machte keinen Unterschied. Fälle von in Bedrängnis geratenen Landsleuten im Ausland sind meine Spezialität. Dieser Mann, der mir gegenübersaß, war in Bedrängnis. Es war unumgänglich gewesen, einen Teil meines Weihnachtsurlaubes zu opfern.
Ich hoffte, daß Dick nun auspacken würde. Aber er schien sich nur betrinken zu wollen. Immer wieder leerte er sein Glas, während ich über meines die flache Hand hielt. Es war also wohl doch notwendig, mein Schweigen zu brechen, zu fragen. Fragen ist nicht ungefährlich, denn Fragen lenken die Auskünfte häufig in Bahnen, die vom Problem wegführen.
Ich räusperte mich. »Dick«, sagte ich. Er sah mich verzweifelt an. Sein mächtiger Brustkorb bewegte sich wie ein Blasebalg. In diesem Moment klopfte es an der Tür. »Das ist Ines«, sagte er. »Sie bringt unser Essen. Ines hilft mir im Buchladen und hier im Haushalt.«
Er sah mich treuherzig an, und ich wußte, daß es die übliche Kombination war. Dick und sein gefallenes Töchterchen.
Die Tür ging auf, und Ines erschien mit einer großen prallgefüllten Plastiktasche. Sie schälte sich aus einem schäbig wirkenden Kaninchenfellmantel und schlang ihre Arme um Dicks Hals, ohne mich eines Blickes zu würdigen. »Sag guten Tag, Ines«, sagte Dick. »Das ist mein Freund Piet.« Ines gab mir die Hand und machte einen Knicks, an dem ein Tanzschullehrer früherer Zeiten seine Freude gehabt hätte. Sie hatte glatte, schwarze, zurückgekämmte und zu einem Knoten verschlungene Haare. Ihr Gesicht war maskenhaft ebenmäßig, der große Mund sorgfältig geschminkt, die großen, bleifarbenen Augen dunkel umrandet. Sie hatte Rouge aufgelegt und sah älter aus, als sie vermutlich war. Ihr enges Schlauchkleid betonte ihre Brüste und ihr Gesäß.
»Mach uns das Essen zurecht«, sagte Dick, der es offenbar genoß, mir vorzuführen, wie sehr er Herr im Hause war. Ines schnurrte wie eine Katze: »Mein Schatz, du weißt, daß ich alles für dich tue.« Das Wort »Schatz« klang in ihrem Mund nach Jahrmarkt und türkischem Honig, nach Flitter, Tand und Kettenkarussell. Jetzt erst streifte sie mich mit einem taxierenden Blick. Ines schien körperlich zwanzig, geistig sechzehn und seelisch zwölf zu sein.
»Ines ist eine Süße«, sagte Dick mit einer Stimme, die einer Behauptung durch Lautstärke Glaubwürdigkeit zu verleihen sucht. Wahrscheinlich bist du ein Biest, dachte ich, während ich ihr zusah, wie sie die zwei mitgebrachten, fettglänzenden Brathähnchen mit einem Brotmesser zerteilte.
»Broiler sind das einzige, was man hier essen kann«, kommentierte mein Gastgeber. »Wir essen jeden zweiten Tag Broiler.«
Mir fiel auf, daß wir Deutsch sprachen, seit Ines eingetroffen war. Dick schien großen Wert darauf zu legen, daß Ines von uns einbezogen wurde.
Sie kam mit den Portionen, drei halben Hähnchen und Brot auf Steinguttellern, stellte sie auf den Tisch, brachte Bier, schenkte ein, setzte sich auf Dicks Schoß und begann zu essen. Das Fett verschmierte den Lippenstift breit um ihren Mund herum. Während Dick an ihr vorbeilangte und seinem Broiler das Bein ausbrach, erzählte Ines mit vollem Mund allerlei vom Tage. Ihr Dialekt war fürchterlich. Auch Dick schien nicht alles zu verstehen. Er zwinkerte mir hinter ihrem Rücken zu, nagte das Broilerbein ab, trank abwechselnd Genever und Bier, das übrigens ausgezeichnet schmeckte. Ich vergaß allmählich den Grund meines Hierseins. Es war eine Situation, in der Angst etwas Abstraktes war und der Augenblick des Lebens die Oberhand gewonnen hatte, jedenfalls für den erstaunlich langen Moment, den ein Augenblick unter günstigen Umständen zu dauern vermag.
»Es gibt bald die Csárdásfürstin«, sagte Ines. »Mein Lieblingsstück. Kaufst du mir eine Karte?« Dick tätschelte unbeholfen ihre Brust. »Ich möchte Weihnachten in die Csárdásfürstin. Wenn du nicht mitwillst, geh ich allein.« Sie leckte sich die fettglänzenden Finger und rutschte von Dicks Schoß herunter, ging in die Küche, wusch sich die Hände und trällerte dazu ein Lied, das ich sehr gut kannte. »Machen wir’s den Schwalben nach, bau’n wir uns ein Nest.« Meine Mutter hatte es mir oft vorgesungen, als ich klein war und Einschlafschwierigkeiten hatte. »Ich bin müde«, sagte Ines. »Ich geh schon ins Bett. Wenn du wieder so betrunken bist wie gestern, kannst du bei deinem Freund schlafen.« Sie kam noch einmal herein und knickste uns zu. Dann verschwand sie im Schlafzimmer.
»Ist sie nicht eine Süße?« sagte Dick mit schwerer Zunge. »Verstehst du jetzt, warum ich nicht einfach abhauen kann?« Er stand auf, legte Holz nach und öffnete die Luftklappe. Der schwarze Kanonenofen begann zu fauchen.
»Was macht dir eigentlich solche Angst?« fragte ich unvermittelt. Dicks Gesicht nahm ruckhaft einen vollkommen anderen Ausdruck an. Es war, als ob einem Daumenkino ein paar Seiten fehlten. Die Grimasse trunkener Lebenslust verwandelte sich übergangslos in die schlaffe Mimik hoffnungslosen Elends.
»Mußt du ausgerechnet jetzt damit anfangen! Du hättest wenigstens heute abend die Klappe halten können.« Er sah mich mit einer unangenehmen Feindseligkeit an.
Ich stellte mich unwillkürlich auf seinen Schuljungenton ein. »Komm, Dick, spuck’s aus. Du hast doch vor etwas fürchterliche Angst. Sonst hättest du mich nicht hergeholt.«
»Ich und Angst?« Er begann röhrend zu lachen, wippte den Stuhl zurück, ließ sich wieder nach vorne fallen und schlug krachend die Faust auf den Sofatisch. Unsere frisch gefüllten Gläser fielen um, der Duft von Oude Genever verbreitete sich im Zimmer und ließ die Trunkenheit in mir und Dick auf und ab schwanken wie Flüssigkeit in kommunizierenden Gefäßen, die jemand bewegt. Immer wieder hieb Dick auf den Tisch, als wollte er die Platte durchschlagen. Die Haut an seinen Knöcheln platzte auf, rote Flecken breiteten sich in der Schnapslache aus. »Wenn du es genau wissen willst, es ist der Deutschling.«
»Der wer?«
Ines erschien in der Tür in einem durchsichtigen Negligé. Sie wirkte wie aus dem Playboy ausgeschnitten. »Was macht ihr für einen Krach?« sagte sie. »Könnt ihr euch in Anwesenheit einer Dame nicht besser benehmen?«
Sie kam an den Tisch, tauchte den Finger in die Geneverpfütze, leckte daran, schüttelte sich. Dann sah sie Dicks blutende Faust.
»Du verrückter Kerl!« rief sie. Sie ging hinaus und kam mit einem Lappen zurück, wischte Dicks Handrücken ab, den er ihr brav hinhielt. »Komm jetzt ins Bett, du Nasenbär. Und laß dir die Tatze verbinden.« Ines war von überschäumender Mütterlichkeit. Sie drückte seinen Kopf gegen ihre Brüste. »Ist er nicht fürchterlich? Dieser Grobian?« Es waren die ersten Worte, die sie an mich richtete.
»Sie steckt mit dem Deutschling unter einer Decke«, sagte Dick. »Aber gleich auch mit mir.« Er packte sie um die Taille, hob sie auf und trug das strampelnde Mädchen hinaus. Ich blieb sitzen und starrte vor mich hin, auf die Geneverpfützen, die in der Hitze des Raumes zu trocknen begannen. Warum hast du nicht auch eine Ines? dachte ich.
Er kam noch einmal zurück. In der Unterhose. Sein mächtiger Brustkorb war dicht behaart. »Ich habe dir ein Bett in meinem Arbeitszimmer gemacht. Die Tür neben dem Klo. In der Küche steht eine Kanne mit frischem Hibiskustee. Er hilft gegen Kater. Bis morgen, Piet. Dann reden wir über alles.«
Ich ging hinüber in die Küche und trank eine Tasse der dunkelroten Flüssigkeit. Der Raum, in dem ich schlafen sollte,
Die Erstausgabe dieses Romans erschien 1994 im Vito von Eichborn Verlag, Frankfurt am Main.
Umwelthinweis: Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend.
btb Taschenbücher erscheinen im Goldmann Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
1. Auflage Neuausgabe September 2003
Copyright © 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagfoto: Zefa/Masterfile KR · Herstellung: Augustin Wiesbeck
eISBN : 978-3-641-02389-8
www.btb-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de