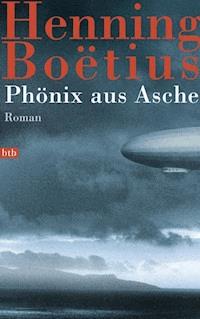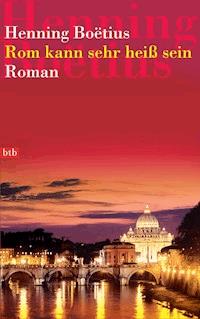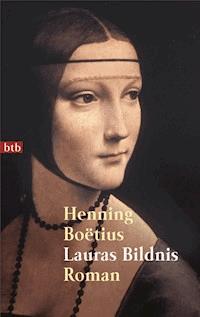Inhaltsverzeichnis
Lob
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Copyright
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2006 by btb Verlag München, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
ISBN 978-3-641-01341-7V002
www.btb-verlag.de
O Schwermut, Schwermut
Von so weit her bringst du mir wieder, woran du so lang schon trugst?
1
Ich weiß nichts von Marconi. Ich weiß nur, dass er entscheidend zur Entwicklung der drahtlosen Telegraphie beigetragen hat. Ein Erfinder war er, besser gesagt, ein Entdecker neuer Welten, in der die unsichtbaren Wogen eines elektromagnetischen Meeres die kleinen Papierschiffchen und Flaschenpostbotschaften des Lebens von Ufer zu Ufer tragen. Er, Guglielmo Marconi, war der Columbus dieses unsichtbaren Meeres, dessen Wellen immer noch steigen und steigen und uns umspülen, bis die Gefahr besteht, dass wir in ihm untergehen. Er wagte sich als Erster auf diesen rätselvollen Ozean hinaus. Er besaß die Kühnheit und den Erfindungsreichtum, ihn zu durchqueren mit seinen Frittern, Funkeninduktoren und Radioröhren, um schließlich einen Kontinent zu erreichen, den es auf keiner Weltkarte gibt und der doch inzwischen die Wirklichkeit beherrscht: den achten Kontinent, den Kontinent der Information.
Ich weiß nichts von Marconi, höchstens, wann er geboren wurde und wann er starb. Ich habe mich lange gescheut, seine Lebensdaten in einem Lexikon nachzuschlagen. Warum?, frage ich mich. Vielleicht aus Angst, den Mythos dieses Entdeckers zu zerstören, ihm zu nahe zu kommen, so, wie ich Angst habe, mir selbst, meiner eigenen Lebensgeschichte zu nahe zu kommen? Ich traue mich nur ungern in den verwilderten Garten meiner Vergangenheit hinein, aus Furcht, Personen zu begegnen, die einst über die Macht verfügten, zu entscheiden, was Unkraut sei, was ausgerottet werden müsse oder was es wert sei, gepflegt und geerntet zu werden.
Eben quert eine schwarze Katze den kleinen, steinigen Platz vor dem Turm, an dessen Mauer gelehnt ich sitze. Eine Mahnung vielleicht, behutsam vorzugehen im Umgang mit dem eigenen inneren Kontinent der Erinnerung, diesem babylonischen Sprachgewirr einst gesendeter und empfangener Botschaften, ausgehend von Menschen und Dingen oder an sie gerichtet. Sie sind oft entweder vergessen, in alle Winde verstreut, oder sie haben dieses Schicksal noch vor sich. Irgendwann werden sie sich verlieren in den Weiten des Weltalls, werden sie die Heaviside-Schicht durchdringen, diese die Erde einschließende Schale ionisierter Luft, die für Kurzwellen wie ein Spiegel wirkt, nicht jedoch für die Frequenzen, die heutzutage unsere Äußerungen transportieren. Die meisten sind inzwischen auf dem Wege zu anderen Zivilisationen, in denen es vielleicht kein Wort mehr für Liebe gibt und keines für Tod und wo den Botschaften der Vergangenheit ewiges Vergessensein droht.
Es ist Marconis Turm oder vielmehr einer seiner Türme, die er für seine Experimente nutzte. Ein breiter Stummel aus Stein inmitten von Zypressen und Wacholderbüschen, gelegen auf einer unter Naturschutz stehenden Halbinsel im Tyrrhenischen Meer. Marconi hat hier einst seine Geräte vor Sturm und Regen bewahrt, hat hier sein Brot verzehrt und seinen Wein getrunken, wenn er nicht auf der Turmterrasse war, um bei schönem Wetter Radiowellen zu versenden, sie mit sanften Gebärden seiner feingliedrigen Hände im Äther zu verteilen, so wie man feine Glaceehandschuhe abstreift, um sie dem Geliebten von der Logenbrüstung aus zuzuwerfen.
Ich weiß nichts von Marconi, so wie ich am liebsten möchte, dass ich nichts von mir selber weiß. Denn auch ich besitze insgeheim einen Turm, der einst meinen kleinen Lebensexperimenten als Standort diente. Er ist inzwischen nicht weniger verfallen als Marconis Turm. Allerdings beherbergt er in seinem Kellerverlies nicht jenes Gerümpel alter Radiogeräte, Spulen, Kondensatoren, Röhren, Isolatoren, Kupferdrähte, die dort durcheinander liegen wie die Überreste ausgeweideter Tiere. Dafür enthält er zahllose Relikte wichtiger und unwichtiger Ereignisse, schemenhafte Reminiszenzen an Gesichter und Wolken, an Horizonte, hinter denen ein Unwetter aufzieht, Echos von Eindrücken, Berührungen, die man kaum voneinander unterscheiden kann. Mir scheint übrigens, dass die unwichtigen Erinnerungen oft deutlicher sind als die wichtigen.
Auch mein Turm hat Risse, auch er ist vom Einsturz bedroht. Wenn ich versucht habe, in dieses wenig imposante Bauwerk einzudringen, seine altersschwache Tür mit dem rostigen Schlüssel der Erinnerung zu öffnen, dann habe ich dies mit schlechtem Gewissen getan. Doch war mir längst klar geworden, dass es höchste Zeit war, dass ich mich würde beeilen müssen, hastig wie ein Grabräuber diese unansehnlichen Schätze zu bergen, ehe sie vollends verschüttet würden. Auch ein Brief, den ich noch nicht gelesen habe und der vor vielen Jahrzehnten in meinem Namen geschrieben wurde, gehört dazu.
Eben kommt die schwarze Katze zurück. Ihr Buckel ist gekrümmt, als wollte sie mir pantomimisch ihr Missbehagen über meine Inkonsequenz erklären. Sie hat Recht. Es ist so viel geschehen in letzter Zeit, dass es mir schwer fällt, meinem Bericht eine Ordnung zu geben. Ich werde mich deshalb lieber an die Regeln meines Freundes Luigi, des Strandläufers, halten und einfach drauflosschreiben. Er hat Recht, man darf nicht in den Fehler verfallen, beim Schreiben bestimmte künstlerische Absichten zu verfolgen. Oder schlimmer noch, nachträglich Ordnung in sein Leben bringen zu wollen. Man muss vielmehr so wahllos und sprunghaft vorgehen wie das Dasein selbst.
2
Bis vor kurzem wohnte ich im Süden des Landes in einem
Tal. Es ist eng, und der Fluss an seinem Grund ist fast immer trocken. Das Meer ist nicht weit. Ich konnte es von der Haustür aus sehen. Wie eine graue, dreieckige Mauer verschließt es den Einschnitt der bergigen Landschaft an seinem Ende. Manchmal, bei Wind, ging ich die Straße hinunter bis zu ihrem Fuß und lauschte den Wellen. Ich hatte das Gefühl, dass sie lauter geworden waren in letzter Zeit, dass die eine oder andere Woge bereits dabei war, mit ihrem großen, feuchten Rachen das Land zu verschlingen. Dann fiel es mir schwer, meine Angst zu bekämpfen. Ich wich zurück und ging mit schnellen Schritten wieder in diese kleine Wohnung, die ich mein Zuhause nannte, weil mir kein besseres Wort einfiel für den Platz, an dem ich meine häufig schlaflosen Nächte verbrachte.
Seitlich am Ende des Tals liegt die Stadt. Sie erinnert aus der Entfernung an ein abstraktes Gemälde, das ein Künstler mit großem Geschick auf die Leinwand des Himmels gemalt hat. Weiße und hellbraune Rechtecke verschiedener Größe überlappen sich. Trapeze und kleine schwarze Quadrate lockern, über das Bild verstreut, den malerischen Eindruck auf. Doch dieser Anblick täuscht. Nähert man sich, verwandelt sich die scheinbar so raffiniert gestaltete Fläche in ein räumliches Objekt. Man gewahrt plötzlich Häuser mit Türen und Fenstern, scheinbar wahllos aufeinander getürmt und ineinander verschachtelt. Treppen und schmale Gassen bilden zusammen mit den Wohn-, Arbeits- und Vorratsräumen ein verwinkeltes Labyrinth, in dem Menschen wie Mollusken umherkriechen, als hätten sie kein anderes Ziel wie das, sich in einer schützenden Schale zu verbergen.
Die Stadt liegt auf einem Felsen, der wie eine mächtige, geballte Faust ins Meer hinausragt. Sie ist uralt und von der Schönheit eines zu Stein gewordenen Traums. Ich habe mir anfangs, als ich sie zum ersten Mal vor mir liegen sah, gewünscht, dort für immer zu bleiben, über eine dieser schmalen Wendeltreppen mein eigenes Zimmer zu erreichen, einen kahlen Raum mit meterdicken Mauern, von Fensterhöhlen durchbrochen, durch die man aufs gleißende Meer hinausblickt. Aber es ist zu gefährlich, in einem Traum zu leben. Man verlernt dabei das Erwachen. Man existiert schließlich nur noch halb, wie ein Somnambuler auf dem schmalen Grat zwischen Tod und Leben.
Außerdem bemerkte ich bald, dass die Einheimischen wenig übrig haben für Fremde. Sie empfinden sie als Eindringlinge, gar als Usurpatoren. Die Leute sind zwar nicht unfreundlich. Bereitwillig helfen sie, wenn man sich nach dem Weg erkundigt, nachdem man mehrfach in die Irre gegangen ist. Aber sie tun dies vermutlich nur, weil sie möchten, dass man aus ihrer Stadt hinausfindet, um endlich ganz zu verschwinden.
Ich begreife diese Einstellung nur zu gut. Allzu viele Erholungssuchende kommen im Sommer und mieten sich ein in diesem weiß schimmernden Termitenbau. Manche kaufen auch Wohnungen, obwohl sie fast unerschwinglich teuer sind. Und so besteht die Gefahr, dass die ganze Stadt eines Tages zu einer Kulisse für ein fremdes Theaterstück wird, in dem die Hauptfiguren einzig und allein dem Egoismus ihrer Lustgefühle huldigen. Ein langweiliges Stück, das die wenigen alteingesessenen Fischer und Bauern zu Statisten macht.
Ich hatte mir aus all diesen Gründen eine Wohnung vor der Stadt gesucht, jedoch nicht zuletzt auch deshalb, weil ich mir so die Möglichkeit erhalten wollte, ihre allabendliche Rückverwandlung in ein Traumbild zu erleben. Zweck meines Aufenthaltes war, Muße zu finden für die Arbeit an einem Buch, das zu schreiben mir wichtig schien, hatte es doch indirekt mit dem Beruf meines Vaters zu tun, der Seemann gewesen war. Mein Verleger hatte mir einen ungewöhnlich hohen Vorschuss zukommen lassen, ein Indiz dafür, welchen kommerziellen Erfolg er sich von dem Projekt versprach. Es sollte um das Leben eines berühmten Piraten gehen. Ich versprach mir von meinem derzeitigen Wohnort Inspiration, war er doch einst immer wieder von Seeräubern überfallen worden. Statt jedoch zügig an die Arbeit zu gehen, verfiel ich mehr und mehr in einen für mich ungewöhnlichen Zustand empfindlichen Nichtstuns. Ich begann, viel spazieren zu gehen oder in den Bars zu stehen, als wartete ich auf etwas, das mir im Grunde gleichgültig war.
Es gibt einen kleinen Hafen unterhalb der Stadt. Nur noch wenige Fischerboote liegen dort. Den meisten Platz besetzen im Sommer die Motorboote der Fremden, die die Stadt als Sommerresidenz benutzen. Im Winter jedoch ist der Hafen immer noch ein geheimnisvoller Ort, an dem ich mich damals besonders gerne aufhielt. Hier schien mir mein zu einer leeren Hülse erstarrtes Warten sinnvoller zu sein als anderswo.
Das Weiß der Häuser dieser Stadt, vor der ich damals lebte, lässt sie im Sonnenschein leuchten wie eine unwirkliche Erscheinung. Vogelfelsen haben oft diese Farbe, weil sie der kalkhaltige Kot ihrer Bewohner bedeckt. Es ist keine Farbe der Unschuld, keine Beschwörung der graphischen Wirkung von Licht und Schatten, kein Versuch, der Sommerhitze den Zutritt zu erschweren. Es ist vielmehr die Farbe der Trauer, wie sie nach dem Verlust eines geliebten Menschen in Ländern getragen wird, denen christliche Missionare nicht die Schwarzmalerei ihrer Religion aufzuzwingen vermocht hatten. Die Einwohner streichen jedes Jahr im Frühling ihre Häuser mit Kalkfarbe, weil wieder ein Jahr verloren ist, davongeflogen, ohne mehr zu hinterlassen als die brüchigen Schalen eines Eis, aus dem der Vogel geschlüpft ist. Schicht um Schicht bedeckt dieses Weiß das uralte Mauerwerk, um daran zu erinnern, dass die Vergänglichkeit eine gefräßige Riesenkrake ist, die zuweilen aus dem Meer auftaucht und die Menschen mit ihren langen Polypenarmen aus ihren Kammern und Betten reißt, um sie in ihrem schnabelförmigen Maul zu zerquetschen. Vielleicht haben die Bewohner der weißen Stadt Angst vor diesem Untier. Vielleicht sitzen sie deshalb des Abends nach Sonnenuntergang oft auf den kleinen Steinbänken der nach Westen gelegenen schmalen Plätze und starren schweigend auf die See hinaus, auf ihren von der Abendbrise blind gewordenen Spiegel.
Manchmal setzte ich mich zu ihnen auf die Bank, wobei ich sorgfältig darauf achtete, ein wenig Abstand zu halten, denn ich spürte ihr Misstrauen wohl. Auch ich starrte dann aufs Meer und fühlte die gleiche brüderliche Angst in mir aufsteigen. Bei klarer Luft tauchten am Horizont Inseln auf wie die Rücken einer kleinen Schule von Tümmlern. Während die untergehende Sonne das Meer blutrot färbte, hörte ich das Tuscheln der Frauen, die die Köpfe zusammensteckten, sah ich das furchtsame Deuten der Männer mit dem Finger zum Horizont. Erst wenn der Nachthimmel endlich seine dunkelblaue Markise über den Bergen im Osten entrollte, stand ich auf und ging nach Hause in meine kleine Wohnung.
Vom ersten Tag meines Aufenthaltes in der weißen Stadt an hatte ich geahnt, dass ich etwas tun musste gegen diese Angst vor der Vergänglichkeit. Doch hielt ich schon damals die Erinnerung für genauso gefährlich wie das Vergessen. Beide sind zusammengehörige Ungeheuer wie Skylla und Charybdis, beide bedrohen das kleine Lebensschiff, das zwischen ihnen seinen Weg sucht. Skylla ist ein Doppelwesen, halb Hund und halb Fisch. Es haust in einer Höhle und droht, alle zu töten, die ihm zu nahe kommen. So ist die Erinnerung. Charybdis aber ist das Vergessen, ein gewaltiger alles verschlingender Strudel.
Ich habe vergeblich versucht, es mit beiden aufzunehmen. Meine Versuche zu vergessen waren dilettantisch. Immer wieder quälten mich unwesentliche Erinnerungen. Was wesentlich war, entglitt mir, schien jedenfalls nicht deutlich genug und vor allem nicht wahrheitsgemäß. Alles, was ich zusammentrug, glich bunten Abziehbildern, die man ins Poesiealbum des Lebens klebt. Sich absichtlich erinnern ist schwer. Ein mühseliges Unterfangen, ähnlich müßig wie der Versuch, Quecksilberperlen mit den Fingern aufzulesen. Sie zerteilen sich bei der geringsten Berührung und rinnen blitzschnell davon, um in allen möglichen Ritzen zu verschwinden.
Ich schlief schlecht in jenen Tagen. Da half auch der Rotwein nicht, den ich in großen Mengen trank. So versuchte ich, die Stunde der Wahrheit hinauszuzögern, die Unruhe zu betäuben, die den Archäologen befällt, wenn er sich auf einem Terrain zu befinden glaubt, unter dem die Schätze einer versunkenen Zivilisation liegen. Dabei war ich, ohne es zu wissen, längst dabei, mich meinen Erinnerungen zu stellen und ihre Bruchstücke auszugraben: All diese noch nicht von Grabräubern geplünderten Phantasien, all diese Vasen voller berauschender oder auch vergifteter Augenblicke! Wenn man die frühesten Momente im Leben, an die man sich erinnert, wie die Bruchstücke eines Gefäßes miteinander verkittet, entsteht, wenn man Glück hat, eine unregelmäßige, im Zickzack verlaufende Linie. Sie ähnelt einer geheimnisvollen Schrift und bedeutet, dass die Scherben wenigstens teilweise zusammenpassen. Natürlich klaffen auch große Löcher zwischen ihnen, die signalisieren, dass Teile der Vergangenheit unwiederbringlich verloren gegangen sind. Um die Form der Vase zu erhalten, muss man sie mit grauem Ton ausfüllen. Beim nachträglichen Brennen nimmt er eine rötliche Farbe an, auf der man die verloren gegangenen Muster, so gut es geht, rekonstruieren kann.
Ich lag oft, erschöpft vom Nichtstun, auf meinem Bett. Die Vorhänge hatte ich zugezogen. Die Schatten der Nacht kamen und gingen. Sie erinnerten an einfache Frauen in schwarzen Kleidern. Sie trugen ihre Träume auf dem Haupt wie durchsichtige Amphoren. Ich vertraute ihnen mehr als den Männern, die die Stille töten mit ihrem Geschwätz. Ich konnte nicht einschlafen. Also versuchte ich wieder einmal, auf dem Ruinenfeld meiner Kindheit zu graben, die wenigen Reste, die ich fand, von der Asche der Zeit zu befreien, die sie bedeckt.
3
Als ich wieder einmal mit schwerem Kopf erwachte, glaubte ich, von meiner Mutter geträumt zu haben. Es war nicht das erste Mal, dass sie mir im Traum erschien. Wie immer konnte ich mich an nichts erinnern, und dennoch zeugten bestimmte, unbeschreibliche Gefühle von einer nächtlichen Wiederbegegnung mit ihr. Beinahe so, als ob noch ein Geruch im Raum schwebte, der von einer Person stammte, die ihn gerade verlassen hatte. Und war dort nicht auch eine Kuhle auf der Bettdecke, den ihr Körper als deutlichen Abdruck hinterlassen hatte?
Meine Versuche, einen solchen Traum ins Bewusstsein zurückzuholen, scheiterten gewöhnlich. Ich fragte mich, warum ich mich gerade an meine Mutter so schwer erinnern konnte, jedenfalls an die Person, die sie gewesen sein musste, bevor sie alt geworden war. Es kam mir vor, als hätte ich zwei Mütter, eine junge und eine alte. An die alte habe ich sehr deutliche Erinnerungen, sie sehe ich auch jetzt genau vor mir, aber es ist eine andere Frau als meine Mutter in ihren jungen Jahren. Sie hat mit ihr nicht viel mehr gemein als den Namen. Manchmal denke ich, die junge hat mich geboren, die alte hat mich verraten. Das mag zu einfach sein, aber ich litt jedenfalls sehr darunter, dass sich meine junge Mutter meinem Gedächtnis so standhaft entzog. Gäbe es keine Fotos von ihr, ich wüsste nicht einmal, wie sie ausgesehen hat. Sie muss eine ungewöhnliche Schönheit gewesen sein – mit ihren rotblonden Haaren, den rehbraunen Augen, der hochgewölbten Stirn, den fein gezogenen Brauen und der schmalen, geraden Nase. Ein Madonnengesicht, das den Eindruck einer undefinierbaren Lebensfrömmigkeit vermittelte.
Vierzehn Jahre lebte ich in übergroßer Nähe zu ihr, war ein Teil von ihr, fühlte mich in ihrer Obhut geborgen. Sie umgab mich mit ihrer Liebe, ihrer Fürsorge, ihren Meinungen, ihrem Duft, ihrem Körper und vor allem aber mit ihren Inszenierungen, die sie meisterhaft beherrschte. Sie konnte aus jedem Essen, selbst als es im Krieg kaum mehr etwas gab, eine Art Galadiner machen, oft nur durch die Dekoration des Tisches und die Begleitmusik aus dem Radio. Immer schuf sie für mich ein wärmendes Nest, in dem ich als das Kuckucksei lag, das ich nur ungern und spät von innen aufzupicken unternahm, wohl ahnend, dass dieser hässliche Vogel nach seinem Schlüpfen von den übrigen Nestinsassen als Fremdling erkannt werden würde.
Wir spielten damals wahrscheinlich jeden Tag das gleiche Stück: Ich war der Prinz, und meine Mutter verkörperte alle anderen Rollen. Sie war Prinzessin, Königin, König, gute und böse Fee, Zauberer, Herold, Narr, das Volk. Möglicherweise kann ich mich deshalb nicht an meine Mutter erinnern, weil sie zu viele Rollen hatte und mir gleichzeitig zu nahe war, so wie etwas in seinen Konturen verschwimmt, wenn man es zu dicht an die Nase hält. Doch werde ich nicht aufgeben. Ich werde bis an mein Lebensende versuchen, mich dieser fremden Frau, ihres Gesichts, ihres Lächelns, ihrer Gestalt zu vergewissern, bis ich mich an mehr erinnere als an den Fetzen eines Kattunkleides, eine goldene Haarlocke, ein braunes Rehauge oder eine himbeerfarbene Brustwarze.
Das Badeviertel der Stadt beginnt an ihrem nördlichen Fuß und erstreckt sich einige Kilometer die Küste entlang. Im Sommer drängen sich hier die Kurgäste. Es ist dann laut und für meinen Geschmack unerträglich. In der Nachsaison sind die Strände dagegen leer; die Spuren des sommerlichen Badetriebs sind jedoch noch überall vorhanden. Ich liebe diese Zeit, in der es noch warm ist, die meisten Fremden aber abgefahren sind, weil sie irgendwo ein ordentliches, von Pflichten und Beziehungen bestimmtes Leben führen müssen. Jetzt werden die Straßenkehrer plötzlich zu Hauptpersonen. Mit ihren Besen gleichen sie Künstlern, die ihre kühnen Kompositionen mit den Borsten ihres Pinsels auf die Promenade tupfen.
Die meisten Lokale haben schon geschlossen. Heruntergelassene Jalousien verbreiten eine Stimmung von Unweigerlichkeit. Am Strand werden Schirme und Liegestühle abgebaut. Die braungebrannten jungen Männer, die damit beschäftigt sind, wirken so konzentriert und entschlossen bei ihrer Arbeit, dass man meinen könnte, sie würden am liebsten auch das Meer zusammenrollen und in einem der Bauwagen verstauen, in denen sie ihre Gerätschaften aufbewahren.
Auch die See ist in der Nachsaison verändert. Sie wirkt entspannt, befreit, ein wenig wie ein entlassener Sträfling, der, zum ersten Mal wieder in Freiheit, einen blauen, ungebügelten Anzug trägt. Sie hat noch nicht die Wildheit der Herbststürme, aber sie spielt mit ihren Wellen bereits so, dass man ahnen kann, welche Kraft in ihnen steckt.
Hätte ich nicht einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend auf einer Nordseeinsel verbracht, ich wäre kaum empfänglich für die unnachahmliche Melancholie der Nachsaison. Am besten lässt sich ihre Atmosphäre in einem der wenigen Cafés erleben, die noch betrieben werden. Die Tür steht offen, die Plastikstreifen des Vorhangs wehen in der Seebrise auseinander und geben den Blick frei auf das Meer. Die Geräusche der Kaffeemaschine, der halbvollen Gläser, die die wenigen Morgentrinker vorsichtig, fast schuldbewusst auf die Marmorplatte des Tresens stellen, die halb gemurmelten Banalitäten, all das fügt sich zu einer angenehmen Geräuschkulisse, die nicht die Anstrengung des Zuhörens verlangt. Der Mann an der Bar reibt Gläser mit einem Tuch und blickt prüfend durch sie hindurch wie ein Astronom, der den Nachthimmel liebt. Ich bestelle einen Campari-Soda, denn ich mag dieses Getränk, weil in ihm Süße und Bitterkeit unversöhnt geblieben sind.
Ich liebe die Nachsaison. Auch die des Lebens. In meinem Alter hat sie begonnen. Ich liebe sie genauso wie jenes bittersüße Getränk, denn jetzt vergeht nicht mehr mein Leben, sondern nur noch meine Zeit. Ich entsinne mich eines dieser Momente in einer Strandbar, die noch nicht geschlossen war. Ich versuchte nachzudenken. Ein komplizierter Zustand, wenn einem nach nichts anderem zumute ist als nach den Wohltaten eines leeren Augenblicks. Beim dritten Campari-Soda kam mir der Gedanke, dass es zwei unterschiedliche, ja konträre Lebensstrategien gibt: eine des Eroberns und eine des Verteidigens. Meine Mutter verfügte in einem extremen Maße über die zweite Form. Sie spürte die Schwäche eines Menschen sofort. Mit ihrer destruktiven Phantasie war sie in der Lage, sein eventuelles Scheitern in diesem und jenem Bereich vorauszusehen und, wenn sie wollte, durch Bemerkungen noch zu beschleunigen. Die Tatsache, dass ich mich mit meinen vielen Talenten ein Leben lang in allen möglichen Bereichen verzettelt habe, ohne es je in einem von ihnen zur echten Meisterschaft zu bringen, hängt wohl mit dieser Fähigkeit meiner Mutter zusammen. Sie inspirierte mich auf vielfältige Weise, doch sie vermittelte mir auch immer zugleich die vermeintlichen Grenzen meiner Talente und brachte mich dadurch aus dem Tritt. »Du könntest ein Genie werden«, sagte sie oft, »wenn du endlich einmal konsequent bei einer Sache bleiben würdest.« Das war in höchstem Maße fatal, denn sie hatte gerade wieder einmal durch eine kleine, abschätzige Bemerkung, die zugleich ein übertriebenes Kompliment enthielt, mein Engagement auf einem bestimmten Betätigungsfeld zu Fall gebracht. Heute vermute ich, dass sie ihr eigenes Scheitern als Malerin auf ihren Sohn projizierte. »Du bist zu sensibel für diese grobe Form der Musik«, hatte sie ein andermal gesagt, nachdem ich angefangen hatte, Akkordeon zu lernen. »Du solltest lieber Klavier spielen, du hast die richtigen Finger dafür, mein Sohn.« Das Akkordeon blieb im Kasten. Ein Klavier hatten wir leider nicht.
Meine Mutter war auch eine Meisterin der Lüge. Die Wahrheit kannte sie nicht oder sie mied sie, als sei sie ein scheußliches Reptil. Mein Vater war das krasse Gegenteil. Er schien in einem Maße der Wahrheit verpflichtet, dass dies fast schon wieder in die Verlogenheit führte. Ich befand mich als Kind hilflos zwischen diesen beiden Gegensätzen. Also drehte ich mich auf der Spitze der Lügen meiner Mutter, getroffen von der Peitschenschnur der Wahrheitsliebe meines Vaters, ein kleiner Brummkreisel, der unverständliche Töne von sich gab und umfallen würde, wenn einst die Schnelligkeit der Rotation nachließ. Erst als meine Mutter tot war, verlor mein Vater seinen übertriebenen Hang zum Realismus, wie er es nannte. Er, der zu Lebzeiten meiner Mutter meist geschwiegen hatte, weil er Reden bereits als Betrug an der Wahrheit empfand und es daher lieber seiner Frau überließ, begann nach deren Tod zu reden, zuerst sporadisch, dann immer häufiger, eine Zeit lang nahezu pausenlos. In seiner Schweigsamkeit sprudelte plötzlich eine Quelle und bildete bald einen Fluss, der übers Ufer trat und Daten, Anekdoten, Geschichten, verrückte Thesen, Fragen, Seemannslatein herbeischwemmte. In diesem Strom bildete seine alte Stummheit kleine Inseln, die zuweilen auftauchten, wenn er aus dem Fenster sah oder mit mir telefonierte, Klippen, an denen sich sein Reden brach.
Wenn ich ihn besuchte, hörte ich ihm manchmal zu, ohne den Sinn seiner Worte zu beachten. Es war, als säße ich an diesem Fluss, um sein permanentes Rauschen zu bestaunen. Hätte man ihn kanalisiert, begradigt, gestaut, wäre vielleicht so etwas wie ein Roman daraus geworden, so aber glich das Naturschauspiel meines unaufhörlich redenden Vaters eher der Lamentation einer im Käfig der Vergangenheit gefangenen armen Seele.
Ich blickte immer noch hinaus aufs Meer, hob das vierte Glas mit der roten, perlenden Flüssigkeit des Campari-Soda und schaute hindurch wie durch eine getönte Brille in die blasse Scheibe der Sonne, die bereits hoch am Himmel stand. So schuf ich mir meinen eigenen Sonnenuntergang. Gerade als ich gehen wollte, fuhr ein Konvoi von Autos vorbei. Vorneweg ein offener Lieferwagen voller Kränze, dann ein Leichenwagen, durch dessen Fenster man einen schwarzlakkierten Sarg sah, umgeben von brennenden Kerzen, gefolgt von mindestens fünfzehn vollbesetzten PKWs. Keiner der Insassen war dem Anlass gemäß gekleidet. Mädchen in Shorts und knappen T-Shirts, junge Männer in weißen Hosen, offenen bunten Hemden. Es wurde gelacht. Radios plärrten. Das Ganze hätte auch eine Hochzeitsgesellschaft sein können.
Ich stellte mir vor, der Mann im Sarg sei mein Vater. Ich habe ihn als Kind selten gesehen. Er ist für mich eigentlich immer tot gewesen, ohne dabei je die Fähigkeit zu besitzen, sterben zu können. Dennoch oder gerade darum habe ich ihn bewundert, verehrt und sogar geliebt. Mein Vater war immer irgendwie absent, auch wenn er da war. Er war Seemann, er war im Krieg, er war im Wald oder im Bett meiner Mutter oder sonstwo, jedenfalls immer hinter dem Horizont meiner kleinen Welt. Das Niemandsland zwischen ihm und mir war zudem von meiner Mutter vermint. Sie beherrschte uns beide, indem sie uns gegeneinander ausspielte.
Als kleines Kind dachte ich manchmal, mein Vater lebe in Pommerland und Pommerland sei abgebrannt. So sang es schließlich manchmal seine Frau. Ich hatte nie das Gefühl, ihn je wirklich ganz und gar zu Gesicht zu bekommen. Wer da hin und wieder auf Urlaub war, bei uns am Tisch saß, Weißbrot toastete und sich mein Vater nannte, musste ein Stellvertreter sein, den mein richtiger Vater geschickt hatte, um uns, meiner Mutter und mir, die Wartezeit auf ihn zu verkürzen.
Ich stand auf, zahlte und ging an den Strand. Eine leichte Übelkeit hatte mich befallen. Ich setzte mich auf einen Stein und starrte in den Himmel. Er wirkte höher als sonst. Zarte Schleier von Stratozirrus zogen von Westen heran. Die Front der Wolkenbänder war hakenförmig gekrümmt. Ich wusste, was dies bedeutete: Ein Wetterwechsel stand bevor. Es würde bald Sturm geben.
Trotz der kühlen Jahreszeit legte ich mich in den Sand und schloss die Augen. Irgendwann tauchte ich ein in Bewusstlosigkeit. Kurz nachdem ich wieder erwachte, sah ich aus den Augenwinkeln einen Menschen. Wie ein Stück Treibholz lag er einige Meter entfernt flach auf dem Rücken. Ich wusste nicht, wie lange ich geschlafen hatte. Ich drehte mich auf den Bauch, schlug das Buch auf, das ich dabei hatte und tat so, als ob ich lesen würde, aber in Wirklichkeit beobachtete ich die Person neben mir. Sie lag völlig regungslos da, als sei sie angetrieben, der Kopf umgeben von einem Fächer offener, blonder Haare.
Meine Augen begannen im Salzwind zu tränen. Feine Sandkörner sammelten sich zwischen den Seiten des Buches und auf meinen Lippen. Plötzlich kam Leben in die Frau. Sie erhob sich, ging dorthin, wo die Wellen im Sand ausliefen und starrte aufs Meer hinaus. Der stärker werdende Wind zerrte an ihren Haaren. Schließlich drehte sie sich um und ging, ohne mir einen Blick zu schenken, in den schmalen Weg hinein, der zwischen Ferienhäusern zum Ort hinaufführte. Ich schaute ihr nach. Verwirrt, aufgewühlt. Ich verspürte den Drang, ihr nachzulaufen, wie ich es vor einigen Jahren noch getan hätte, nicht um sie anzusprechen, sondern um für eine Weile aus der verstohlenen Nähe zu einer Fremden, ihrem Gang, ihrem Ausgeliefertsein gegenüber meinen Blicken und geheimen Gedanken so etwas wie eine Wegzehrung für Tagträume zu beziehen. Doch ich ging nur zu der Stelle, wo sie gelegen hatte, und legte mich auf den Abdruck, den ihr Körper hinterlassen hatte.
Ich musste wieder eingeschlafen sein. Ich träumte von der Haut meines Vaters. Die wenigen Male, wo ich seinen nackten Oberkörper gesehen hatte, hatten mich fasziniert, da seine helle Haut über und über von zahllosen Leberflecken bedeckt war. Sie war wie das Negativ eines Sternenhimmels. Als ich älter wurde, traten bei mir dieselben Heerscharen von braunen Punkten auf. Es war beinahe, als schlüpfte ich mehr und mehr in seine Haut.
Dann träumte ich von der Insel meiner Kindheit. Das Meer dort war anders als hier, ebenso der Strand. Der Sand war grobkörniger, die Wellen waren dunkler, von jenem tiefen Grün, wie es planktonreiches Wasser aufweist. Die Stadt zog sich flach hinter dem Ufer dahin, kleine Häuser mit hölzernen Veranden, die Giebel dem Meer zugewandt, einige große Hotels mit verglaster Front, viele Balkons, Baumreihen davor, eine Mühle auf einem Hügel, vom Wind zerzauste Ulmen.
Würde ich die Gassen jener Stadt betreten, würde mich eine Welle von Zeit erfassen und um Jahrzehnte zurückspülen. Angst befiel mich, ich könnte mir selbst begegnen, würde wieder jene kindliche Hoffnung in mir spüren, von der ich heute nur noch die Wunden oder die Narben fühle, die ich ihr zu verdanken habe. Ja, das wusste ich noch: Einst war mein Vertrauen in ein erfülltes Leben stark gewesen. Natürlich dachte ich damals nicht über die Zukunft nach, hatte weder Pläne, noch stellte ich Prognosen an. Als Kind ist man auf eine andere Weise nachdenklich als später als Erwachsener. Man wägt nicht ab, man analysiert nicht, jedoch ist man keineswegs jenes dumpfe, vegetative Wesen, als das man sich im Nachhinein vielleicht vorkommen mag. Im Gegenteil, man sieht, hört, riecht, schmeckt, empfindet viel empfindlicher, man denkt in Gerüchen, in Tasterlebnissen, als seien Gedanken und Begriffe sinnliche Phänomene, die sich zu ihrer Artikulation alle möglichen Erscheinungsformen der Natur suchen wie zum Beispiel Wind, Wellen, Wetter, Blumen, Steine, Vögel, Fische, Schmetterlinge. Alles ist Sprache, und alles ist zugleich stumm, alles ist Zeit, egal ob Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit, und alles ist zugleich Ewigkeit. Eine ziehende Wolke vermag in jenen glücklichen Tagen mehr Gedankenspiele auszulösen als später die Lektüre eines noch so klugen Buches. Die Seele eines Kindes ist durchtränkt von einer Magie, derer sich erwachsene Menschen eher schämen und die sie im dunkelsten Eck des Kellers ihrer Person verwahren wie Kartoffeln, weil deren wachsende, bleiche Augen etwas zu sehen in der Lage sind, was das normale Leben stört.
Jene Magie, von der ich rede, hängt mit Phantasie zusammen. Die Phantasie eines Kindes ist anders als die eines Erwachsenen. Sie gleicht einer Hülle, die das Kind wie eine dünne, unsichtbare Membran umgibt. Sie reagiert wie ein hochempfindliches Mikrophon oder ein lichtempfindlicher Film auf alles, was auf sie von außen einwirkt. Das Älterwerden ist der Prozess, in dem diese dünne Haut verhornt oder verkalkt, bis sie zum Schneckenhaus wird, in das sich das Ich schließlich aus Angst vor allzu großer Freiheit zurückzieht. Die Phantasie des Erwachsenen ist dann nichts anderes mehr als der Versuch, dieses Haus mit Bildern eines verloren gegangenen Lebens auszuschmücken.
All dies dachte ich im Schlaf, ohne eigentlich zu denken, so wie man in der Dunkelheit eines Traumes vieles klarer sieht als im Licht des Bewusstseins. Und plötzlich bemerkte ich sie: ein Mädchen mit bäurischen Zügen, schweren, blonden Zöpfen, einem runden Gesicht, üppigen Formen. Es lag ganz in meiner Nähe. Sand bedeckte seine Haut, als es sich auf den Rücken drehte. Dann stand es auf und ging sehr aufrecht mit langsamen, ausholenden Schritten eine hitzeflirrende, staubige Straße ins Land hinein. Die Sonne brannte, und die Zöpfe des Mädchens pendelten auf seinem sandbedeckten Rücken. Ein unglaubliches Sehnen packte mich, süß und schmerzend. Ich wollte ihr nach, aber es gelang mir nicht, mich vom Strand zu erheben. Halb in ihn eingegraben sah ich, wie die Erscheinung im Sommerglast verschwand, bald gänzlich verschluckt von Hitzeschlieren und Staub.
Heute weiß ich: Dies war meine erste Anwandlung körperlichen Begehrens gewesen. Ich war damals nicht älter als zehn Jahre. Manchmal frage ich mich, ob ich seitdem nicht in jeder Beziehung zu einer Frau vergeblich Anstalten mache, mich vom Strand zu erheben, auf dem ich damals bäuchlings lag, um jener bäurischen Göttin der Lust nachzugehen, die sich, so kommt es mir jedenfalls vor, ein einziges Mal nach mir umdrehte, ehe sie sich in Luft auflöste.
Und dann träumte ich wieder einmal von John Jakob Boysen, meinem Großonkel, der 1887 im Alter von siebzehn Jahren den Seemannstod starb. Meinen Vater beschäftigte das spurlose Verschwinden seines Onkels, solange ich mich erinnern kann. Oft erzählte er von John Jakob und spekulierte darüber, was geschehen wäre, wenn der Junge nicht auf See geblieben wäre. Mein Vater besaß ein Foto von ihm, eine Daguerreotypie. Sie zeigt einen zarten Jüngling mit breitem Schädel und schmalem Kinn unter einem ausdrucksvoll geschwungenen Mund mit vollen Lippen. Er hat blonde, glatte Haare und dunkle Augen. Ich glaube, er sieht mir ähnlich. Jedenfalls hat das mein Vater immer behauptet.
Ein heftiger Regenschauer weckte mich. Ich erhob mich und klopfte den Sand aus meinen Kleidern. Mich fror. Ich ging die Treppen hoch in den Ort hinauf. Als ich an einer Telefonzelle vorbeikam, spürte ich, wie so oft in letzter Zeit, das Bedürfnis, meinen Vater anzurufen. Dass er immer noch lebte, kam mir manchmal wie ein Wunder vor. Er war uralt und dennoch geistig völlig klar. Er hatte Krebs, die Ärzte hatten ihn schon vor zwanzig Jahren aufgegeben, doch er verstand es immer noch vortrefflich, seine Krankheit zur Schärfung seines Geistes zu nutzen wie eine Stütze, die ihm Halt gab.
Ich schob ein paar Münzen in den Automat und wählte seine Nummer. Es war wie immer: Nachdem es sehr lange geklingelt hatte, hörte ich, wie er abnahm. Zunächst war Stille. Seine Stille. Eine ungeheuer private, eigensinnige, mit niemandem sonst geteilte Stille, die er Tag für Tag und Nacht für Nacht produzierte wie einen Kokon, der ihn schützte. Doch dann war da plötzlich seine Stimme. Sie schlüpfte aus dem Kokon und stieß hart seinen Namen in die Telefonmuschel, so dass ich den Hörer weghielt.
Mein Vater hatte alle seine negativen Eigenschaften beibehalten, Starrsinn, Unsensibilität, bockige Eigenliebe, Insistieren auf konservativen Vorurteilen. Doch sie hatten sich inzwischen zu ihrem Vorteil verändert, hatten die Patina des hohen Alters und wirkten auf mich nicht mehr abschreckend. Eher machten sie mich sentimental, erzeugten bei mir hilflose Gefühle von Sohnesliebe.
»Aber«, wollte ich nach jedem seiner kurzen Sätze einwenden, doch weiter kam ich nie. Dieses ›Aber‹ verwandelte sich daher jedes Mal in eine ohnmächtige Pause, in der ich mir eingestehen musste, dass er auf Grund seines biblischen Alters wie Moses in allem Recht hatte, was er sagte, so, als handelte es sich bei seinen Äußerungen nicht um Argumente, sondern um steinerne Tafeln, die von der Hand eines ewig Lebenden beschriftet waren.
»Ich mache mir Sorgen um dich«, sagte er. Ich schwieg.
»Du lebst ungesund.«
»Aber...«, wollte ich sagen. Doch er fuhr schon fort: »Du isst zu fett, du hast Übergewicht.«
»Aber wie kannst du das denn am Telefon wahrnehmen... «
Auch diesen Einwand erstickte er, indem er sagte: »Disziplin war noch nie deine Stärke.«
Ich sagte schnell: »Ja, das kann schon sein.«
Diesmal war die Pause auf seiner Seite besonders lang, und die nächsten Worte, die er hervorstieß, kamen mir wie Gegenstände vor, die er nach mir warf. »Es geht mir nicht gut. Ich fürchte, ich werde langsam alt. Die Kraft lässt nach. Ich habe heute das Laub zusammengerecht und zehn Schubkarren in den Wald gefahren, dann war ich so erschöpft, dass ich ins Haus gegangen bin.«
4
Die Dinge kamen ein wenig in Bewegung, als ich den Flohmarkt der Stadt besuchte. Auf der sich unterhalb der Stadt entlangziehenden Uferstraße wird an Wochenenden unter Schirmen nutzloser Trödel verkauft, Berberware, Schmuck von zweifelhaftem Wert, afrikanische Masken, die wahrscheinlich in Asien produziert werden, Töpferware mit kleinen Fehlern, Amphoren, die durch allerlei Tricks, Schmutz, Asche und schwarze Farbe künstlich gealtert werden, so dass sie für den Laien aussehen, als habe man sie ausgegraben oder vom Grunde des Meeres geholt, während sie in Wahrheit aus dem Brennofen einer nahegelegenen Fabrik für Blumentöpfe kommen.
Ich schlenderte an den Ständen entlang und beobachtete die Leute, die wenigen Touristen, die es um diese Jahreszeit noch gab, die Händler, die versuchten, ihnen ihre Ware aufzudrängen. Mich selbst interessierte nichts. Ich hatte inzwischen fast eine Abneigung gegen jede Art von Antiquitäten, vielleicht bedingt durch das Bewusstsein, allmählich selbst in diese Kategorie zu gehören.
Halb verborgen zwischen bedruckten Stoffen, entdeckte ich auf einem der Tische eine Schreibmaschine, die mir vertraut vorkam. Das Äußere des dunkelhäutigen Verkäufers, seine grauen Locken, sein asketisch geschnittenes Gesicht, das selbst einer afrikanischen Maske glich, und zwar einer echten, flößte mir Vertrauen ein. Ich sah mir die Schreibmaschine näher an. Sie trug den Markennamen ›Erika‹ und war offenbar das gleiche Modell, das auch mein Vater besitzt. Ich fragte nach dem Preis. Er nannte eine viel zu hohe Summe. »Ist sie noch in Ordnung?«, fragte ich. »Ja, völlig«, sagte er und lachte wie jemand, der es genießt, die Unwahrheit zu sagen. Er ließ nicht mit sich handeln, und so kaufte ich das Gerät zu dem überhöhten Preis und schleppte es nach Hause.
Sie war keineswegs in Ordnung. Die Typen klemmten, der Wagen verhakte sich beim Transport. Ich machte mich an die Arbeit. Ugo, mein Hauswirt, lieh mir Werkzeug. Glücklicherweise bin ich geschickt in solchen Dingen, und so hatte ich die Maschine bald so weit, dass man mit ihr einigermaßen schreiben konnte. Ich betrachtete sie liebevoll, wie ein Fossil aus jener Zeit, in der ich den Beruf des Schriftstellers noch ausgeübt hatte, ohne dabei an Geld zu denken.
Mein Vater benutzte seine Erika in letzter Zeit fleißiger denn je. Er hatte vor Jahren damit begonnen, eine Familienchronik zu schreiben. Unter Familie verstand er allerdings nur die männliche Linie, also die, die den Namen von Generation zu Generation weitergibt. Zuweilen schickte er mir schlecht lesbare Durchschläge. Die ›o‹s ausgestochen, die ›e‹s verschmiert und etliche andere Buchstaben aus der Reihe tanzend.
Ich musste zugeben, dass er seinen Kampf gegen das Vergessen bravourös führte. Seine Texte waren zumeist trocken und nur an Fakten orientiert, so wie er es vom Führen eines Schiffstagebuchs gewöhnt war. Aber die Diktion dieser langen Sätze schwang dennoch volltönend und harmonisch wie der Klang einer Schiffsglocke im Nebel. Vielleicht wäre er ein besserer Schriftsteller geworden als ich, wenn sein Lebensweg anders verlaufen wäre. Joseph Conrad war sein Lieblingsschriftsteller, und das merkte man. Die Texte meines Vaters klangen, als stammten sie von einem Bruder des großen Autors, der Buchhalter geworden war. Zuweilen verließ er in letzter Zeit jedoch das lineare Nacherzählen der Familiengeschichte, brach aus dem Gefängnis der Jahreszahlen, Namen und Fakten aus und begann zu räsonieren. Reflexionen über das Leben, die Zeit, den Begriff des Schicksals. Naive Texte, doch in ihrer verblüffenden Klarheit und bohrenden Fragestellung wirkten sie wie inspiriert von einer kindlichen Neugier, um die ich ihn nur beneiden konnte.
Ich hatte die Erika gekauft, weil ich hoffte, besser mit meinem Romanprojekt zurechtzukommen, wenn ich nicht den Laptop, sondern die alte Schreibmaschine benutzte. Allein der mechanische Widerstand, den sie meinen Formulierungen entgegensetzte, mochte sich positiv auswirken auf mein Vorhaben. Ich spannte also ein Blatt Papier in die Maschine und prüfte noch einmal sämtliche Lettern und Zeichen. Dann schloss ich die Augen und versuchte, mich auf den Anfang des Romans zu konzentrieren, den ich schreiben sollte. ›Ein Piratenroman mit Tiefgang‹, wie es mein Verleger in seiner burschikosen Art formuliert hatte. Ich stellte mir eine weite Bucht vor, eine Sichel aus weißem Sand. Über ihr wölbte sich ein hoher, wolkenloser Himmel, dessen fahle Farbe wie eine dünne Lasur von Smalte auf die Schwärze des Weltalls aufgetragen schien. Das Meer glich einem dünnen Tuch aus japanischer Seide, das wie eine waagrechte Fahne in einem Wind flatterte, der in der Tiefe wehte. Weit draußen lag ein Schiff vor Anker, ein Dreimaster, eine Bark der Besegelung nach. Ich beobachtete, wie ein Boot zu Wasser gelassen wurde. In ihm saß ein einzelner Mensch. Man sah nur seinen Rücken, seinen Hinterkopf, denn er ruderte auf den Strand zu. Näher und näher kam das Boot, doch plötzlich schien es auf der Stelle zu verharren, ganz so, als sei es auf Grund gelaufen, obwohl jener Mensch immer noch aus Leibeskräften ruderte. Er wandte den Kopf, und ich sah, dass es ein Junge war. Er hatte blonde Haare, ein fliehendes Kinn und war von schmächtiger Gestalt.
Ich öffnete die Augen und versuchte, das innerlich Geschaute dem Blatt Papier anzuvertrauen. Vergeblich, denn es entstanden nur holprige Sätze, die das nicht wiedergaben, was ich gesehen hatte. Vielleicht musste ich mir mehr Zeit lassen, vielleicht erst den ständigen Konflikt zwischen Erinnern und Vergessen lösen, der mich seit Wochen so sehr lähmte. Ich nahm mir daher endgültig vor, in nächster Zeit den verwunschenen Park meiner Vergangenheit zu betreten. Vorsichtig und behutsam, ohne Pflanzen zu knicken, ohne Blumen zu zertreten. Wie sollte ich denn, sagte ich mir, ein Piratenleben aus einem längst vergangenen Jahrhundert erfinden können, wenn mir schon mein eigenes Leben verschlossen blieb wie ein Buch mit sieben Siegeln?
Ich begann meine Arbeit damit, eine Liste der Momente aufzustellen, die mir besonders eindringlich in Erinnerung geblieben waren. Der erste Hagel, der erste Regen, die Kiste mit Puderzucker, die zerquetschte Hornisse, der Mann im Radio, die Tage und Nächte in einem angeblich bombensicheren Keller und andere Impressionen aus der frühen Kindheit.
Ich starrte die Erika an. Ihre Schwärze animierte mich, die Augen zu schließen. Ich musste eingeschlafen sein. Denn als ich aufwachte, lag mein Kopf auf der Maschine. Ich erinnerte mich dunkel an einige Bilder, die ich geträumt hatte. *
Es regnet, rauscht und gluckst. Braunes Wasser bedeckt die Erde bis zum Horizont. Die Kreise auf dem Wasser wachsen und durchdringen sich unaufhörlich. Als das Kind den Blick nach oben richtet, sieht es die Wolken auf ihren prallen Bäuchen über einen bleifarbenen Himmel rutschen. Das Kind kriecht auf dem Teppich herum. Dann zieht es sich an den Beinen des kleinen Tischchens hoch und erblickt seltsame Dinge. Windmühlen, Wellen, das Meer, Segel, einen kleinen Jungen, der auf einem Hügel steht und aufs Meer hinaus deutet. Das Kind weiß nicht, dass es Delfter Kacheln sind. Es hat Angst, in die Bilder hineinzufallen, und beginnt zu weinen. Dann kommt ein Kinderwagen. Vor den Augen des Kindes sind bunte Kugeln auf Drähten. Über ihm ein Himmel, über den ständig neue Baumkronen ragen. Hin und wieder das Gesicht einer Frau mit blonden Haaren, zu einem Zopf geflochten und auf dem Kopf zusammengeringelt. Ihre Stimme spricht vom Himmel herab immer wieder Zahlen: »Eins, zwei, drei, vier.« Das Kind sagt: »Einszweivierdrei.« »Nein«, sagt die Stimme, es muss heißen: »Eins, zwei, drei, vier.« Das Kind sagt: »Einszweivierdrei.«
Weiße Hagelkörner prasseln auf ein Fenstersims und springen davon. Eine kleine Hand greift hinein in diesen Wirbel und fängt ein, zwei eisige Perlen. Als das Kind eine in den Mund steckt, schmeckt es den faden Schneegeschmack. Kalte Bälle liegen auf einem Schlitten aus Eisen mit einem roten Geländer. Das Kind nimmt einen Ball und leckt an ihm, dann wirft es ihn fort in den Schnee. Das Mädchen nimmt den Schneeball und gibt ihn dem Kind zurück. Der Schneeball ist größer geworden.
Im Sommer kommt ein Mann aus dem Krieg. Er trägt eine weiße Hose und ein Hemd aus Zucker. Er riecht nach Seife und hebt das Kind aus dem Kinderbett. Die Sonne brennt.
Sie sitzen zu dritt auf der Veranda im Schatten. Es ist warm. Aus einem glänzenden Kasten kommen gelb-braun gestreifte Scheiben Brot. Die Butter zerfließt auf ihnen, und der Honig bildet Muster.
Aus einem anderen Kasten kommt eine schöne Stimme. Die Eltern lächeln, und man hört die Maikäfer summen. Das Kind beobachtet eine Ameise, die im ausgelaufenen Honig zappelt. Dann ein Knacken im Radio und plötzlich eine andere Stimme: Quelle Siegfried Sieben, Quelle Siegfried Sieben. Eine verzerrte, hässliche Stimme, die diese Wörter immer wieder spricht. Die Mutter des Kindes springt auf und beginnt, den Tisch abzudecken. Der Mann blickt ernst und streicht seinem kleinen Sohn über die dünnen, weißblonden Haare. »Quelle Siegfried Sieben, das ist unser Planquadrat. Sie greifen wieder an. Bald wird es Fliegeralarm geben. «
Dann wird es dunkel, denn der Vater hat das Kind in den Keller getragen. Es liegt auf einer Matratze, klein und voller Angst; es ist kaum größer als sein Herz, das heftig schlägt. Die Mutter breitet eine Wolldecke über seinen Körper. Als die Bomben fallen, ist es, als ob jemand pfeift und dann mit beiden Füßen im Ohr des Kindes landet. Die Marmeladengläser im Regal zittern.
Die Bombentrichter im Garten sind voll gelbem Wasser. Froschlaich schwimmt darin. Auf dem Boden in der Nähe der Verandatür liegt ein großes, breitgequetschtes Monstrum. Dazu ein schriller Schrei. Die Mutter hat eine Hornisse zertreten. Später dann sieht das Kind die Mutter in einem anderen Garten in der Sommersonne stehen. Es ist ein sehr heißer Tag. Die Mutter bückt sich und richtet sich wieder auf. Wieder und wieder. Sie trägt ein buntes Kleid mit halblangen Ärmeln. Unter den Achseln haben sich große, dunkle Flecken gebildet. Manchmal ruft die Mutter das Kind zu sich und gibt ihm eine rote Erdbeere in den Mund. Die Frucht fühlt sich rau an, ehe sie süß wird, wenn das Kind sie mit der Zunge zerdrückt. Es riecht den Staub und den Schweiß. Beides riecht ähnlich. Am besten riecht es den Staub, wenn es hinter der Hecke steht und in den warmen Sand pinkelt. Das Kind ist nackt, und das warme gelbe Rinnsal fließt um seine Füße. Die Zehen bewegen sich, bis brauner Matsch zwischen ihnen hoch quillt.
5
Der Regen musste über Nacht gekommen sein. Ich erwachte vom glucksenden Geräusch des Regenrohres vor meinem Fenster. Dann hörte ich auch das Rauschen des Flusses. Ich ging hinaus vor die Tür. Die steile Flanke des Tales war hinter dichten Tropfenvorhängen verborgen. Der Fluss, gewöhnlich nicht mehr als ein Rinnsal, glich einer wütenden, gelben Schlange, die auf ihr Opfer zuschoss, um es zu verschlingen. »Warte nur, du Ungeheuer«, flüsterte ich. »Du wirst dich am Meer überfressen. Wenn du glaubst, es verschlingen zu können, wird es dich zum Platzen bringen.«
Ich folgte dem Weg hinüber zur Stadt. Er war voller Schlamm und Geröll. Der Fluss floss ein Stück unter der Stadt hindurch und trat zwischen Felsen wieder ans Tageslicht, kurz bevor er über den schmalen Strand ins Meer strömte. Dort wuschen gewöhnlich alte Frauen ihre Wäsche, rieben sie auf den Felsen mit Seife ein und spülten sie in dem Rinnsal aus Süßwasser aus. Jetzt aber schoss ein Katarakt über den Strand, riss den Sand mit, grub einen tiefen Canyon hinein und stürzte sich in die von Regen gesprenkelten Wogen. Das Meer verfärbte sich lehmig an dieser Stelle. Wie gelbes Blut, das aus den Flanken der Wellen brach.
Ich ging zum Hafen. Ein sehr alter Mann saß im strömenden Regen auf dem Dollbord seines Bootes und flickte ein Netz. Eine Weile sah ich ihm schweigend bei der Arbeit zu. Er schien mich nicht zu beachten, doch ich täuschte mich. Mit einer ausholenden Geste seiner Hand lud er mich ein, an Bord zu kommen. Eine Weile saß ich schweigend neben ihm und sah ihm bei der Arbeit zu. Dass ich inzwischen genauso nass war wie er, störte mich nicht. Seine Finger waren außerordentlich geschickt. Sie wirkten wie Lebewesen, die zwar selbständig waren, jedoch mit großer Aufmerksamkeit aufeinander reagierten. Plötzlich brach er sein Schweigen. »Sie sind fremd hier«, sagte er und nickte dabei, als sei er mit dieser Tatsache einverstanden. »Aber Sie zeigen Interesse.«