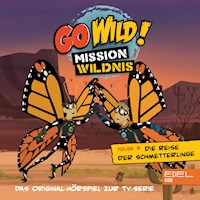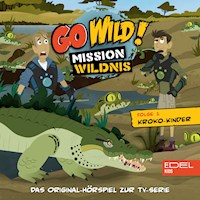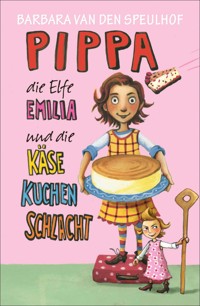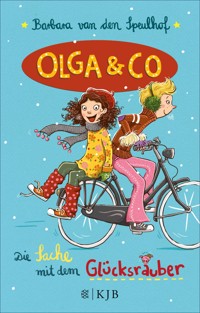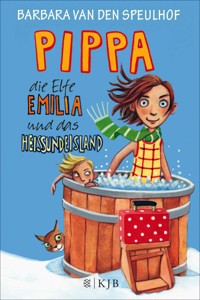5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pippa
- Sprache: Deutsch
Elfenmut tut gut! Als die schüchterne Pippa die Puppe Emilia geschenkt bekommt, ahnt sie natürlich nicht, dass diese ihr Leben gehörig auf den Kopf stellen wird. Denn Emilia ist eine Elfe mit Mut für drei, und sie gibt Pippa davon jede Menge ab. Und Mut hat Pippa auch bitter nötig: Denn um die Katze Zimtundzucker zu retten, müssen die beiden gemeinsam durch die dunkle Nacht … Barbara van den Speulhof erzählt in einem tollen frischen Ton eine spannende, humorvolle Geschichte, die ganz nebenbei Kinder ermutigt, sich mehr zuzutrauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara van den Speulhof
Pippa, die Elfe Emilia und die Katze Zimtundzucker
FISCHER E-Books
Inhalt
Geschichten müssen erzählt werden. Sonst sind es keine.
Oma Dotti, 81 Jahre
Geschichten sind wie Primeln. Du musst sie gießen, damit sie nicht eingehen und vertrocknen.
Emilia, 741 Jahre
Geschichten mag ich. Am liebsten, wenn sie mir selbst passieren.
Pippa, 9 Jahre
Eins
Der Überfall der Grasmückenkomantschen
»Nein! Ich will das nicht! Bindet mich los!«, brüllte ich so laut, dass die Blätter des Baums, an den ich gefesselt war, erzitterten.
Von meinen Entführern keine Spur. Nichts regte sich in der grünen Hölle, in die sie mich verschleppt hatten. Bevor sie verschwunden waren, hatten sie von Lösegeld gesprochen. Erpressung also. Aber sie hatten kein Wort über die Bedingungen meiner Freilassung verloren. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Ich fühlte mich einsam und verlassen. In diesem Moment wünschte ich mir nichts sehnlicher, als jemand an meiner Seite zu haben. Jemand, der das alles mit mir zusammen durchstehen würde. Eine Freundin. Eine beste Freundin. Von mir aus auch nur eine klitzekleine. Nur Angst dürfte sie keine haben. Nicht so wie ich jetzt.
Die Mittagssonne brannte heiß auf meinen Kopf. Meine Nase juckte, und die Wespe, die sich gerade auf meine Schulter gesetzt hatte, konnte ich nicht vertreiben. Denn ich war gefesselt. Ich war eine Gefangene des Stamms der Grasmückenkomantschen. Einer Indianerhorde, die in der Nähe eines einsamen Waldsees ihre Zelte aufgeschlagen hatte.
Aus der Ferne konnte ich hören, wie ein Kanu zu Wasser gelassen wurde. Waren das meine Entführer? Wollten sie abhauen? Mich alleine hier verhungern und verdursten lassen? Oder würden mich Ameisen auffressen, nachdem mir Krähen die Augen ausgehackt hatten?
Ich hörte die Paddel ins Wasser platschen und bekam mit, wie der Anführer der Grasmückenkomantschen den Befehl gab loszurudern. »Und eins und zwei. Und eins und zwei. Und eins und zwei …«
Die Geräusche der Rudernden und die Stimme des Komantschenhäuptlings wurden immer leiser, bis nur noch das Zwitschern der Vögel in den Baumkronen um mich herum zu hören war.
Ich hoffte, dass ich mir vor Angst nicht in die Hosen machen würde. In meiner aussichtslosen Lage ging mir das Gesinge der Piepmätze langsam, aber sicher auf die Nerven. Es klang viel zu fröhlich. Es passte nicht zu einer Entführung. Eigentlich hätten Geier um mich kreisen und mich mit durchdringendem Blick anschauen müssen. Aber Spatzen, Amseln und Finken?
Mit der Zunge rollte ich den rosaroten Kaugummi in meinem Mund zu einer runden Kugel und wartete, bis sich ein kleiner Spucketeich gebildet hatte, in dem der Kaugummi schwimmen konnte. Dann peilte ich den kleinen Spatz an, der vor mir auf dem Boden saß und mich mit schief gelegtem Kopf neugierig anschaute. Mit aller Kraft spuckte ich jetzt das ordentlich eingespeichelte Gummigeschoss auf den Spatz, der erschreckt hochflog, bevor ich ihn hatte treffen können.
»Hol Hilfe!«, rief ich ihm verzweifelt hinterher.
Das hatte ich mal in einem Buch gelesen, und da hatte es funktioniert. In Büchern funktionieren solche Sachen immer. Da können Tiere reden und Menschenleben retten und all so was.
Hier stand ich, gefesselt, und wusste nicht, wie ich etwas ändern konnte.
In Büchern ist das einfacher. Wenn es zu gruselig wird, kann man weiterblättern und dort weiterlesen, wo es wieder ruhiger ist. Natürlich macht man das nicht, weil Gruseliges ja schön ist, aber man kann weiterblättern. Und das »Können« ist das Wichtige dabei.
Aber das half jetzt nichts. Denn der Spatz holte natürlich keine Hilfe, und reden konnte er, wie man sich denken kann, auch nicht.
»Du Dämlack!«, rief ich in die Richtung, in die er geflogen war. Dämlack war ein Wort, das ich erst vor ein paar Tagen gelernt hatte. Ich hatte es bisher nur gelesen, noch nie ausgesprochen. Es war sozusagen ein ganz frisches Wort. Laut gerufen hörte es sich sehr schön an, und ich nahm mir vor, es in Zukunft häufiger zu benutzen. Zum Beispiel, wenn ich einen meiner drei Brüder beschimpfen wollte. Natürlich nur, wenn ich jemals in meinem Leben noch einmal Gelegenheit haben sollte, meine Brüder wiederzusehen.
Ich schaute in den Himmel. Obwohl ich das Gefühl hatte, hier seit Stunden gefangen zu sein, hatte sich die Sonne nur ein kleines bisschen weiterbewegt. Während ich noch überlegte, ob meine rothäutigen Entführer noch vor Einbruch der Dämmerung zurückkehren würden oder mich dem schrecklichen Dunkel der Nacht überlassen wollten, hörte ich ein Rascheln im Gebüsch. Dann das Knacksen trockener Zweige. Dann ein Krächzen, dem ein Husten folgte. Keine Frage: Das waren die Grasmückenkomantschen! Ich wollte tapfer sein, auch wenn es mir schwer fiel, und auf keinen Fall heulen, wenn sie kamen. Todesmutig schaute ich in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Ich war auf alles gefasst.
Da tauchte schon der erste Rotschopf auf, dann der zweite. Der Anführer – er war der Größte und Stärkste – schälte sich als Letzter aus dem Dickicht.
Mit finsteren Mienen kamen sie auf mich zu. Entschlossen und zu allem bereit. Was hatten sie vor? Ich schluckte. Nein, ich wollte nicht heulen. Auf keinen Fall.
»Bläh! Igitt wie eklig«, rief plötzlich einer der beiden rothaarigen Indianer. Erschrocken hob er den Fuß und schaute auf seine nackte Fußsohle.
»Was ist, Rotkopf? Hat dich der schwarze Killerkäfer gebissen?«, fragte der Anführer mit donnernder Stimme. »Oder warum kreischst du herum wie ein Mädchen?«
Wortlos hielt der Rotkopf dem Anführer seinen Fuß hin, der daraufhin verächtlich grinsend die Mundwinkel verzog: »Macht sich gut. So ein ausgelabberter, rosaroter Kaugummi auf deiner dreckigen, schwarzen Fußsohle.«
Er drehte sich zu mir um und schaute mich mit stahlhartem Blick an. Dann setzte er sich in Zeitlupentempo in Bewegung und steuerte auf mich zu. Ohne mich aus den Augen zu lassen, zog er dabei langsam ein Messer aus der Tasche. Dicht vor mir blieb er stehen. Seine Fußspitzen berührten meine. Sein Gesicht kam dem meinen so nah, dass ich seinen heißen, wütenden Atem auf meinen Wangen spüren konnte. Ängstlich hielt ich seinem Blick stand.
»Das wirst du büßen, du bleichgesichtige Tochter einer farbenmischenden, pinselschwingenden Hexerin und eines buchstabenverdrehenden, zweiradgesteuerten Zauberers!«, zischte er mit fiesem Grinsen. Er war mir so nah, dass ich roch, dass er seine Zähne nicht geputzt hatte. Aber meine Lage war zu ernst, um ihm das ins Gesicht zu sagen.
»Wir werden sie skalpieren. Wollen wir?«, fragte er die beiden Rotschopfigen, die einander glichen wie ein Ei dem anderen.
»Es genügt, wenn wir ihr eine Locke abschneiden«, antwortete der, dem kein Kaugummi am Fuß klebte.
»Nee, zwei wären besser«, fügte der mit Kaugummi am Fuß hinzu und versuchte dann, einen Schritt in meine Richtung zu gehen. Lange rosa Fäden zogen sich zwischen Boden und Fußsohle.
»Guuhuut«, murmelte der Häuptling mit funkelnden Augen und ließ die Messerklinge in der Sonne blitzen. Mit hypnotisierendem Blick fixierte er mich und packte eine meiner dunkelbraunen Locken. »Das wird dir ein Denkzettel sein.« Er begann, den untersten Zipfel meiner Haarsträhne abzusäbeln.
»Spaghetti!«, schallte es plötzlich durch das Dickicht der grünen Hölle. »Käsesoße al Fredo!«, rief eine zweite Stimme hinterher.
Zwei
Wir lagen vor Madagaskar
»Wir kommen!«, rief der Häuptling eilig, der im wirklich wahren Leben Paul heißt und mein großer Bruder ist.
Er ist zwölf Jahre alt, fast dreizehn sogar. Mama sagt, er sei jetzt in der Pubertät.
Pubertät ist übrigens kein fremdes Land, wie ich früher mal vermutet hatte. Mama meint, das wäre die Zeit, in der man entweder komisch wird oder Erwachsene für komisch hält. Oder beides gleichzeitig. Als sie mir das zum ersten Mal erklärte, war ich nicht sicher, ob sie das Wort richtig ausgesprochen hatte. Pickeltät wäre das bessere Wort, fand ich. Denn Pauls Gesicht war übersät von Pickeln und ist es immer noch. Die hat er vorher nicht gehabt. Es muss etwas mit der komischen Zeit zu tun haben.
»Bindet sie los«, befahl Pickel-Paul den beiden Rotschöpfen. Sie gehorchten.
»Das mit dem Kaugummi wirst du trotzdem büßen«, zischte Julius, der eigentlich mein älterer kleiner Bruder war und gleichzeitig der Zwillingsbruder von Jannik, der mit dem Kaugummi.
Beide sind elf Jahre alt, Julius aber 29 Minuten älter, weil er sich als Erster getraut hat, aus Mamas Bauch rauszukommen.
»Erst essen wir Spaghetti, dann nagst du mir zum Nachtisch den Kaugummi vom Fuß«, blökte Jannik.
»Und wovon träumst du nachts?«, blökte ich zurück und fand mich dabei ungeheuerlich gut.
Diesen Spruch hatte ich erst vor ein paar Tagen auf dem Campingplatz, auf dem wir gerade Ferien machten, gehört und gleich benutzt. Wenn man Worte nicht benutzt, werden sie schimmelig oder welk, sagt mein Papa.
Als wir uns durch das Unterholz gekämpft hatten, hatte sich die Sache mit dem Kaugummi von selbst erledigt. Jannik hatte ihn unabsichtlich verloren, obwohl es ihm lieber gewesen wäre, ich hätte ihm den Fuß abgelutscht. Aber das konnte er jetzt knicken. Abhaken. Vergessen. Es war sowieso nicht mehr wichtig, denn die Schüssel mit den dampfenden Spaghetti stand schon auf der Picknickdecke, Papa brachte gerade die Käsesoße, und wir hatten Riesenhunger.
Mein Vater heißt Fredo, genau wie die Soße, die er erfunden hat. Eigentlich heißt er Alfred, aber erstens mag er diesen Namen nicht, und zweitens wird bei uns keiner so gerufen, wie er bei seiner Geburt genannt wurde und wie es in Zeugnissen oder anderen bedeutsamen Papieren steht, die man ein Leben lang aufheben muss.
Mein großer Bruder Paul wird meist Pillepalle genannt. Pickel-Paul sage ich nur, wenn er es nicht hört.
Meine rothaarigen Zwillingsbrüder Jannik und Julius rufe ich Pech und Schwefel, weil sie immer zusammenhalten. Egal, was passiert. Manchmal nenne ich sie auch die Jottjotts, weil sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Und da genügt ein Name völlig, finde ich.
Der Name meiner Mutter ist Elisabeth. Meine Brüder und ich sagen Mama zu ihr. Sie selbst nennt sich Lissy oder »Die Chefin«. Sie ist das Oberhaupt der Familie. Auch so eine Art Häuptling also.
Ich bin übrigens Pippa und neun Jahre alt. Neun ist eine schöne Zahl, aber zehn ist noch schöner. Deshalb habe ich mir vorgenommen, möglichst bald zehn zu werden.
Ich hoffe, dass ich später einen Trick finden werde, um nicht in die Pickeltät zu kommen. Besser wäre, ich könnte einfach nur komisch werden. Das würde ich dann Pippatät nennen und würde damit über Nacht zur Erfinderin eines neuen Wortes werden. Alle würden es benutzen, und es würde nie schimmelig oder welk werden.
Aber noch ist es nicht so weit.
Pech und Schwefel schaufelten sich jetzt so viel Nudeln auf die Teller, als hätten sie hundert Jahre nichts mehr zu essen gekriegt.
Sie behaupteten, dass Entführungen irre hungrig machten und dass sie heute außerdem gleich ein paar Zentimeter wachsen wollten.
In jedem unserer Campingurlaube futtern sie doppelt so viel wie zu Hause. Ob es daran liegt, dass wir dann zum Essen auf der Picknickdecke hocken oder ob es wegen der vielen frischen Luft ist, wusste keiner.
Was wir aber wussten, war, dass wir morgen nach Hause fahren würden. Der Urlaub war fast vorbei, das war schade. Denn ich hatte während der Zeit auf dem Campingplatz mindestens zehn neue Berufe gelernt. Zum Beispiel Laubhüttenarchitektin, Schatzfinderin, Waldseetaucherin, Spurensucherin oder Fernsehköchin. Dass ich auch ›Opfer bei einer Entführung sein‹ gelernt hatte, war nicht freiwillig passiert.
Was ich allerdings vor dem Urlaub schon konnte, war Angst haben. Vermutlich bin ich eine der größten Angsthaberinnen der Welt. Ich habe Angst vor Mäusen, Ratten und Spinnen und anderen zwei- bis achtbeinigen Monstern. Ich habe Angst in dunklen Kellern und Angst, aus großer Höhe runterzuschauen. Ich weiß, wie sich schleichende Angst anfühlt und plötzliche Angst. Wenn einer eine Schule erfinden würde, wo man das Angsthaben lernen könnte, würde ich Direktorin werden. Ganz bestimmt.
Zum Glück habe ich auch gelernt, so zu tun, als hätte ich gar keine Angst. Wenn man drei Brüder hat, ist es sehr wichtig, das zu können.
Nach dem Urlaub hatten wir noch drei Wochen schulfrei. Darüber sprachen wir beim Abendessen.
»Damit du deinen Brüdern während der restlichen Ferien nicht vollständig ausgeliefert bist, kannst du nächste Woche mit mir ins Altersheim kommen.« Mama lächelte und schenkte mir Apfelsaft nach. »Ich gebe einen Intensivkurs. Freies Malen. Montag bis Freitag. Von neun bis zwölf Uhr. Was hältst du davon, Pippa?«
Mama ist Malerin von Beruf. Deshalb hatte sie Häuptling Pillepalle auch farbenmischende, pinselschwingende Hexerin genannt.
Ich mag es, wie sie mit Farben herumpanscht und große Leinwände bunt anmalt. Man kann zwar nichts Genaues darauf erkennen, also Bäume oder Häuser oder eine Sonne oder so. Trotzdem gefallen mir ihre Bilder. Es heißt abstrakt, wenn man nichts erkennen kann.
Das Wort sollte man sich unbedingt merken. Man kann es gut gebrauchen, wenn man etwas erklären will, das man selbst nicht versteht.
Mama sagt, dass das Wichtige an der Kunst nicht das sei, was auf dem Bild drauf ist, sondern das, was das Bild mit einem macht. Mich machen ihre Bilder fröhlich. Das mag ich. Also mag ich auch Kunst.
Und ich wollte mitkommen ins Altersheim.
Meine Brüder waren sauer, weil ich als Opfer für ihre Spiele in der nächsten Woche ausfallen würde, aber das war mir egal. Sollten sie doch mal sehen, wie es war, den Helden zu spielen, ohne ein Opfer zu haben. Ganz schön schwierig.
Am nächsten Morgen packten wir unsere Sachen. Das dauerte ungefähr fünf Stunden, weil wir aus fast allem die Luft rauslassen mussten. Aus den Zelten, den Luftmatratzen, dem Gummiboot, dem Aufblasdelphin und so weiter. Danach war auch bei uns die Luft raus. Papa belegte noch ein paar Brote mit Löcherkäse und Tomatenscheiben und schnippelte Apfelhäppchen für unsere Heimreise. Als wir endlich in unserem Campingbus saßen, wünschten wir alle, wir wären schon zu Hause. So erschöpft waren wir.
Mama fuhr los. Zum Abschied winkten wir noch dem Campingmann zu, der neben der Schranke in einer Hütte saß, nicht größer als ein Dixi-Klo.
»Mama, ich muss mal!«, rief ein Jottjott.
»Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt alle vorher noch mal zur Toilette gehen!«, rief Mama mit einer Stimme, die so genervt klang, als hätten wir einen ganzen Tag auf der Autobahn im Stau gestanden.
»Aber ich hab’s vergessen. Und ich bin gar nicht dazu gekommen. Weil ich doch die ganze eingesperrte Luft aus unseren Sachen befreien musste«, verteidigte sich der Jottjott.
»Nie um eine gute Ausrede verlegen«, grinste Papa und kraulte sich amüsiert am Kinn. »Das gefällt mir.«
Mama war weniger amüsiert und grummelte nur etwas von Äpfeln, die nicht weit vom Stamm fallen. Keine Ahnung, was sie damit meinte.
Pech und Schwefel gingen pinkeln, und dann ging es endlich los. Papa fing an, Lieder aus seiner Kindheit zu singen. Er war der Überzeugung, das würde uns gefallen und uns die Zeit vertreiben. Um ihm einen Gefallen zu tun, sangen wir mit. Nachdem wir fünfzehnmal »Wir lagen vor Madagaskar« und elfmal »Von den blauen Bergen kommen wir« geträllert hatten, reichte es uns.
Papa sollte sich selbst beschäftigen, fanden wir und stellten die Singerei ein. Schließlich hatten wir keine Langeweile, sondern er.
Drei
Das Gespenst auf zwei Rädern
Weil wir nach langer Fahrt und Pausen an zwei Autobahnraststätten erst spät nachts nach Hause kamen, ließen wir unser Gepäck im Campingbus und nahmen nur unsere Zahnbürsten mit hinein.
Mama und ich wollten am nächsten Morgen nach dem Frühstück gleich ins Altersheim zu unserem Malkurs fahren. Papa und die Jungs mussten dann allein das Gepäck entladen, die Wäsche waschen und alles aufräumen. Das war eine clevere Idee von Mama und mir.
Nach dem Zähneputzen und einem Kurzwaschgang einmal quer über das Gesicht sangen wir noch für Papa das Lied »Der Mond ist aufgegangen«. Danach fielen wir alle todmüde in unsere Betten.
Unser Zuhause besteht aus drei Häusern. Aus einem Haupthaus, das uns allen gehört und in dem Mama und Papa schlafen. Dort sind auch Küche, Wohnzimmer, ein großes Badezimmer und das Arbeitszimmer von Papa. Daneben steht das Kinderhaus mit einem großen Spielzimmer und einer Abstellkammer im Erdgeschoss und drei Kinderzimmern und einem Bad im ersten Stock.
Wenn man die beiden Häuser vom Himmel aus anschauen könnte, würde man sehen, dass sie zusammen wie der Buchstabe L aussehen. Der große, lange Strich ist das Mama-Papa-Haus, und der kleine Strich ist das Kinderhaus.
Mama gehört auch der Pavillon im Garten. Dort kann sie in Ruhe ihre Bilder malen.