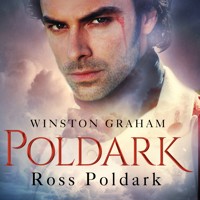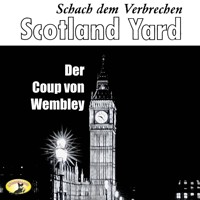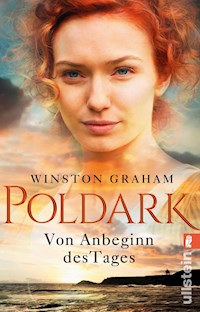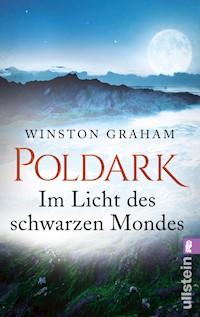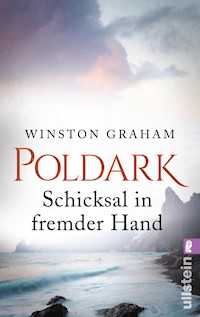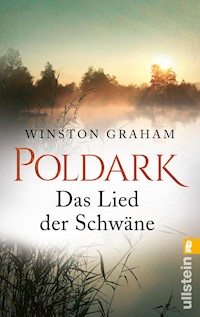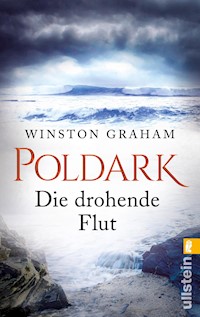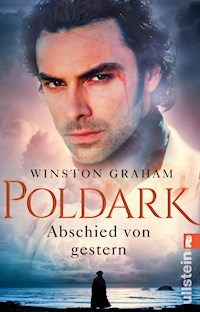
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Cornwall 1783-1787 Der Krieg in Nordamerika ist vorbei, doch als Ross Poldark in seine Heimat zurückkehrt, ist nichts, wie es war. Er hat alles verloren: Sein Vater ist tot, sein Besitz heruntergekommen und Elizabeth, die er heiraten wollte, ist mit seinem Cousin Francis verlobt. All seine Bemühungen, Elizabeth doch noch umzustimmen, sind vergeblich. Er verliert jegliches Interesse am Leben. Und dann begegnet er einem Mädchen mit dem Namen Demelza. Sie ist arm und nicht aus seiner Welt. Seine Familie ist entsetzt, doch sie wird sein Leben für immer verändern ... »Vom unvergleichlichen Winston Graham …, der all das hat, was die anderen haben, und dann noch eine ganze Menge mehr« The Guardian Der erste Roman der großen Poldark-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
Das Buch
Cornwall, 1783 bis 1787: Müde kehrt Ross Poldark aus dem Krieg in Amerika heim. Doch anstelle eines fröhlichen Wiedersehens erwartet ihn ein Schock: Sein Vater ist tot, sein Besitz ist heruntergekommen, und Elizabeth, die er liebt, ist mit seinem Cousin Francis verlobt. Obwohl Ross sich bemüht, sie umzustimmen, zieht sie die Sicherheit, die sie an Francis’ Seite zu finden glaubt, einem Leben mit dem grüblerischen, unberechenbaren Ross vor. Während ihre Hochzeitsglocken läuten, verliert Ross jegliches Interesse an seiner Umwelt, dem Haus, seinem Land, sogar an sich selbst. Doch sein Mitleid mit den mittellosen Minenarbeitern und Farmern seines Bezirks lässt ihn eines Tages der halbverhungerten Demelza zu Hilfe kommen. Er nimmt sie bei sich auf – eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern wird.
Der Autor
Winston Mawdsley Graham, geboren 1908 in Manchester, gestorben 2003 in London, hat über vierzig Romane geschrieben, darunter auch Marnie, der 1964 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Er war Mitglied der Royal Society of Literature sowie des Order of the British Empire und lebte in London und Cornwall.
Die Poldark-Serie von Winston Graham ist in unserem Hause in chronologischer Reihenfolge erschienen:
Poldark – Abschied von gesternPoldark – Von Anbeginn des TagesPoldark – Schatten auf dem WegPoldark – Schicksal in fremder HandPoldark – Im dunklen Licht des MondesPoldark – Das Lied der SchwänePoldark – Vor dem Steigen der Flut
Winston Graham
Poldark
Abschied von gestern
Roman
Aus dem Englischenvon Gisela Stege
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1235-4
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© Winston Graham 1945Titel der englischen Originalausgabe: Ross Poldark (Pan Books, Pan Macmillan, London 2015; first published in 1945 by Werner Laurie Ltd.)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München (nach einer Vorlage von Pan Books, Pan Macmillan)Titelabbildung: Aidan Turner: Photography Robert Viglasky© Mammoth Screen Limited 2014
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Prolog
Joshua Poldark starb im März 1783. Als er im Februar dieses Jahres spürte, dass sein Leben nicht mehr von langer Dauer sein würde, sandte er nach seinem Bruder in Trenwith.
Charles kam an einem kalten grauen Nachmittag auf seinem mächtigen Rotschimmel herübergaloppiert, und Prudie Paynter, mit ihrem schütteren Haar, dunkelgesichtig und fett, führte ihn direkt ins Schlafzimmer, wo Joshua mit Kissen und Polstern aufgestützt in dem großen Schrankbett lag. Charles sah sich mit einem misstrauischen Seitenblick seiner kleinen, wässrigen blauen Augen in dem Raum um, betrachtete die Unordnung und den Schmutz, hob dann seine Rockschöße und ließ sich in einem Korbstuhl nieder, der unter seinem Gewicht ächzte.
»Nun, Joshua.«
»Nun, Charles.«
»Das ist eine üble Sache.«
»Du hast ganz recht.«
»Was glaubst du, wann du wieder auf den Beinen sein wirst?«
»Das weiß kein Mensch. Ich glaube, der Totengräber hat es auf mich abgesehen.«
Charles schob seine Unterlippe vor.
»Unsinn, alter Junge. An Gicht in den Beinen ist noch niemand gestorben. Erst wenn sie in den Kopf emporsteigt, wird es gefährlich.«
»Choake ist nicht deiner Meinung, er sagt nämlich, dass es einen ganz anderen Grund für das Anschwellen gibt. Zum ersten Mal frage ich mich, ob der alte Narr nicht recht hat. Obwohl eigentlich nach Gottes Ratschluss du an meiner Stelle hier liegen solltest, da ich ja nur die Hälfte deines Umfanges habe.«
Charles blickte auf die Landschaft der schwarzbestickten Weste hinunter, die sich unter seinem Kinn hervorwölbte.
»Das ist gesundes Fleisch. Ein Mann nimmt in seinen mittleren Jahren zu. Ich möchte kein Yard Brunnenwasser sein wie Vetter William-Alfred.«
Joshua zog ironisch eine Augenbraue hoch, sagte aber nichts mehr, und es herrschte Schweigen. Die Brüder hatten einander viele Jahre lang wenig zu sagen gehabt, und bei diesem ihrem letzten Zusammensein ließ sich schwer alltäglicher Gesprächsstoff finden. Charles, der ältere und wohlhabendere, an den Familiensitz und Landbesitz und dazu die meisten Grubeninteressen gefallen waren, Familienoberhaupt und eine geachtete Erscheinung in der Grafschaft, war niemals imstande gewesen, den Verdacht völlig loszuwerden, dass sein jüngerer Bruder ihn verachtete. Joshua war ihm immer ein Dorn im Fleisch gewesen. Joshua hatte sich niemals damit zufriedengegeben, das zu tun, was man von ihm erwartete: in die kirchliche oder die Armeelaufbahn einzutreten oder Grundbesitz zu heiraten und Charles den Distrikt selbst verwalten zu lassen.
Nicht, dass Charles ihm ein paar Fehler nachgetragen hätte, doch es gab Grenzen, und Joshua hatte sie überschritten. Die Tatsache, dass er sich in den letzten paar Jahren untadelig aufgeführt hatte, machte alten Kummer mit ihm nicht wieder gut.
Was Joshua anging, einen Mann mit zynischem Geist und wenig Illusionen, so hatte er keine Klage über das Leben oder seinen Bruder. Er hatte das eine bis zur Grenze ausgekostet und den anderen nicht beachtet. Es lag eine gewisse Wahrheit in seiner Antwort auf Charles’ nächste Bemerkung: »Also, alter Junge, du bist noch jung genug. Zwei Jahre jünger als ich, und ich bin in Form und fühle mich wohl. Harrumpf!« Joshua sagte nämlich: »Zwei Jahre an Lebenszeit, vielleicht, aber du hast nur halb so rasch gelebt.«
Charles saugte am Ebenholzknauf seines Spazierstockes und ließ seine Augen unter schweren Lidern den Raum seitlich überfliegen. »Dieser verdammte Krieg ist noch nicht beigelegt. Die Preise steigen ins Uferlose. Der Weizen sieben und acht Shilling das Scheffel. Das Pfund Butter neun Pence. Nun ja, das tut uns nicht weh. Ich wünschte nur, das Kupfer hätte seinen Preis gehalten. Wir wollen in der Grambler-Grube einen neuen Horizont anschneiden. Achtzig Klafter tief. Vielleicht wird das die Anfangskosten hereinbringen, obwohl ich daran zweifle. Hast du in diesem Jahr viel mit deinen Feldern angefangen?«
»Ich wollte dich wegen des Krieges sprechen«, sagte Joshua, während er sich ein wenig die Kissen emporplagte und nach Atem rang. »Es kann jetzt nur noch eine Sache von Monaten sein, bevor der Vorfriede bestätigt wird. Dann wird Ross nach Hause kommen, und ich werde nicht mehr da sein, um ihn zu empfangen. Du bist mein Bruder, obwohl wir nie so besonders miteinander ausgekommen sind. Ich möchte dir sagen, wie die Dinge stehen, und es dir ans Herz legen, dich um alles zu kümmern, bis er zurückkommt.«
Charles entfernte den Spazierstock von seinem Mund und lächelte abwehrend.
»Du weißt, ich habe nicht viel Zeit.«
»Es wird dich nicht viel Zeit kosten. Ich kann wenig bis nichts hinterlassen. Eine Abschrift meines Testaments liegt da auf dem Tisch neben dir. Lies sie in Ruhe durch. Pearce hat das Original.«
Charles griff mit seiner plumpen, fleckigen Hand danach und nahm von dem rachitischen dreibeinigen Tisch hinter sich ein Stück Pergament.
»Wann hast du zum letzten Mal von ihm gehört?«, fragte er. »Was soll geschehen, wenn er nicht zurückkommt?«
»Das Gut bekommt Verity. Verkaufe es, wenn sich irgendein Käufer findet, es wird wenig bringen. Das steht im Testament. Verity bekommt auch meinen Anteil an Grambler, nachdem sie die Einzige von deiner Familie ist, die hier drüben gewesen ist, seit Ross wegging.« Joshua putzte sich die Nase in dem schmutzigen Bettlaken. »Doch Ross wird zurückkommen. Ich habe seit der Einstellung der Kämpfe von ihm Nachricht erhalten.«
Charles starrte wieder in das gelbliche, zerfurchte Gesicht, das einmal so hübsch gewesen war. Er war ein wenig erleichtert, dass Joshua nicht mehr von ihm gewollt hatte, gab aber eine gewisse Vorsicht noch nicht auf. Und Mangel an Ehrfurcht auf einem Totenbett erschien ihm ruchlos und fehl am Platze.
»Vetter William-Alfred besuchte mich neulich. Er erkundigte sich nach dir.«
Joshua zog ein Gesicht.
»Ich sagte ihm, wie krank du bist«, fuhr Charles fort. »Er meinte, obwohl du vielleicht nicht den Reverend Mr Odgers zugezogen haben möchtest, würdest du vielleicht gern geistlichen Zuspruch von einem Mitglied deiner eigenen Familie empfangen.«
»Damit meint er natürlich sich selbst.«
»Nun, er ist der einzige Geistliche von uns, seit dem Dahinscheiden von Bettys Mann.«
»Ich will keinen von ihnen«, sagte Joshua. »Obwohl es zweifellos gut gemeint war. Doch wenn er glaubt, es würde mir guttun, meine Sünden zu beichten – ist er der Meinung, ich würde Geheimnisse eher einem Blutsverwandten preisgeben? Nein, ich würde lieber Odgers etwas anvertrauen, wenn er auch nur ein halbverhungerter kleiner Hornhautteufel ist. Ich will aber keinen von ihnen dahaben.«
»Solltest du deine Meinung ändern«, sagte Charles, »dann schicke Jud mit einer Nachricht hinüber. Wharrf!«
Joshua grunzte. »Ich werde es bald genug wissen. Aber selbst wenn etwas an ihrem ganzen Pomp und ihren Litaneien dran sein sollte, sollte ich sie dann in dieser Stunde holen lassen? Ich habe mein Leben gelebt, und bei Gott, ich habe es genossen! Jetzt herumzuschnüffeln brächte nichts ein. Ich tue mir nicht leid, und ich will auch nicht jemand anderem leidtun. Was kommt, werde ich akzeptieren. Und das ist alles.«
Es herrschte Stille im Zimmer. Draußen zerrte der Wind an Schiefer und Stein.
»Für mich ist es Zeit zu gehen«, meinte Charles. »Diese Paynters lassen dein Haus auf seltene Art und Weise verkommen. Warum besorgst du dir nicht jemand Verlässlichen?«
»Ich bin zu alt, um mir neue Esel zu besorgen. Überlass das Ross. Er wird die Sache bald in Ordnung bringen.«
Charles rülpste ungläubig. Er hatte keine hohe Meinung von Ross’ Fähigkeiten.
»Er ist jetzt in New York«, sagte Joshua. »Gehört zur Garnison. Er hat sich von seiner Verwundung gut erholt. Es war ein Glück für ihn, dass er der Belagerung von Yorktown entgangen ist. Er ist jetzt Hauptmann, weißt du. Noch in der Zweiundsechziger Infanterie. Ich habe seinen Brief verlegt, sonst würde ich ihn dir zeigen.«
»Francis ist mir in diesen Tagen eine große Hilfe«, warf Charles ein, »und das wäre dir auch Ross gewesen, würde er jetzt zu Hause sein, anstatt Franzosen und Kolonialisten nachzujagen.«
»Da ist noch etwas anderes«, sagte Joshua, »siehst oder hörst du gelegentlich etwas von Elizabeth Chynoweth?«
Nach einer ausgiebigen Mahlzeit brauchten Fragen ihre Zeit, um in Charles’ Gehirn einzudringen, und wenn sein Bruder im Spiel war, mussten sie noch dazu nach verborgenen Absichten überprüft werden. »Wer ist das?«, fragte er fast einfältig.
»Die Tochter von Jonathan Chynoweth. Du kennst sie. Ein schlankes, schönes Kind.«
»Nun, und?«, sagte Charles.
»Ich fragte, ob du sie gesehen hast. Ross erwähnte sie immer. Ein hübsches kleines Ding. Er zählt darauf, dass sie hier ist, wenn er kommt, und ich glaube, es ist eine passende Verbindung. Durch eine frühe Heirat wird Ross gesetzter werden, und sie könnte keinen anständigeren Mann finden, obwohl ich das als sein Vater nicht sagen sollte. Zwei gute alte Familien. Wäre ich nicht bettlägerig, so wäre ich zu Weihnachten hinübergegangen, um Jonathan zu besuchen und es mit ihm festzulegen. Wir haben schon früher davon gesprochen, er meinte aber, wir sollten warten, bis Ross zurück ist.«
»Zeit für mich zu gehen«, sagte Charles, der sich mit Mühe erhob. »Ich hoffe, der Junge wird sesshaft werden, wenn er zurückkehrt, ob er nun heiratet oder nicht. Er befand sich in schlechter Gesellschaft, in die er niemals hätte geraten sollen.«
»Verkehrst du jetzt mit der Familie Chynoweth?« Joshua ließ sich nicht durch Anspielungen auf seine eigenen Fehler ablenken. »Ich bin hier von der Welt abgeschnitten, und Prudie hat für nichts ein Ohr, außer für die Skandalgeschichten in Sawle.«
»Oh, wir bekommen sie von Zeit zu Zeit zu Gesicht. Verity und Francis haben sie auf einer Gesellschaft in Truro getroffen …« Charles spähte durchs Fenster. »Der Teufel soll mich holen, wenn das nicht Choake ist. Nun, jetzt hast du weitere Gesellschaft, dabei hattest du durchblicken lassen, es käme dich nie jemand besuchen. Ich muss jedenfalls gehen.«
»Der ist nur schnüffeln gekommen, damit er sieht, um wie viel schneller seine Pillen mich erledigen. Die oder seine politischen Ansichten. Als ob es mir was ausmachte, ob Fox schon in der Erde liegt oder auf die Jagd nach konservativen Hühnern geht.«
»Hauptsache, du kommst auf deine Rechnung.« Für einen Mann seines Umfanges bewegte sich Charles rasch, als er seinen Hut und seine Stulpenhandschuhe zusammenraffte und sich zum Gehen fertig machte. Schließlich stand er verlegen am Bett und fragte sich, wie er sich am besten verabschieden sollte, während das Geklapper von Pferdehufen vor dem Fenster zu hören war.
»Sag ihm, ich will ihn nicht sehen«, sagte Joshua irritiert. »Sag ihm, er soll seine Tropfen seiner einfältigen Frau verabreichen.«
»Beruhige dich«, sagte Charles. »Tante Agathe schickt dir alles Liebe, dass ich’s nicht vergesse; und sie sagt, du musst warmes Bier mit Zucker und Eiern trinken. Sie meint, das wird dich kurieren.«
Joshuas Gereiztheit schwand.
»Tante Agathe ist eine weise alte Runkunkel. Sag ihr, ich werde ihren Rat befolgen. Und – und sag ihr, ich werde ihr einen Platz neben mir reservieren.« Er begann zu husten.
»Gott sei mit dir«, sagte Charles rasch und verdrückte sich aus dem Raum.
Joshua blieb allein.
Er konnte Dr Choake mit seinem Bruder bei der Eingangstür reden hören: den knirschenden, verdickten Tenor seines Bruders, die Stimme von Choake, tief, schwerfällig und pompös. Ärger und Ohnmacht stiegen in Joshua hoch. Was zum Teufel sollte das heißen, dass sie auf seiner Türschwelle salbaderten, wobei sie zweifellos über ihn sprachen, ihre Köpfe zusammensteckten und tiefsinnige Äußerungen machten.
Joshua sah sich nach seinem Stock um, entschlossen, noch eine Anstrengung zu machen, aufzustehen und zu ihnen hinauszugehen. Aber dann erhoben sich die Stimmen zum Abschied, und man hörte ein Pferd, das über das Pflaster und in Richtung auf den Bach dirigiert wurde.
Das war Charles.
Dann wurde laut mit einer Reitpeitsche an die Tür geschlagen, und der Arzt kam herein.
Thomas Choake stammte aus Bodmin und hatte in London praktiziert, die Tochter eines Bierbrauers geheiratet und war in seine Heimatgrafschaft zurückgekehrt, um ein kleines Gut in der Nähe von Sawle zu kaufen. Er war ein großer, plumper Mann mit einer dröhnenden Stimme, mit dachstrohgrauen Brauen und einem ungeduldigen Mund. Unter dem kleineren Landadel verlieh ihm seine Londoner Zeit einen guten Ruf; sie meinten, er sei den zeitgenössischen ärztlichen Vorstellungen voraus. Er war Arzt in mehreren Gruben im Distrikt und legte das Messer mit der gleichen Alles-oder-nichts-Einstellung an wie als Jäger.
Joshua hielt ihn für einen Schwindler und zog mehrmals in Betracht, Dr Pryce aus Redruth kommen zu lassen. Nur die Tatsache, dass er zu Dr Pryce nicht mehr Zutrauen hatte, hielt ihn davon ab.
»Well, well«, sagte Dr Choake. »Wir haben also Besuch gehabt, wie? Wir werden uns also zweifellos durch den Besuch unseres Bruders besser fühlen.«
»Ich habe mir eine Angelegenheit vom Hals geschafft«, sagte Joshua. »Deshalb habe ich ihn eingeladen.«
Dr Choake fühlte mit schweren Fingern nach dem Puls des Kranken. »Husten Sie«, sagte er. Joshua fügte sich ärgerlich.
»Unser Zustand ist ziemlich derselbe«, sagte der Arzt. »Die Krankheit hat sich nicht verschlechtert. Haben wir unsere Pillen genommen?«
»Charles ist zweimal so umfangreich wie ich. Warum verarzten Sie nicht ihn?«
»Sie sind krank, Mr Poldark. Ihr Bruder ist es nicht. Ich stelle keine Verschreibungen aus, wenn ich nicht darum ersucht werde.« Dr Choake schlug die Bettdecke zurück und fing an, die geschwollenen Beine seines Patienten abzutasten.
»Ein großer Fleischberg ist das«, brummelte Joshua. »Der wird seine Füße nie mehr zu sehen bekommen.«
»Oh, gehen Sie; an Ihrem Bruder ist nichts Ungewöhnliches. Ich erinnere mich genau, als ich in London war –«
»Uff!«
»Hat das weh getan?«
»Nein«, sagte Joshua.
Dr Choake tastete die Stelle noch einmal ab, um sich zu vergewissern. »Da ist eine deutliche Besserung im Zustand unseres linken Beins. Nur noch zu viel Wasser in beiden. Wenn wir nur das Herz dazu bringen könnten, es fortzupumpen. Ich erinnere mich gut, als ich in London war und zu dem Opfer einer Wirtshausrauferei nach Westminster gerufen wurde. Er hatte mit einem italienischen Juden gestritten, der einen Dolch zog und dem Mann diesen bis ans Heft in den Bauch stieß. Die schützende Fettschicht war aber so dick, dass sich herausstellte, dass die Messerspitze nicht einmal die Eingeweide durchbohrt hatte. Ein Bursche von bemerkenswertem Umfang. Warten Sie einmal, habe ich Sie zur Ader gelassen, als ich das letzte Mal hier war?«
»Ja.«
»Dann, glaube ich, können wir es diesmal sein lassen. Unser Herz neigt zu Aufregungszuständen. Zügeln Sie Ihre Wutausbrüche, Mr Poldark. Ein ausgeglichenes Temperament hilft dem Körper, die richtigen Säfte auszuscheiden.«
»Sagen Sie mir«, wollte Joshua wissen, »sehen Sie manchmal die Familie Chynoweth? Die Chynoweths von Cugarne, wissen Sie. Ich habe meinen Bruder gefragt, doch er gab mir eine ausweichende Antwort.«
»Die Familie Chynoweth? Ich sehe sie von Zeit zu Zeit. Ich glaube, sie sind bei guter Gesundheit. Ich bin natürlich nicht ihr Hausarzt, und wir statten einander keine gesellschaftlichen Besuche ab.«
Nein, dachte Joshua, Mrs Chynoweth wird schon dafür Sorge tragen. »Ich nehme an Charles ein gewisses Schwanken wahr«, sagte er schlau. »Bekommen Sie Elizabeth zu Gesicht?«
»Die Tochter? Gelegentlich.«
»Es gab da eine Abmachung in Bezug auf sie zwischen ihrem Vater und mir.«
»Tatsächlich? Ich habe nichts davon gehört.«
Joshua schob sich die Kissen hinauf. Sein Gewissen hatte angefangen, ihn zu beunruhigen. Es war ziemlich spät für das Erwachen dieser vor langem eingeschlummerten Instanz, doch er mochte Ross, und in den langen Stunden seiner Krankheit hatte er angefangen, sich zu fragen, ob er nicht mehr hätte tun sollen, um die Interessen seines Sohnes zu vertreten.
»Ich glaube, ich werde Jud morgen hinüberschicken«, murmelte er. »Ich werde Jonathan ersuchen lassen, dass er mich besuchen kommt.«
»Ich bezweifle, dass Mr Chynoweth die Zeit dazu haben wird; diese Woche ist Vierteljahressitzung. Ah, das ist ein willkommener Anblick.«
Prudie Paynter kam mit zwei Kerzen hereingeschlurft. Im gelben Lichtschein zeigte sich ihr verschwitztes rotes Gesicht, das von schwarzem Haar umrahmt war.
»Haben Sie Ihre Medizin genommen, wie?«, fragte sie in einem kehligen Flüsterton.
Joshua wandte sich gereizt an den Doktor. »Ich habe Ihnen schon gesagt, Choake: Pillen schlucke ich, Gott steh mir bei, aber Tropfen und sonstiges Gebräu will ich nicht sehen.«
»Ich erinnere mich wohl«, sagte Choake gewichtig, »an die Zeit, da ich als junger Mann in Bodmin praktizierte, als einer meiner Patienten, ein älterer Herr, der an Harnzwang und Steinen litt …«
»Sie glauben also, dass ich auf dem Weg der Besserung bin, wie?«, sagte Joshua, bevor der Arzt weiterreden konnte. »Wie lange wird es noch dauern, bis ich wieder auf den Beinen bin und herumgehe?«
»Hm, hm. Eine leichte Besserung, habe ich gesagt. Es ist noch eine Weile große Sorgfalt geboten. Wir haben Sie wieder auf den Beinen, bevor Ross zurückkehrt. Nehmen Sie regelmäßig ein, was ich Ihnen verschreibe, und Sie werden merken, dass es Ihnen bessergeht …«
»Wie geht es Ihrer Frau?«, fragte Joshua boshaft.
Bei dieser erneuten Unterbrechung legte Choake die Stirn in Falten. »Zufriedenstellend, danke.«
Der Umstand, dass die einen leichten Bartflaum tragende lispelnde Frau, obwohl nur halb so alt wie er, abgesehen von ihrer Mitgift kein neues Familienmitglied hervorgebracht hatte, war ein ständiger Vorwurf gegen sie. Solange sie unfruchtbar blieb, konnte er keine Frau dazu überreden, nicht mehr Beifuß oder andere, weniger geachtete Wundermittel von fahrenden Zigeunern zu kaufen.
Der Doktor war gegangen, und Joshua war wieder einmal allein – diesmal bis zum Morgen. Er konnte, wenn er beständig die Glockenschnur zog, einen unwilligen Jud oder eine ebensolche Prudie zu sich rufen, solange sie noch nicht zu Bett gegangen waren, danach gab es niemanden mehr, und auch schon vor diesem Zeitpunkt zeigten sie Zeichen von Schwerhörigkeit, seit seine Krankheit deutlicher erkennbar geworden war. Er wusste, dass sie abends die meiste Zeit mit Trinken verbrachten, und wenn sie einmal ein gewisses Stadium erreicht hatten, konnte sie überhaupt nichts mehr in Bewegung bringen.
Es wäre anders gewesen, wäre Ross hier gewesen. Damit hatte Charles einmal recht, aber nur teilweise. Er war es gewesen, Joshua, der Ross ermutigt hatte wegzugehen. Er glaubte nicht, dass es gut war, Jungen als zusätzliche Dienstboten zu Hause aufwachsen zu lassen. Sie mussten ihre eigenen Steigbügel finden.
Joshua spürte, dass er noch einmal gern aufs Meer hinaussehen würde, das sogar jetzt an die Felsen hinter dem Haus schlug. Er hatte keine sentimentale Einstellung zum Meer; er hatte keinen Sinn für seine Gefahren oder seine Schönheit; für ihn war es ein guter Bekannter, dessen Tugenden oder Schwächen, dessen Lächeln oder Wutanfall er schließlich zu verstehen gelernt hatte.
Das Land ebenfalls. War das Lange Feld gepflügt? Ob Ross nun heiratete oder nicht, es würde ohne das Land wenig genug zum Lebensunterhalt geben.
Mit einer ordentlichen Frau, welche die Dinge in die Hand nahm … Elizabeth war ein Einzelkind; eine seltene Tugend, die es wert war, dass man sie im Gedächtnis behielt. Die Familie Chynoweth war ein wenig verarmt, doch es würde etwas da sein. Er musste Jonathan besuchen und die Dinge ins Reine bringen.
Joshua döste. Er bildete sich ein, er sei draußen und gehe um die Ecke des Langen Feldes, mit dem Meer zu seiner Rechten und einem starken Wind, der gegen seine Schulter drückte. Eine helle Sonne wärmte seinen Rücken, und die Luft schmeckte nach Wein aus einem kalten Keller. Die Ebbe reichte bis an den Hendrawna-Strand, und die Sonne zeichnete Reflexe in den nassen Sand. Das Lange Feld war nicht nur gepflügt, es war darauf bereits gesät worden, und es sprosste bereits.
Er ging um den Acker herum, bis er die Landzunge von Damsel Point erreichte, wo die niedere Klippe mit Felsstufen und Steinbrocken bis zum Meer hinunter abfiel.
Mit einem besonderen Ziel im Kopf kletterte er die Felsen hinunter, bis das kalte Meerwasser mit einem Mal seine Knie umspülte, wobei es einen unangenehmen Schmerz durch seine Beine schickte, so wie den, den er durch das Anschwellen in diesen letzten paar Monaten verspürt hatte.
Das hielt ihn aber nicht auf, und er ließ sich ins Wasser gleiten, bis es ihm an die Kehle reichte. Dann stieß er sich von der Küste ab. Er war voller Freude, sich nach einer Unterbrechung von zwei Jahren wieder im Wasser zu befinden. Er atmete sein Vergnügen in langen, kühlen Atemzügen aus und erlaubte dem Wasser, bis dicht an seine Augen zu sprühen.
Joshua schlief. Draußen fielen die letzten Spuren Tageslicht aus dem Himmel und ließen das Haus, die Bäume und Bäche und Klippen im Dunkel. Der Wind frischte auf, blies beständig und stark aus dem Westen, suchte unter den verfallenen Bergwerksschuppen auf dem Hügel, brachte die Wipfel der geschützten Apfelbäume zum Rauschen, hob einen Zipfel von losem Strohdach auf einer der Scheunen, blies einen Schauer kalten Regens durch einen zerbrochenen Fensterladen der Bibliothek, wo zwei Ratten mit vorsichtigem, zuckendem Scharren zwischen Zimmerholz und Staub herumschnupperten. Der Bach zischte und blubberte in der Dunkelheit, und darüber schwankte ein langes unausgebessertes Tor mit knarrendem Geräusch in seinen Angeln. In der Küche brach Jud Paynter der zweiten Flasche Gin den Hals, und Prudie warf einen neuen Holzklotz ins Feuer.
»Der Wind kommt auf«, sagte Jud. »Der Teufel soll’s holen. Immer gibt es Wind. Immer, wenn man ihn nicht haben will, geht der Wind.«
»Gib mir was zu trinken, schwarzer Wurm«, grollte Prudie.
»Nimm dir selbst was«, sagte Jud.
Joshua schlief.
Erstes Buch
Oktober 1783–April 1785
1
Es war windig. Der blasse Nachmittagshimmel war mit Wolkenfetzen bedeckt, die Straße, die in der letzten Stunde staubiger und unebener geworden war, war voller loser raschelnder Blätter.
Es saßen fünf Personen in der Postkutsche; ein magerer Mann mit verkniffenem Beamtengesicht und abgewetztem Anzug; dazu seine Frau, die so fett war wie ihr Gatte mager, an ihrer Brust ein Bündel rosa und weiße Tücher, aus dem die faltigen und überhitzten Züge eines Säuglings sahen. Die übrigen Reisenden waren Männer, einer ein Geistlicher von ungefähr fünfunddreißig, der andere noch jünger.
Nahezu seit die Postkutsche St. Austell verlassen hatte, hatte Schweigen geherrscht. Das Kind schlief trotz der Stöße des Fahrzeugs und des Geratters der Fenster und des Fahrgestellklirrens ruhig, auch das Anhalten hatte es nicht geweckt. Von Zeit zu Zeit tauschte das ältliche Paar leise Bemerkungen aus, doch der magere Gatte zeigte keine Lust zu reden, ein wenig überwältigt von der höheren Gesellschaftsklasse, in der er sich befand. Der jüngere der beiden Männer hatte die ganze Reise hindurch in einem Buch gelesen, der ältere die vorbeifliegende Landschaft beobachtet, wobei er mit einer Hand den staubigen braunen Samtvorhang zurückhielt.
Er war ein kleiner, schmächtiger Mann, streng in kirchlichem Schwarz, der sein Haar zurückgekämmt trug, welches über und hinter seinen Ohren gelockt war. Der Stoff seines Anzuges war von sehr guter Qualität, seine Strümpfe Seidenstrümpfe. Er hatte ein langes, scharfes, humorloses, dünnlippiges Gesicht, das vital und hart wirkte. Der kleine Schreiber kannte das Gesicht, ohne sagen zu können, wem es gehörte.
Der Geistliche befand sich in ziemlich der gleichen Lage gegenüber den anderen Insassen der Kutsche. Mehrmals hatte sein Blick auf dem dichten ungepuderten Haar ihm gegenüber und auf dem Gesicht seines Mitreisenden geruht.
Als sie sich nicht mehr als fünfzehn Minuten außerhalb von Truro befanden und die Pferde in einen langsamen Schritt den steilen Hügel aufwärts verfallen waren, sah der andere von seinem Buch auf.
»Sie werden mir vergeben, Sir«, sagte der Geistliche in einem scharfen, kraftvollen Ton. »Ihr Gesicht ist mir vertraut, es fällt mir aber schwer, mich daran zu erinnern, wo wir uns kennengelernt haben. War es in Oxford?«
Der junge Mann war groß, mager und grobknochig, mit einer Narbe auf der Wange. Er trug eine zweireihige Reitjacke, die an der Vorderseite hoch angesetzt war, um die Weste sehen zu lassen sowie die strammen Reithosen, beide von einem helleren Braun. Sein Haar, das einen Stich ins Kupferrot zeigte, war schlicht zurückgekämmt und im Nacken mit einem braunen Band zusammengebunden.
»Sie sind der Reverend Dr Halsey, nicht wahr?«, sagte er.
Der kleine Schreiber, welcher dieser Wechselrede gefolgt war, zeigte seiner Frau ein bedeutungsvolles Gesicht. Rektor von Towerdreth, Kurat von St. Erme, Direktor der Grammatikschule von Truro, Ehrenbürger der Stadt und Exbürgermeister. Dr Halsey war eine Persönlichkeit. Das erklärte auch seine Haltung.
»Sie kennen mich also«, sagte Dr Halsey herablassend. »Ich habe normalerweise ein Gedächtnis für Gesichter.«
»Sie haben schon viele Schüler gehabt.«
»Ah, das ist die Erklärung. Reife verändert Gesichter. Und – hm. Lassen Sie mich sehen … sind Sie Hawkey?«
»Poldark.«
Die Augen des Geistlichen verengten sich in der Bemühung, sich zu entsinnen. »Francis, nicht wahr? Ich dachte …«
»Ross. Sie werden sich an meinen Vetter deutlicher erinnern. Er ging weiter in die Schule. Ich glaubte, ganz zu Unrecht, dass meine Bildung mit dreizehn abgeschlossen war.«
Die Erinnerung stellte sich ein. »Ross Poldark. Nun, nun. Sie haben sich verändert. Ich erinnere mich jetzt«, sagte Dr Halsey mit einem Schimmer kalten Humors. »Sie waren ein kleiner Aufrührer. Ich musste Sie häufig züchtigen, und dann liefen Sie weg.«
»Ja.« Poldark blätterte die Seiten in seinem Buch um. »Eine böse Geschichte, und Ihre Handgelenke schmerzten Sie so wie mich meine Hinterbacken.«
Zwei kleine rötliche Flecken zeigten sich auf den Wangen des Geistlichen. Er starrte einen Augenblick auf Ross und wandte sich dann ab, um aus dem Fenster zu sehen.
Der kleine Schreiber hatte von den Poldarks gehört, besonders von Joshua, vor dem, wie es hieß, in den fünfziger und sechziger Jahren keine hübsche Frau, verheiratet oder unverheiratet, sicher gewesen war. Dieser Mann musste sein Sohn sein. Ein ungewöhnliches Gesicht mit seinen stark hervortretenden Backenknochen, mit dem breiten Mund und den großen, kräftigen weißen Zähnen. Die Augen waren von sehr hellem Blaugrau unter jenen schweren Lidern, die einer Anzahl von Poldarks dieses täuschend schläfrige Aussehen verliehen.
Dr Halsey ging wieder zum Angriff über.
»Francis, nehme ich an, befindet sich wohl? Ist er verheiratet?«
»Nicht, als ich das letzte Mal von ihm hörte, Sir. Ich bin einige Zeit in Amerika gewesen.«
»Du guter Gott. Ein bedauerlicher Fehler, diese Kämpfe. Ich war vom ersten bis zum letzten Tag dagegen. Haben Sie viel vom Krieg mitbekommen?«
»Ich war mittendrin.«
Sie hatten endlich die Hügelkuppe erreicht, und der Kutscher ließ, mit der Talfahrt vor sich, die Zügel locker.
Dr Halsey rümpfte seine scharfe Nase. »Sind Sie ein Konservativer?«
»Ein Soldat.«
»Nun, es war nicht die Schuld der Soldaten, dass wir verloren haben. England war nicht mit dem Herzen dabei. Wir haben einen gebrechlichen alten Mann auf dem Thron. Er wird es nicht mehr lange machen. Der Kronprinz hat andere Ansichten.« Der Geistliche nahm eine Prise Schnupftabak und nickte selbstgefällig.
Die Straße an der steilsten Stelle des Hügels wies tiefe Radspuren auf, und die Kutsche holperte und schwankte gefährlich. Das Baby begann zu weinen. Sie erreichten die Talsohle, und der Mann neben dem Kutscher ließ auf seiner Trompete einen Ruf erschallen. Sie bogen in die St.-Austell-Straße ein und hielten schließlich vor dem Gasthaus »Zum Roten Löwen«.
In dem Gedränge, das sich nun ergab, stieg der Reverend Dr Halsey mit einem steifen Abschiedsgruß als Erster aus und verschwand, indem er zwischen den Pfützen von Regenwasser und Pferde-Urin der anderen Seite der engen Straße entschlossen zuschritt. Ross Poldark erhob sich, um ihm zu folgen, und der Schreiber sah zum ersten Mal, dass er hinkte.
Als Ross die Kutsche verließ, fing es an zu regnen, ein dünner, feiner Regen, den der Wind vor sich herblies, der in Stößen kam und hier, im Einschnitt zwischen den Hügeln, unerwartet auffrischte.
Ross blickte sich um und sog prüfend die Luft ein. Dies alles war so vertraut, eben so eine echte Heimkehr, wie er sie empfinden würde, wenn er sein Vaterhaus erreichte. Diese enge gepflasterte Straße mit dem Wasserbächlein, das sie herabplätscherte, die eng aneinandergebauten viereckigen Häuser mit ihren Bogenfenstern und Spitzenvorhängen, die unzählige Gesichter verbargen, welche die Ankunft der Kutsche beobachteten, und sogar die Rufe der Postjungen schienen einen anderen und vertrauten Ton angenommen zu haben.
Truro war ihm und seiner Familie in den alten Tagen der Mittelpunkt des »Lebens« gewesen. Ein Hafen und eine Stadt mit Münzrecht, das Einkaufszentrum und ein Treffpunkt in Modefragen. Die Stadt war in den letzten paar Jahren rasch gewachsen, neue und stattliche Häuser waren in dem unordentlichen Gewirr der alten emporgeschossen, um ihre Eigenschaft als Winter- und Stadtquartier für einige der ältesten und einflussreichsten Familien in Cornwall zu kennzeichnen: die Lemons, die Treworthys, die Warleggans, Familien, die sich ihren Weg aus bescheideneren Anfängen an die Spitze der neuen Industrien gebahnt hatten.
Eine seltsame Stadt. Er fühlte das bei seiner Rückkehr stärker. Eine geheimnisvolle, wichtige kleine Stadt, die im Einschnitt zwischen den Hügeln und an ihren vielen fließenden Gewässern hingestreut dalag, beinahe von fließendem Wasser umgeben und durch Buchten, Brücken und Trittsteine mit der übrigen Welt verbunden. Und immer die Gefahr von Ansteckung und Fieber.
Es gab keine Spur von Jud.
Er ging, den Fuß nachziehend, in das Gasthaus.
»Mein Knecht hätte mich hier erwarten sollen«, sagte er. »Sein Name ist Paynter. Jud Paynter von Nampara.«
Der Wirt starrte ihn kurzsichtig an. »Oh, Jud Paynter. Ja, den kennen wir gut, Sir. Wir haben ihn heute aber nicht zu Gesicht bekommen. Sie sagen, er hätte hier auf Sie warten sollen? Junge, geh und stell fest, ob Paynter – kennst du ihn? –, ob Paynter in den Ställen ist oder ob er heute hier gewesen ist.«
Ross bestellte ein Glas Branntwein, und als man es vor ihn setzte, war der Junge zurück und sagte, Mr Paynter sei heute noch nicht hier gewesen.
»Es war ganz sicher ausgemacht. Spielt keine Rolle. Haben Sie ein Reitpferd, das ich mieten kann?«
Der Wirt rieb sich die Spitze seiner langen Nase. »Nun, wir haben eine Stute, die jemand vor drei Tagen hierließ. Tatsächlich hielten wir sie an Zahlungs statt. Ich glaube nicht, dass es einen Einwand dagegen geben könnte, dass wir sie Ihnen vermieten, wenn Sie uns ein paar Referenzen geben können.«
»Ich heiße Poldark. Ich bin der Neffe von Mr Charles Poldark von Trenwith.«
»Du lieber Gott, ja; dass ich Sie nicht erkannt habe, Mr Poldark. Ich lasse die Stute sofort für Sie satteln.«
»Nicht so hastig. Es herrscht noch etwas Tageslicht. Halten Sie sie für mich in einer Stunde bereit.«
Wieder auf der Straße draußen, schritt Ross den engen Streifen der Church Lane hinunter. An deren Ende wandte er sich nach rechts und hielt, nachdem er an der Schule, in der seine Erziehung ein unansehnliches Ende gefunden hatte, vorbei war, vor einer Tür an, auf der in Druckbuchstaben stand: Nat. G. Pearce; Notar und beeidigter Nachlassverwalter. Er zog einige Zeit an der Glocke, ehe ihn eine Frau mit Pusteln einließ.
»Mr Pearce fühlt sich heute nicht wohl«, sagte sie. »Ich werde sehen, ob er Sie empfängt.«
Mr Nathaniel Pearce saß in einem Lehnstuhl vor einem großen Feuer, wobei eines seiner Beine bandagiert und auf einen anderen Stuhl gebettet war. Er war ein großer Mann mit einem großflächigen Gesicht, das infolge zu guter Ernährung leicht pflaumenrot gefärbt war.
»Oh, das ist aber eine Überraschung, Mr Poldark, ich muss schon sagen. Wie angenehm. Sie vergeben mir, wenn ich nicht aufstehe; das alte Leiden. Jeder Anfall scheint ärger zu sein als der vorige. Setzen Sie sich.«
Ross ergriff eine feuchte Hand und wählte sich einen Stuhl so weit vom Feuer, wie es gerade noch höflich war. Es war unerträglich heiß hier drinnen, und die Luft war abgestanden und verbraucht.
»Sie werden sich erinnern«, sagte er. »Ich schrieb Ihnen, dass ich diese Woche zurückkomme.«
»O ja, Mr Hauptmann Poldark; es war mir im Augenblick entfallen. Wie nett von Ihnen, auf Ihrem Heimweg hereinzusehen.« Mr Pearce richtete seine Stutzperücke zurecht, die, seinem Berufsstand gemäß, eine hohe Stirnlocke aufwies sowie einen langen Haarbeutel hinten, der in der Mitte abgebunden war. »Ich bin hier ganz verzweifelt, Hauptmann Poldark, meine Tochter leistet mir keine Gesellschaft; sie ist zu irgendeiner Art von Methodistenglauben übergetreten und ist fast jeden Abend außer Haus bei irgendeiner Gebetsversammlung. Sie redet so viel von Gott, dass sie mich damit ganz in Verlegenheit bringt. Sie müssen ein Glas gelben Kräuterlikör trinken.«
»Ich werde nur kurz bleiben«, sagte Ross. Ich halte es nicht länger aus, dachte er, oder ich verschmachte. »Ich brenne darauf, wieder zu Hause zu sein, dachte aber, ich sollte Sie auf dem Heimweg besuchen. Ihr Brief erreichte mich erst vierzehn Tage, bevor ich mich in New York einschiffte.«
»Du guter Gott, was für eine Verzögerung. Was für ein Schlag das für Sie gewesen sein muss! Und Sie wurden noch dazu verwundet – ist es arg?«
Ross lagerte sein Bein bequemer. »Ich entnehme Ihrem Brief, dass mein Vater im März gestorben ist. Wer hat seither meinen Besitz verwaltet, mein Onkel oder Sie?«
Mr Pearce kraulte geistesabwesend die Rüschen auf seiner Hemdbrust. »Ich weiß, Sie hätten es gern, dass ich offen zu Ihnen bin.«
»Natürlich.«
»Nun, als es dazu kam, dass wir uns mit dieser Angelegenheit befassten, Mr – eh – Hauptmann Poldark, da sah es nicht so aus, als hätte er auch nur für einen von uns viel Verwaltbares hinterlassen.«
Ein langsames Lächeln spielte um Ross’ Mund; es ließ ihn noch jünger und weniger widersprüchlich aussehen.
»Alles wurde natürlich Ihnen hinterlassen. Ich gebe Ihnen eine Abschrift des Testaments, bevor Sie gehen. Sollten Sie vor ihm sterben, wäre alles an seine Nichte Verity gefallen. Abgesehen vom eigentlichen Grundbesitz gibt es wenig, was Sie beanspruchen können. Oh, dieses verflixte Bein schmerzt wirklich höchst unangenehm!«
»Ich habe meinen Vater nie als einen reichen Mann betrachtet. Ich habe trotzdem gefragt und bin gespannt auf die Antwort aus einem besonderen Grunde. Wurde er in Sawle begraben?«
Der Notar hörte auf zu kratzen und beäugte den anderen mit schlauer Miene. »Wollen Sie sich jetzt in Nampara niederlassen, Hauptmann Poldark?«
»Ja.«
»Sollte ich jemals etwas Geschäftliches für Sie erledigen können, nur zu gern«, beeilte sich Mr Pearce hinzuzufügen, als Ross sich erhob. »Ich würde aber sagen, dass Sie Ihren Besitz ein wenig vernachlässigt finden werden.«
Ross wandte sich um.
»Ich bin nicht selbst hinübergeritten«, sagte Mr Pearce, »dieses Bein, wissen Sie, sehr betrüblich, und ich noch nicht zweiundfünfzig, doch mein Schreiber war draußen. Ihr Vater kränkelte seit einiger Zeit, und die Dinge werden nicht so sauber und ordentlich gehalten, wie man wünschen möchte, wenn der Gutsherr nicht nach allem sieht, nicht wahr? Noch ist Ihr Onkel so jung wie früher. Holt Paynter Sie mit einem Pferd ab?«
»Das hätte er tun sollen, er ist aber nicht aufgetaucht.«
»Dann, mein lieber Herr, verbringen Sie doch die Nacht bei uns.«
Ross zog ein Taschentuch hervor und trocknete sich das Gesicht ab.
»Das ist sehr nett von Ihnen. Ich glaube aber, da ich heute schon so weit gekommen bin, werde ich doch lieber ganz nach Hause reiten.«
Mr Pearce seufzte und mühte sich um eine bequemere Stellung. »Dann helfen Sie mir doch bitte, ja? Ich mache Ihnen eine Abschrift des Testaments, damit Sie es mitnehmen und in Ruhe lesen können.«
2
Das Abendessen in Trenwith House war in vollem Gang.
Es wäre normalerweise um diese Zeit vorüber gewesen: Wenn Charles Poldark und seine Familie allein speisten, dauerte das Essen selten länger als zwei Stunden, doch war dies ein besonderer Anlass. Und der Gäste wegen wurde die Mahlzeit in der Halle im Mittelpunkt des Hauses eingenommen, in einem Raum, der zu groß und zugig war, wenn die Familie allein zu Tisch ging.
Es saßen zehn Personen an dem langen, schmalen Eichentisch. Oben an der Tafel saß Charles selbst mit seiner Tochter Verity zu seiner Linken. Zu seiner Rechten saß Elizabeth Chynoweth und neben ihr Francis, sein Sohn. Anschließend Mr und Mrs Chynoweth, Elizabeths Eltern, und am Ende der Tafel zerkleinerte Tante Agatha ihr ohnehin schon weiches Essen und mampfte es zwischen ihren zahnlosen Kiefern. Auf der anderen Seite unterhielt sich Vetter William-Alfred mit Dr Choake und seiner Frau.
Der Fisch, das Geflügel und die Fleischgerichte waren verzehrt, und Charles hatte gerade die Süßspeisen verlangt.
»Verflixt«, sagte er in der Ruhepausenstille, die sich auf die Gesellschaft gesenkt hatte. »Ich weiß nicht, warum ihr zwei Turteltauben nicht schon morgen heiratet, anstatt noch einen Monat damit zu warten. Harf! Was fehlt euch denn noch? Fürchtet ihr, dass ihr es euch noch anders überlegt?«
»Was mich betrifft, so würde ich deinen Rat befolgen«, sagte Francis, »doch es ist Elizabeths Ehrentag ebenso wie meiner.«
»Ein kurzer Monat ist wenig genug«, sagte Mrs Chynoweth und fummelte mit der Schließe an dem hübschen Spitzenkragen ihres Kleides herum. Ihr gutes Aussehen wurde von einer langen besitzergreifenden Nase gestört: Wenn man sie zum ersten Mal sah, verspürte man einen Schock darüber, dass hier so viel Schönheit verdorben war. »Wie kann man von mir erwarten, dass ich alle Vorbereitungen treffe, ganz zu schweigen von dem armen Kind?«
»Was hat sie gesagt?«, wollte Tante Agathe wissen.
»Nun, das ist es wohl«, sagte Charles Poldark. »Das ist es wohl. Ich nehme an, wir müssen Geduld aufbringen, nachdem sie es tun. Nun, ich bringe einen Trinkspruch aus. Auf das glückliche Paar!«
»Du hast diesen Toast bereits dreimal ausgebracht«, wandte Francis ein.
»Macht nichts. Vier ist eine bessere Glückszahl.«
»Aber ich kann beim Trinken nicht mit dir mithalten.«
»Still, Junge! Das ist unwichtig.«
Unter einigem Gelächter leerten alle ihre Gläser. Als die Gläser klirrend wieder hingestellt wurden, kamen die Tischlichter herein, hohe Kerzen in schimmernden Silberleuchtern, die für diesen Anlass hervorgeholt und besonders poliert worden waren. Dann kam die Haushälterin, Mrs Tabb, mit den Apfelkuchen, den Pflaumenkuchen und den gelierten Früchten.
»Nun«, sagte Charles und schwenkte sein Messer und seine Gabel über dem größten Apfelkuchen, »ich hoffe, das ist so gut, wie es aussieht. Wo ist die Sahne? Oh, da. Gib mir davon darauf, Verity, meine Liebe.«
»Es tut mir leid«, sagte Elizabeth, ihr Schweigen brechend. »Doch ich bin ganz und gar nicht imstande, noch irgendetwas zu mir zu nehmen.«
Alle sahen sie daraufhin gleichzeitig an, und sie errötete.
Elizabeth Chynoweth war schmächtiger, als ihre Mutter je gewesen war, und auf ihrem Gesicht lag die Schönheit, die ihrer Mutter nicht vergönnt gewesen war. Als das gelbe Kerzenlicht die Dunkelheit zurück und gegen die hohe Waffeldecke drängte, zog ihre feine, helle klare Haut unter den Schatten im Raume und gegen das dunkle Holz der hochlehnigen Stühle alle Aufmerksamkeit auf sich.
»Unsinn, Kind«, meinte Charles. »Du bist dünn wie ein Gespenst. Man muss etwas Blut in deine Adern bringen.«
»Wirklich, ich –«
»Lieber Mr Poldark«, sagte Mrs. Chynoweth, jede Silbe betonend, »wenn man sie so ansieht, würde man niemals glauben, wie dickköpfig sie sein kann. Zwanzig Jahre lang habe ich mich bemüht, sie dazu zu bringen, dass sie etwas isst, doch sie lässt das beste Essen einfach stehen. Vielleicht wirst du imstande sein, sie zu überreden, Francis.«
»Ich bin sehr zufrieden mit ihr, wie sie ist«, versicherte Francis.
»Ja, ja«, sagte sein Vater, »doch ein wenig Essen … verdammich, das schadet niemandem. Eine Frau muss kräftig und gesund sein.«
»Oh, sie ist sehr kräftig«, beeilte sich Mrs Chynoweth zu sagen. »Sie würden auch darüber überrascht sein. Es ist ihr Schlag, nichts sonst als ihr Schlag. War ich nicht zierlich als Mädchen, Jonathan?«
»Horcht, wie sich der Wind erhebt!«, sagte Tante Agathe, die ihren Kuchen zerkrümelte.
»Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann«, sagte Dr Choake, »wie Ihre Tante, Mr Poldark, obwohl sie fast taub ist, immer ein Gespür für Naturlaute hat.«
»Ich glaube, sie bildet sie sich ebenso oft nur ein.«
»Das tue ich nicht«, sagte Tante Agathe. »Wie kannst du es wagen, Charles!«
»War da jemand an der Tür?«, warf Verity ein.
Tabb war nicht im Raum, doch Mrs Tabb hatte nichts gehört. Die Kerzen flackerten in der Zugluft, und die roten Damastvorhänge vor den Fenstern blähten sich, als bewege sie eine Hand. Die Mauern der Halle waren von einer eichenen Täfelung eingefasst, die mehr als ein notwendiges Maß an Lüftung zuließ.
»Erwartest du jemanden, meine Liebe?«, fragte Mrs Chynoweth.
Verity wurde nicht rot. Sie hatte wenig von dem guten Aussehen ihres Bruders, war klein und dunkel und von gelblicher Gesichtsfarbe, mit dem breiten Mund, den einige der Poldarks hatten.
Und dann konnte kein Zweifel daran bestehen, dass jemand an die Außentür klopfte. Mrs Tabb setzte das Kuchenservierbrett hin und ging an die Tür.
Der Wind blähte die Vorhänge, und von den Kerzenflammen tropfte Talg die silbernen Leuchter herab.
»Gott steh mir bei!«, sagte die Haushälterin, als hätte sie einen Geist gesehen.
Ross kam in eine Gesellschaft, die auf sein Auftauchen ganz und gar nicht vorbereitet war. Als er im Eingang erschien, brach einer nach dem anderen der Tischgäste in Worte der Überraschung aus. Elizabeth und Francis und Verity und Dr Choake hatten sich erhoben, Charles hatte sich zurücksinken lassen, grunzend und vor Schreck bewegungsunfähig. Vetter William-Alfred polierte seine stahlgefassten Augengläser, während Tante Agathe an seinem Ärmel zupfte und murmelte: »Was ist das? Was soll man machen? Wir haben noch nicht fertiggegessen.«
Ross kniff die Augen zusammen, bis er sich an das Licht gewöhnt hatte. Trenwith House lag fast auf seinem Heimweg, und er war gar nicht auf die Idee gekommen, er könne bei einer Gesellschaft stören.
Als Erste begrüßte ihn Verity. Sie lief zu ihm hinüber und schlang die Arme um seinen Nacken. »Also, Ross-Liebling! Stellt euch das vor!«, war alles, was sie zu sagen wusste.
»Verity!« Er drückte sie an sich. Und dann sah er Elizabeth.
»So etwas«, sagte Charles, »so bist du endlich zurück, mein Junge. Für das Abendessen bist du zu spät dran, doch wir haben ein paar feine Apfeltörtchen übrig.«
»Haben sie uns lahmgeschossen, Ross?«, sagte Dr Choake. »Der Teufel hole den Krieg. Er stand von Anfang an unter einem Unstern. Gott sei Dank ist er vorüber.«
Francis kam nach kurzem Zögern rasch um den Tisch herum und ergriff die Hand des anderen Mannes. »Es ist gut, dich wieder hier zu sehen, Ross! Du hast uns gefehlt.«
»Es ist ein schönes Gefühl, zurück zu sein«, sagte Ross, »euch alle zu sehen, und …«
Die Farbe ihrer Augen unter den schweren Lidern war das einzige Zeichen dafür, dass sie Vettern waren. Francis war fest, schlank und ordentlich, mit der frischen Gesichtsfarbe und den klaren Zügen hübscher Jugend. Er sah so aus, wie er war, sorglos, unbeschwert, selbstbewusst, ein junger Mann, der nie erlebt hat, was es heißt, in Gefahr zu sein oder zu wenig Geld zu haben oder seine Kraft mit der eines anderen Mannes zu messen, es sei denn in Spielen oder bei einer Rauferei. In der Schule hatte sie jemand den ›lichten Poldark‹ und den ›dunklen Poldark‹ genannt. Sie waren immer gute Freunde gewesen, was überraschte, da ihre Väter es nicht gewesen waren.
»Das ist eine feierliche Gelegenheit«, sagte Vetter William-Alfred. »Eine Familienzusammenführung ist mehr als ein Wort. Ich hoffe, du bist nicht ernstlich verwundet, Ross. Diese Narbe ist eine beträchtliche Entstellung.«
»Oh, die«, sagte Ross. »Es würde nichts machen, müsste ich nicht den Fuß nachziehen wie ein lahmer Esel.«
Er ging um den Tisch herum und begrüßte die anderen. Mrs Chynoweth begrüßte ihn kalt, indem sie ihm eine Hand aus der Entfernung zustreckte.
»Erzählen Sie uns doch«, lispelte Polly Choake, »erzählen Sie uns doch einige Ihrer Erlebnisse, Hauptmann Poldark, wie wir den Krieg verloren haben, wie diese Amerikaner so sind, und –«
»Ziemlich so wie wir, gnädige Frau. Deswegen haben wir auch verloren.« Er war bei Elizabeth angelangt.
»Nun, Ross«, sagte sie weich.
Seine Augen glitten über ihr Gesicht. »Das trifft sich sehr gut. Ich hätte es mir nicht anders wünschen können.«
»Ich schon«, sagte sie. »Oh, Ross, ich schon.«
»Und was wirst du jetzt machen, mein Junge?«, fragte Charles. »Es ist höchste Zeit, dass du dich sesshaft machst. Besitz kümmert sich nicht um sich selbst, und auf bezahlte Arbeitskräfte kann man sich nicht verlassen. Dein Vater hätte dich dieses vergangene Jahr und länger gut gebrauchen können –«
»Ich wäre beinahe heute Abend zu euch gekommen, um dich zu sprechen«, sagte Ross zu Elizabeth, »verschob es aber auf morgen. Selbstbeherrschung findet ihren Lohn.«
»Ich muss dir erklären. Ich habe dir geschrieben, doch –«
»Also«, sagte Tante Agathe, »Gott verdamm mich, wenn das nicht Ross ist! Komm her, mein Junge! Ich dachte, du seist dahingegangen, um einen der Heiligen da oben abzugeben.«
Zögernd ging Ross zum Ende der Tafel, um seine Großtante zu begrüßen. Elizabeth blieb, wo sie war, und hielt die Lehne ihres Stuhles so fest, dass ihre Knöchel noch weißer waren als ihr Gesicht.
Ross gab Tante Agathe einen Kuss auf die behaarte Wange und sagte in ihr Ohr: »Ich freue mich zu sehen, dass du noch immer eine der Seligen hier unten bist.«
Sie kicherte vor Vergnügen, wobei sie ihren blassen, bräunlich rosigen Gaumen zeigte. »Nicht ganz so selig vielleicht. Aber ich möchte auch nicht gerade jetzt übersiedeln.«
»Elizabeth«, sagte Mrs Chynoweth, »hol mir bitte meinen Umhang von oben. Mich fröstelt ein wenig.«
»Ja, Mutter.« Sie wandte sich um und ging, hochgewachsen und fast noch kindlich. Ihre Bewegungen zeigten eine ungewöhnliche Anmut für einen so jungen Menschen.
»Dieser Paynter ist ein Schurke«, sagte Charles und wischte sich die Hände an seinen Reithosen ab. »An deiner Stelle würde ich ihn hinauswerfen und mir jemand Verlässlichen besorgen.«
Ross sah Elizabeth nach, wie sie langsam die Treppe hinaufging. »Er war der Freund meines Vaters.«
Charles zuckte etwas verärgert mit den Schultern. »Du wirst das Haus in keinem guten Zustand finden.«
»In einem solchen befand es sich auch nicht, als ich wegging.«
»Iss das, Ross«, sagte Verity und brachte ihm einen aufgetürmten Teller. »Und setz dich hierher.«
Ross dankte ihr und setzte sich auf den Platz, der ihm zwischen Tante Agathe und Mr Chynoweth angeboten wurde. Er hätte es vorgezogen, neben Elizabeth zu sitzen, doch damit musste er noch warten. Er war überrascht, Elizabeth hier zu finden. Sie und ihre Eltern waren in den zwölf Monaten, die er sie gekannt hatte, nicht ein einziges Mal in Nampara gewesen.
Verity half Mrs Tabb, einige der gebrauchten Teller abzuservieren; Francis stand bei der Eingangstür und kaute auf seiner Lippe; die anderen saßen wieder in ihren Stühlen. Schweigen hatte sich über die Gesellschaft gesenkt.
»Es ist keine heitere Gegend, in die Sie zurückkehren«, sagte Mr Chynoweth und zupfte an seinem Bart. »Überall Unzufriedenheit. Hohe Steuern, gesunkene Löhne. Das Land von seinen vielen Kriegen erschöpft; und jetzt, da die Konservativen an der Macht sind, kann ich mir keine schlimmeren Aussichten vorstellen.«
»Wären die Konservativen früher an der Macht gewesen«, meinte Dr Choake, der nicht taktvoll sein wollte, »so hätte nichts von alldem eintreten müssen.«
Ross blickte zu Francis hinüber. »Ich bin in eine Gesellschaft hereingeplatzt. Findet sie zur Feier des Friedens oder zu Ehren des nächsten Krieges statt?«
Auf diese Weise erzwang er die Aufklärung, die zu geben sie gezögert hatten.
»Nein«, sagte Francis, »Ich … er … Die Situation ist die …«
»Wir feiern etwas ganz anderes«, sagte Charles und bedeutete mit einer Handbewegung, man möge sein Glas wieder vollgießen. »Francis soll heiraten. Das feiern wir.«
»Heiraten«, sagte Ross und zerteilte seine Portion. »Und wen?«
»Elizabeth«, sagte Mrs Chynoweth.
Es herrschte Schweigen.
Ross legte sein Messer hin. »Wen –?«
»Meine Tochter.«
»Kann ich dir etwas zu trinken bringen?«, flüsterte Verity Elizabeth zu, die gerade unten an der Treppe auftauchte.
»Nein, nein … Bitte, nicht.«
»Oh«, sagte Ross, »Elizabeth.«
»Wir sind sehr glücklich«, plauderte Mrs Chynoweth, »dass unsere beiden alten Familien sich zusammentun sollen. Sehr glücklich und sehr stolz. Ich bin sicher, Ross, dass du wie wir Francis und Elizabeth viel Glück zu ihrer Verbindung wünschen wirst.«
Sehr sorgfältig, als hätte sie ein wenig Angst vor ihren eigenen Schritten, kam Elizabeth zu Mrs Chynoweth herüber.
»Dein Umhang, Mama.«
»Danke, mein Liebes.«
Ross konzentrierte sich wieder auf seinen Teller.
»Ich weiß nicht, was du davon hältst«, sagte Charles nach einer Weile herzhaft, »aber was mich betrifft, so hänge ich an diesem Portwein. Er wurde im Herbst ’79 von Cherbourg herübergebracht. Als ich einen Probeschluck nahm, sagte ich zu mir, der ist zu gut, um noch einmal zu kommen; da kaufe ich die ganze Ladung. Und es ist auch keine solche mehr gekommen, keine mehr. Und das sind die letzten zwölf Flaschen.« Er senkte die Hände, um seinen dicken Bauch gegen den Tisch abzustützen.
»Ein Pech«, meinte Dr Choake und schüttelte den Kopf. »Er hat ein Bouquet, wie man es selten bei einem Wein findet. Eff-em … wirklich selten.«
»Ich nehme an, du wirst sesshaft werden, Ross, wie?«, sagte Tante Agathe und legte ihre runzlige Hand auf seinen Ärmel. »Wie wär’s also mit einem Frauchen, eh? Das müssen wir als Nächstes für dich finden!«
Ross sah zu Dr Choake hinüber.
»Sie haben meinen Vater behandelt?«
Dr Choake nickte.
»Hat er viel gelitten?«
»Am Ende. Doch es dauerte nur kurze Zeit.«
»Seltsam, dass er so rasch verschied.«
»Es war nichts zu machen. Ein wassersuchtähnlicher Zustand, den zu kurieren sich menschlichen Kräften entzog.«
»Du musst etwas von diesem Apfelkuchen essen, Ross«, sagte Verity leise hinter ihm, während sie auf die Adern in seinem Nacken sah. »Ich habe ihn heute Nachmittag selbst gebacken.«
»Ich darf mich nicht aufhalten. Ich wollte hier nur auf ein paar Minuten hereinschauen und außerdem meinem Pferd, das lahmt, eine Ruhepause gönnen.«
»Oh, es besteht aber keine Notwendigkeit, heute Abend weiterzureiten. Ich habe Mrs Tabb gesagt, sie soll ein Zimmer für dich vorbereiten. Dein Pferd könnte im Dunkeln ausgleiten und dich abwerfen.«
Ross sah zu Verity auf und lächelte. In dieser Gesellschaft konnten sie kein vertrautes Wort miteinander wechseln.
Nun mischten sich Francis und auch sein Vater in die Unterhaltung ein. Doch Francis war befangen, sein Vater halbherzig und Ross entschlossen.
Charles sagte: »Nun, ganz wie du willst, mein Junge. Ich würde mir nicht wünschen, heute Abend in Nampara anzukommen. Es wird kalt und nass sein, und vielleicht wird dich niemand empfangen. Verleibe dir noch ein wenig Geistiges ein, um die Kälte abzuhalten.«
Ross tat, wozu man ihn drängte, und trank drei Gläser hintereinander. Mit dem vierten stand er auf.
»Auf Elizabeth«, sagte er leise, »und auf Francis … Mögen sie miteinander ihr Glück finden.«
Elizabeth stand noch hinter dem Stuhl ihrer Mutter; Francis hatte sich endlich von der Tür wegbewegt, um sich bei ihr unterzuhaken.
»Du wirst in ein oder zwei Tagen herüberkommen, wie?«, sagte Francis, eine Spur von Wärme im Ton. »Wir haben bis jetzt noch nichts von deinen Erlebnissen gehört oder von deiner Verwundung oder von deiner Heimreise, nichts als die bloßen Tatsachen in großen Zügen. Elizabeth wird morgen nach Hause zurückkehren. Wir haben vor, in einem Monat zu heiraten. Falls du meine Hilfe in Nampara brauchst, schick mir eine Nachricht herüber; du weißt, ich würde gern kommen. Es ist ja wie in den alten Zeiten, dich wieder hier zu sehen! Wir hatten Angst, ob du es heil überstehen würdest, nicht wahr, Elizabeth?«
»Ja«, sagte Elizabeth.
Ross nahm seinen Hut. Sie standen zusammen bei der Tür und warteten darauf, dass Tabb die Stute bringen würde. Ross hatte ein frisches Pferd für die letzten drei Meilen abgelehnt.
Francis öffnete die Tür. Der Wind blies ein paar Regentropfen herein. Er ging taktvollerweise hinaus, um zu sehen, ob Tabb schon gekommen war.
Ross sagte: »Ich hoffe, meine Auferstehung zur unrechten Zeit hat keinen Schatten über euren Abend geworfen.«
Elizabeth sah ihn einen Augenblick lang an. Das Licht aus dem Innern warf einen Strahl über ihr Gesicht und die grauen Augen. Die Schatten hatten sich bis zu ihrem Gesicht verbreitet, und sie sah aus, als ob ihr übel sei.
»Ich bin froh, dass du zurück bist, Ross. Ich hatte befürchtet, wir alle hatten befürchtet … Was musst du von mir halten!«
»Zwei Jahre sind eine lange Zeit, nicht wahr? Zu lange vielleicht.«
Francis kam zurück. »Er ist jetzt hier. Hast du die Stute gekauft? Sie ist ein hübsches Tier, aber sehr bösartig.«
»Schlechte Behandlung lässt den Mildesten zur Bestie werden«, erwiderte Ross. »Hat der Regen aufgehört?«
»Nicht ganz. Kennst du deinen Weg?«
»Jeden Kieselstein. Hat sich was daran geändert?«
»Nichts, das dich in die Irre führen könnte. Reite nicht über die Brücke über den Mellingay, die mittlere Planke ist durchgefault.«
»Das war sie schon, als ich wegging.«
»Vergiss nicht«, sagte Francis, »wir erwarten, dass du bald wieder hierher zurückkommst. Verity wird öfter etwas von dir zu sehen bekommen. Wenn sie die Zeit erübrigen kann, werden wir morgen zu dir hinüberreiten.«
Doch nur Wind und Regen gaben ihm eine Antwort sowie der Hufschlag, als die Stute mit Seitenschritten unmutig den Fahrweg hinuntertänzelte.
Es war jetzt dunkel geworden, obwohl im Westen ein Streifen Dämmerlicht glühte. Der Wind blies kräftiger, und der weiche Regen schlug in einem Getrommel gegen seinen Kopf.
In seinem Gesicht wäre nicht leicht zu lesen gewesen, und man hätte aus seinem Ausdruck nicht schließen können, dass er in der letzten halben Stunde den schwersten Schlag seines Lebens erlitten hatte. Außer dass er nicht länger in den Wind pfiff oder mit seiner reizbaren Stute sprach, gab es keinerlei Anzeichen dafür.
Schon früh hatte er von seinem Vater eine Meinung zu den Dingen übernommen, die sehr wenig voraussetzte, doch in seiner Partnerschaft mit Elizabeth Chynoweth war er in die Art Falle geraten, der auszuweichen ihn eine solche Einstellung hätte befähigen müssen. Sie hatten einander geliebt, seit sie sechzehn war und er knapp zwanzig.
Nachdem er eine Zeitlang geritten war, zeigten sich vor ihm die Lichter der Grambler-Grube. Das war die Grube, um welche die Schicksale des Hauptstammes der Familie Poldark sich rankten. Von ihren Launen hing nicht nur der Wohlstand von Charles Poldark und seiner Familie ab, sondern auch der Lebensunterhalt einiger dreihundert Grubenarbeiter und ihrer Familien, die in Hütten und Cottages über die ganze Pfarre verstreut lebten. Für sie war die Grube ein wohlmeinender Moloch, dem sie ihre Kinder in frühen Jahren zum Fraß vorwarfen und von dem sie ihr tägliches Brot erhielten.
Er sah, wie schwankende Lichter ihm entgegenkamen, und schlug sich auf die Seite des Fahrweges, um einen Maultierzug vorbeizulassen, bei dem die Tragkörbe mit Kupfererz zu jeder Seite der Tierrücken angebunden waren. Einer der Begleiter sah misstrauisch zu ihm auf und schrie ihm dann einen Gruß zu. Es war Mark Daniel.
Die Hauptgebäude der Grube umgaben ihn jetzt alle, die meisten von ihnen zusammengedrängt und unbestimmt, doch hie und da überragte das kräftige Gerüst von Freistrukturen und das aus Steinen errichtete Motorenhaus alles Übrige. Gelbe Lichter zeigten sich in den oberen Bogenfenstern des Motorenhauses, warm und geheimnisvoll vor dem tief herabhängenden Nachthimmel. Er kam dicht an einem von ihnen vorbei und hörte das Geratter und Klirren der großen Pumpe, die Wasser von den tiefsten Stellen auf die Erde heraufholte.
Dann erklang in einem der Motorenhäuser eine Glocke mit einem melodischen Ton – das Zeichen für den Schichtwechsel; deshalb waren auch so viele Männer da. Sie gesellten sich zueinander, um einzufahren. Andere würden jetzt gerade auf ihrem Rückweg sein, kletterten wie Ameisen die hundert Faden auf rachitischen Leitern, schweißüberströmt, mit rostigen Spuren der Minerale im Felsen oder dem schwarzen Pulverrauch von Sprengstoff bedeckt.
Sie würden eine halbe Stunde oder mehr brauchen, um an die Oberfläche zu kommen, da sie ja ihre Werkzeuge trugen, und auf der ganzen Strecke würden sie mit dem Wasser aus den löchrigen Pumpen bespritzt und durchnässt werden. Hatten sie dann den Erdboden erreicht, so stand vielen ein Fußmarsch von drei oder vier Meilen durch Wind und Regen bevor.
Er bewegte sich weiter. Hin und wieder war das Gefühl in ihm so stark, dass er körperlich krank hätte sein können.
Der Mellingay war durchwatbar, und Pferd und Reiter fingen an, müde den schmalen Pfad zu der letzten Gruppe von Föhren zu erklettern. Ross machte einen tiefen Atemzug. Die Luft war schwer von Regen und mit dem Geruch des Meeres getränkt. Er stellte sich vor, er könne die Wellen in der Brandung hören. Auf der Anhöhe oben stolperte die Stute, deren böses Temperament wie verflogen war, und stürzte beinahe, so dass Ross ungeschickt abstieg und beschloss, zu Fuß zu gehen. Zuerst konnte er seinen Fuß kaum auf den Boden setzen, doch er begrüßte diesen Schmerz im Gelenk, weil er seine Gedanken beschäftigte, die sonst anderswo gewesen wären. Auf der anderen Seite des Pfades lagen jetzt die verfallenen Gebäude von Wheal Maiden – eine Grube, die seit vierzig Jahren versiegt war; als Junge hatte er hier seine Schlachten geliefert und war auf der verfallenen Seilwinde und auf dem Pferdeseilzug herumgeklettert, hatte den kurzen ebenen Stollen erkundet, der den Hügel durchquerte und nahe dem Fluss herauskam.
Jetzt spürte er, dass er wirklich zu Hause war; im nächsten Augenblick würde er auf seinem eigenen Land stehen. An diesem Nachmittag hatte ihn die Aussicht darauf mit Freude erfüllt, doch jetzt schien nichts mehr zu zählen.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.