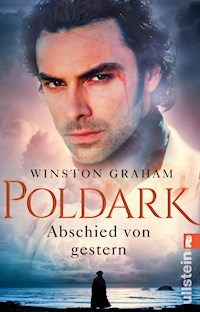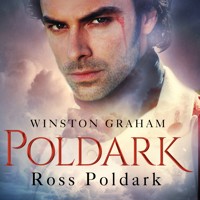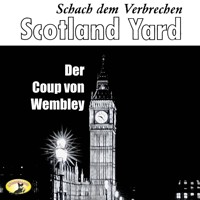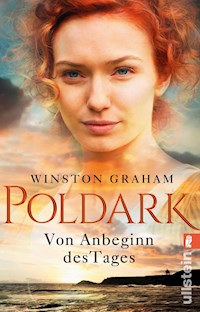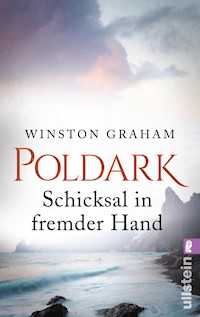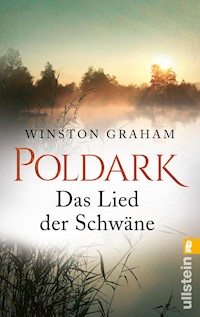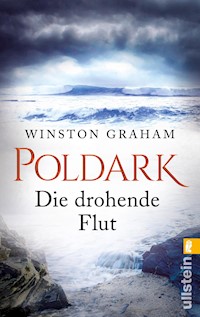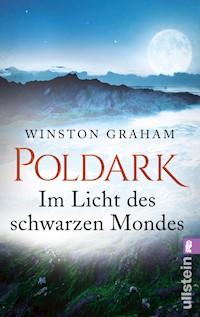
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Cornwall 1794-1795 Ross Poldark und George Warleggan sind verbissene Rivalen. Die Geburt des Sohnes von Elizabeth und George weitet die Kluft zwischen den Poldarks und den Warleggans noch mehr. Als sich die Gouvernante der Familie Warleggan, in Demelzas Bruder verliebt, wird die Rivalität zwischen George und Ross zu bitterer Feindschaft … »Vom unvergleichlichen Winston Graham …, der all das hat, was die anderen haben, und dann noch eine ganze Menge mehr« The Guardian Der fünfte Roman der großen Poldark-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Cornwall, 1794 bis 1795: Die Vergangenheit lässt Ross Poldark nicht los. Als Elizabeth und George Warleggan einen Sohn bekommen, verschärft sich die Rivalität der beiden Männer noch mehr. In diesem Klima aus Hass und Misstrauen verliebt sich Morwenna Chynoweth, die Gouvernante der Familie Warleggan, in Demelza Poldarks Bruder Drake Carne. Kann diese Liebe die Kluft zwischen den beiden Familien überbrücken, oder wird sie an der Feindschaft zwischen Ross und George zerbrechen?
Der Autor
Winston Mawdsley Graham, geboren 1908 in Manchester, gestorben 2003 in London, hat über vierzig Romane geschrieben, darunter auch Marnie, der 1964 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Er war Mitglied der Royal Society of Literature sowie des Order of the British Empire und lebte in London und Cornwall.
Die Poldark-Serie von Winston Graham ist in unserem Hause in chronologischer Reihenfolge erschienen:
Poldark – Abschied von gestern
Poldark – Von Anbeginn des Tages
Poldark – Schatten auf dem Weg
Poldark – Schicksal in fremder Hand
Poldark – Im Licht des schwarzen Mondes
Poldark – Das Lied der Schwäne
Poldark – Die drohende Flut
Winston Graham
Poldark
Im Licht des schwarzen Mondes
Roman
Aus dem Englischenvon Christiane Kashin
Ullstein
Diese Ausgabe ist erstmals 1981unter dem Titel Im dunklen Licht des Mondes imVerlag Fritz Molden erschienen.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1239-2
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© Winston Graham 1973Titel der englischen Originalausgabe: The Black Moon(Pan Books, Pan Macmillan, London 2008; first published in 1973 by William Collins Sons & Co. Ltd)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Erstes Buch
1
Mitte Februar 1794 gebar Elizabeth Warleggan in Trenwith ihr zweites Kind, das erste aus ihrer Ehe mit George Warleggan.
Das Haus war in Aufruhr. Zwar hatten Elizabeth und George ursprünglich beschlossen, dass die Niederkunft in ihrem Stadthaus stattfinden sollte, wo Elizabeth die besten Ärzte zur Verfügung standen, doch in Truro hatten monatelang Epidemien gewütet, zuerst die Cholera, die bis Weihnachten dauerte, dann die Grippe und die Masern. Und Dr Behenna, der jede Woche zu ihnen herauskam, um nach seiner Patientin zu sehen, versicherte ihnen, es bestehe kein Grund zur Eile.
Doch am dreizehnten, einem Donnerstag, glitt Elizabeth, als sie zu ihrem Zimmer gehen wollte, aus und stürzte. Die Treppe, die von der großen Halle nach oben führte, mündete auf einen dunklen Korridor, von dem aus man über weitere fünf Treppenstufen zu den beiden großen Schlafzimmern des Hauses gelangte. Elizabeth blieb mit dem Fuß an dem ausgezackten Rand der oberen Stufe hängen und fiel.
Sofort war das ganze Haus in Aufruhr. George wurde gerufen und trug seine bewusstlose Frau zu ihrem Bett. Da Dr Dwight Enys noch immer auf See war, blieb nichts anderes übrig, als den alten Dr Choake zu rufen; außerdem ritt ein Diener nach Truro, um Dr Behenna zu holen.
Elizabeth hatte, von einem zerschrammten Ellbogen und einem leicht verstauchten Fuß abgesehen, offenbar keinen Schaden erlitten, und nachdem Dr Choake sie zur Ader gelassen und ihr ein Herzstärkungsmittel verabreicht hatte, schlief sie ein. George mochte Choake nicht; alles an ihm war ihm unsympathisch – seine eitle Selbstgefälligkeit, seine grobe Art, Patienten gleich unters Messer zu nehmen, seine einfältige Frau, seine Zugehörigkeit zur Whig-Partei –, doch er nahm sich zusammen, lud den alten Mann zum Abendessen ein und schlug ihm vor, über Nacht in Trenwith zu bleiben. Choake, der seit Francis Poldarks Tod das Haus nicht mehr betreten hatte, lehnte steif ab.
Es war ein trübsinniges Mahl. Mrs Chynoweth, Elizabeths Mutter, wollte nicht essen und bestand trotz ihrer schlechten körperlichen Verfassung – sie konnte seit ihrem Schlaganfall nur stotternd sprechen, ein Bein war gelähmt und ein Auge blind – darauf, sich im Zimmer ihrer Tochter aufzuhalten, falls diese erwachte. So leistete nur der alte Jonathan Chynoweth den beiden andern Männern am Tisch Gesellschaft. Sie sprachen über den Krieg mit Frankreich, die Getreideknappheit, die steigenden Preise von Zinn und Kupfer. George, dem die andern beiden zuwider waren, hörte meist schweigend zu. Er hatte sich wieder beruhigt, sann aber darüber nach, dass Elizabeth sich in Zukunft mehr in Acht nehmen müsse. Sie war oft viel zu leichtsinnig gewesen, hatte zu wenig an die Sicherheit des Kindes gedacht. George hätte es verstehen können, wenn sie hin und wieder niedergeschlagen, unausgeglichen, weinerlich gewesen wäre. Aber dass sie sich auf ein Pferd setzte, das lange im Stall gestanden hatte und ohnehin als unberechenbar galt, dass sie schwere Bücher aus einem Regal nahm, darauf war George nicht gefasst gewesen.
Überhaupt erschien Elizabeth ihm nun in einem andern Licht. Er entdeckte immer wieder neue Seiten an ihr – manches, was ihn faszinierte, manches, was ihn beunruhigte. Jahrelang war sein größter Wunsch gewesen, sie zu besitzen, doch er hatte sie besitzen wollen wie ein Sammler und Kenner, der einen schönen und begehrenswerten Gegenstand erblickt. Seit seiner Heirat war dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, aber das hatte an seinem Besitzerstolz nichts geändert. Im Gegenteil, er hatte Elizabeth nun erst richtig kennengelernt. Und wenn George überhaupt lieben konnte, so liebte er seine Frau.
Als George so seinen Gedanken nachhing und das Geschwätz der beiden alten Männer an sich vorbeirauschen ließ, trat ein Diener ein und meldete, Mrs Poldark sei aufgewacht und habe Schmerzen.
Dr Behenna traf gegen Mitternacht ein. Er war in den Dreißigern, ein kräftiger, untersetzter und selbstbewusster Mann, der sich erst vor einigen Jahren in Truro niedergelassen hatte. Mit seinen neuen Methoden hatte er einige aufsehenerregende Erfolge gehabt, vor allem aber hatte er in London bei berühmten Ärzten Geburtshilfe studiert.
Nachdem er die Patientin untersucht hatte, teilte er George mit, die Schmerzen seiner Frau seien eindeutig Geburtswehen. Das Kind sei am Leben, werde aber vorzeitig zur Welt kommen. Trotzdem bestehe kein Grund zu übermäßiger Sorge.
Am nächsten Tag gegen Mittag trafen Georges Eltern ein. Sie hatten in Truro von Elizabeths Unfall gehört. Und Nicholas Warleggan hielt es für seine Pflicht, seinem Sohn in diesen kritischen Stunden beizustehen. George war mittlerweile schier außer sich vor Angst und Unruhe.
Elizabeth lag nach wie vor in den Wehen. Als Dr Behenna um fünf Uhr mit der Familie den Tee einnahm, sagte er, das dritte Stadium sei nun erreicht, und er habe sich entschlossen, wenn das Kind nicht bald komme, die Zange anzusetzen, da der bloße Reiz des Metalls die Wehen beschleunigen und möglicherweise doch noch zu einer natürlichen Geburt verhelfen werde.
Doch die Vorsehung war auf Seiten der Mutter. Um sechs kamen die Wehen häufiger, ohne Stimulanz. Um Viertel nach acht gebar Elizabeth einen gesunden Knaben. Zum selben Zeitpunkt trat eine totale Mondfinsternis ein.
Später wurde George ein Besuch bei Frau und Sohn gestattet. Elizabeth lag erschöpft im Bett, ihr Gesicht war blass, doch sie lächelte – zum ersten Mal seit Wochen. George beugte sich über sie und küsste ihre feuchte Stirn. Dann ging er zur Wiege hinüber und betrachtete das kleine, rotgesichtige Häufchen Menschlichkeit, das, wie eine Mumie verpackt, darin lag. Sein Sohn. Vor fünfunddreißig Jahren hatte Nicholas Warleggan mit einer Zinnschmelzhütte begonnen und nach und nach ein Vermögen angehäuft. Heute erstreckten sich die Minen- und Bankinteressen der Warleggans bis nach Plymouth. Zu dieser Expansion hatte George in den letzten zehn Jahren weitgehend beigetragen. All das sollte dieser Knabe, wenn er die Fährnisse der Kindheit überstand, eines Tages erben.
George war sich klar darüber, dass seine Ehe mit Elizabeth Poldark für seine Eltern eine herbe Enttäuschung bedeutet hatte. Nicholas hatte Mary Lashbrook, eine ungebildete Müllerstochter, geheiratet, und das hatte sich auf seinen sozialen Aufstieg hemmend ausgewirkt. Für seinen Sohn hatte er andere Ambitionen. George hatte eine sorgfältige Erziehung genossen, er war vermögend, war in der Lage, sich in Kreisen zu bewegen, die Nicholas in seiner Jugend verschlossen gewesen waren und ihm auch heute noch nicht völlig offenstanden. Sie hatten Töchter aus wohlhabenden Häusern auf ihren Landsitz in Cardew eingeladen, hatten Gesellschaften für adlige und einflussreiche Leute in ihrem Haus in Truro veranstaltet und dabei peinliche Absagen riskiert. Sie hatten so sehr auf Georges Sinn für sozialen Aufstieg gebaut, hatten so sehr gehofft, er werde sich für eine Frau mit Titel und Einfluss entscheiden. Stattdessen war er bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr unverheiratet geblieben und hatte sich trotz seines sozialen Ehrgeizes für die zarte, verarmte Witwe von Francis Poldark entschieden.
Zwar war Elizabeths Familie alt und in der Grafschaft sehr angesehen. Aber sie war auch degeneriert – man brauchte nur Elizabeths Vater anzusehen, um das zu erkennen. Seit langem hatten die Chynoweths nicht mehr zustande gebracht, als nur weiterzuleben. Nicht einmal eine vorteilhafte Heirat war ihnen geglückt.
Doch Elizabeth war schön – und sie war jetzt schöner denn je. Ihr Äußeres war makellos und frisch, und sie wirkte mit ihren dreißig Jahren wie eine Zwanzigjährige, die ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat.
Zu den Ersten, die Elizabeth im Wochenbett besuchten, zählte natürlich ihr Schwiegervater. Nachdem er sie geküsst und sich nach ihrem Befinden erkundigt hatte, bewunderte er seinen Enkel. Als er schließlich das Schlafzimmer verließ, den knarrenden Flur zur Treppe entlangging und die Stufen zur großen Halle hinabstieg, dachte er: Ich sollte zufrieden sein. Das Fortbestehen der Familie war gesichert. Seine Schwiegertochter hatte seinen Erwartungen entsprochen. Mehr konnte er von ihr nicht verlangen. Vielleicht hatten die Warleggans, vor allem in der Zukunft, auch keine einflussreichen familiären Beziehungen mehr nötig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die großen Familien in Cornwall sie akzeptieren würden. Und Elizabeth gehörte zu ihnen. Einen Titel konnte man auch auf andere Weise bekommen – vielleicht durch einen Sitz im Parlament oder durch größere Stiftungen … Der Krieg musste sich günstig auswirken. Die Kaufleute und Händler würden an ihm verdienen, die Banken florieren. In der vergangenen Woche war der Zinnpreis um fünf Pfund gestiegen.
Abgesehen von ihrer vornehmen Abstammung hatte Elizabeth auch noch dieses Haus in die Ehe gebracht, das 1509 gebaut und erst 1531 vollendet worden war. Im letzten Sommer hatte George es gründlich restaurieren lassen. Zum ersten Mal war Nicholas vor elf Jahren hier gewesen, bei dem Empfang und dem Bankett anlässlich der Heirat von Elizabeth Chynoweth mit dem Sohn des Hauses, Francis. Damals war der alte Charles William noch am Leben gewesen, Herr des Hauses, des Bezirks, des Familienclans; sein Erbe war Francis, ein lebhafter Zweiundzwanzigjähriger. Dann war da noch die Tochter Verity, die später einen unbedeutenden Seemann geheiratet hatte und nun in Falmouth lebte. Außerdem gab es die Vettern – William Alfred, einen frömmelnden Pfarrer, der mit seiner Familie in Devon lebte. Und Ross Poldark, der bedauerlicherweise in der Nachbarschaft wohnte und wider Erwarten zu Wohlstand gekommen war.
Nicholas ging zu dem großen Fenster der Halle hinüber und blickte hinaus. Damals, vor elf Jahren, war die stattliche Halle nicht so still gewesen wie jetzt. Er erinnerte sich, wie sehr er die Poldarks damals um dieses Haus beneidet hatte. Zwar hatte er kurz darauf ein Haus gekauft, das doppelt so groß war – Cardew, seinen in palladianischem Stil gebauten Landsitz, mit dem verglichen Trenwith provinziell und altmodisch wirkte. Aber Trenwith hatte Stil, und außerdem war es schon immer im Besitz der Poldarks gewesen. Nicholas erinnerte sich, wie grau und hager der junge Ross Poldark damals gewirkt hatte. George kannte ihn schon lange, doch er, Nicholas, hatte ihn erst bei der Hochzeit kennengelernt und hatte sich über sein düsteres Wesen gewundert, bis George ihn über die Ursache aufgeklärt hatte. Offenbar hatten alle – Ross, Francis und George – Elizabeth haben wollen. Ross hatte geglaubt, sie gehöre ihm, doch während seines Aufenthalts in Amerika war er von seinem Vetter Francis ausgebootet worden. Was machte diese Frau eigentlich so begehrenswert? Kopfschüttelnd stocherte Nicholas im Kaminfeuer. Wahrscheinlich ihre Zartheit, ihre zerbrechliche, ätherische Schönheit. Alle drei hatten Elizabeth beschützen, umsorgen wollen, jeder hatte der starke Mann sein wollen, der die schöne, hilflose junge Frau verwöhnte. Selbst sein eigener Sohn, der so vernünftig, manchmal fast zu berechnend war, hatte so reagiert.
Als Nicholas im Feuer stocherte, fiel ein kleines Holzscheit klappernd zu Boden, und Nicholas bückte sich, um es mit der Zange wieder an seinen Platz zu befördern. In diesem Augenblick bewegte sich etwas in dem Lehnstuhl neben dem Kamin.
Nicholas fuhr auf. »Wer ist das?«, sagte er scharf. »Bist du das, George?« Dann sah er, dass es Agatha Poldark war.
Abgesehen von Geoffrey Charles, Elizabeths Sohn aus ihrer ersten Ehe, der bisher kaum zählte, war Agatha das letzte Mitglied der Poldark-Familie, das noch im Haus lebte. Den Warleggans gegenüber zeigte sie Verachtung und beleidigte sie ständig. Sie war eine hagere alte Hexe, die nur noch aus Haut und Knochen bestand und eigentlich längst hätte tot sein müssen. Es hieß, im August werde sie neunundneunzig Jahre alt. Noch vor einem Jahr hatte es so ausgesehen, als müsse sie für den Rest ihres Lebens das Bett hüten und als könnten die Warleggans sie einfach stillschweigend vergessen, doch seit Elizabeths Heirat und vor allem seit sie erfahren hatte, dass ein Kind unterwegs war, war ihre Vitalität und damit auch ihre Streitsucht so weit wieder aufgeflammt, dass sie nun – meist im unpassendsten Augenblick – irgendwo im Haus auftauchte und herumschlurfte.
»Oh, da ist ja Georges Vater …« Aus ihrem einen Auge löste sich eine Träne, blieb einen Augenblick in einer Falte stecken und rann dann langsam die Wange hinab bis zu dem behaarten Kinn. Sie war kein Zeichen von Bewegtheit, sondern nur von Altersschwäche. »Sie waren wohl oben und haben sich das Kleine angesehen, wie? Ein hübsches kleines Dingelchen. Durch und durch ein Chynoweth.«
Auf ihrem Schoß saß ein schwarzes Kätzchen. Das war Smollett. Sie hatte es vor ein paar Monaten irgendwo gefunden, und seitdem waren die beiden unzertrennlich.
Nicholas wusste, dass Agathas Worte nur dem einen Zweck dienten: ihn zu ärgern. Doch diese Erkenntnis hinderte ihn nicht daran, sich tatsächlich zu ärgern. Besonders ärgerlich war auch, dass er ihr nicht in geziemender Weise antworten konnte, denn sie war fast taub, und man konnte sich nur mit ihr verständigen, wenn man ihr ins Ohr schrie. Da es unmöglich war, ihr zu widersprechen, konnte sie ungehindert eine boshafte Bemerkung nach der andern machen. George hatte ihm gesagt, es gebe nur ein Mittel, sie ebenfalls zu ärgern: wenn sie spreche, müsse man ihr den Rücken kehren und einfach fortgehen. Doch Nicholas hatte keine Lust, sich von dieser widerspenstigen alten Frau vom Feuer vertreiben zu lassen.
Er legte das Holzscheit wieder auf die Glut, doch so ungeschickt, dass ein Ende herausragte und eine dünne Rauchsäule zur Decke stieg.
»Dieser Arzt«, sagte Agatha, »ist ein richtiger Hohlkopf. Er hat den Kleinen viel zu fest gewickelt. Wenn ich darüber zu bestimmen hätte, kriegte der Junge mehr Luft.«
»Sie haben aber nicht darüber zu bestimmen«, antwortete Nicholas.
»Wie? Was sagten Sie? Reden Sie lauter!«
In diesem Augenblick öffnete sich eine Tür, und George trat ein. Manchmal, besonders wenn die beiden unter sich und entspannt waren, trat die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn stark zutage. George war etwas kleiner als sein Vater, hatte aber die gleiche schwere Statur, den gleichen starken Nacken, den gleichen entschlossenen Schritt.
»Was sehe ich da«, sagte George, als er näher kam. »Mein Vater unterhält sich mit der alten Hexe. Früher hätte man solche längst überfälligen alten Weiber rechtzeitig ertränkt. Es ist eine Schande, dass man in einem kultivierten Haushalt so etwas ertragen muss.«
Zu Agathas Genugtuung machte das Kätzchen einen Buckel und fauchte den Neuankömmling an. »Ah, George«, sagte sie. »Sicher fühlen Sie sich nun als großer Mann, seit Sie Vater eines achtmonatigen Kindes geworden sind. Wie soll es denn heißen, he? Georges gibt’s schon zu viele.« Sie hustete. »Das Feuer qualmt. Mr Warleggan versteht nicht, damit umzugehen.«
»Wenn ich hier zu bestimmen hätte, würde ich das Weib in ihrem Zimmer einsperren«, sagte Nicholas. »Sie braucht jemanden, der auf sie aufpasst.«
»Wenn ich hier zu bestimmen hätte«, erwiderte George, »so käme sie morgen auf den Kehrichthaufen – und vielleicht noch ein paar andere.«
»Wer hat denn hier eigentlich zu bestimmen?«, fragte Nicholas.
George blickte ihn nachdenklich an. »Ich. Aber wenn man die Zitadelle erst einmal eingenommen hat, kann man mit der Säuberungsaktion eine Zeitlang warten.«
»Ihr könntet ihn Robert nennen«, ertönte Tante Agathas dünne Stimme aus dem Lehnsessel. »Nach Robert dem Buckligen. Wäre der Erste dieses Namens. Oder Ross. Was meint ihr zu Ross?« Husten, mit boshaftem Gelächter untermischt, schüttelte sie.
George wandte sich ab, ging zum Fenster hinüber und blickte hinaus. »Ich hoffe«, sagte er, »die alte Hexe erstickt noch mal an ihrer Bosheit.«
»Amen … Aber was den Namen betrifft … Sicher habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht. In unserer Familie gibt es ein paar gute …«
»Das habe ich schon entschieden. Schon vor seiner Geburt.«
»Vor seiner Geburt? Wieso? Wenn es ein Mädchen gewesen wäre –«
»Dieser Unfall, den Elizabeth hatte, hätte für beide lebensgefährlich sein können. Doch es war nicht so, und ich habe das Gefühl, dass hier die Vorsehung gewaltet hat – alles scheint auf einen bestimmten Tag hinzuweisen. Und als das Kind an diesem Tag geboren wurde, habe ich mich auch für den Namen entschieden. Wenn es ein Mädchen gewesen wäre, hätte ich ihm den gleichen gegeben.«
»Und welchen?«, fragte Nicholas.
»Valentin.«
»Valentin«, wiederholte Nicholas. »Valentin Warleggan. Das spricht sich gut. Aber in beiden Familien gibt es niemanden dieses Namens.«
»Mein Sohn wird in beiden Familien einzigartig sein.«
»Hm. Ich werde deine Mutter fragen, ob der Name ihr gefällt. Gefällt er Elizabeth?«
»Elizabeth weiß es noch nicht.«
Nicholas zog die Augenbrauen hoch. »Aber du bist sicher, dass er ihr gefällt?«
»Ich bin sicher, dass sie zustimmt. Wir sind in so vielen Dingen der gleichen Meinung. Sie wird mir zustimmen, dass diese Frucht der Vereinigung zwischen ihr und mir – zwischen dem ältesten Adel und dem jüngsten – eine seltene Frucht ist und nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft blicken sollte. Wir brauchen einen ganz neuen Namen.«
Nicholas hustete nun auch und trat vom Feuer fort. »Den Namen Warleggan wirst du behalten müssen, George.«
»Ich will ihn gar nicht ablegen, werde es nie wollen, Vater. Er wird bereits respektiert – und gefürchtet.«
»Du sagst es … auf den Respekt sollten wir bauen, die Furcht aber zerstreuen.«
»Onkel Cary würde dir da nicht beistimmen.«
»Du hörst viel zu viel auf Cary.« Nicholas ging zum Feuer hinüber und schob das qualmende Holzscheit so zurecht, dass der Rauch in den Schornstein hinaufging.
»Das ist schon besser, mein Sohn«, sagte Agatha.
George ging zur Klingel und zog an der Quaste. Schweigend warteten sie, bis ein Diener eintrat. »Holen Sie mir die Harry-Brüder her«, sagte George.
»Jawohl, Sir.«
Gleich darauf trat Harry Harry in die Halle, von seinem jüngeren Bruder Tom gefolgt. »Sir?«
»Bringen Sie Miss Poldark auf ihr Zimmer«, sagte George. »Klingeln Sie dann Miss Pipe und sagen Sie ihr, dass Miss Poldark heute hier unten nicht mehr erwünscht ist.«
Die beiden Männer holten einen kleineren Stuhl herbei und setzten die heftig protestierende Tante Agatha darauf. Das miauende Kätzchen an die Brust gedrückt, krächzte sie: »Du wirst keine Freude an deinem kleinen Sohn haben, George. Gott ist einem Kind, das bei Mondfinsternis geboren wurde, nicht wohlgesonnen. Ich kenne zwei solche, und sie haben beide ein böses Ende genommen!«
Ihre dünne Stimme verlor sich, als die Harry-Brüder sie die Treppe hinauftrugen.
»Elizabeth hätte das Kind in Cardew bekommen sollen«, sagte Nicholas, »dann wäre uns dieser Ärger erspart geblieben.«
»Mir erscheint es aber ganz passend, dass unser erstes Kind hier geboren wurde.«
»Willst du denn hier bleiben? Willst du Trenwith zu eurem Heim machen?«
»Ich weiß noch nicht«, erwiderte George unschlüssig. »Immerhin war es bisher Elizabeths Heim. Ich werde es jedenfalls nicht verkaufen. Aber ich habe auch nicht vor, es nur für die Chynoweths und Poldarks zu erhalten. Ich habe auch schon eine ganze Menge Geld für dieses Haus ausgegeben.«
»Ich weiß. Und es gibt noch einen anderen Poldark, um den du dir Gedanken machen musst.«
»Geoffrey Charles?«
»Ja.«
»Ich habe nichts gegen ihn. Ich habe Elizabeth versprochen, dass er eine gute und teure Ausbildung bekommt.«
»Das meinte ich gar nicht. Er hängt zu sehr am Schürzenzipfel seiner Mutter. Ich hoffe, dass dein Sohn Elizabeth ein wenig von Geoffrey Charles ablenkt, aber in jedem Fall halte ich es für nötig –«
»Ich weiß genau, was nötig ist, Vater.«
»Entschuldige. Ich wollte nur vorschlagen …«
Stirnrunzelnd blickte George auf einen Flecken auf seiner Manschette. Die Frage von Geoffrey Charles’ Zukunft war einer der wenigen Punkte, in denen er mit Elizabeth in den vergangenen Monaten nicht einer Meinung gewesen war. »Geoffrey Charles wird eine Gouvernante bekommen.«
»So … das ist gut … aber mit zehn Jahren –«
»Es wäre besser für ihn, wenn er einen Lehrer hätte oder von hier fortginge, da stimme ich dir zu. Irgendeine gute Schule in der Nähe von London. Oder in Bath. Aber so weit … sind wir noch nicht.«
»So.«
George schwieg eine Weile, dann fügte er hinzu: »Er wird noch etwa ein Jahr hierbleiben. Wir haben ein junges Mädchen gefunden, das sich um ihn kümmern kann.«
»Woher stammt sie?«
»Aus Bodmin. Sicher erinnerst du dich noch an Hubert Chynoweth, Jonathans Vetter, der dort Dekan war.«
»Ist er gestorben?«
»Ja. Im letzten Jahr. Wie alle Chynoweths besaß er kein Privatvermögen, und seiner Familie geht es deshalb nicht gut. Seine älteste Tochter ist siebzehn. Sie ist sanft und gefügig wie alle Chynoweths und gut erzogen. Elizabeth wird sich freuen, sie hier zu haben. Und die Tochter eines Dekans ist als Gouvernante durchaus akzeptabel.«
»Ja, da stimme ich dir bei. Sicherlich weiß sie sich zu benehmen. Die Frage ist nur, ob sie imstande ist, auch Geoffrey Charles Manieren beizubringen. Er ist sehr verwöhnt und braucht eine feste Hand.«
»Die wird er bald bekommen«, erwiderte George. »Dies ist nur eine Zwischenlösung. Ein Versuch. Wir werden sehen, ob er gutgeht.«
2
Am Vormittag eines windigen Märztages wanderten zwei junge Männer den Pfad entlang, der an den verfallenen Gebäuden der Grambler-Mine vorbeiführte. Tiefhängende Wolken trieben am Himmel; gelegentlich gab es einen Regenschauer. Das Meer war unruhig und trug weiße Schaumkronen, und an den Felsen zerstäubte das Wasser zu feinem Nebel.
Etwa ein Dutzend Hütten scharten sich um die Mine. Sie waren noch immer bewohnt, aber in schlechtem Zustand. Die Grambler-Mine, die einst den Poldarks Wohlhabenheit beschert und dreihundert Bergleute ernährt hatte, war nun seit sechs Jahren stillgelegt, und ihre verfallenden Gebäude boten einen trüben Anblick.
»Es ist überall das Gleiche, Drake«, sagte der ältere der beiden jungen Männer. »Von Illuggan bis hierher eine Mine nach der andern. Ein hässliches Bild. Aber wir dürfen nicht in die Sünde der Undankbarkeit verfallen. Unser barmherziger Herrgott hat uns das als Züchtigung auferlegt.«
»Sind wir auf dem richtigen Weg?«, fragte Drake. »Ich bin, glaube ich, noch nie hier gewesen. Oder? Ich erinnere mich nicht.«
»Nein, du warst noch zu klein.«
»Wie weit ist es noch?«
»Ungefähr fünf Kilometer. Ich erinnere mich auch nicht mehr genau.«
Auf den ersten Blick wirkten die beiden jungen Männer nicht wie Brüder. Sam sah sehr viel älter aus als zweiundzwanzig. Er hatte breite Schultern, einen linkischen Gang, ein schmales, trotz seiner Jugend gefurchtes Gesicht, aus dem die Augen düster blickten. Erst wenn er lächelte, machte er einen freundlichen und liebenswürdigen Eindruck. Der achtzehnjährige Drake war ebenso groß wie er, aber schmaler gebaut. Er sah auffallend gut aus mit seinem fein geschnittenen, fröhlichen Gesicht, das keine Pockennarben trug. Zu Hause beim Vater hatte er diesen Hang zur Fröhlichkeit stets zügeln müssen. Beide waren ärmlich, aber anständig gekleidet; jeder trug ein kleines Bündel und einen Stock.
Sie betraten eine halb morsche Brücke und überquerten den Mellingey, dann stiegen sie den Hang zu einem Kiefernwäldchen hinauf. Dahinter lag die nächste verfallene Mine, Wheal Maiden. Krächzend erhoben sich Krähen von den überwucherten Steinen.
Doch als sie ins Tal kamen, sahen sie Rauch. Nun, da sie sich ihrem Ziel näherten, gingen sie langsamer. Durch Farn, Ginster, Weißdorn und wilde Nussbäume bot sich ihnen der Blick auf das Maschinenhaus. Es war nicht neu, schien aber instand gesetzt worden zu sein. Neu war das Kopfgestell, waren die Hütten, die sich um die Mine scharten. Das Geklapper und Gestoße der vom Mellingey getriebenen Zinnstampfwerke drang zu ihnen herüber. Unten im Tal, nur von einem kleinen Stück Wiese und einigen Büschen von der Mine getrennt, lag ein niedriges Steinhaus, teils schiefer-, teils strohgedeckt, größer und stattlicher als ein Bauernhaus, mit vielen Nebengebäuden und viereckigen Schornsteinen. Hinter dem Haus lag ein sacht ansteigendes gepflügtes Feld und rechter Hand der Strand, der zum schiefergrauen Meer hinunterführte.
»Also ist es wahr«, sagte Drake.
»Ja, anscheinend. Sieht alles ganz anders aus als damals.«
»Ist die Mine neu?«
»Ich glaub schon. Nanfan sagte, sie wäre erst wieder seit zwei Jahren in Betrieb.«
Drake fuhr sich mit der Hand durch sein üppiges schwarzes Haar. »Ganz hübsches Haus. Allerdings nicht so groß wie Tehidy.«
»Die Poldarks sind kleiner Landadel, kein großer.«
»Immer noch groß genug für uns«, erwiderte Drake und lachte nervös.
»Vor dem Angesicht Jehovas sind alle Menschen gleich«, sagte Sam.
»Kann sein, aber mit Jehova haben wir es hier nicht zu tun.«
Sie überquerten abermals den Fluss und kamen zum Haus. Bevor sie klopfen konnten, öffnete sich die Tür, und eine kleine, dicke, braunhaarige Frau in mittlerem Alter, die einen Korb trug, trat heraus. Als sie die beiden jungen Männer erblickte, blieb sie stehen und wischte sich die freie Hand an ihrer Schürze ab.
»Bitte schön, Madam«, sagte Sam, »wir würden gern mit Mrs Poldark sprechen.«
»Sagen Sie ihr, zwei Freunde wären da«, fügte Drake hinzu.
»Freunde?« Jane Gimlett musterte die beiden Männer unschlüssig. »Wartet hier«, sagte sie und ging ins Haus zurück. Ihre Herrin war in der Küche und wusch Jeremy, der sich beim Überklettern einer Mauer aufgeschürft hatte, eine Wunde am Knie aus. Ein großer, struppiger Hund von unbestimmbarer Rasse lag neben ihr. »Draußen sind zwei junge Männer, Madam. Die wollen mit Ihnen sprechen. Bergleute oder so, würde ich sagen.«
»Bergleute? Von unserer Mine?«
»Nein. Fremde.«
Demelza wischte sich eine Locke aus der Stirn und richtete sich auf. »Bleib hier, mein Schatz«, sagte sie zu Jeremy und ging zur Vordertür. Blinzelnd blickte sie die beiden jungen Männer an, erkannte sie aber nicht gleich.
»Wir sind hergekommen, um dich zu sehen, Schwester«, sagte Sam. »Ist sechs Jahre her, seit wir uns zuletzt getroffen haben. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Sam, der Zweite. Ich erinnere mich gut an dich. Das ist Drake, der jüngste. Er war sieben, als du weggegangen bist.«
»Du meine Güte!«, rief Demelza. »Was seid ihr beide gewachsen!«
Ross war mit Will Henshawe und den beiden Ingenieuren, die die Maschine gebaut hatten, in der Mine gewesen, um das Pumpgestänge zu überprüfen, und da die Maschine für diesen Zweck gestoppt werden musste, hatten sie auch die Gelegenheit ergriffen, den Kessel zu reinigen.
Nachdenklich, aber guter Stimmung kehrte Ross nun nach Nampara zurück. Die Mine hatte die Grenzen ihrer mutmaßlichen Expansion erreicht. Die Maschine arbeitete auf vollen Touren; eine zweite zu bauen, war bei den gegenwärtigen Kohlepreisen nicht ratsam. Doch da die Adern so ergiebig und trotz ihrer Tiefe gut zugänglich waren, brachte diese Mine nun besseren Gewinn als manche andere. Große Konzerne wie die Vereinigten Minengesellschaften hatten jährlich elftausend Pfund verloren, bis sie sich entschlossen, ihre Minen zu schließen. Wheal Grace war klein, hatte aber in ihren Erträgen Ross’ Erwartungen weit übertroffen. Innerhalb eines halben Jahres hatte er seine gesamten Schulden abzahlen können. Bald würde er in der Lage sein, Geld auf einer Bank zu deponieren oder zu fünf Prozent anzulegen, es in Beuteln unter dem Bett zu verstecken oder einfach auszugeben.
Dieser plötzliche Erfolg konnte einem wirklich zu Kopf steigen. Weder er noch Demelza hatten sich bisher daran gewöhnt. Da die Mine so nah beim Haus lag, ging er zum Mittagessen, gegen zwei Uhr, meist nach Nampara. Jetzt war es erst eins, doch er wollte in der Bibliothek noch einen Blick auf die Kostenbücher werfen. Seit ihrer Versöhnung zu Weihnachten hatte er sich so viel wie möglich in Nampara aufgehalten. Damals hatte Demelza fortgehen wollen. Dass sie so kurz vor einer Trennung gestanden hatten, schien ihnen nun unglaublich. Und ihre Versöhnung war leidenschaftlich und zärtlich gewesen. Dennoch waren die alten Wunden noch nicht ganz verheilt, das tiefe, ruhige Gefühl des Vertrauens, das sie einst empfunden hatten, war noch nicht ganz wiederhergestellt.
Georges Anwesenheit in Trenwith setzte ihrer Freude über den Erfolg der Mine einen Dämpfer aus. Und die Geburt und Taufe des kleinen Valentin war ein neuer Dorn im Fleisch. Keiner von beiden sprach aus, was sie bewegte, denn es waren unaussprechliche Gedanken. Caroline Penvenen hatte Demelza geschrieben:
Ich war sehr enttäuscht, Sie nicht zu sehen, obwohl ich es, ehrlich gesagt, nicht erwartet hatte, da ich ja weiß, wie sehr Ross und George einander lieben. Ich war noch nie in Trenwith gewesen, und es gefiel mir sehr. Das Kind ist dunkelhaarig, ähnelt aber sonst Elizabeth. Zur Taufe waren unendlich viele Warleggans geladen.
Onkel Ray konnte mich nicht begleiten, er war zu schwach. Er vermisst Dwight sehr. Den letzten Brief von Dwight habe ich vor zwei Wochen erhalten. Er war an Bord der Travail geschrieben, aber schon zwei Wochen alt, als ich ihn bekam; so weiß ich also nicht, wie es ihm in den letzten vier Wochen gegangen ist. Das und das Bewusstsein, dass er nur durch meine Schuld zur Marine gegangen ist, bedrückt mich sehr. Wenn dieser Krieg nur endlich zu Ende wäre …
Obwohl es ein sehr freundschaftlicher Brief war, hätte Ross ihn lieber nicht erhalten. Er rief zu viele Erinnerungen in ihm wach. Zwar hätte er einer Einladung zur Taufe nicht Folge leisten können, dennoch schmerzte es ihn, dass er Trenwith nicht mehr betreten, Tante Agatha und seinen Neffen nicht besuchen und das restaurierte Haus nicht begutachten konnte. Bei seinem letzten ungebetenen Besuch zu Weihnachten hatte er genug gesehen, um zu erkennen, dass das Haus sich wandelte, fremd wurde.
Jeremy rutschte von Demelzas Schoß und lief Ross entgegen: »Papa! Papa!« Ross hob ihn hoch, küsste ihn und stellte ihn wieder hin. Die beiden jungen Männer standen linkisch da und wussten nicht, wohin mit ihren Händen.
»Erinnerst du dich an meine Brüder, Ross?«, fragte Demelza. »Das ist Samuel, der zweitälteste, und das Drake, der jüngste. Sie sind von Illuggan herübergekommen, um uns zu besuchen.«
Ross zögerte ein wenig. »Wir haben uns lange nicht gesehen«, sagte er. Sie schüttelten einander ein wenig reserviert und nicht sonderlich herzlich die Hand.
»Sechs Jahre«, sagte Sam. »Jedenfalls seit ich hier war. Drake war noch nie hier. Er war noch zu klein.«
»Hast du deinen Brüdern etwas zu trinken angeboten, Demelza?«, fragte Ross. »Was möchten Sie? Genever? Oder einen Likör?«
»Vielen Dank. Die Schwester hat’s uns angeboten, aber wir trinken keinen Alkohol.«
»So …«, sagte Ross. »Dann nehmen Sie doch Platz.« Unschlüssig blickte er Demelza an, und als sie ihm durch einen Wink zu verstehen gab, dass sie seine Anwesenheit wünschte, setzte er sich ebenfalls.
»Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn andere trinken«, erklärte Drake.
»Wie geht es Ihrem Vater?«, fragte Ross.
»Dem Allmächtigen hat es gefallen, ihn im letzten Monat zu sich zu nehmen«, sagte Sam. »Wir sind gekommen, um es der Schwester zu sagen.«
»Oh«, sagte Ross. »Das tut mir leid.« Er blickte Demelza an, doch die Nachricht schien sie nicht zu berühren. »Woran … ist er gestorben?«
»An den Pocken. Er kriegte sie ganz plötzlich, und schon eine Woche später lag er unter der Erde.«
Auch Sam schien der Tod des Vaters nicht sonderlich erschüttert zu haben.
»Und Stiefmutter Nellie?«, fragte Demelza. »Wie geht es ihr?«
»Gut. Luke ist verheiratet und wohnt nicht mehr zu Hause. William und John und Bobby sind auch Bergleute und würden in der Mine arbeiten, aber die ist stillgelegt. In Illuggan herrscht Hungersnot.«
»Nicht nur in Illuggan«, sagte Ross.
»Nur zu wahr, Bruder«, bestätigte Sam. »Wie ich ’n kleiner Junge war, da waren um Illuggan und Camborne fünfundvierzig Pumpen in Betrieb, Tag und Nacht. Jetzt sind’s bloß noch vier.«
»Und was tun Sie?«, fragte Ross.
»Ich bin Bergmann, wie die andern«, antwortete Sam. »Aber der Allmächtige hat auch mir eine Bürde auferlegt, die ich tragen muss. Drake war sieben Jahre bei einem Stellmacher in der Lehre. Er hat fleißig gearbeitet, aber in letzter Zeit gab’s auch für ihn nichts mehr zu tun.«
Ross hatte einen Verdacht in Bezug auf den Zweck dieses Besuches, sagte aber nichts darüber. »Und Sie gehören beide der Sekte der Methodisten an?«, fragte er.
Sam nickte. »Wir wandeln nun beide auf den Spuren Christi.«
»Ich dachte immer, du hättest das Licht nicht erblickt«, sagte Demelza. »Als unser Vater damals herkam und mich nach Hause holen wollte, sagte er, alle außer dir wären bekehrt, Samuel.«
Verlegen rieb sich Sam die Wange. »Das stimmt schon, Schwester. Zwanzig Jahre lang habe ich sündig und ohne Gott gelebt, aber dann hat Gott meine Seele befreit.«
»Und jetzt«, fügte Drake hinzu, »ist Sam das Heil mehr zuteil geworden als uns.«
Ross musterte den Jüngeren. In seinem Ton schwang leichte Ironie, doch sein blasses Gesicht war ernst. Er ähnelte Demelza, hatte den gleichen Teint, die gleichen Augen, vielleicht auch den gleichen Sinn für Humor. »Sie sind sich Ihres Glaubens nicht so sicher?«, fragte er.
Drake lächelte. »Von Zeit zu Zeit weiche ich vom Weg der Gnade ab.«
»Das tun wir wohl alle«, erwiderte Ross.
Jeremy zupfte am Rock seiner Mutter. »Darf ich jetzt gehen, Mama?«, fragte er. »Darf ich draußen mit Garrick spielen?«
»Ja. Aber pass auf, dass du nicht wieder von einer Mauer fällst.« Als Jeremy fort war, sagte sie: »Heute könnt ihr nicht mehr zurück. Es ist zu weit. Ihr müsst hier übernachten.«
»Danke, Schwester.« Samuel räusperte sich. »Um ehrlich zu sein, wir wollten dich – und auch den Bruder – um einen Gefallen bitten. In Illuggan hat’s seit drei Monaten kein Fleisch mehr gegeben, wir haben kümmerlich von Brot und schwachem Tee gelebt. Nicht, dass ich mich beklagen möchte, Gott bewahre. Unser Herr Jesus Christus bewahrt uns vor dem Hunger der Seele. Aber …«
»Sprechen Sie weiter«, sagte Ross ruhig.
»Nun ja, Bruder, wir haben gehört, es gibt hier Arbeit. Es hieß, Sie hätten letzten Monat in Ihrer Mine zwanzig neue Arbeiter eingestellt. Ich bin ein tüchtiger Bergmann, so wahr mir Gott helfe. Und Drake ist sehr geschickt, nicht nur als Zimmermann. Wir sind hergekommen, um hier Arbeit zu finden.«
Ross biss sich auf die Lippen und warf Demelza einen Blick zu. Sie saß still da, die Hände im Schoß gefaltet. Offensichtlich wollte sie, dass er eine Entscheidung traf.
Konnte er die Bitte überhaupt ablehnen? Die beiden waren Demelzas Brüder; sie waren arm und arbeitslos, während Ross nun wohlhabend war. Doch es war für Demelza schwer gewesen, sich von ihrer Familie zu lösen – besonders von ihrem Vater. Als Ross’ Frau hatte sie in den vergangenen vier Jahren Zutritt zur vornehmen Gesellschaft bekommen. Nun waren sie, nach jahrelangem Kampf gegen die Armut, endlich wohlhabend genug, neue Kleider zu kaufen, ihr Heim besser auszustatten, selbst Gäste zu empfangen. Konnte Demelza wirklich daran gelegen sein, sich zu diesem Zeitpunkt zwei Brüder auf den Hals zu laden, einfache, linkische Arbeiter, die auf ihre Verwandtschaft mit ihr pochten und sie nur in Verlegenheit bringen konnten?
»Wheal Grace ist eine kleine Mine«, sagte Ross. »Alles in allem können wir nicht über hundert Arbeiter beschäftigen. Und die Mine floriert erst seit kurzem. Alles deutet darauf hin, dass die beiden Zinnadern, die wir entdeckt haben, uns noch etwa zwei Jahre Arbeit geben. Mehr kann ich nicht versprechen. Bei den niedrigen Zinnpreisen und der schmalen Gewinnspanne ist es ratsam, das Unternehmen nicht weiter zu vergrößern. Denn je mehr Zinn auf dem Markt ist, desto weniger bringt es ein. Und je länger der Krieg dauert, desto wahrscheinlicher ist, dass auch weiterhin Metalle gebraucht werden und die Preise steigen. Wir mussten schon viele abweisen, die hier nach Arbeit fragten.«
Er schwieg und sah die beiden jungen Männer an. »Wir möchten andern nicht die Arbeit wegnehmen«, sagte Sam.
»Ich werde mit Mr Henshawe darüber sprechen«, sagte Ross. »Er stellt die Arbeiter ein. Ich werde das gleich morgen Vormittag tun. Sie können bei uns übernachten, und etwas zu essen bekommen Sie auch.«
»Vielen Dank, Bruder.«
»Was ich noch sagen wollte«, bemerkte Demelza, »ihr könnt mich gern Schwester nennen. Aber meinen Mann solltet ihr mit Hauptmann Poldark anreden.«
Sam grinste freundlich. »Natürlich tun wir das, Schwester. Bitte um Verzeihung, bei den Methodisten ist es üblich, alle Männer Bruder zu nennen.«
»Das ist dann also geklärt«, sagte Ross. »Ich werde morgen früh mit Henshawe reden. Aber Arbeit kann ich Ihnen nicht versprechen. Nur, dass ich mit ihm rede.«
»Vielen Dank«, sagte Sam.
»Vielen Dank, Hauptmann«, sagte Drake.
Demelza stand auf. »Ich werde Jane sagen, dass sie noch zwei Gedecke auflegen soll.«
Nachts, als sie im Bett lagen, sagte Ross: »Ich habe mit Henshawe gesprochen, und wir können die beiden beschäftigen – vorausgesetzt, sie sind mit dem Lohn einverstanden, den wir ihnen bieten. Drake kann im Maschinenhaus arbeiten.«
»Ich danke dir, Ross.«
»Aber dir ist doch klar, dass die beiden dich vielleicht irgendwann in Verlegenheit bringen?«
»Wieso denn?«
Ross erklärte es ihr.
»Hm«, sagte sie. »Das muss ich dann eben auf mich nehmen. Wo willst du sie denn unterbringen?«
»Ich habe an Mellin gedacht. Seit der alte Joe Triggs tot ist, hat Betsy ja ein Zimmer übrig. Für sie wäre es auch eine Hilfe.«
Nachdenklich sagte Demelza: »Sam hätte ich wohl noch erkannt, aber Drake …«
»Er ähnelt dir, findest du nicht?«, sagte Ross.
»Inwiefern?«
Ross schob eine Hand unter Demelzas Nachthemd und legte sie auf ihr eines Knie. »Ach, der Teint … der Gesichtsschnitt. Der ganze Ausdruck …«
»Was für ein Ausdruck?«
»Das solltest du doch wissen … ein bisschen widerspenstig. Eigensinnig.«
Demelza zog ihr Knie fort. »Ich wusste doch, dass gleich etwas Boshaftes kommt.«
Ross legte die Hand auf ihr anderes Knie. »Das Knie gefällt mir noch besser. Es ist das mit der Narbe … als du fünfzehn warst, wolltest du auf eine Ulme klettern und bist heruntergefallen.«
»Nein, damals habe ich mir die Beine nur ein bisschen zerkratzt. Die Narbe stammt von dem Schrank, den ich über mich gekippt habe.«
»Genau das meine ich ja … widerspenstig. Eigensinnig.«
»Und verschrammt.«
»Das macht nichts. Bei einem Menschen, den man liebt, werden einem auch seine Schrammen lieb und teuer.«
»Das hast du hübsch gesagt«, bemerkte Demelza. Eine Weile lagen sie still nebeneinander. Dann fuhr sie fort: »Übrigens, Ross …«
»Ja?«
»Was ich dir noch sagen wollte … bald werden wir noch ein Kind haben.«
»Was?!« Ross war plötzlich hellwach. »Was hast du da gesagt? Bist du sicher?«
»Nicht ganz. Aber meine letzte Regel ist ausgeblieben. Letztes Mal hast du mir Vorwürfe gemacht, weil ich es dir zu spät gesagt habe, deshalb wollte ich es dir diesmal so früh wie möglich sagen.«
»Mein Gott!«, sagte Ross. »Darauf war ich eigentlich nicht gefasst.«
»Ich schon. Seit Weihnachten haben wir doch eigentlich keine Nacht ausgelassen.«
»Und wäre es dir anders lieber gewesen?«
»Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte mich gewundert, wenn gar nichts passiert wäre.«
»Hm … da hast du wohl recht.«
Sie schwiegen. »Bist du ärgerlich?«, fragte sie.
»Nicht ärgerlich. Aber auch nicht gerade entzückt. An sich hätte ich gern noch mehr Kinder. Aber es ist eben immer so gefährlich für dich und für das Kind. Gerade haben wir unsere Schulden abgezahlt und brauchen die Armut nicht mehr zu fürchten … ich hätte gern ein, zwei Jahre in Frieden gelebt … ohne dem Schicksal wieder ein Unterpfand zu gönnen.«
»Aber wir sind ständig selbst ein Unterpfand des Schicksals – einfach, indem wir leben.«
»Das stimmt. Ich bin feige. Aber ich bin nur feige in Bezug auf die Menschen, die ich liebe.«
»Vielleicht ist es ja auch falscher Alarm. Meinetwegen brauchst du keine Angst zu haben. Die beiden letzten Male ist ja auch alles glatt gegangen.«
»Und wann soll es kommen?«
»Im November wahrscheinlich.«
»Erinnerst du dich noch an den Sturm, der bei Julias Geburt tobte? Als ich den alten Dr Choake holen ging, konnte ich kaum stehen.«
»Dabei brauchte ich ihn gar nicht. Mrs Zacky wurde bestens mit allem fertig. Wenn ich schon einen Mann als Arzt haben muss, dann wäre mir Dwight lieber. Bis November ist er sicher wieder zurück.«
»Darauf würde ich mich lieber nicht verlassen. Bis jetzt ist noch kein Ende des Krieges abzusehen.«
»Ich muss Caroline bald besuchen. Wir haben nicht so viel für sie getan, wie wir sollten. Und es ist bestimmt schrecklich für sie, dass sie mit niemandem über Dwight reden kann.«
»Ja, das Gleiche habe ich mir auf dem Heimweg von der Mine auch überlegt.« Ross rückte zu Demelza hinüber und legte seine Wange an ihre. Eine Weile lagen sie ganz still beieinander. Dann sagte er: »Ich hoffe, es ist ein Mädchen. Aber anders als du. Eine wie du genügt mir völlig.«
3
Ein etwa vierzigjähriger, hochgewachsener Mann mit aristokratisch geschnittenen Gesichtszügen ritt die Auffahrt von Killewarren hinauf, stieg vom Pferd und zog an der Glocke. Er trug ein teures braunes Reitkostüm und eine schwarze Seidenkrawatte. Sein dunkles Haar war an den Schläfen grau meliert. Als ein Diener öffnete, sagte er, er sei gekommen, um Mr Ray Penvenen zu besuchen.
»Dem Herrn geht es gar nicht gut«, sagte der Diener. »Bitte treten Sie ein, Sir. Wen darf ich melden?«
»Mr Unwin Trevaunance.«
Der Besucher wurde in den ersten Stock in das große Wohnzimmer mit den verblassten Samtvorhängen, den abgenutzten Möbeln und Perserteppichen geführt. Seit seinem letzten Besuch – vor vier Jahren – war das Haus noch mehr heruntergekommen. Er rümpfte die Nase, fuhr mit einem Finger über den Kaminsims und beschloss, als er ihn voll Staub fand, sich nicht zu setzen.
Kurz darauf trat Caroline Penvenen ein. Mit Unmut nahm er zur Kenntnis, dass sie ihren kleinen Mops auf dem Arm trug. Als das Tier den Besucher wiedererkannte, begann es erst zu knurren und dann zu kläffen.
»Unwin!«, rief Caroline. »Was für eine Überraschung! Horace erinnert sich an dich. Keine Angst, mein Liebling, ich werde nicht zulassen, dass der große Mann dich frisst. Ich habe dich bei der Taufe von Valentin Warleggan gesehen, Unwin, aber wir sind gar nicht dazu gekommen, miteinander zu sprechen.«
»Du sagst es.« Unwin neigte sich über ihre Hand. »Ich habe gehört, dass es deinem Onkel nicht gutgeht, und wollte ihm deshalb meine Aufwartung machen. Ich hoffe, es geht ihm jetzt besser.«
»Leider nicht. Aber ich danke dir für deine Anteilnahme. Ich werde ihm sagen, dass du hier warst.«
»Darf er keinen Besuch empfangen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Der Arzt hat es verboten.«
»Wer ist euer Arzt?«
»Dr Sylvane von Blackwater.«
»Kenne ich nicht. Aber ich bin jetzt nur noch selten in Cornwall. Ist er tüchtig?«
»Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es geht Onkel Ray immer schlechter, aber das kann auch an der Krankheit liegen, gegen die auch der tüchtigste Arzt nichts ausrichten kann.«
Unwin blickte aus dem Fenster. Regen peitschte gegen die Scheiben. »Ich fürchte, ich muss euch bitten, mir so lange Gastfreundschaft zu gewähren, bis dieser Schauer vorbei ist.«
»Mit Vergnügen. Darf ich dir eine Erfrischung anbieten? Französischen Cognac? Oder Kanarienwein?«
»Ein Glas Cognac nehme ich gern.«
Caroline klingelte und befahl dem Diener, Cognac zu bringen. Inzwischen musterte Unwin sie mit unverhohlenem Interesse. Seiner Meinung nach sah sie nicht mehr so gut aus wie damals vor vier Jahren, als er ihr den Hof gemacht hatte. Sie war eine schlanke, selbstbewusste, rothaarige achtzehnjährige Schönheit gewesen, die Erbin zweier betagter, begüterter Junggesellen. Eine bessere Partie für ihn konnte es kaum geben. Anderthalb Jahre lang hatte er ihr den Hof gemacht, doch dann hatte sie plötzlich beschlossen, mit ihm nichts mehr zu tun haben zu wollen. In letzter Zeit hatte das Gerücht von einer Verlobung mit einem Lord Coniston wissen wollen, aber daraus war anscheinend auch nichts geworden. Unwin glaubte die Hintergründe zu kennen. Sie waren einer der Gründe für seinen Besuch. Doch Caroline war nicht mehr so schön wie früher. Ihre schlanke Gestalt war nun ein wenig eckig, ihr Teint nicht mehr ganz so frisch. Mit ihren zweiundzwanzig Jahren war sie noch immer eine sehr anziehende Frau, und mit ihrem flammendroten Haar fiel sie nach wie vor überall auf, doch er stellte fast mit Genugtuung fest, dass die Zeit nicht spurlos an ihr vorübergegangen war. Vielleicht war sie nun nicht mehr ganz so selbstbewusst und eigensinnig.
Als der Diener den Cognac brachte, nahm Unwin einen Schluck. »Mmm, ausgezeichnet. Auf den Schmuggel hat sich der Krieg also nicht ungünstig ausgewirkt. Nun ja, wir haben nicht mehr so viel Leute für die Küstenwache übrig.«
Caroline setzte Horace zu Boden. Er blieb schnaufend neben ihr sitzen und warf von Zeit zu Zeit einen argwöhnischen Blick auf Unwin. »Deine Karriere blüht und gedeiht, hoffe ich?«
»Durchaus. Mein Sitz im Parlament ist dies Jahr wieder bestätigt worden. Aber sag mir doch, Caroline – dein Onkel … hält der Arzt die Krankheit für tödlich?«
»Etwas Derartiges würde Dr Sylvane niemals aussprechen. Aber ich mache mir keine Illusionen.«
»Und was hast du in diesem Fall vor? Wirst du nach London zurückkehren? Allein hierbleiben kannst du doch kaum.«
»Warum nicht? Ich weiß es noch nicht. Ich lebe gern in den Tag hinein.«
»Tja … ich habe schon oft überlegt, was geschehen wäre, wenn wir damals vor zwei Jahren nicht gestritten hätten.«
»Dann wäre ich jetzt wohl deine Frau, Unwin«, erwiderte Caroline lächelnd. »Aber ich wäre dir keine gute Frau gewesen.«
»In dem Punkt bin ich anderer Meinung, mit Verlaub. Ich wage sogar zu glauben, dass du glücklicher gewesen wärst. Ich bin schließlich kein Ungeheuer. Die meisten Menschen halten mich für ganz akzeptabel. Und ich bin ziemlich einflussreich. Du hättest an meiner Seite ein erfülltes und interessantes Leben führen können. Auch wenn du mich nicht liebst – wir hätten ein glänzendes Paar abgegeben. Jedenfalls wäre dein Leben sehr viel schöner gewesen als das, was du hier führst, allein, weit weg von deinen Freunden in London und Oxfordshire …«
»Und als Pflegerin eines kranken alten Mannes«, ergänzte Caroline. »Ja, mein Leben wäre sicher ganz anders gewesen. Und deins auch. Aber man trifft nun einmal bestimmte Entscheidungen. Wenn ich ausreite, bleibe ich nicht zu Hause am Kamin sitzen. Wenn du heute Morgen nicht Onkel Ray besucht hättest, wärst du nicht Gefahr gelaufen, auf dem Rückweg durchnässt zu werden. Jeder Mensch entscheidet sich für oder gegen etwas. Meinen das die Pfarrer, wenn sie von freiem Willen sprechen?«
Unwins Unterlippe schob sich unwillig vor. Er mochte Carolines ironischen Ton nicht. »Das wird es wohl sein. Aber nicht alle Entschlüsse sind unwiderruflich. Dein Entschluss in Bezug auf mich ist es jedenfalls nicht.«
Sie schwiegen; draußen rauschte der Regen.
»Mein Entschluss, dich zu heiraten, Unwin? Wie kommst du darauf, dass ich meine Meinung geändert haben könnte?«
»Nun, es könnte doch sein. Wir sind beide älter geworden. Was wir vor zwei Jahren im Affekt gesprochen haben, muss nicht unbedingt endgültig sein.«
Caroline schüttelte den Kopf. »Ich danke dir für diese freundlichen Worte, Unwin. Aber es geht nicht. Bei unserem Streit vor zwei Jahren war ich wohl etwas heftig, nicht sehr … höflich. Du musst mir das verzeihen; ich war damals noch sehr ungestüm und jung. Aber an meiner Entscheidung hat sich nichts geändert. Ich kann dich nicht heiraten. Es tut mir leid. Trotzdem danke ich dir dafür, dass du mich nochmals gefragt hast.«
Unwin nahm einen Schluck Cognac, streckte seine langen Beine aus und starrte auf einen Schlammspritzer auf seinen blankgewichsten Stiefeln. »Tja … du musst es wissen. Aber lass uns einen Kompromiss schließen: Solange keiner von uns beiden verheiratet ist, steht diese Tür noch offen. Falls du deinen Sinn einmal änderst und ich gerade nicht in Cornwall bin – John kennt meine Adresse.«
»Ich danke dir, Unwin.« Es lag ihr auf der Zunge, ihm zu sagen, nichts könne sie je veranlassen, ihm zu schreiben. Aber sie war nun reifer und behutsamer geworden.
Es hatte aufgehört zu regnen, und durch einen Riss in den Wolken schimmerte das Blau des Himmels.
»Bisher hat doch immer dieser junge Arzt deinen Onkel behandelt«, sagte Unwin, »Wie hieß er doch noch? Enys. Dwight Enys.«
Caroline überlegte, ob das eine gezielte Frage war. »Dr Enys ist zu Weihnachten als Arzt zur Marine gegangen und dient jetzt beim Geschwader West. Mein Onkel vermisst ihn sehr.«
»So … hoffentlich war sein Schiff nicht an dem Gefecht letzte Woche beteiligt.«
»Was für ein Gefecht? Ich habe nichts darüber gehört.«
»Ich war gestern in Falmouth, und es gab kaum ein anderes Gesprächsthema. Es war Ned Pellews Geschwader. Es heißt, das Gefecht habe elf Stunden gedauert und in einem schweren Sturm stattgefunden. Sir Edward ist ein großer Mann. Wir brauchten mehr solche Leute.«
Caroline sagte: »Wir hören alle Neuigkeiten erst viel später als die andern. Weißt du Genaueres darüber?«
»Leider nur wenig. Pellew war Kommandant der Arethusa, glaube ich, und noch von zwei anderen Schiffen. Sie griffen ein französisches Linienschiff und eine französische Fregatte an. Das französische Linienschiff war wohl das größte von allen fünf Schiffen. Es gab ein hitziges Gefecht, die beiden französischen Schiffe wurden an Land getrieben und zerstört. Wir haben eins von unseren Schiffen verloren.«
»Verloren? Du meinst, es ist gesunken?«
»Es wurde wie die Franzosen im Sturm an Land getrieben. Die Arethusa und die andere Fregatte kamen ungeschoren davon.«
»Ich habe ein paar Freunde bei diesem Geschwader«, sagte Caroline, »und einige waren, glaube ich, auf der Arethusa oder einem ihrer Begleitschiffe. Kennst du die Namen der Begleitschiffe?«
Unwin trank seinen Cognac aus. »Ja, ich habe sie gehört. Aber im Augenblick kann ich mich nicht daran erinnern. Die Schiffe heißen alle ähnlich.«
Die Sonne war nun durchgekommen; ihre Strahlen glänzten auf dem schiefergrauen Meer.
»Warte«, sagte Unwin, »gleich fällt’s mir wieder ein. Das eine war die Travail. Unter Kapitän Harrington … das andere war die Mermaid, aber an den Namen des Kapitäns erinnere ich mich nicht. Banks, vielleicht, aber ich bin nicht sicher.«
»Und welches von beiden ging unter?«
»Ich glaube, die Travail. Ja, so war es wohl, denn Harrington fiel in der Schlacht, und die Mermaid setzte ihre eigene Sicherheit aufs Spiel, als sie versuchte, die Überlebenden aufzufischen … War denn jemand an Bord, den du gut kennst? Ich hoffe, ich habe dich nicht aufgeregt, Caroline?«
»Nein, nein«, antwortete Caroline nachdenklich. »Ganz und gar nicht.«
In ihrem kleinen Haus am Ende der Hauptstraße von Falmouth, von dem aus man einen Blick über den Hafen hatte, brachte Verity Blamey, geborene Poldark, gerade ihr Kind zu Bett, als es an der Tür klopfte. Die Sonne war schon untergegangen, das Wasser hatte seine leuchtenden Farben verloren und schimmerte dunkel. Hinter Fenstern und an Masten flammten Lichter auf.
Verity war allein im Haus, denn Mrs Stevens war zu Besuch bei einer Nachbarin. Bevor sie nach unten ging, schaute sie durch das Fenster und sah, dass eine hochgewachsene junge Frau, die ein Pferd am Zügel führte, vor der Tür stand. Verity erinnerte sich an das flammendrote Haar. Sie ging zur Tür und machte auf.
»Mrs Blamey?«
»Miss Penvenen, nicht wahr? Fehlt Ihnen etwas?«
»Darf ich hereinkommen? Mein Pferd kann ich doch hier stehenlassen?«
»Ja, ja. Bitte kommen Sie herein.«
Die junge Dame folgte Verity die Treppe hinauf ins Wohnzimmer. Auf ihren Wangen waren rote Flecken; sie wirkte fiebrig. »Wir kennen uns noch nicht«, sagte Caroline sachlich und ohne Umschweife. »Obwohl wir so viele gemeinsame Freunde haben. Ich brauche Hilfe. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Finden Sie das merkwürdig?«
»Natürlich nicht. Ich weiß, wie freundschaftlich Sie sich zu Ross verhalten haben. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich hole Ihnen eine Erfrischung.«
»Nein, danke.« Caroline blieb am Fenster stehen. »Ich weiß nicht, ob Sie mir helfen können. Ich bin von Killewarren hergeritten.«
»Von Killewarren – ohne Begleitung?«
Caroline schob diese Frage mit einem Achselzucken beiseite. »Wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber Sie haben sicher von mir gehört. Bestimmt hat Ross Ihnen von meiner Beziehung zu Dwight Enys erzählt.«
»Ja.«
»Hat er Ihnen auch gesagt, dass ich mich letzte Weihnachten mit Dwight verlobt habe?«
Verity nestelte an den Knöpfen ihres schlichten Leinenkleides. Sie wusste, dass Caroline für ihre unkonventionelle Art bekannt war, und fragte sich, wieweit sie dem jungen Mädchen eine Hilfe sein konnte. »Ich habe Ross seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Und auch sonst niemanden von der Familie. Demelza hat mir zweimal geschrieben, aber nichts davon erwähnt.«
»Wahrscheinlich wollte sie es geheim halten, weil mein Onkel diese Verlobung nicht billigt und im Augenblick schwerkrank ist. Ich hatte vor, es ihm erst nach Dwights Rückkehr zu sagen. Meinetwegen … wegen der Schwierigkeiten mit mir ist Dwight zur Marine gegangen.«
Verity ging zu einem Beistelltischchen und goss aus einer Karaffe etwas Cognac in ein Glas. Caroline nahm es, trank aber nicht.
»Ich wusste, dass er bei der Marine ist«, sagte Verity, »aber nicht, warum.«
»Er ist kurz nach Weihnachten in See gestochen, und ich habe seither zwei Briefe von ihm bekommen. Sein Schiff gehört zu dem Geschwader unter Sir Edward Pellew. Eine Fregatte.«
»Oh …« Verity blickte sie erschrocken an. »Wollen Sie damit sagen, dass es bei dem Gefecht mitgekämpft hat?«
»Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur heute Morgen gehört, dass ein englisches Schiff gesunken ist. Wissen Sie den Namen?«
»Warten Sie … ich werde in der Zeitung nachsehen.« Verity ging durchs Zimmer und kam nach kurzem Suchen mit einem Zeitungsblatt zurück. »Da steht es. Ja, die Travail.« Sie blickte auf. »Man hat sie vor der französischen Küste aus den Augen verloren.«
Caroline ließ sich auf den nächstbesten Stuhl fallen. Aus ihrem Glas schwappte etwas Cognac auf den Teppich. Verity trat zu ihr und legte ihr den Arm um die Schultern. »Es ist mir sehr peinlich«, sagte Caroline, »ich kenne Sie erst seit fünf Minuten. Aber mir ist wirklich nicht gut.«
»Trinken Sie einen Schluck Cognac. Er wird Ihnen gut tun.«
»Danke. Es geht schon wieder.«
»Das Schiff wurde nicht von den Franzosen versenkt, sondern nur bei dem Sturm beschädigt. Bestimmt hat es viele Überlebende gegeben.«
Caroline versuchte ruhig zu atmen. »Auf dem ganzen Weg hierher habe ich mir wieder und immer wieder gesagt, dieser dumme Unwin hat sich bestimmt geirrt! Bestimmt ist es nicht gerade dieses Schiff. Es wird die Turmoil oder die Terror oder die Trident gewesen sein. Diese Schiffe heißen doch alle gleich …«
»Sie dürfen sich nicht zu sehr aufregen. Vielleicht ist er gesund und in Sicherheit. Alles ist möglich.«
»Und ich dachte, ich muss unbedingt nach Falmouth und Ross’ Cousine fragen.«
»Natürlich. Wenn Andrew nur hier wäre … Oder James. Das ist Andrews Sohn, er ist auch auf See.«
»Steht sonst nichts in der Zeitung?«
»Nichts. Es ist nur eine Nachricht von Kapitän Pellew, der noch immer auf See ist. Und es heißt darin nur, dass die Travail in der Bucht von Audierne auf Grund gelaufen ist und dass die Mermaid um ein Haar selbst beschädigt worden wäre, als sie versuchte, die Leute von der Travail zu retten.«
»Wen können wir denn fragen? Wer könnte mehr wissen?«
»Das überlege ich gerade. Ich glaube, ein Kanonenboot hat die Nachricht gebracht. Ich bin im Postamt gut bekannt, wegen Andrew. Ben Pender ist meist bis acht Uhr dort. Wenn irgendjemand etwas weiß, dann er. Ich werde Sie dorthin begleiten. Mrs Stevens ist, glaube ich, gerade zurückgekommen; sie wird auf den kleinen Andrew aufpassen. Glauben Sie, dass Sie gehen können?«
»Oh ja. Natürlich.«
Zehn Minuten später schritten sie über das schmutzige Kopfsteinpflaster der Straße. Die Läden waren noch offen, die Gasthäuser voller Menschen. Es war ein schöner, klarer und warmer Aprilabend. Doch Caroline schien er kalt und düster.
Im Postamt sprach Ben Pender, ein müde dreinblickender kleiner Mann mit altmodischer Perücke und in braunem Rock, mit einem Offizier der Postflotte. Als der Offizier Verity sah, begrüßte er sie und küsste ihr die Hand. Verity machte die beiden Männer mit Caroline bekannt und erklärte, was sie hergeführt hatte.
»Unglücklicherweise, Madam«, sagte der Offizier, »haben wir nicht mehr als die Nachricht, die das Boot gebracht hat. Es ist inzwischen schon wieder auf See. Auch Pellew und seine Schiffe sind noch auf See. Hier ist die Nachricht: Sir Edward Pellew sichtete am Donnerstag um drei Uhr nachmittags fünfzig Seemeilen südwestlich von Ushant zwei französische Schiffe, die Héros und die Palmier. Es blies ein steifer Westwind, und Sir Edward machte sich an die Verfolgung der Franzosen. Um Viertel vor sechs wurden sie von der Nymphe und der Travail eingeholt. Bis zehn Uhr fand bei stetig zunehmendem Sturm ein heftiges Gefecht statt, an dem später auch die Mermaid teilnahm. Der Sturm trieb die fünf Schiffe auf die französische Küste zu. Als die bretonische Küste in Sicht kam, war die Héros manövrierunfähig, und auch die Palmier, die Nymphe und die Travail waren stark beschädigt. Die beiden Franzosen versuchten die Mündung von Brest zu gewinnen, doch die Palmier fuhr bei der Ile de Sein auf einen Felsen auf und sank, die Héros trieb in die Bucht von Audierne und lief bei schwerer See auf Grund. Auch die Travail lief in der Nähe der Héros auf Grund. Der Nymphe gelang es, an der Pointe de Penmarche vorbeizukommen und die offene See zu gewinnen. Die Mermaid, die von allen fünf Schiffen am wenigsten beschädigt war, versuchte, den Schiffbrüchigen zu helfen, war aber gezwungen, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Auf der Nymphe gab es sechzehn Gefallene und siebenundfünfzig Verwundete. Auf der Mermaid fünf Gefallene und fünfunddreißig Verwundete. Kapitän Harrington von der Travail fiel schon zu Beginn des Gefechts. Das ist das Ende der Nachricht, Madam.«
»Haben Sie mit irgendeinem Mitglied der Besatzung des Kanonenboots gesprochen?«, fragte Caroline.
»Ja, mit dem Kapitän. Aber er hat an dem Gefecht nicht teilgenommen. Er hat nur die Nachricht gebracht.«
»Haben Sie auch über die Travail gesprochen?«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.