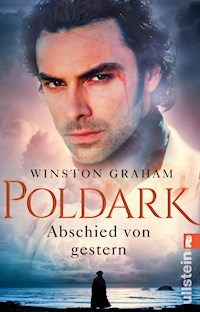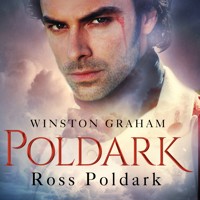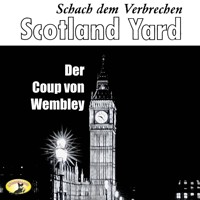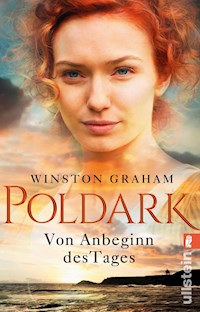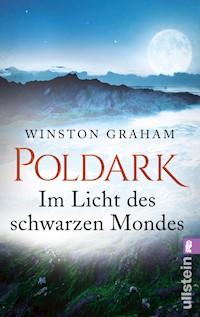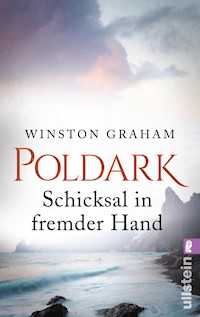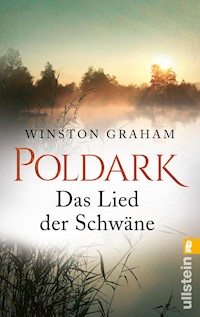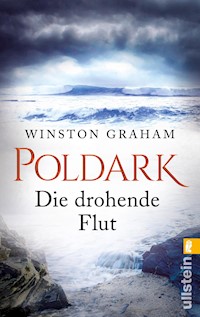4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Cornwall 1790-1791 Ross Poldark steht vor den schlimmsten Stunden seines Lebens: Er wird vor Gericht für zwei Schiffsunglücke verantwortlich gemacht. Seine junge Frau Demelza schart Unterstützer um sich, doch auch seine Feinde bleiben nicht untätig. Besonders der mächtige Bankier George Warleggan ist daran interessiert, Ross zugrunde zu richten ... »Vom unvergleichlichen Winston Graham …, der all das hat, was die anderen haben, und dann noch eine ganze Menge mehr« The Guardian Der dritte Roman der großen Poldark-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Cornwall, 1790 bis 1791: Ross Poldark sieht sich den schlimmsten Stunden seines Lebens gegenüber. Er wird vor Gericht für zwei Schiffsunglücke verantwortlich gemacht. Für Ross, der sich immer wieder bedenkenlos für seine Leute einsetzt, kann es keinen schlimmeren Vorwurf geben. Seine junge Frau Demelza schart Unterstützer um sich, um die Kläger dorthin zu verweisen, wohin sie gehören: auf die Anklagebank. Doch auch seine Feinde bleiben nicht untätig. Besonders mit dem mächtigen Bankier George Warleggan verbindet Ross eine immer persönlicher werdende Rivalität. Nun wittert Warleggan die Chance, ihn zugrunde zu richten …
Der Autor
Winston Mawdsley Graham, geboren 1908 in Manchester, gestorben 2003 in London, hat über vierzig Romane geschrieben, darunter auch Marnie, der 1964 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Er war Mitglied der Royal Society of Literature sowie des Order of the British Empire und lebte in London und Cornwall.
Die Poldark-Serie von Winston Graham ist in unserem Hause in chronologischer Reihenfolge erschienen:
Poldark – Abschied von gestern
Poldark – Von Anbeginn des Tages
Poldark – Schatten auf dem Weg
Poldark – Schicksal in fremder Hand
Poldark – Im Licht des schwarzen Mondes
Poldark – Das Lied der Schwäne
Poldark – Die drohende Flut
Winston Graham
Poldark
Schatten auf dem Weg
Roman
Aus dem Englischenvon Christiane Kashin
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1237-8
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© Winston Graham 1950Titel der englischen Originalausgabe: Jeremy Poldark (Pan Books, Pan Macmillan, London 2008; first published in 1950 by Werner Laurie Ltd.)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Erstes Buch
1
Im August 1790 ritten drei Männer den Saumpfad entlang, der an der Grambler-Mine vorbeiführte, auf die verstreut liegenden Hütten am Ende des Dorfes zu. Es war schon Abend und die Sonne gerade untergegangen; mit einer westlichen Brise hatten Wolken den Himmel bezogen, die nun im Abendrot erglühten. Selbst die Schornsteine der Mine, aus denen seit fast zwei Jahren kein Rauch mehr aufgestiegen war, leuchteten im Abendlicht in einem warmen Gelb. Der größere der beiden hatte ein Loch, in dem Tauben nisteten. Das Schlagen ihrer Flügel hallte in der Stille, die über der Gegend lag, besonders laut. Ein halbes Dutzend zerlumpter Kinder spielte um eine selbstgebastelte Schaukel, die zwischen zwei Schuppen aufgehängt war, und vor den Hütten standen einige Frauen mit verschränkten Armen und musterten die vorbeireitenden Männer.
Die drei machten in ihrer gepflegten schwarzen Amtskleidung einen respektablen Eindruck, und in ihren Mienen und ihrer Haltung spiegelte sich das Bewusstsein ihrer Wichtigkeit. In diesem halb heruntergekommenen, halb verlassenen Dorf, das nur für die Mine entstanden war und durch die Mine hatte existieren können und nun, da die Mine stillgelegt war, selbst nach und nach verfiel, tauchten derartige Leute nur selten auf. Zuerst sah es so aus, als wollten die drei Männer das Dorf nur durchqueren, doch plötzlich nickte der eine, und sie hielten vor einer Hütte, die ganz besonders verwahrlost wirkte. Es war eine einstöckige, strohgedeckte Hütte, der ein altes Eisenrohr als Schornstein diente und deren Dach immer wieder mit Sackleinen und Treibholz geflickt worden war. Vor der offenen Tür saß auf einer umgestülpten Kiste ein krummbeiniger Mann, der an einem Stück Holz herumschnitzte. Er war mittelgroß, kräftig gebaut, aber schon in fortgeschrittenem Alter. Er trug alte Reitstiefel, die mit Schnüren zusammengebunden waren, gelbe schweinslederne Kniehosen, ein schmutziges graues Flanellhemd, dessen einer Ärmel am Ellbogen abgerissen war, und ein steifes schwarzes Lederwams, dessen Taschen von wertlosem Krimskrams ausgebeult waren. Er pfiff fast unhörbar vor sich hin, doch als die drei Männer abstiegen, verstummte er und musterte sie wachsam aus seinen blutunterlaufenen Augen; sein Messer ruhte auf dem Stock, den er zugespitzt hatte.
Der Anführer, ein großer, hagerer Mann, dessen Augen so nah beieinanderstanden, dass er zu schielen schien, sagte: »Guten Tag. Ist Ihr Name Paynter?«
Das Messer rutschte ein Stück tiefer. Der krummbeinige Mann hob einen schmutzigen Daumen und kratzte sich damit an der kahlsten Stelle seines stark gelichteten Haars.
»Kann sein.«
»Raus mit der Sprache, Mann«, sagte der Hagere ungeduldig. »Entweder sind Sie Paynter, oder Sie sind’s nicht. Bei dieser Frage kann man nicht verschiedener Meinung sein.«
»Bin da gar nicht so sicher. Die Leute gehen heutzutage ziemlich großzügig mit den Namen von andern um. Vielleicht gibt’s da zweierlei Ansichten. Vielleicht sogar drei. Hängt ganz davon ab, was Sie von mir wollen.«
»Es ist Paynter«, sagte einer der Reiter. »Wo ist Ihre Frau, Paynter?«
»Die ist weg nach Marasanvose. Wenn Sie also was von ihr wollen …«
»Mein Name ist Tankard«, sagte der Hagere scharf. »Ich bin Kronanwalt bei dem Fall Rex versus Poldark, der bald verhandelt wird. Wir möchten Ihnen ein paar Fragen stellen, Paynter. Dies ist Mr Blencowe, mein Sekretär, und das Mr Garth, der an dem Fall interessiert ist. Vielleicht gehen wir besser hinein.«
Jud Paynters verrunzeltes, braungebranntes Gesicht nahm einen Ausdruck gekränkter Unschuld an, doch trotz dieser aufgesetzten Abwehrhaltung verriet sein Blick tiefe Beunruhigung.
»Wieso belästigen Sie mich schon wieder? Ich hab dem Gericht doch schon alles gesagt, was ich wusste, und das war so gut wie nichts. Der heilige Petrus selber könnte nicht christlicher leben als ich, sitze ganz friedlich vor meinem Haus und störe keine Menschenseele. Lassen Sie mich in Ruhe.«
»Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen«, antwortete Tankard und wartete ungeduldig, bis Paynter sich endlich bequemte, aufzustehen. Erst musterte Paynter argwöhnisch die drei Gesichter, dann ging er ihnen voran in die Hütte. Sie setzten sich in dem düsteren Raum nieder, wobei Tankard sich angewidert umblickte und seine Rockschöße hob, um sie nicht zu beschmutzen. Die drei Besucher waren zwar nicht übermäßig geruchsempfindlich, dennoch warf Blencowe, ein blasser kleiner Mann mit krummem Rücken, einen sehnsüchtigen Blick nach draußen auf den milden Abend.
»Ich weiß nichts über die Sache«, begann Jud. »Bei mir sind Sie auf ’ner falschen Fährte.«
»Wir haben Grund zu der Annahme«, antwortete Tankard, »dass Ihre Aussage vor dem Untersuchungsrichter falsch war. Falls –«
»Verzeihen Sie«, unterbrach ihn Garth mit gedämpfter Stimme. »Bitte lassen Sie mich ein paar Worte mit Paynter wechseln, Mr Tankard. Sie werden sich sicher noch erinnern, dass ich, bevor wir herkamen, sagte, es gibt verschiedene Möglichkeiten …«
Tankard verschränkte seine mageren Arme. »Nun gut.«
Jud richtete seine blutunterlaufenen Augen auf den neuen Gegner. Er glaubte, Garth schon einmal gesehen zu haben, bei einem Ritt durch das Dorf oder Ähnlichem. Beim Schnüffeln wahrscheinlich.
In freundlichem Unterhaltungston sagte Garth: »Soviel ich weiß, waren Sie und auch Ihre Frau früher viele Jahre lang bei Hauptmann Poldark in Dienst, und davor auch schon bei seinem Vater?«
»Kann sein.«
»Und nachdem Sie so viele Jahre ehrlich für ihn gearbeitet hatten, wurden Sie plötzlich, ganz unvorbereitet und ohne jede Warnung, hinausgeworfen.«
»Stimmt. Das war nicht recht, das muss ich sagen.«
»Es heißt – aber das wird nur so geredet, verstehen Sie –, dass er Sie abscheulich behandelte, bevor Sie sein Haus verließen, dass er Sie – wegen irgendeiner Verfehlung, deren Sie sich angeblich schuldig machten – mit einer Pferdepeitsche schlug und Sie unter der Pumpe fast ertränkte. Ist das richtig?«
Jud spuckte auf den Boden und entblößte dabei zwei große Zähne.
»Das ist gesetzwidrig«, warf Tankard ein und schielte an seiner langen dünnen Nase herab. »Eine tätliche Beleidigung gegen Ihre Person. Sie hätten ihn verklagen können, Paynter.«
»Und ich wette, das war nicht das erste Mal«, sagte Garth.
»Nein, war es nicht«, bestätigte Jud nach kurzem Nachdenken, wobei er an seinen zwei Zähnen lutschte.
»Leute, die treue Bedienstete schlecht behandeln, verdienen sie gar nicht«, sagte Garth. »Im Ausland weht da jetzt ein ganz anderer Wind. Jedermann ist genauso viel wert wie sein Nachbar. Lassen Sie sich nur mal erzählen, was sich in Frankreich tut.«
»Ja, ich weiß Bescheid darüber«, antwortete Jud, schwieg dann aber. Diese aufdringlichen Schnüffler brauchten nichts von seinen geheimen Besuchen in Roscoff zu wissen. All diese Fragen nach dem Poldark-Fall waren vielleicht nur eine Falle, mit der sie ihm andere Eingeständnisse entlocken wollten.
»Blencowe«, sagte Tankard, »haben Sie den Cognac bei sich? Wir könnten alle einen Schluck vertragen, und Mr Paynter sagt bestimmt auch nicht nein.«
Nach und nach verblasste das Abendrot, und die mit Gerümpel vollgestopfte Hütte wurde immer dunkler.
»Glauben Sie mir«, sagte Garth, »die Aristokratie ist am Ende. Ihre Zeit ist vorbei. Der gemeine Mann wird nun zu seinem Recht kommen. Und eins seiner Rechte ist, dass man ihn nicht schlimmer als einen Hund behandelt, dass man ihn nicht wie einen Sklaven hält. Sind Sie mit dem Gesetz vertraut, Mr Paynter?«
»Das Heim des Engländers ist seine Burg«, antwortete Jud. »Ich kenne auch die Habeas-Corpus-Akte und weiß, dass man den Grenzstein seines Nachbarn nicht verrücken darf.«
»Wenn das Gesetz gebrochen wird«, fuhr Garth fort, »wie es hier im Januar der Fall war, ist es manchmal schwer für die Justiz zu handeln, wie sie sollte. Sie schreitet also ein, so gut sie kann. Und bei Aufruhr, Überfall und Plünderung und solchen Dingen kümmert sie sich nicht um die Mitläufer, weil ihr mehr daran gelegen ist, der Anführer habhaft zu werden. In diesem Fall nun ist ganz offensichtlich, wer der Anführer sein muss.«
»Kann sein.«
»Kein ›Kann sein‹. Nur ist es schwer, stichhaltige Beweise in die Hand zu bekommen. Zeugenaussagen von verantwortungsbewussten Menschen, wie Sie es sind … Und bedenken Sie: Wenn die Justiz keine hieb- und stichfeste Anklage gegen den Anführer erheben kann, dann schaut sie sich natürlich weiter um und hält sich auch an die Mitläufer. Das ist die reine Wahrheit, Mr Paynter, so wahr ich hier sitze, und deshalb ist es für alle das Beste, dass der richtige Zeuge vor den Geschworenen steht.«
Jud nahm sein Glas in die Hand und setzte es gleich wieder hin, da es leer war; rasch hielt Blencowe ihm die Cognacflasche hin. Es gluckerte beruhigend, als Jud sich eingoss.
»Ich versteh nicht, wieso Sie zu mir kommen, wo ich doch gar nicht dabei war«, antwortete er, noch immer auf der Hut. »Was man nicht gesehen hat, da kann man auch nichts drüber sagen.«
»Hören Sie, Paynter«, sagte Tankard, ohne auf Garth’s warnende Geste zu achten. »Wir wissen sehr viel mehr, als Sie glauben. Die Untersuchungen werden nun schon seit fast sieben Monaten geführt. Es wäre besser für Sie, wenn Sie bei der Sache reinen Tisch machten.«
»Reinen Tisch …«
»Wir wissen, dass Sie am Morgen des Schiffbruchs mit Poldark zusammengearbeitet haben. Wir wissen, dass Sie am Tag des Aufruhrs und auch in der folgenden Nacht am Strand waren. Wir wissen, dass Sie bei dem Widerstand gegen die Soldaten, bei dem einer schwer verletzt wurde, eine führende Rolle spielten, ja, in gewisser Weise haben Sie sich ebenso schuldig gemacht wie Ihr Herr –«
»Das ist wirklich der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Ich? Ich war noch nicht mal in der Nähe des Wracks –«
»Aber wie Mr Garth schon erklärt hat, sind wir bereit, das alles zu übersehen, falls Sie sich einverstanden erklären, vor Gericht auszusagen. Wir haben bereits schwerwiegendes Beweismaterial gegen diesen Poldark beisammen, möchten es aber noch erhärten. Sie schulden ihm wirklich keine Loyalität mehr. Sie haben ja selber zugegeben, dass er Sie schandbar behandelt hat! Geben Sie sich einen Ruck, Mann – es ist nur vernünftig, uns die Wahrheit zu sagen, und es ist auch Ihre Pflicht der Allgemeinheit gegenüber.«
Nicht ohne Würde erhob sich Jud.
»Außerdem«, fügte Garth hinzu, »würde es sich auch für Sie lohnen.«
Jud drehte sich nachdenklich auf dem Absatz herum und setzte sich wieder. »Eh?«
»Wir können es natürlich nicht offiziell tun. Das wäre nicht ratsam. Aber es gibt andere Möglichkeiten.«
Jud reckte den Kopf und blickte durch die Tür. Von Prudie war noch nichts zu sehen. Es war immer das Gleiche, wenn sie ihre Kusine besuchte. Er warf den drei Männern in der Hütte einen verstohlenen, abschätzenden Blick zu.
»Was für andere Möglichkeiten?«
Garth zog seinen Geldbeutel heraus und ließ ihn klimpern. »Der Krone ist an einem Schuldspruch gelegen. Sie ist deshalb gewillt, für nützliche Informationen zu zahlen. Streng geheim, natürlich, ganz unter Freunden. Sie können es als Belohnung für eine Verhaftung ansehen. Und das ist es ja auch gewissermaßen, nicht wahr, Mr Tankard?«
Tankard gab keine Antwort. Jud nahm sein Glas und trank seinen Cognac aus. Tonlos sagte er: »Zuerst Drohungen und jetzt Bestechung. Bestechung, so wahr ich lebe! Judasgeld bieten sie einem an. Da soll man vor einem Gericht stehen und gegen einen alten Freund aussagen. Das ist noch schlimmer als Judas, denn der hat’s wenigstens im Stillen gemacht. Und wofür? Für dreißig Silberlinge. Und ich glaube, so viel würden Sie mir noch nicht mal zahlen. Ich müsste es wahrscheinlich für zwanzig oder zehn tun. Das ist nicht vernünftig, das ist nicht anständig, nicht christlich, es ist einfach nicht recht.«
Eine Weile herrschte Schweigen.
»Zehn Guineen jetzt gleich und zehn nach der Verhandlung«, sagte Garth.
»Ha!«, sagte Jud. »Genau wie ich dachte.«
»Vielleicht könnte es auch auf fünfzehn erhöht werden.«
Jud stand langsam auf, schnalzte mit seinen Zähnen und versuchte zu pfeifen, doch seine Lippen waren trocken. Er zog seine Kniehosen hoch und holte mit zwei Fingern eine Prise Schnupftabak aus einer Wamstasche.
»Es ist nicht fair, einem Mann so zuzusetzen«, knurrte er. »Mein Kopf dreht sich wie ein Kreisel. Kommen Sie in vier Wochen wieder.«
»Die Verhandlung ist auf Anfang September festgesetzt.«
Auch Tankard erhob sich. »Wir verlangen keine komplizierte Aussage von Ihnen«, sagte er. »Nur ein paar Sätze, mit denen Sie die Haupttatsachen beschreiben, soweit sie Ihnen bekannt sind. Und Sie müssen Ihre Bereitschaft erklären, das Ganze zu gegebenem Zeitpunkt zu wiederholen.«
»Und was soll ich sagen?«, fragte Jud.
»Die Wahrheit natürlich, und Sie müssen sie beschwören können.«
Hastig unterbrach ihn Garth: »Die Wahrheit natürlich, aber wir könnten Ihnen ein paar Hinweise geben, was wir am dringendsten brauchen. Am dringendsten brauchen wir einen Zeugen, der über den Angriff auf die Soldaten berichten kann. Er fand in der Nacht des achtundzwanzigsten Januar statt. Sie waren damals doch am Strand, nicht wahr, Mr Paynter? Zweifellos haben Sie den Vorfall miterlebt.«
Jud sah alt aus, aber sein Blick war wachsam. »Nein … ich erinnere mich daran nicht mehr.«
»Es könnte zwanzig Guineen wert sein, wenn sich Ihr Gedächtnis etwas auffrischte.«
»Zwanzig jetzt und zwanzig hinterher?«
»… ja.«
»So viel ist Ihnen eine gute Geschichte wert …«
»Wir wollen nur die Wahrheit«, sagte Tankard ungeduldig. »Waren Sie Zeuge des Überfalls oder nicht?«
Garth legte seinen Geldbeutel auf einen wackligen, dreibeinigen alten Tisch, der einst Joshua Poldark gehört hatte. Er begann zwanzig Goldmünzen abzuzählen.
»Was wäre«, sagte Jud, den Blick unverwandt auf das Geld gerichtet, »wenn da so ’n Soldat ’nen Hieb übern Schädel gekriegt hätte, dass er richtig klaffte, und wenn all die andern schneller von Hendrawna Beach weggejagt worden wären, als sie hingekommen waren? Mann, hab ich da drüber gelacht! Haben Sie das gemeint?«
»Natürlich. Das, und Hauptmann Poldarks Beteiligung bei dem Überfall.«
Die Nacht senkte sich auf die Hütte und füllte mit ihren Schatten den Raum. Das Klicken der Münzen klang wie das Tropfen einer schweren Flüssigkeit, und einen Augenblick lang schien es, als sei ein letzter Lichtschimmer über dem kleinen, golden leuchtenden Guineenberg zurückgeblieben.
»Hm«, sagte Jud und schluckte krampfhaft, »ich glaube, daran erinnere ich mich ganz gut. Obwohl ich selber da nicht mitgemacht habe, wissen Sie. Ich war – die ganze Zeit da irgendwo in der Gegend.« Zögernd spuckte er aus. »Warum haben Sie mir nicht gleich gesagt, dass Sie das meinten?«
Am folgenden Tag ritt eine junge Frau in entgegengesetzter Richtung durch das Dorf Grambler, durchquerte Sawle, machte einen Bogen um Trenwith und bog dann zu dem steilen Pfad nach Trevaunance Cove ab. Sie war dunkelhaarig, etwas über mittelgroß und trug ein enganliegendes blaues Reitkostüm, ein hellblaues Mieder und einen kleinen Dreispitz. Man konnte sie nicht eigentlich als schön bezeichnen, dennoch erregte sie bei den Männern für gewöhnlich Aufmerksamkeit.
Sie ließ die Schmelzhütte, deren ockergelbe Dämpfe die Vegetation in der Bucht zerstört hatten, hinter sich und ritt zur anderen Seite, zum Place House, hinüber, das, mit seinem gedrungenen, soliden Bau Wind und Sturm trotzend, über dem Meer aufragte. Je näher sie dem Haus kam, umso offensichtlicher wurde, dass die junge Frau nervös war. Sie fingerte ungeschickt am Zaum ihres Pferdes, und als ein Stallknecht herbeieilte, um ihr absteigen zu helfen, hatte sie Mühe, ihr Anliegen ohne Stottern vorzubringen.
»Sir John Trevaunance, Madam? Ich werde fragen, ob er da ist. Wen soll ich melden?«
»Mrs Poldark.«
»Mrs Poldark. Äh – jawohl, Madam.« War ihr der interessiert aufleuchtende Blick des Burschen aufgefallen? »Bitte folgen Sie mir.«
Sie wurde in einen warmen kleinen Damensalon geleitet, der zu einem Wintergarten führte. Einige Minuten vergingen, in denen sie sich die Handschuhe von den Fingern zerrte, dann hörte sie Fußtritte, ein Diener trat ein und sagte, Sir John sei anwesend und würde sie gern empfangen.
Er war in einem langgestreckten Raum, einer Art Arbeitszimmer, mit Blick auf das Meer. Sie war erleichtert, ihn allein anzutreffen; zu seinen Füßen lag nur ein großer Saurüde. Sir John war weniger imposant, als sie gefürchtet hatte, kaum größer als sie, hatte eine frische Gesichtsfarbe und eine joviale Ausstrahlung.
»Ich stehe Ihnen zu Diensten, Madam«, sagte er. »Bitte nehmen Sie doch Platz.«
Er wartete, bis sie sich auf dem Rand eines Stuhls niedergelassen hatte, und setzte sich dann wieder hinter seinen Schreibtisch. Sie saß eine Zeitlang mit gesenktem Blick da, wohl wissend, dass er sie prüfend anblickte, und dass sie diese Musterung über sich ergehen lassen musste.
Schließlich sagte er vorsichtig: »Ich hatte noch nicht das Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen …«
»Nein … Sie kennen meinen Mann recht gut …«
»Natürlich. Wir hatten bis … bis vor kurzem geschäftlich miteinander zu tun.«
»Ross war sehr bekümmert, als er diese Verbindung aufgeben musste. Er war immer so stolz darauf.«
»Hmhm! Die Umstände waren schuld, niemand sonst, Madam. Wir alle haben bei dieser Transaktion Geld verloren.«
Nun blickte sie auf und stellte fest, dass seine Musterung zu ihren Gunsten ausgefallen war. Demelzas Fähigkeit, Männern zu gefallen, gehörte zu den wenigen glücklichen Umständen, die ihr das Auftreten in der Gesellschaft erleichterten. Sie sah darin nicht eigentlich eine Macht, die sie ausübte, sondern eher eine Stütze, wenn ihr der Mut sank. Sie war sich klar darüber, dass ihr Besuch bei Sir John nach den Regeln der gesellschaftlichen Etikette vom Üblichen abwich – und ihm musste das auch klar sein.
Von ihrem Platz aus konnten beide den Rauch sehen, der von der Schmelzhütte über die Bucht zog, und nach kurzem Zögern fuhr er ein wenig steif fort: »Wie Sie – hm – zweifellos wissen, ist die Gesellschaft neu gegründet worden – unter einer neuen Geschäftsleitung. Es war für uns alle ein Schlag, als das Unternehmen zusammenbrach, aber sicher können Sie meine Situation verstehen. Die Gebäude lagen auf meinem Land – sozusagen direkt vor meiner Nase –, ich hatte mehr Kapital als irgendjemand anders in das Geschäft gesteckt, und es wäre deshalb Wahnsinn gewesen, sie ungenutzt verkommen zu lassen. Als sich die Gelegenheit auftat, neues Kapital zu bekommen, musste der gesunde Menschenverstand mir raten, sie wahrzunehmen. Ich hoffe, Hauptmann Poldark hat dafür Verständnis.«
»Bestimmt hat er das«, sagte Demelza. »Und ich bin sicher, dass er Ihnen Erfolg für jedes neue Unternehmen wünscht – auch wenn er nicht daran beteiligt ist.«
Sir Johns Blick verriet Unsicherheit. »Sehr freundlich von Ihnen, das zu sagen. Bisher können wir allerdings kaum unsere Kosten bestreiten, aber ich hoffe, dass die Lage sich bessert. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Ein Glas Kanarienwein vielleicht?«
»Nein, vielen Dank …« Sie zögerte. »Aber ein Glas Portwein würde ich gern annehmen, wenn es nicht zu viele Umstände macht.«
Sir Johns Augenbrauen hoben sich ironisch; er stand auf und läutete. Bald darauf wurde der Wein gebracht, und während sie tranken, machten sie höfliche Konversation. Sie sprachen von Minen, von Kühen, Kutschen und dem missglückten Sommer. Demelzas Verkrampfung löste sich, und Sir Johns Vorsicht ließ nach.
»Um die Wahrheit zu sagen«, sagte Demelza, »ich glaube, es ist das schlechte Wetter, weshalb wir mit den Tieren so viel Schwierigkeiten haben. Wir haben eine gute Kuh – sie heißt Emma –, noch vor zwei Wochen hat sie reichlich Milch gegeben, und jetzt gibt sie kaum noch etwas. Bei einer anderen ist es genau das Gleiche, obwohl es bei der nicht so erstaunlich ist –«
»Ich besitze eine gute Hereford-Kuh, die eine Menge Geld wert ist«, erwiderte Sir John. »Sie hat vor zwei Tagen erst zum zweiten Mal gekalbt, und jetzt liegt sie mit einer Querschnittslähmung da. Der Tierarzt, Dr Phillips, ist schon mehr als fünfmal hier gewesen. Es würde mich wirklich treffen, wenn ich sie verlöre.«
»Ist das Kalb gesund?«
»Ja, das schon, aber es war eine schwere Geburt. Minta konnte hinterher nicht aufstehen. Auch mit ihren Zähnen ist etwas nicht in Ordnung – sie sind ganz locker –, und die Schwanzknochen scheinen irgendwie gebrochen. Phillips ist am Ende seiner Weisheit und mein eigener Mann ebenfalls.«
»Ich erinnere mich«, sagte Demelza, »dass wir, als ich noch in Illuggan lebte, einen ganz ähnlichen Fall hatten. Die Kuh des Pfarrers wurde krank, mit ganz ähnlichen Symptomen. Und auch, nachdem sie gekalbt hatte.«
»Hat er ein Mittel dagegen gefunden?«
»Ja, Sir, er hat ein Mittel gefunden.«
»Und was für eines?«
»Tja … es steht mir wohl nicht zu, darüber zu urteilen, ob er das Richtige tat … jedenfalls fand er es nicht unter seiner Würde, eine alte Frau zu rufen, die Maggy Dawes hieß – sie wohnte am andern Ufer des Flusses, glaube ich. Sie hatte ein seltenes Geschick, Warzen wegzubringen und Skrofulose zu heilen. Einmal ging ein Junge mit einem schlimmen Auge zu ihr, und kaum hatte sie –«
»Aber was ist nun mit der Kuh, Madam?«
»Ach, ja. Darf man einen Blick auf sie werfen, Sir John? Ich würde sie sehr gern sehen, um sicher zu sein, dass sie die gleichen Beschwerden hat wie die Kuh des Pfarrers.«
»Wenn Sie so freundlich sein wollen, werde ich Sie selbst hinführen. Darf ich Ihnen noch ein Glas Portwein einschenken?«
Kurz darauf gingen sie über den kopfsteingepflasterten Hof hinter dem Haus und betraten den Stall, in dem die Kuh lag. Demelza musterte die massiven Steinmauern der Nebengebäude und wünschte, sie gehörten ihr. Die Kuh lag auf der Seite, ihre sanften braunen Augen hatten einen traurigen, aber klaglosen Blick. Ein Mann erhob sich von einem hölzernen Schemel und stellte sich respektvoll neben die Tür.
Demelza beugte sich zu der Kuh hinab und untersuchte sie – mit einer Sachkenntnis und Geschicklichkeit, die nicht von ihrer Kindheit in Illuggan herstammten, sondern von den sieben Jahren, die sie nun in Nampara lebte. Die Beine des Tieres waren gelähmt, und der Schwanz war etwa in der Mitte merkwürdig abgeknickt.
»Ja«, sagte Demelza nach einer Weile, »es ist genau das Gleiche. Meggy Dawes nannte das die Schwanzkrankheit.«
»Und das Heilmittel?«
»Das hat sie sich ausgedacht, nicht ich.«
»Ja, ja, das ist mir klar.«
Demelza fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Sie sagte, man müsse den Schwanz hier, etwa dreißig Zentimeter vom Ende, wo die Knochen auseinandergerutscht sind, aufschlitzen und eine gut gesalzene Zwiebel hineinstecken, sie mit grobem Zwirn festbinden, eine Woche lang an dieser Stelle lassen und den Zwirn dann entfernen. Das Tier dürfe nur einmal täglich ein wenig zu fressen bekommen, und man solle ihm außerdem ein Stärkungsmittel aus Rosmarin, Wacholderbeeren und geschälten Kardamomsamen verabreichen.«
Demelza blickte Sir John abwartend an. Er nagte an seiner Unterlippe.
»Hm«, sagte er, »von diesem Heilmittel habe ich nie gehört, aber die Krankheit ist ja auch ziemlich selten. Außer Ihnen habe ich auch noch nie jemanden getroffen, der ihr schon begegnet war. Wie dem auch sei, ich glaube, ich möchte das Mittel probieren. Was meinen Sie dazu, Lyson?«
»Ist auf jeden Fall besser, als das Tier leiden zu lassen.«
»Ganz meine Meinung. Soviel ich gehört habe, verstehen diese alten Weiber gerade bei den weniger bekannten Krankheiten Wunder zu wirken. Würden Sie so freundlich sein, die Instruktionen für Lyson zu wiederholen, Mrs Poldark?«
»Aber gern.« Als das geschehen war, gingen sie ins Haus zurück.
»Ich hoffe«, sagte Sir John, »dass Hauptmann Poldark seinem Prozess mit Ruhe entgegensieht.«
Er hatte diesen Satz kaum ausgesprochen, da bedauerte er seine Unbesonnenheit bereits. Es war offenkundig, dass sie dieses Thema absichtlich vermieden hatte, und nun hatte er es unbedachtsamerweise angeschnitten. Glücklicherweise reagierte sie nicht so heftig, wie er befürchtet hatte.
»Tja, natürlich sind wir sehr unglücklich darüber. Aber ich glaube, ich mache mir mehr Sorgen als er.«
»Sie werden das Ganze bald hinter sich haben, und seine Aussichten auf einen Freispruch sind, so glaube ich, nicht schlecht.«
»Meinen Sie das wirklich, Sir John? Das tröstet mich sehr. Werden Sie während der Verhandlung in Bodmin sein?«
»Ich? Hm, das weiß ich noch nicht. Warum fragen Sie?«
»Ich habe gehört, dass im September auch eine Wahl stattfinden soll, und da die Verhandlung auf den sechsten angesetzt ist, dachte ich, Sie würden dann vielleicht auch dort sein.«
»Sie meinen, um meinen Bruder zu unterstützen? Ach, der ist durchaus in der Lage, sich selbst um seinen Sitz im Parlament zu kümmern.« Sir John warf einen leicht misstrauischen Blick auf ihr ruhiges Gesicht, als sie den langgestreckten Raum betraten, den er als Arbeitszimmer benutzte. Schwer zu sagen, was sie dachte. »Selbst wenn ich in der Stadt bin, werde ich doch zu viel zu tun haben, um an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Außerdem, aufrichtig gesagt, möchte ich auch nicht gern Zeuge sein, wenn ein alter Freund in einer Notlage zu kämpfen hat.«
»Wir haben gehört, dass es zwei Richter geben wird«, sagte sie.
»Oh, nein, nicht zwei für einen Fall. Zwei werden sich die verschiedenen Verhandlungen teilen, nehme ich an. Wentworth Lister ist kein übler Mensch, allerdings ist es Jahre her, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Sie werden ganz bestimmt eine faire Verhandlung bekommen. Dafür wird die britische Justiz sorgen.« Der Saurüde war auf ihn zugetrottet; Sir John holte einen Keks aus einer Schublade und reichte ihn dem Hund.
»Ich finde es ziemlich verwirrend«, sagte Demelza, »dass ein Mensch – ein Richter – von weit her angereist kommen und innerhalb weniger Stunden über einen Fall verhandeln und rechtsprechen kann. Mir kommt das unmöglich vor. Ich frage mich, ob er sich vor Prozessbeginn jemals Gedanken über die Wahrheit macht.«
Sir John lächelte. »Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie schnell ein erfahrener Kopf die wahren Fakten erkennt. Und bedenken Sie, das Urteil wird nicht vom Richter, sondern von den Geschworenen gesprochen, und das sind komische Menschen wie wir– Grund genug, die Sache optimistisch zu sehen. Noch einen Schluck Portwein?«
Dankend lehnte Demelza ab. »Ich fürchte, er ist ein bisschen schwer. Aber er hat eine wunderbare Blume. Wenn wir den Prozess hinter uns haben, würden wir Sie gern einmal bei uns zu Gast sehen, Sir. Ross hat mir aufgetragen, Ihnen das zu sagen.«
Sir John erwiderte, er freue sich darauf. Der Hund verstreute Kekskrümel auf dem Boden. Demelza erhob sich.
»Ich setze große Hoffnungen darauf«, sagte er zum Abschied, »dass Ihr Heilmittel Minta hilft.«
Demelza antwortete, das hoffe sie auch, und bemühte sich, ihre Zweifel nicht merken zu lassen. »Würden Sie mich darüber auf dem Laufenden halten?«
»Natürlich. Ich gebe Ihnen Nachricht. Und falls Ihr Weg Sie wieder an meinem Haus vorbeiführt … ich würde mich sehr freuen …«
»Vielen Dank, Sir John. Ich reite manchmal nur so die Küste entlang; es ist unebenes Gelände für ein gutes Pferd, aber ich liebe den Blick über das Meer, und die frische Luft tut mir gut.«
Sir John begleitete sie zur Tür und half ihr aufs Pferd, wobei er ihre schlanke Figur und ihren geraden Rücken bewunderte. Im gleichen Augenblick, als sie aus dem Tor ritt, kam ein Mann auf einem grauen Pferd herein.
»Wer war das?«, fragte Unwin Trevaunance und warf seine grauen Reithandschuhe auf einen Stapel Zinnschecks. Sir Johns jüngerer Bruder tat alles bewusst und absichtlich und verlieh damit oft Handlungen eine Bedeutsamkeit, die sie im Grunde gar nicht hatten. Er war sechsunddreißig oder siebenunddreißig Jahre alt, groß, hatte ein herrisches Auftreten und war als Persönlichkeit sehr viel eindrucksvoller als sein Bruder. Dennoch verdiente Sir John Geld, und Unwin nicht.
»Das war die Frau von Ross Poldark. Eine sehr anziehende junge Frau. Ich kannte sie noch gar nicht.«
»Was wollte sie?«
»Das weiß ich noch nicht«, antwortete Sir John. »Offenbar wollte sie nichts Bestimmtes.«
Unwin hatte eine Falte zwischen den Augen, die sich noch vertiefte, wenn er die Stirn runzelte. »War sie nicht sein Küchenmädchen oder etwas Derartiges?«
»Es haben sich vor ihr schon andere Leute emporgearbeitet, die geringere Talente besaßen. In ihrer Art, sich zu geben, hat sie bereits eine gewisse Eleganz. Noch ein paar Jahre, und man kann sie kaum noch von einer Frau aus guter Familie unterscheiden.«
»Und sie kam einfach so? Das möchte ich bezweifeln. Meiner Meinung nach ist sie eine gefährliche Frau.«
»Gefährlich?«
»Wir hatten Gelegenheit, uns kurz zu mustern, als sie fortritt. Und ich besitze eine ziemlich gute Menschenkenntnis, John.«
»Meine Menschenkenntnis ist auch nicht schlecht, Unwin, und ich glaube, ich werde das Risiko in Kauf nehmen.« Sir John gab dem Hund noch einen Keks. »Sie hat mir ein Heilmittel für Minta angeboten, und ich werde es ausprobieren, obwohl ich bezweifle, dass es hilft. – Hast du Ray angetroffen?«
»Ja. Oh ja. Ich habe ihm gesagt, dass Caroline die Reise hier bei uns unterbrechen möchte, um während der Wahl in Bodmin sein zu können, aber Caroline hatte ihm das schon geschrieben, er wusste es also bereits. Das sieht ihr ähnlich, mich zu bitten, dass ich ihren Onkel um Erlaubnis frage, und ihm dann selbst zu schreiben.«
»Sie ist noch sehr jung. Du musst Geduld mit ihr haben, Unwin. Du wirst viel Geduld brauchen. Sie ist temperamentvoll und eigensinnig. Und außer dir gibt es noch andere, die sie für eine gute Partie halten.«
Unwin nagte an seiner Reitpeitsche. »Der Alte ist ein eingefleischter Geizkragen. Heute Morgen saß er da und blätterte mit seinen grindigen Händen in den Rechnungen, und das Haus, das schon in seinen Glanzzeiten nicht gerade ein Herrenhaus war, ist so reparaturbedürftig, dass es demnächst auseinanderfällt. Das ist wirklich kein geeigneter Ort für Caroline.«
»Das wirst du ja eines Tages ändern können.«
»Ja, eines Tages. Aber Ray ist höchstens dreiundfünfzig oder vierundfünfzig. Und er kann noch zehn Jahre leben.« Unwin ging zum Fenster und blickte über das Meer, das an diesem Morgen ruhig war. Die Wolke, die tief über den schroffen Klippen hing, hatte die Farbe des Wassers in ein dunkles Grün verwandelt. Auf dem Haus hatten sich ein paar kreischende Möwen niedergelassen. Auf Unwin, der das Londoner Stadtleben gewöhnt war, machte die Szene einen melancholischen Eindruck. »Penvenen hat ziemlich ungewöhnliche Ansichten. Heute Morgen meinte er doch tatsächlich, Cornwall sei im Parlament überrepräsentiert. Er sagte, die Sitze sollten unter die neuen Städte in Mittelengland verteilt werden. Was für ein Blödsinn!«
»Du darfst diese kleinen Schwächen gar nicht zur Kenntnis nehmen. Er sagt solche Dinge oft, um jemanden zu ärgern. Das ist so seine Art.«
Unwin wandte sich um. »Jedenfalls hoffe ich, dass es in den nächsten sieben Jahren keine Wahlen mehr gibt. Das bloße Vergnügen, wieder gewählt zu werden, wird mich über zweitausend Pfund kosten, und du weißt, damit hört es nicht auf – es beginnt vielmehr erst.«
Sir Johns Blick nahm die wachsame Ausdruckslosigkeit an, die er immer hatte, wenn von Geld die Rede war. »Deinen Beruf hast du dir selbst gewählt, mein Junge. Andere sind noch schlimmer dran. Carter von Grampound hat mir erzählt, dass er für jede Stimme jedes Mal dreihundert Guineen zahlen muss.« Er stand auf und klingelte. »Mrs Poldark hat mich gefragt, ob ich zur Wahl nach Bodmin komme. Ob sie dabei wohl irgendetwas im Sinn hatte?«
2
Es ging schon auf Mittag zu, als Demelza ihr Pferd auf den Heimweg lenkte. Als sie das Grundstück von Trenwith House im Bogen umritt, bedauerte sie, dass sie nicht dort einkehren konnte, um ein paar Minuten mit Verity zu plaudern. Sie vermisste das sehr und konnte sich nicht daran gewöhnen. Doch Verity war in Falmouth, vielleicht auch noch weiter weg – trotz aller düsteren Voraussagen offenbar glücklich verheiratet, und sie, Demelza, hatte diese Veränderung erst ermöglicht, nun durfte sie sich nicht darüber beklagen. Veritys Flucht hatte die Kluft zwischen den beiden Familien noch vertieft, und trotz der aufopfernden Haltung, die Demelza vergangene Weihnachten gezeigt hatte, war sie bisher nicht wirklich überbrückt. Die Schuld daran lag nun nicht mehr bei Francis. Seit den Krankheitsfällen am vergangenen Weihnachtsfest und dem Tod der kleinen Julia war er eifrig darauf bedacht, Demelza für alles, was sie getan hatte, seine Dankbarkeit zu erweisen. Aber Ross wollte von einer Versöhnung nichts wissen. Der Zusammenbruch der Carnmore-Kupfergesellschaft lag als unüberwindliches Hindernis zwischen ihnen. Und falls der Verdacht, den Ross in Bezug auf diesen Zusammenbruch hegte, zutraf, konnte Demelza es ihm noch nicht einmal verdenken. Dennoch wäre es ihr anders sehr viel lieber gewesen. Sie hielt eine entschiedene Bereinigung von Konflikten für wesentlich besser als einen unausgesprochenen, von Affekten verzerrten Verdacht.
Gerade als das Haus aus ihrem Blickfeld verschwand, sah sie Dwight Enys, der den Pfad hinter ihr hergeritten kam. Sie zügelte ihr Pferd und wartete auf ihn. Als der junge Arzt sie eingeholt hatte, zog er den Hut.
»Ein schöner Morgen, Madam. Es freut mich zu sehen, dass Sie die frische Luft genießen.«
»Aber nicht ganz ohne einen Zweck«, antwortete sie lächelnd. »In letzter Zeit hat alles, was ich tue, irgendeinen Zweck. Vom moralischen Standpunkt ist das sicher anerkennenswert.«
Er lächelte ebenfalls – denn Demelzas Lächeln war unwiderstehlich – und lenkte sein Pferd neben ihres. Der Pfad bot gerade genug Raum dafür. Mit dem geübten Blick des Arztes bemerkte er, dass sie noch ebenso dünn war wie nach ihrer Krankheit im Januar.
»Das hängt vermutlich davon ab, ob es ein moralischer Zweck war oder nicht.«
Sie strich eine Locke fort, die ihr der Wind ins Gesicht geweht hatte. »Ach, das weiß ich nicht. Da müssen wir den Pfarrer fragen. Ich war im Place House und habe bei Sir Johns Vieh den Arzt gespielt.«
Dwight machte ein überraschtes Gesicht. »Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Viehexpertin sind.«
»Wusste ich auch nicht. Ich kann nur beten, dass seine Hereford-Kuh wieder gesund wird. Wenn sie stirbt, habe ich nichts Gutes getan.«
»Und wenn sie am Leben bleibt?«
Sie warf ihm einen Blick zu. »Wohin reiten Sie, Dwight?«
»Ich muss ein paar Leute in Sawle besuchen. Ich werde von Tag zu Tag beliebter bei den Patienten, die nicht zahlen können. Und Choake wird immer fauler.«
»Und auch immer unfreundlicher. Sagen Sie, was steckt eigentlich hinter all den Bemühungen, Ross einen Schuldspruch einzubrocken?«
Der junge Arzt sah verlegen aus. Er schlug mit einer Schlaufe der Zügel auf den Ärmel seines schwarzen Samtmantels. »Die Justiz, nehme ich an …«
»Oh ja, die Justiz. Aber noch etwas anderes. Seit wann ist die Justiz so pedantisch, nur weil ein Wrack ausgeraubt wurde oder weil ein paar Steuereinnehmer ein bisschen grob angefasst wurden – selbst wenn Ross daran beteiligt gewesen wäre, und wir wissen, dass das nicht der Fall war. Derartiges hat es schon gegeben, seit ich denken kann, ach was, seit Hunderten von Jahren sind solche Dinge vorgekommen.«
»Ich weiß nicht, ob Sie da recht haben – nicht ganz. Ich würde alles tun, was ich kann, um Ross zu helfen, und ich werde es tun, das wissen Sie …«
»Ja, das weiß ich.«
»Aber man sollte sich nichts vormachen: Man kann das Gesetz zehnmal missachten, beim elften Mal erwischt es einen doch und klammert sich an einem fest wie ein Blutegel. Dann lässt es einen nicht los, bis die Sache ausgestanden ist. Das ist die Wahrheit. Bei diesem Fall fragt man sich allerdings doch, ob hier, nachdem die Justiz zugegriffen hat, nicht auch noch andere Kräfte im Spiel sind –«
»Bei uns sind Leute aufgetaucht, die sogar den Gimletts, unseren eigenen Bediensteten, Fragen gestellt haben. Es gibt bestimmt kaum eine Hütte in unserem Bezirk, wo nicht so ein Mensch mit Fragen aufgetaucht ist, und sie alle versuchen, Ross die Schuld in die Schuhe zu schieben! Zweifellos steckt da die Justiz dahinter, aber eine Justiz, die erstaunlich viel Geld ausgeben und Zeit verschwenden kann – denn keiner von seinen Leuten wird gegen ihn aussagen, und das sollte doch bekannt sein. Ross hat Feinde, aber nicht unter den Bergleuten, die ihm bei dem Schiffbruch geholfen haben!«
Sie hatten nun Sawle erreicht, dessen Kirchturm schief stand wie der Turm von Pisa, und Dwight hielt bei der Talmulde an. Auf dem abfallenden Feld am Hügel mähten einige Frauen den Weizen. Rund um den Feldrain war er bereits aufgeschichtet, in der Mitte aber noch ungemäht geblieben, und das Ganze sah aus wie ein besticktes Taschentuch.
»Kommen Sie nicht mit hinunter?«
»Nein, Ross wartet auf mich.«
»Sollten bei dem Fall noch andere Kräfte am Werk sein außer der Justiz«, sagte Dwight, »so würde ich dafür nicht eine aufgeblasene Null wie Dr Choake verantwortlich machen, der weder reich noch gefährlich genug ist, um ernsthaften Schaden anzurichten.«
»Das tue ich auch nicht, Dwight. Wir tun es beide nicht.«
»Gut. Zu Ihrer Information: Ich habe die Warleggans seit einem Jahr nicht mehr besucht.«
»Ich habe bisher nur George kennengelernt. Wie sind die andern denn?«, fragte sie.
»Ich kenne sie nur wenig. Nicholas, Georges Vater, ist ein großer, harter, despotischer Mann, aber er genießt den Ruf vollkommener Rechtschaffenheit. Georges Onkel, Cary, hält sich mehr im Hintergrund, und wenn es um irgendwelche fragwürdigen Aktionen geht, so ist vermutlich er dafür zuständig. Aber ich muss gestehen, zu mir waren sie immer sehr freundlich.«
Demelza blickte über das blau-silberne Dreieck des Meeres, das den Abschluss des Tales bildete. »Sanson, der bei dem Schiffbruch umkam, war ein Vetter von ihnen, und es gibt noch andere Dinge zwischen Ross und George – sogar aus der Zeit vor der Kupfergesellschaft. Dies ist daher eine gute Gelegenheit, alte Rechnungen zu begleichen.«
»Ich würde mir deshalb nicht zu viel Sorgen machen. Das Gericht wird sich nur um die Wahrheitsfindung bemühen.«
»Da bin ich nicht so sicher«, antwortete sie.
Hendrawna Beach bot einen ganz anderen Anblick als Trevaunance Cove. Obwohl sich Ebbe und Flut um die Felsen nur wenig bemerkbar machten, schlug das Meer doch mit donnernden Wellen auf den flachen Sandstrand, und die ruhige, milde Luft war leicht dunstig. Ross war auf dem Rückweg von seinem üblichen Morgenspaziergang, der ihn immer bis zu den Dark Cliffs führte, und blickte nun über die Klippen hinweg zu der Stelle, wo die Hütten der Wheal-Leisure-Mine standen, konnte sie aber durch den Nebel kaum erkennen. Man ging an diesem Morgen wie durch ein Dampfbad.
Seit Julias Tod und der Anklage gegen ihn hatte er sich gezwungen, täglich diesen Spaziergang zu machen. Manchmal, wenn ihm danach zumute und das Wetter günstig war, nahm er auch das Dingi und segelte bis nach St. Ann’s. Zwar änderten diese Aktivitäten nichts an dem Druck, der auf seiner Seele lastete, doch er fühlte sich nun wenigstens ausgeglichen genug, die Aufgaben des Tages in Angriff zu nehmen. Seine Tochter war tot, sein Vetter hatte ihn hintergangen, das Schmelzprojekt, an dem er so viel gearbeitet hatte, war in die Brüche gegangen, er musste vor Gericht auf eine Anklage gefasst sein, die ihm das Todesurteil oder lebenslängliche Verbannung einbringen konnte, und falls das Glück es wollte, dass er das unbeschadet überstand, so war es doch nur eine Frage von Monaten, bis ihm Bankrott und der Schuldturm drohten. Bis dahin mussten die Felder bestellt werden, Kupfer musste gefördert und verkauft, Demelza gekleidet, ernährt und liebevoll umsorgt werden – soweit er im Augenblick überhaupt zu liebevoller Fürsorge imstande war.
Julias Tod hatte ihn am härtesten getroffen. Demelza hatte ebenso tief getrauert wie er, aber sie besaß eine flexiblere Natur als er und reagierte stärker auf Stimulantia, die ihm wenig bedeuteten. Schöllkraut, das zu ungewohnter Jahreszeit blühte, ein Wurf junger Kätzchen, auf den sie plötzlich in einem Heuboden stieß, Sonnenschein, der nach kalten Tagen wieder durchbrach, der Duft des ersten Heus – all das verschaffte ihr vorübergehend seelischen Aufschwung, und der Kummer konnte sie deshalb nicht so tief niederdrücken wie ihn. Und was die liebevolle Fürsorge betraf, so war sie im vergangenen Jahr zum größeren Teil von ihr ausgegangen, obwohl ihm das nicht bewusst war.
Nach den Störungen um Weihnachten war es ein ruhiger Winter gewesen; dennoch hatte im Bezirk kein wirklicher Frieden geherrscht, so wenig wie in Ross’ Seele. Die Kupferpreise waren zwar ein wenig gestiegen, doch gerade so viel, dass die Minen, die zurzeit in Betrieb waren, einen leichten Gewinnanstieg verzeichnen konnten, aber zu wenig, um das Wagnis neuer Unternehmen oder die Wiederinbetriebnahme alter Minen zu rechtfertigen. Alle Erträge reichten gerade aus, um sich über Wasser zu halten – das war der augenblickliche Lebensstandard.
Als er vom Strand abbog und über die zerbrochene Mauer stieg, sah er, wie Demelza das Tal herabgeritten kam; sie erblickte ihn im selben Augenblick und winkte. Er winkte zurück. Sie erreichten das Haus fast gleichzeitig, er half ihr vom Pferd und gab Gimlett, der herbeigeeilt war, die Zügel.
»Du hast dich heute für deinen Morgenritt elegant zurechtgemacht«, bemerkte er.
»Ich wollte nicht nachlässig gekleidet ausreiten, so als liege mir nichts daran, dass ich Mrs Poldark bin.«
»Manche denken das im Augenblick vielleicht trotzdem.«
Nachdrücklich schob sie ihren Arm unter seinen; sie wollte ihn dazu bringen, einen Rundgang durch den Garten mit ihr zu machen.
»Meine Stockrosen sind dieses Jahr nicht sehr schön«, sagte sie.
»Zu viel Regen. Die ganze Ernte ist verzögert. Wir brauchten einen heißen September.«
»Dann wäre es im Gerichtssaal aber sehr stickig.«
»Wir werden ja nicht den ganzen Monat im Gericht sein. Nur einen Tag. Dann wirst du frei sein.«
»Wer sagt das? Hast du deine Hexen um Rat gefragt?«
Sie bückte sich und hob eine Schnecke auf, die unter einem alten Primelblatt lag. Sie hielt sie zwischen Zeigefinger und Daumen von sich ab und betrachtete sie mit Abscheu. »Ich weiß nie, was ich mit ihnen machen soll.«
»Leg sie auf diesen Stein.«
Sie tat es und wandte sich ab, während er die Schnecke zertrat. »Arme kleine Schnecke. Aber sie sind so gefräßig. Es wäre mir ja gleich, wenn sie mit ein, zwei Blättern zufrieden wären … Apropos Hexen, Ross, hast du schon mal von einer Kuhkrankheit gehört, die sich Schwanzkrankheit nennt?«
»Nein.«
»Die Hinterbeine sind gelähmt, und die Zähne werden locker.«
»Kuhzähne sind immer locker«, sagte Ross.
»Und der Schwanz sieht ganz merkwürdig aus, wie gebrochen. Daher der Name. Was meinst du – könnte man die Krankheit heilen, wenn man den Schwanz aufschneidet und eine gesalzene Zwiebel hineinsteckt?«
»Nein«, antwortete Ross.
»Aber schaden würde es doch nicht, wenn es der Kuh dadurch bessergeht?«
»Was hast du heute Morgen gemacht?«
Sie warf einen Blick auf sein knochiges, vornehmes Gesicht. »Auf dem Heimweg habe ich Dwight getroffen. Er wird bei der Gerichtsverhandlung anwesend sein.«
»Ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen. Halb Sawle und Grambler werden da sein, wie mir scheint. Nun, ein Vergnügen auf Kosten anderer ist ja ein besonderes Vergnügen.«
Sie gingen schweigend weiter. Unter den tiefhängenden Wolken lag der Garten reglos da, Blätter und Blüten strahlten eine warme Festigkeit aus, als seien sie unvergänglich. Es gibt nichts Unvergängliches, dachte Ross, nur flüchtige Augenblicke voll Wärme und Freundschaft, kostbare Ruhepunkte in einer fließenden Linie unruhiger Tage.
Ein Regenschauer ging nieder und trieb sie zum Haus zurück. Sie standen eine Weile am Wohnzimmerfenster und sahen zu, wie dicke Regentropfen auf die Blätter des Fliederbaumes klatschten und sie dunkel färbten. Zu Beginn des Regens hatte Demelza den unwillkürlichen Impuls gehabt, nachzusehen, ob Julia draußen schlief. Erst hatte sie zu Ross darüber sprechen wollen, behielt es dann aber für sich. Manchmal fürchtete sie, dass Julias Tod eine Schranke zwischen ihnen aufgerichtet hatte, denn obgleich er sich große Mühe gab, sich nichts anmerken zu lassen, nagte die Erinnerung an die unheilvolle Krankheitsphase noch immer an ihm.
»Meinst du nicht«, sagte sie, »dass du den Notar Pearce wieder aufsuchen solltest?«
Er brummte nur. »Der Mann ärgert mich bloß. Je weniger ich von ihm sehe, desto besser.«
Leise antwortete sie: »Aber Ross, mein Leben – und auch deins – steht auf dem Spiel.«
Er legte den Arm um sie. »Unsinn. Wenn mir etwas zustößt, bleibt dir immer noch genug zum Leben. Das Haus und das Land gehören dann dir. Du wirst erster Aktionär der Wheal-Leisure-Mine. Und du wirst Pflichten haben – den Menschen und dem Land gegenüber …«
Sie unterbrach ihn. »Nein, Ross, ich werde nichts haben. Ich werde wieder eine Bettlerin sein. Ich werde die Magd eines unerfahrenen Bergmanns sein –«
»Du wirst eine anziehende junge Frau Anfang zwanzig mit einem kleinen Besitz und einem Haufen Schulden sein. Die besten Jahre deines Lebens werden noch vor dir liegen –«
»Aber ich lebe nur durch dich. Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin. Du hältst mich für anziehend, du hältst mich für die Frau eines Gutsherrn –«
»Unsinn. Du würdest bestimmt wieder heiraten. Wenn ich nicht mehr da wäre, würden Männer aus der ganzen Grafschaft um dich schwirren. Das ist keine Schmeichelei, sondern nur die Wahrheit. Du könntest dir aus einem Dutzend Bewerber einen herauspicken –«
»Ich würde nie wieder heiraten. Nie!«
Er fasste sie fester. »Wie dünn du noch immer bist.«
»Bin ich nicht. Du solltest wissen, dass ich es nicht bin.«
»Na gut, dann eben schlank. Aber früher hat sich deine Taille weicher angefühlt.«
»Nur nach Julias Geburt. Und das war … etwas anderes.«
Der Name war gefallen.
»Ja«, sagte er.
Eine Weile herrschte Schweigen. Er hielt die Augen gesenkt; sie konnte nicht in seinem Blick lesen.
»Ross«, sagte sie.
»Ja?«
»Vielleicht wird die Zeit es ändern. Vielleicht bekommen wir noch mehr Kinder.«
Er zog seinen Arm zurück. »Das Kind wäre bestimmt nicht froh, einen Galgenvogel zum Vater zu haben … Das Essen müsste nun eigentlich fertig sein.«
Als Dwight und Demelza sich getrennt hatten, ritt Dwight den steilen, schmalen Pfad zum Dorf Sawle, dem Rauschen des Flusses und dem Geklapper der Zinnstampfwerke hinunter. Es war noch gar nicht lange her, seit er, ein unerfahrener junger Arzt mit fortschrittlichen medizinischen Ideen, zu diesem Bezirk gekommen war, doch ihm erschien es wie ein Jahrzehnt. Er hatte sich das Vertrauen und die Zuneigung der Menschen, unter denen er arbeitete, erworben, hatte den Eid des Hippokrates gebrochen, was unentschuldbar war, und seitdem mit großer Mühe versucht, sich als Arzt wieder neu zu etablieren. In den Augen der anderen Menschen, die der Meinung waren, das beteiligte Mädchen sei selbst schuld, war ihm das inzwischen völlig gelungen, in seinen eigenen Augen jedoch nur teilweise, denn er war außerordentlich selbstkritisch und stellte hohe Anforderungen an sich selbst.
Immerhin hatte er viel gelernt: dass die Menschheit aus unendlich verschiedenen und widersprüchlichen Individuen bestand, deren Behandlung ein ständiges geduldiges Experimentieren, neues Versuchen und sich Irren bedeutete, dass der Arzt häufig bloßer Zuschauer bei Schlachten war, die vor seinen Augen geschlagen wurden, dass jede Hilfe, die von außen kam, nur einen Bruchteil der Wirksamkeit besaß, wie sie die normale Regenerationskraft des Körpers hatte, und dass die Pulver und Säfte des Arztes die Genesung manchmal eher hinderten als förderten.
Mit etwas mehr Eitelkeit hätte er Trost bei dem Gedanken gefunden, dass er mit seinen Erkenntnissen bereits so weit gediehen war, denn viele Ärzte, die er kannte, hatten in einem ganzen Leben nicht so viel gelernt und würden es auch nicht mehr lernen. Er vermied es, mit Kollegen zusammenzutreffen, da er regelmäßig mit ihnen in Streit geriet. Sein einziger Trost dabei war, dass sie auch untereinander uneinig waren; nur eins war allen gemeinsam: die unverrückbare Überzeugung von der Unfehlbarkeit ihrer eigenen Methode, eine Überzeugung, die nicht einmal der Tod eines Patienten ins Wanken bringen konnte. Wenn ein Kranker bei der Behandlung zusammenbrach, war daran der Kranke schuld, nicht die Behandlungsmethode.
Über die Einstellung von Dr Thomas Choake zur Medizin war Dwight sich nicht ganz klar. Seit ihrem ersten Streit hatten sie einander nur selten gesehen, doch da sie fast im gleichen Gebiet praktizierten, konnte es nicht ausbleiben, dass sie einander gelegentlich trafen. Choake hatte stets ein Patentmittel zur Hand – ja, manchmal schien er sich schon vor der Untersuchung des Patienten für ein bestimmtes Mittel entschieden zu haben. Doch ob die Wahl dieser Mittel einer starren medizinischen Theorie entsprang oder ob es nur plötzliche Eingebungen waren, hatte Dwight bisher nicht ergründen können.
An diesem Tag musste Dwight mehrere Patienten besuchen, als ersten Charlie Kempthorne. Vor zwei Jahren hatte Kempthorne an Lungenschwindsucht gelitten; zwar waren nur die Spitzen der beiden Lungenflügel angegriffen, doch das kam einem Todesurteil gleich. Und nun ging es ihm offensichtlich recht gut, er hustete nicht mehr, hatte zugenommen und arbeitete wieder, allerdings nicht als Bergmann, sondern als Segelmacher. Dwight traf ihn zu Hause an; er saß vor seiner Hütte und arbeitete mit Nadel und Faden. Als er den Arzt herankommen sah, grinste er über sein ganzes schmales, braungebranntes Gesicht und stand auf, um ihn zu begrüßen.
»Kommen Sie doch rein, Doktor, freue mich, Sie zu sehen. Hab seit Ihrem letzten Besuch ’n paar Eier für Sie aufgehoben.«
»Ich kann nicht lange bleiben«, antwortete Dwight Enys freundlich. »Ich bin nur vorbeigekommen, um zu sehen, ob Sie meine Anordnungen befolgen. Aber vielen Dank.«
»Die Behandlung macht keine große Mühe. Da sitz ich nun hier tagaus, tagein und stichle vor mich hin – und verdiene mehr Geld, als wie ich noch ’n Kumpel war.«
»Und Lottie und May?« Kempthorne hatte zwei magere kleine Töchter, fünf und sieben Jahre alt. Seine Frau hatte er vor drei Jahren verloren; sie war ertrunken.
»Die sind bei Mrs Coad. Ich mach mir ihretwegen ziemlich Gedanken.« Kempthorne steckte den Faden in den Mund und feuchtete ihn an, hielt ihn dann zwischen Zeigefinger und Daumen und warf dem Arzt einen verstohlenen Blick zu. »Wahrscheinlich wissen Sie schon, dass jetzt noch mehr Leute in der Umgegend das Fieber haben. Die alte Sarah Tregeagle hat mich gebeten, es Ihnen zu sagen.«
Dwight erwiderte nichts darauf; er führte nicht gern mit seinen Patienten allgemeine Gespräche über Krankheiten.
»Die Curnows haben es und Betty Coad und die Ishbels, das soll ich Ihnen sagen. Na ja, an sich ist das im August ja nicht anders zu erwarten.«
»Ein schönes großes Segel machen Sie da.«
Charlie grinste. »Ja, Doktor. Das ist für die One and All von St. Ann’s. Sie braucht neue Segel.«
»Würden Sie für die Zollboote auch Segel machen?«
»Nur, wenn ich einen Fehler reinnähen könnte, damit sie reißen, wenn sie jemanden verfolgen.«
Von Kempthornes Haus zu dem Platz am Fuß des Hügels hinunterzureiten war gefährlich. In Gedanken versunken, ging Dwight zu Fuß den steilen, tief zerfurchten Pfad hinab. Die besseren Häuser des Dorfes lagen an der einen Seite des Weges; auf der andern, jenseits der überwachsenen Mauer, fiel das Tal steil zu einem tiefeingeschnittenen Wasserlauf hinab, durch den sich ein Teil des Flusses Mellingey zum Meer schlängelte und die Zinnstampfwerke in Betrieb hielt. Jedes Haus lag etwa zwei Meter tiefer als sein Nachbar; beim letzten band Dwight sein Pferd fest. Als er an die Tür klopfte, brach ein goldener Sonnenstrahl durch die Wolken und ließ die Dächer der Hütten feucht aufschimmern, als habe es bereits geregnet.
In dem Haus, vor dem Dwight haltgemacht hatte, wohnten Jacka Hoblyn, der ein eigenes Zinnstampfwerk besaß, seine Frau Polly, ihre Tochter Rosina, die leicht verkrüppelt war, und ihre zweite Tochter Parthesia, ein lebhaftes elfjähriges Mädchen, das Dwight nun die Tür öffnete. Im Untergeschoss waren zwei kleine Räume mit kalkverputzten Wänden; in dem einen arbeitete Rosina; sie nähte und stellte Holzschuhe her. Parthesia sagte, ihre Mutter liege im Bett, und kletterte vor Dwight behände die steinerne Treppe außerhalb des Hauses zu dem Dachboden hinauf, wo sie alle schliefen. Nachdem sie ihn hineingeführt hatte, sprang sie gleich wieder davon, um, wie sie sagte, ihren Vater zu suchen, der auch krank sei.
Polly Hoblyn war erst vierzig Jahre alt, sah aber aus wie achtundfünfzig. Sie begrüßte den Arzt strahlend, und Dwight lächelte ihr freundlich zu, wobei er mit raschem Blick die Symptome eines Anfalls von Tertiana-Fieber erkannte: Schüttelfrost, bleiches, ausgezehrtes Gesicht, schneeweiße Finger. Es war ein ungewöhnlich schwerer Anfall. Ermutigend war nur, dass man ihn überhaupt gerufen hatte – wenn auch zögernd und unter vielen Entschuldigungen –, um es zu behandeln. Vor zwei Jahren hatten Kranke mit den üblichen Beschwerden, die es sich leisten konnten, Medizin bei Irby, dem Apotheker in St. Ann’s, oder bei einem der alten Weiber in der Nachbarschaft gekauft. Dr Choake zu rufen wagten sie nur, wenn sie sich etwas gebrochen hatten oder schon im Sterben lagen. Doch nun begannen sie, es langsam zu begreifen und zu schätzen, dass Dr Enys bereit war, auch Patienten zu behandeln, die nur in Naturalien oder überhaupt nicht zahlen konnten. Natürlich gab es Leute, die behaupteten, er experimentiere an den Armen herum, aber mit übler Nachrede musste man eben immer rechnen.
Er machte ein Mittel aus Chinarinde für sie zurecht, beobachtete, wie sie es mühsam schluckte, und holte dann zwei abgemessene Dosen Fieberpulver und eine Dosis Rhabarbersalz für die Nacht aus seiner Tasche. In diesem Augenblick erschien Jacka Hoblyn in der Tür.
»Guten Tag, Doktor. Thesia, bring mir mal ein Sacktuch von unten rauf. Ich schwitze wie ein Schwein. Also, Doktor, was fehlt Polly?«
»Sie hat Fieberanfälle. Sie sollte mindestens zwei Tage im Bett bleiben. Und Sie? Ich glaube, Sie haben das Gleiche. Kommen Sie doch bitte mal hier rüber ans Licht.«
Als Hoblyn auf ihn zutrat, stieg Dwight scharfer Gingeruch in die Nase. Jacka war also wieder so weit. Parthesia kam mit einem roten Tuch hereingelaufen, und Jacka wischte sich damit die Stirn. Sein Puls war schwach und rasch. Das Fieber hatte schon ein späteres Stadium erreicht und musste unerträglichen Durst hervorrufen.
»Ja, ich hab’s wohl auch ’n bisschen. Aber Bewegung ist das Beste dagegen, bloß nicht im Bett rumliegen. Je mehr man sich bewegt, umso schneller geht es weg.«
»Passen Sie auf, Hoblyn, ich möchte, dass Sie dies jetzt gleich einnehmen, und dieses Pulver, in Wasser aufgelöst, bevor Sie heute Abend zu Bett gehen. Haben Sie das verstanden?«
Jacka fuhr sich mit der Hand durch sein verstrubbeltes Haar und blickte Dwight düster an. »Ich halte nichts von Ärzten.«
»Trotzdem, dies sollten Sie einnehmen. Sie werden sich dann viel besser fühlen.«
Sie starrten einander an. Doch Dwights autoritärem Blick konnte Hoblyn nicht lange standhalten. Mit einiger Befriedigung beobachtete Dwight, wie der Mann die starke Dosis des aufgelösten Weinsteins schluckte. Das Nachtpulver enthielt zehn Gran Jalape. Hoffentlich war Hoblyn noch genug bei Sinnen, um es einzunehmen, aber das spielte keine allzu große Rolle. Die Gesundheit der drei Frauen lag Dwight mehr am Herzen als die des Mannes.
Als er das Haus verließ, sah er Rosina mit einem Milchkrug den Hügel heraufhinken. Sie war siebzehn, und bisher waren ihre schönen Augen noch nicht vom stundenlangen Nähen bei schlechter Beleuchtung verdorben. Als sie näher kam, lächelte sie ihm entgegen und knickste.
»Ihrer Familie wird es morgen sicher bessergehen. Achten Sie nur darauf, dass Ihre Mutter das Pulver einnimmt.«
»Mache ich bestimmt. Vielen Dank, Herr Doktor.«
»Wird Ihr Vater … schwierig, wenn er trinkt?«
Sie errötete. »Er kriegt dann schlechte Laune, Herr Doktor, man kann nicht gut mit ihm auskommen.«
»Und wird er gewalttätig?«
»Oh nein, Herr Doktor – jedenfalls nur selten. Und hinterher macht er’s dann wieder gut.«
Dwight ging an dem kleinen Erkerfenster von Mary Rogers’ Laden vorbei und kam zu den zerfallenen Hütten am Fuß des Hügels, die Guernsey genannt wurden. Hier begann das größte Elend. Die Fenster waren mit Brettern und Lumpen verstopft, Türen standen neben Öffnungen, die sie eigentlich schließen sollten, es gab offene Sickergruben, zwischen denen Ratten herumliefen, kaputte Dächer und windschiefe Hütten, um die halbnackte Kinder krochen und spielten. Wenn Dwight hierherkam, schämte er sich stets seiner adretten Kleider; in dieser Umgebung wirkten sie wie Dinge aus einer anderen Welt. Er klopfte an die erste Hütte, wobei er mit Überraschung feststellte, dass beide Hälften der Tür geschlossen waren, denn nur durch die Tür drang Licht in das Innere. Vor einer Woche hatte er Betty Carkeek von ihrem ersten Kind, einem Jungen, entbunden, nachdem zwei nach Fisch stinkende Hebammen mit ihrer stümperhaften Hilfe versagt hatten.
Er hörte das Baby in der Hütte schreien, gleich darauf kam Betty zur Tür und zog die obere Hälfte argwöhnisch einen Spalt auf.
»Ach, Sie sind’s, Doktor. Kommen Sie nur rein.« Betty Carkeek, geborene Coad, gehörte nicht zu den Frauen, die – vorausgesetzt, man ließ ihnen nur ein wenig Hilfe angedeihen – gleich wie die Fliegen wegstarben. Dennoch war Dwight sehr erleichtert gewesen, als sich auch nach dem vierten und fünften Tag noch keine Anzeichen von Kindbettfieber gezeigt hatten. Sie würde es schaffen. Er trat hinter ihr in die kleine Steinhütte – denn mehr als eine Hütte war es nicht –, wobei er sich auf der Schwelle bückte, um nicht anzustoßen. Ted Carkeek saß vor einem kleinen Herdfeuer und rührte in einer Art Kräutertee. Ted und Betty waren erst seit einem Monat verheiratet, doch dass ein Mann zu Hause blieb, wenn Arbeit zu tun – und schwer zu bekommen – war, das stellte im Grund keinen überzeugenden Beweis seiner Liebe dar.
Dwight nickte dem jungen Mann kurz zu und untersuchte dann das Baby. Ted stand auf und wollte hinausgehen, doch Betty hielt ihn zurück, so wandte er sich brummend wieder seinem Gebräu zu. Das Kind hatte Schnupfen, und sein Atem ging rasch. Dwight überlegte, was das unerfahrene Mädchen wohl mit ihm angestellt haben mochte; stets hatte er gegen Unwissenheit und Nachlässigkeit zu kämpfen.
»Ist Ihre Mutter nicht hier, Betty?«
»Nein, Herr Doktor. Sie ist ein bisschen erkältet.«
Natürlich. Kempthorne hatte ja die Coads erwähnt. »Fieber?«
»Ja, ich glaube.«
Das Gebräu auf dem Ofen begann zu kochen, und einzelne Tropfen sprangen zischend ins Feuer.
»Und Sie selbst?«
»Mir geht’s gut. Aber Ted ist nicht ganz auf der Höhe –«
»Halt die Klappe«, sagte Ted.
Dwight schenkte ihm keine Beachtung. »Sie sind zu früh aufgestanden«, sagte er zu dem Mädchen. »Wenn Ted zu Hause ist, kann er sich ja um Sie kümmern.«
»Da hab ich mich schon eher um ihn gekümmert.«
Ted machte eine unwillige Geste, doch sie fuhr fort: »Lass dich doch von dem Doktor untersuchen, Ted. Deine Kocherei da führt ja doch zu nichts. Der Doktor ist kein Schwätzer, das wissen wir doch.«
Mürrisch stand Ted auf und trat in das Licht, das von der Tür hereinfiel. »Ich hab mir meine Schulter aufgeschrammt, das ist alles. Da gibt’s nichts dran herumzudoktern.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.