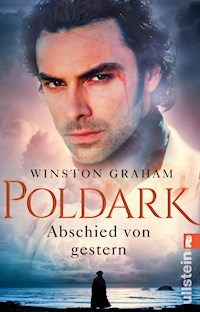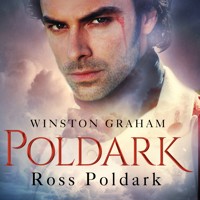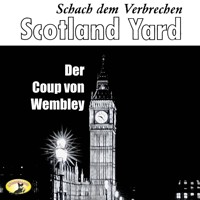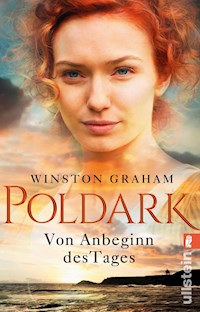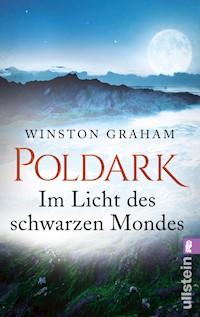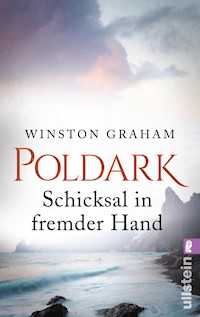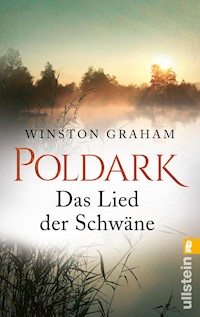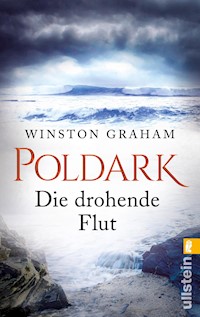
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Cornwall 1798-1799 Ein Jahrhundert geht seinem Ende zu. Ross Poldark ist Mitglied des englischen Parlaments geworden und muss seine Zeit zwischen seiner Familie in Cornwall und seinen Pflichten in London aufteilen. Demelza leidet unter der häufigen Trennung. Bevor das neue Jahrhundert anbricht, werden alte Feindschaften von Verlust verdrängt, und eine Tragödie bringt unerwartet neue Hoffnung … »Vom unvergleichlichen Winston Graham …, der all das hat, was die anderen haben, und dann noch eine ganze Menge mehr« The Guardian Der siebte Roman der großen Poldark-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Cornwall, 1798 bis 1799: Das Jahrhundert geht seinem Ende zu. Ross Poldark ist Mitglied des englischen Parlaments geworden und muss seine Zeit zwischen seiner Familie in Cornwall und seinen Pflichten in London aufteilen. Demelza leidet unter der häufigen Trennung. Die Rivalität zwischen Ross und George brennt unvermindert, genauso wie die unerlaubte Liebe zwischen Morwenna und Drake. Doch bevor das neue Jahrhundert anbricht, werden George und Ross von einem Verlust erschüttert, der größer ist als ihre Feindschaft – und Morwenna und Drake müssen sich einer Tragödie stellen, die ihnen Hoffnung gibt.
Der Autor
Winston Mawdsley Graham, geboren 1908 in Manchester, gestorben 2003 in London, hat über vierzig Romane geschrieben, darunter auch Marnie, der 1964 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Er war Mitglied der Royal Society of Literature sowie des Order of the British Empire und lebte in London und Cornwall.
Die Poldark-Serie von Winston Graham ist in unserem Hause in chronologischer Reihenfolge erschienen:
Poldark – Abschied von gestern
Poldark – Von Anbeginn des Tages
Poldark – Schatten auf dem Weg
Poldark – Schicksal in fremder Hand
Poldark – Im Licht des schwarzen Mondes
Poldark – Das Lied der Schwäne
Poldark – Die drohende Flut
Winston Graham
Poldark
Die drohende Flut
Roman
Aus dem Englischenvon Christiane Kashin
Ullstein
Diese Ausgabe ist erstmals 1982 unter dem Titel Vor dem Steigen der Flut erschienen.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1241-5
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© Winston Graham 1977Titel der englischen Originalausgabe: The Angry Tide (Pan Books, Pan Macmillan, London 2008; first published in 1977 by William Collins Sons & Co. Ltd)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Erstes Buch
1
Es war ein windiger Tag; Wolkenfetzen trieben am fahlen Nachmittagshimmel, und über die Straße, die immer unebener und staubiger geworden war, fegten verdorrte Blätter.
Fünf Menschen saßen in der Kutsche – ein hagerer, blutleer wirkender Mann mit verkniffenem Gesicht und in abgetragener Kleidung, seine gleichfalls magere Frau, ihre halbwüchsige Tochter und zwei weitere Passagiere: der eine ein hochgewachsener aristokratischer Mann etwa Ende dreißig, der andere ein vierschrötiger Geistlicher, der um einige Jahre jünger sein mochte. Letzterer wirkte in dem grünen Seidenanzug, dem Seidenhemd, den roten Strümpfen und schwarzen Schnallenschuhen auffallend aufgeputzt für das geistliche Amt, das er bekleidete.
Das hagere Ehepaar wagte sich nur flüsternd zu unterhalten, denn der hochgewachsene Aristokrat war Hauptmann Poldark, ein Mann, der in jüngster Zeit durch seine Tätigkeit als Parlamentsmitglied für den Wahlbezirk von Truro zu Ansehen gekommen war. Der Geistliche war Pfarrer Osborne Whitworth, Vikar der St.-Margaret-Kirche in Truro und Inhaber der Pfründe von Sawle und Grambler.
Hauptmann Poldark war in St. Blazey zugestiegen und Mr Whitworth bald darauf in St. Austell. Er hatte sich mit den Worten auf seinem Sitz niedergelassen: »Ah, Hauptmann Poldark, Sie sind also wieder zurück. Sicher sind Sie froh, wieder zu Hause zu sein. Wie steht’s in Westminster, bei Pitt und Fox – mein Onkel hat mir erzählt, nirgendwo würde so viel geklatscht wie dort.«
»Mag sein«, antwortete Ross Poldark. »Im Übrigen wird dort auch noch über andere Dinge geredet – das hängt ganz von einem selbst ab.«
»Haha! Sehr richtig. Das deckt sich mit dem, was mir mein Schwager George Warleggan erzählte Es war ja ein bitterer Schlag für ihn – dass Sie ihm seinen Sitz weggenommen haben. Nach einem vollen Jahr im Parlament fiel es ihm außerordentlich schwer, von seiner Tätigkeit als Abgeordneter Abschied zu nehmen.«
Ross Poldark gab keine Antwort. In der Kutsche roch es nach Staub und verbrauchter Luft.
»Nun«, fuhr Ossie Whitworth fort, »ich bin sicher, Mr Warleggan wird das nicht auf sich beruhen lassen. Zweifellos werden Sie bald wieder von ihm hören.«
»Zweifellos«, bestätigte Ross.
»England braucht all seine fähigen Männer«, sagte Ossie. »Im Augenblick mehr denn je. Die Unzufriedenheit im Lande, die Jakobinerklubs, die ständigen Meutereien bei der Marine, Bankrotterklärungen, wohin man schaut, und nun dieser Aufstand in Irland. Haben Sie etwas gehört, ob er niedergeschlagen wurde?«
»Nein.«
»Diese unerhörten Ausschreitungen, die die Katholiken sich geleistet haben, müssen gebührend bestraft werden. Soviel ich gehört habe, sollen sie schlimmer gewesen sein als die Exzesse der Französischen Revolution.«
In diesem Augenblick hielt die Kutsche, und so nahm Whitworth erst, nachdem der Kutscher einen Ast, der quer über dem Weg lag, beiseitegeschoben hatte, das Gespräch wieder auf.
»Ich habe gerade zwei Tage bei den Carlyons verbracht. Kennen Sie die Familie?«
»Nur dem Namen nach.«
»Ihr Haus ist äußerst behaglich und bietet viel Platz. Außerdem haben sie eine hervorragende Köchin, ein wahres Juwel.«
Ross warf einen Blick auf Ossies wohlbeleibte Gestalt und schwieg.
»Das Hammelfleisch war ungewöhnlich zart … wurde natürlich mit Spargel und gebratenem Kalbsherzen serviert. Immer wieder sage ich zu meiner Frau, es kommt nicht nur auf die Zutaten an, sondern vor allem auf die Zusammenstellung.«
»Ich hoffe, Ihrer Frau geht es gut.«
»Ach, sie ist leider ständig in melancholischer Stimmung. Dr Behenna hält es für eine Störung der Milz. Mein Sohn, das kann ich zu meiner Freude sagen, hat sich glänzend herausgemacht. Ich habe noch nie ein so kräftiges zweijähriges Kind gesehen. Ein schönes, gesundes Kind … nicht zu vergleichen mit dem armseligen Geschöpf, das Dr und Mrs Enys hervorgebracht haben. Es soll dünn und schwächlich sein, hat einen viel zu großen Kopf und sabbert ständig …«
Das Gespräch geriet ins Stocken; Ross hing seinen Gedanken nach.
Sonderbar, dachte er, in meinem Leben scheinen immer wieder Parallelen aufzutauchen, ähnliche Situationen. Als ich vor Jahren vom Krieg in Amerika heimkehrte und in Bristol in die Kutsche stieg, hatte ich ganz ähnliche Gesellschaft. Auch ein Ehepaar mit Kind und einen Geistlichen. Damals war es Dr Halse, und er war mir genauso unsympathisch wie Ossie Whitworth. Der Hauptunterschied ist nur, dass ich damals arm war und dass ich jetzt wohlhabend bin. Und als ich nach Hause kam, musste ich feststellen, dass die Frau, die ich liebte, meinen Vetter heiraten wollte. Jetzt habe ich eine Frau … ja, ich habe eine Frau …
Aber damals war ich noch jung, vital und dynamisch. Jetzt bin ich achtunddreißig, nicht mehr so unruhig, aber auch nicht mehr so elastisch. Von einigen Abenteuern abgesehen, habe ich nur zwei Frauen wirklich geliebt, und beide haben sich anderen Männern zugewendet. Ich war der Besitzer von zwei Minen, und ich habe zwei Kinder. Und so weiter und so weiter.
»Wie bitte?« Ross fuhr auf; Whitworth hatte ihn etwas gefragt. »Oh nein, die Sitzungsperiode wird erst in etwa sechs oder sieben Wochen zu Ende sein.«
»Dann kehren Sie also vorzeitig zurück?«
»Ja, ich habe dringende Geschäfte zu erledigen.«
»Ah, Geschäfte, ja.« Bei diesem Stichwort schien Ossie etwas einzufallen. »Übrigens, Sie kennen doch Lord Falmouth so gut …« Er machte eine Pause, aber Ross zeigte keine Reaktion. »Da Sie Lord Falmouth nun so gut kennen … vielleicht wäre es Ihnen möglich, sich bei ihm für mich zu verwenden … mir ist nämlich sehr an der Pfründe von Luxulyan gelegen … Zwar hat Lord Falmouth sie nicht zu vergeben, aber ich bin sicher, wenn er ein gutes Wort für mich einlegen würde … auch ein Brief hätte bestimmt viel Gewicht.«
»Oh, ich höre mit Bedauern, dass Sie Truro verlassen wollen«, antwortete Ross ein wenig boshaft.
»Nein, nein, das ist nicht der Fall«, beeilte sich Ossie zu versichern. »Der Vikar von Luxulyan, der vor kurzem verstorben ist, hat sich nur gelegentlich dort aufgehalten. Ich würde gern mein schmales Einkommen aufbessern, da es kaum ausreicht, meine Familie zu ernähren.«
»Aber Sie haben doch schon zwei Pfründen«, erwiderte Ross. »Erst vor zwei Jahren sind Sie Inhaber der Pfründe von Sawle geworden.«
»Das schon, aber sie bringt nur wenig ein. Die Ausgaben, die sie erfordert, fressen die Einnahmen fast auf.« Ossie warf einen Blick aus dem Fenster. »Ich bin gleich zu Hause, Gott sei Dank. Das Geschaukel in diesen grässlichen Kutschen ist äußerst unbekömmlich.«
Knirschend und quietschend hielt die Kutsche an. Der Kutscher sprang vom Bock und öffnete die Tür, riss, in der Hoffnung auf ein Trinkgeld, den Hut vom Kopf.
Ossie ließ sich Zeit beim Aussteigen. Er knöpfte gemächlich seinen Rock zu. »Vielleicht kann ich mich Ihnen auch in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen, Hauptmann Poldark. Sicher kennen Sie meinen Onkel, Conan Godolphin. Er ist ein enger Freund des Prinzen von Wales, und für einen Abgeordneten ist eine freundschaftliche Beziehung zum Hof doch von großem Wert. Ganz besonders für einen Abgeordneten, der auf dem Lande wohnt und weder Titel noch gesellschaftliche Beziehungen besitzt, wie Sie zum Beispiel. Mein Onkel kennt viele einflussreiche Leute, und wenn Sie dafür ein gutes Wort bei Lord Falmouth für mich einlegen würden, so wäre das gewissermaßen ein Quidproquo.«
Ross schwieg einen Augenblick. Dann antwortete er: »Sie werden in der Gemeinde von Sawle durch Pfarrer Odgers vertreten. Als Ihnen die Pfründe verliehen wurde, erhöhten Sie sein Gehalt von vierzig Pfund auf fünfundvierzig jährlich.«
»Ja, das stimmt. Es war eine großzügige Geste meinerseits. Manchmal frage ich mich allerdings, wozu Odgers so viel Geld eigentlich braucht, da er sich ja auch als Landwirt betätigt und kaum Ausgaben hat.«
»Ich kann Ihnen versichern, seine Lebensumstände sind alles andere als üppig. Er baut Gemüse an und verkauft es auf dem Markt. Seine Frau ist gezwungen, äußerst sparsam zu wirtschaften, und seine Kinder sind weder standesgemäß gekleidet, noch ist Geld für eine angemessene Ausbildung da. Sie sagten eben selbst, dass Geistliche kein gutes Auskommen haben. Nun, mit fünfundvierzig Pfund im Jahr lebt Odgers kaum besser als ein Rossarzt oder Schmied.«
»So … dann muss er sich aber sehr ungeschickt anstellen. Ich habe ihn schon immer für ziemlich unfähig gehalten.«
Ross warf Ossie einen kalten Blick zu. »Über das Quidproquo, das Sie vorschlagen, Mr Whitworth, können wir sprechen, wenn Sie bereit sind, Mr Odgers’ Gehalt auf hundert Pfund im Jahr zu erhöhen. Die Beziehungen Ihres Onkels benötige ich nicht, aber ich würde dafür mit Lord Falmouth über Sie sprechen.«
»Hundert Pfund im Jahr!« Ossie schien anzuschwellen wie ein Luftballon – eine Eigenheit, die sich immer bei ihm zeigte, wenn er sich aufregte oder ärgerte. »Machen Sie sich eigentlich klar, dass das Gesamtgehalt von Sawle zweihundert Pfund beträgt? Wie soll ich dort Vikar sein, wenn ich die Hälfte davon einem ungebildeten Hilfspfarrer auszahle?«
»Immerhin macht er die ganze Arbeit für Sie.«
Ossie setzte seinen Hut auf. Harry, sein Diener, hatte den Koffer abgeladen und wartete vor der Kutsche. »Tja«, sagte Ossie säuerlich, »dann bleibt mir wohl nichts übrig, als Ihnen noch einen guten Tag zu wünschen, Hauptmann Poldark.«
Demelza Poldark hatte im Wohnzimmer mit Rosina Hoblyn Tee getrunken. Seit Dr Enys Rosinas Bein behandelt hatte, humpelte sie kaum noch. Rosina, ein freundliches und sanftes Mädchen, war nun fünfundzwanzig Jahre alt und hatte nach ihrer Verlobung mit Charlie Kempthorne, der vor einigen Jahren ums Leben gekommen war, bisher nicht geheiratet. Ihre jüngere Schwester Parthesia war mit einem Knecht verheiratet und bereits Mutter eines Kindes. Rosina war immer ein stilles Wasser gewesen – vielleicht hing das mit ihrem Hinken zusammen –, sie lebte nach wie vor bei ihren Eltern und verdiente sich etwas Geld mit Näharbeiten.
Demelza war vor einigen Monaten auf Rosina aufmerksam geworden, und in ihrer hilfsbereiten Art versorgte sie das Mädchen nun mit so viel Arbeit wie nur möglich. Und Rosina hatte sich als sehr fleißig und äußerst angenehm im Umgang entpuppt.
Demelza hatte Rosina in der Abenddämmerung auf dem Heimweg ein Stück begleitet. Bei Wheal Maiden verabschiedete sie sich von Rosina, ging aber nicht gleich zurück, sondern blickte ihr noch eine Weile nach, wie sie über das öde Moorland in Richtung auf Sawle davonging. Schade um das nette Mädchen, dachte Demelza, sie ist hübsch und fleißig, sie hat Geschmack und gute Manieren. Von ihrem Vater, dem grobschlächtigen Jacka Hoblyn, hatte sie das bestimmt nicht. Sie beide, Demelza und Rosina, hatten manches miteinander gemein – auch Demelza hatte einen groben, ewig betrunkenen Vater gehabt, und schon mit vierzehn Jahren hatte sie sich um ihre jüngeren Brüder kümmern müssen. Der Unterschied war nur, sie, Demelza, besaß nun alles, was man sich wünschen konnte – ein Gut, eine Mine, ein Haus, zwei hübsche und gesunde Kinder. Sie war gerade erst achtundzwanzig Jahre alt geworden – war noch jung und schlank. Sie verkehrte mit den angesehensten Leuten von Cornwall und wurde von ihnen inzwischen als ihresgleichen akzeptiert.
Und sie hatte Ross. Oder glaubte es zumindest. Aber er war weit fort. Er war schon zu lange zu weit fort gewesen. Das war der einzige Wermutstropfen, den sie hatte schlucken müssen, und er war bitter.
Demelza setzte sich auf einen Granitblock, den Blick noch immer auf die Gestalt von Rosina geheftet, die nun kaum noch zu erkennen war. Rosinas Problem ist, dachte Demelza, dass sie im Grunde zwischen den Stühlen sitzt. Das Mädchen besaß Geschicklichkeit und Geschmack und verstand sich hübsch – wenn auch bescheiden – anzuziehen. Sie hatte sogar Lesen und Schreiben gelernt, doch gerade durch dieses Bestreben, das Beste aus sich zu machen, passte sie nun nicht mehr zu den gewöhnlichen Bergleuten und Fischern mit ihren groben Manieren und schlichten Lebensgewohnheiten. Wahrscheinlich wollten diese Männer von Rosina nichts wissen, weil sie sich ihr unterlegen fühlten, und Rosina wiederum fühlte sich gleichfalls abgestoßen. Das Mädchen hatte es schwer, denn andere Männer lernte sie nicht kennen.
Doch es gab andere Männer – Demelzas Gedanken wanderten zu ihren beiden Brüdern. Sam, der ältere, hatte sich in die selbstbewusste, vitale Emma Tregirls verliebt, und sie erwiderte seine Neigung. Nur Sams methodistischer Glaube stand zwischen ihnen, und da Sam seinen Glauben nicht aufgeben konnte und Emma nicht bereit war, sich gläubig zu stellen, war sie durch Demelzas Vermittlung nach Tehidy gegangen, das fünfzehn Kilometer entfernt lag, um dort als Stubenmädchen zu arbeiten. Eigentlich, dachte Demelza, würde Rosina viel besser zu Sam passen als Emma.
Blieb nur noch Drake, ihr jüngster Bruder. Drake war in wesentlich schlechterer Verfassung als Sam, doch da seine Liebe zu Morwenna Whitworth, Elizabeth Warleggans Cousine, die nun mit dem Vikar Whitworth verheiratet war und bereits einen zweijährigen Sohn hatte, völlig aussichtslos war, hatte es durchaus Sinn, sich nach einer Braut für ihn umzusehen. Morwenna, so unglücklich sie mit Osborne Whitworth auch sein mochte, war für ihn unerreichbar.
Vor zwei Jahren hatte Ross für Drake einen kleinen Hof mit einer Schmiede in der Nähe von St. Ann’s gekauft, und Drake war nun ein angesehener Handwerker. Aber an Frauen verschwendete er keinen Blick, zumindest nicht in der Art, wie andere junge Männer es taten. Er schien seelisch wie erstarrt, und wenn er weiterhin völlig in der Vergangenheit lebte und sich innerlich an ein Mädchen klammerte, das für ihn längst verloren war, so würde er seine Tage als melancholischer Junggeselle beschließen.
Zwar waren drei Jahre Trübsal nicht allzu schlimm für einen jungen Mann von zweiundzwanzig Jahren, doch Demelza fürchtete, Drake könne sich so an seine Melancholie verlieren, dass er nicht wieder herausfand. Er war immer höflich und freundlich, doch von seinem übermütigen Charme und seiner Heiterkeit von einst war nichts geblieben.
Natürlich war es eine heikle Aufgabe, die Heiratsvermittlerin zu spielen, und überdies wahrscheinlich aussichtslos. Wenn der Funke nicht übersprang, halfen alle Bemühungen nichts. Dennoch – man konnte dem Funken wenigstens eine Chance geben überzuspringen, konnte, scheinbar absichtslos und ganz unauffällig, ein Treffen arrangieren und das Ergebnis abwarten.
Demelza stand auf. Von Westen wehte eine leise Brise. Über das Moorland kam ein einsamer Reiter. Wer ritt in der Dämmerung noch diesen Weg? Und kannte sie dieses Pferd nicht? Ach, Unsinn, er hätte geschrieben und es ihr mitgeteilt. Gimlett wäre nach Truro geritten, um ihn abzuholen. Die Sitzung des Parlaments war erst in einigen Wochen zu Ende.
Langsam stieg Demelza den Hügel hinauf. Oben, neben der Kapelle, blieb sie stehen. Die Gestalt des einsamen Reiters war nun deutlich zu erkennen. Das Pferd war ihr unbekannt, der Reiter nicht. Mit wehendem Haar, über den holprigen Weg stolpernd, rannte sie ihm entgegen.
2
Ossie Whitworth war schon einige Stunden vor Ross Poldark bei seinem heimatlichen Ziel angelangt, dem Pfarrhaus der St.-Margaret-Kirche in Truro, doch ihm kam keine aufgeregte, glückliche junge Frau entgegengelaufen.
Ossie war nicht enttäuscht, denn er hatte es ohnehin nicht erwartet. Von seiner Frau konnte er Derartiges nicht erwarten, denn sie war – seiner Meinung nach – geistig gestört.
Ja, es war ein schweres Kreuz, das Ossie zu tragen hatte. Nachdem seine erste – temperamentlose, doch ihm ergebene und gehorsame – Frau im Kindbett gestorben war, hatte er sich rasch nach einer neuen umgesehen, einer Frau, die nicht nur bei seinen beiden kleinen Töchtern Mutterstelle vertreten, sondern ihn auch vor fleischlichen Sünden bewahren konnte. Er hatte sich für Morwenna Chynoweth entschieden, damals ein großes, schlankes, schüchternes, kurzsichtiges Mädchen von achtzehn Jahren, nicht eigentlich hübsch, doch gut gewachsen. Sie stammte aus guter Familie, war die Tochter des verstorbenen Dekans von Bodmin, und ihre Cousine war die Frau des einflussreichen George Warleggan. Die Heirat war trotz Morwennas Widerstand arrangiert worden, und Ossie fand, für ein junges Mädchen mit derart geringen Aussichten auf sozialen Aufstieg war sie das Tor zu einem neuen Leben. Und was die körperliche Seite dieser Vereinigung betraf, so war Ossie sicher gewesen, sie mit seiner Männlichkeit zur Frau erwecken und wenigstens stille Bewunderung in ihr entzünden zu können. Gelang ihm das nicht, so spielte es keine große Rolle, denn Begierde und Wollust waren in seinen Augen ohnehin rein männliche Empfindungen, und eine Frau war genügend belohnt durch die Aufmerksamkeit, die ihr Gatte ihr schenkte.
Morwenna hatte ihm einen Sohn geboren, ein gesundes, kräftiges Kind, doch ihr selbst ging es seit der Geburt nicht gut, und schon damals hatten sich die ersten Anzeichen ihrer geistigen Gestörtheit gezeigt – ihre zunächst nur subtile Abneigung gegen den ehelichen Akt hatte sich in eine heftige Aversion verwandelt. Doch dann hatte sich alles noch viel schlimmer entwickelt. Nachdem ihre jüngste Schwester Rowella zu ihnen ins Haus gekommen war, um sich um die Kinder zu kümmern, war Morwennas geistige Verwirrung ständig gewachsen, und als sie einer Affäre zwischen Rowella und ihm, Osborne, auf die Spur gekommen war, hatte sie ihn angeschrien und ihm verboten, sie je wieder zu berühren. Sollte er es doch versuchen – und er hatte es versuchen wollen –, so werde sie seinen Sohn töten.
Ein solches Kreuz zu tragen wäre für jeden Mann zu schwer gewesen, und Ossie machte sich ernsthaft Gedanken darüber, was er unternehmen könne, dass diese Last von ihm genommen werde. Sicherlich hätte ein reicher Mann, der nicht durch religiöse Überzeugungen gebunden war, Mittel und Wege gefunden. Doch von Ossie, dem Diener Gottes, erwartete man, dass er sein Leid klaglos ertrug, und es würde seiner Karriere sicher nicht zuträglich sein, wenn seine Vorgesetzten zu der Ansicht gelangten, dass er voreilig oder gar selbstsüchtig gehandelt habe, indem er seine Frau einfach abschob. Ossie nahm sich vor, nach Exeter zu fahren und mit dem Bischof zu sprechen.
Als Ossie ins Wohnzimmer trat, fand er dort Morwenna vor, die in der Abendsonne am Fenster saß und nähte.
Sie stand sogleich auf.
»Oh, Osborne. So früh habe ich dich nicht erwartet. Möchtest du eine Tasse Tee?«
»Die Kutsche ist schon etwas früher abgefahren.« Er ging zum Kaminsims hinüber, auf dem drei Briefe für ihn bereitgelegt waren. »Wo ist John?
»Im Garten, mit Sarah und Anne.«
»Du solltest ihn nicht ohne Aufsicht lassen. Der Fluss ist gefährlich.«
»Er ist nicht ohne Aufsicht; Lottie ist bei den Kindern.«
Lottie war seit Rowellas Heirat mit Arthur Solway als Kindermädchen eingestellt worden.
Ossie zog seine Uhr heraus. »Vermutlich habt ihr schon gegessen«, bemerkte er mürrisch. »Was haben wir im Haus? Sicher nichts Rechtes.«
»Doch, wir haben Huhn da und eine Zunge. Und auch noch etwas Hammelfleisch. Außerdem Pudding und Kuchen. Sind die Dinge bei den Carlyons nicht gut gelaufen?«
»Wie kommst du darauf? Natürlich ist alles gut gelaufen!« Ossie betrachtete die Briefe. Einer war von dem Notar Nathaniel Pearce, der ihn vermutlich zu einer Partie Whist einlud. Der zweite stammte von einem seiner Kirchenvorsteher und enthielt sicher irgendeine Beschwerde. Auf dem dritten waren Name und Adresse aufgedruckt, und das Siegel auf der Rückseite war einfaches Siegelwachs. Ossie blickte auf und betrachtete seine Frau. In letzter Zeit wurde sie immer schlampiger, ihr Haar war meist nicht ordentlich gekämmt, und das Kleid sah aus, als habe sie darin geschlafen. Ein weiteres Anzeichen für ihre fortschreitende Gestörtheit.
»War die Reise beschwerlich?«, fragte Morwenna höflich.
»Beschwerlich? Ja, natürlich war sie beschwerlich.«
Ossie erbrach das Siegel auf dem dritten Brief. Die Handschrift war ihm nur zu bekannt, und zu seinem Ärger begann sein Herz, heftig zu klopfen.
Lieber Herr Vikar,
bitte verzeihen Sie mir, dass ich mich nach so langer Zeit mit einigen Zeilen an Sie wende; ich hoffe, dass Sie in den vergangenen zwei Jahren das harte Urteil, das Sie einst über mich fällten, ein wenig gemildert haben. Ich versichere Ihnen, dass ich selbst Ihnen und meiner Schwester gegenüber niemals etwas anderes als tiefe Dankbarkeit empfinden werde, für all die Aufmerksamkeit und Zuneigung, die Sie mir zukommen ließen.
Ich habe mehrmals versucht, mit Morwenna zu sprechen, doch sie hat es immer abgelehnt. Ich nehme daher an, dass ich in Ihrem Haus oder in Ihrer Kirche auch in Zukunft nicht mehr willkommen bin. Natürlich verstehe ich, dass meine unstandesgemäße Heirat ein zusätzliches Hindernis für eine Versöhnung bedeutet. Dennoch, wir leben in derselben Stadt und werden es auch in Zukunft tun, und ich wäre so glücklich, wenn ich wüsste, dass die Feindseligkeit zwischen uns ein Ende hat. Ich bitte Sie flehentlich, Ihren Einfluss auf Morwenna dahingehend auszuüben.
Als ich vor zwei Jahren Ihr Haus verließ, um Arthur zu heiraten, habe ich versehentlich mit meinen eigenen Büchern auch zwei mitgenommen, die Ihnen gehören. Es handelt sich dabei um die Reden von Hugh Latimer und die gesammelten Predigten von Jeremy Taylor. Ich hätte sie längst gern zurückgegeben, wusste aber nicht, wie ich das tun sollte, da es in jedem Fall als ein Vorwand erschienen wäre. Bitte teilen Sie mir doch mit, ob es Ihnen recht ist, wenn ich die beiden Bücher Arthur in die Bibliothek mitgebe, oder ob es Ihnen lieber ist, sie in unserer Wohnung in der Calenick Street 17 abzuholen. Ich bin nachmittags meist zu Hause und würde, wenn Sie sich dazu herablassen könnten, darin ein Zeichen sehen, dass Sie mir vergeben haben.
Ihre gehorsame Dienerin und dankbare SchwägerinRowella Solway.
»Was hast du gesagt?«, fragte Ossie scharf.
»Du hast mir noch nicht gesagt«, antwortete Morwenna, »ob du jetzt gleich essen oder lieber bis zum Abendbrot warten möchtest.«
Ossie starrte sie an, doch in Wirklichkeit stand Rowella vor ihm. Welche Unverschämtheit, welche Anmaßung! Wie konnte sie es wagen, ihm zu schreiben!
»Ist dir nicht gut?«, fragte Morwenna. »Vielleicht bekommst du eine Erkältung.«
»Unsinn!« Abrupt wandte Ossie sich ab, ging zum Spiegel und rückte seinen Kragen zurecht. Seine Hände zitterten vor Zorn. »Sag Harry, dass ich umgehend zu essen wünsche.«
Das festliche Essen in dem Stadthaus der Warleggans in Truro war gerade erst zu Ende gegangen, und Elizabeth erhob sich, um den beiden Herren Gelegenheit zu einem Gespräch unter Männern zu geben.
Das Diner war sorgfältig überlegt und eigens zu dem Zweck zusammengestellt worden, den Gast zu beeindrucken. Elizabeth mit ihrem feinen Taktgefühl hatte George zwar darauf aufmerksam gemacht, dass – da es sich um keine große Gesellschaft handle – das Mahl allzu erlesen sei und die Absicht damit zu deutlich durchschimmere. Doch George hatte nicht auf sie hören wollen.
Christopher Hawkins war gerade vierzig Jahre alt geworden, ein mittelgroßer, grauhaariger Mann, der sich gutmütig und freundlich gab, dessen Blick aber weltmännische Erfahrung und kühle Intelligenz verriet. Er war Rechtsanwalt, Parlamentsmitglied, ehemaliger oberster Richter von Cornwall, Mitglied der Royal Society, Baronet, Junggeselle und – er verkaufte Parlamentssitze.
Ein Diener schenkte den beiden Herren Portwein ein. Nach einem Augenblick des Schweigens, in dem die Männer einen ersten Schluck von dem Wein nahmen, sagte George:
»Es freut mich sehr, dass sich diese Gelegenheit ergab, Sie als Gast in meinem Haus zu begrüßen. Wir würden Sie gern auch über Nacht hier behalten.«
»Sehr freundlich«, antwortete Hawkins, »aber es sind von hier aus ja nur zwei Stunden bis zu meinem Haus, und ich habe morgen früh dringende Geschäfte zu erledigen. Dieser Portwein ist hervorragend, Mr Warleggan.«
»Danke.« George nickte. »Nun, vielleicht ergibt sich eine andere Gelegenheit, und Sie können doch einmal ein oder zwei Tage bei uns bleiben, entweder in Cardew, wo mein Vater wohnt, oder in Trenwith. Es liegt an der Nordküste.«
»Ah ja, das alte Haus der Poldarks … Es gibt doch noch einen Poldark, nicht wahr?«
»Ja, Geoffrey Charles. Er ist zurzeit in Harrow.«
»Der Sohn von Francis Poldark, natürlich. Und dann gibt es ja auch noch Ross Poldark, der weiter östlich lebt. Soviel ich weiß, hat er auch einen Sohn.«
George warf seinem Gast einen scharfen Blick zu und überlegte, ob die Erwähnung von Ross Poldark mit oder ohne Absicht erfolgt war. Doch von Sir Christophers Miene ließ sich nichts ablesen. »Geoffrey Charles wird Trenwith natürlich eines Tages erben«, sagte er. »Allerdings wird er kaum die Mittel haben, dort zu leben. Sollte meinem Vater eines Tages etwas zustoßen, so werden Elizabeth und ich nach Cardew umsiedeln. Es ist wesentlich geräumiger und hat wohl gewisse Ähnlichkeiten mit Ihrem eigenen Haus – es ist ebenfalls von Bäumen umgeben und hat einen schönen Blick auf die Südküste.«
»Ich wusste gar nicht, dass Sie mein Haus kennen.«
»Nun ja, ich kenne es nur vom Hörensagen.«
»Dann sollten Sie es wirklich kennenlernen«, antwortete Hawkins höflich.
»Danke, sehr gern.« George war inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass Ross Poldarks Name vielleicht aus einem ganz anderen Grund gefallen war, und beschloss, die Gelegenheit zu ergreifen. »Wenn es etwas gibt, worum ich Sie beneide, Sir Christopher, dann handelt es sich aber nicht um Ihr Haus.«
Hawkins zog die Augenbrauen hoch. »So? Und was wäre das?«
»Nun ja, so reagiert man wohl, wenn man etwas verloren hat, was einem wichtig war. Wie Sie wissen, war ich selbst über ein Jahr lang Abgeordneter.«
Der Diener trat wieder ein, doch George bedeutete ihm mit einem Wink zu gehen und schenkte selbst Portwein nach. Schweigend saßen die beiden Männer an dem Tisch, auf dem im gedämpften Licht Silber und Kristall schimmerten. Obwohl sie fast im gleichen Alter waren, boten sie doch völlig unterschiedliche Erscheinungsbilder. Hawkins, beleibt, weltmännisch, von scharfer Intelligenz und einer gewissen Neigung zum Zynismus, war durch und durch ein Edelmann. George wirkte neben ihm schwerfällig und fast ungeschlacht.
»Den Sitz von Truro haben Sie damals durch die Protektion von Sir Francis Basset, Lord de Dunstanville, errungen«, sagte Hawkins. »Als Basset seine Differenzen mit Lord Falmouth beilegte, haben Sie den Sitz mit knapper Minderheit an Poldark verloren. Das ist nichts Ungewöhnliches. Einen neuen Sitz in einem Parlament zu finden, das erst seit sechs Monaten tagt, dürfte schwierig sein. Aber wenn Sie gern nach Westminster zurückkehren wollen – hat Basset Ihnen nichts anzubieten?«
»Nein, Basset hat mir nichts anzubieten.«
»Hat es zwischen Ihnen Unstimmigkeiten gegeben?«
»Sir Christopher, es ist kein Geheimnis, dass Lord de Dunstanville mich nicht mehr so protegiert wie ehemals.«
»Tja … wenn de Dunstanville sich nicht mehr für Sie einsetzen will und Sie sich, wie ich vermute, Lord Falmouth zum Feind gemacht haben, ist Ihre Auswahl aber sehr beschränkt.«
»Nicht in einer Grafschaft, die vierundvierzig Abgeordnete stellt.«
Sir Christopher reckte sich ein wenig. »Ich selbst habe drei Sitze, wie Sie sicher wissen, Mr Warleggan, aber sie sind alle vergeben.«
»Trotzdem wäre ich Ihnen für Ihren Rat dankbar.«
»Gern, lassen Sie hören.«
»Ich bin ein reicher Mann, Sir Christopher, und habe vor, mir diesen Umstand zunutze zu machen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir einen Rat geben könnten, wie ich mir meine Rückkehr ins Parlament erkaufen könnte.« George machte eine Pause. »Vielleicht könnte ich mich Ihnen irgendwie erkenntlich zeigen …«
»Wenn Sie sich vor der Wahl im letzten September an mich gewandt hätten, Mr Warleggan, wäre meine Antwort klar und einfach gewesen: Für gewöhnlich verkauft die Regierung Sitze für dreitausend bis viertausend Pfund.«
»Damals war ich noch Abgeordneter für Truro.«
»Ja, ich weiß. Aber im Augenblick –«
»Ich bin weniger daran interessiert, mir einen Sitz zu kaufen, als vielmehr einen Wahlbezirk. Ich möchte es vermeiden, wieder von einem Protektor abhängig zu sein. Ich möchte selbst einen Wahlbezirk besitzen.«
»Das käme Sie wesentlich teurer. Und es ist auch nicht so ohne weiteres durchzuführen. Man muss schließlich an die Wähler denken.«
»Ach, die Wähler … in manchen Wahlbezirken spielen sie kaum eine Rolle. Auf welche Bezirke haben Sie Einfluss, Sir Christopher?«
»Auf Grampound und St. Michael.«
»Und in welcher Weise könnten Sie Ihren Einfluss auf die Wähler geltend machen?«
»Mir gehört das Land, das sie bewirtschaften«, antwortete Sir Christopher trocken.
»Ah …«
»Aber man muss dabei vorsichtig zu Werke gehen, Mr Warleggan. Wenn offenkundig wird, dass Bestechung vorliegt, werden Wahlen manchmal für ungültig erklärt, und der entsprechende Abgeordnete, beziehungsweise sein Protektor, kann ins Gefängnis wandern.«
George fingerte nervös an seinem Glas. »Ich bin sicher, Sie würden mich in dieser Angelegenheit bestens beraten. Falls ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann, sei es bei Bankgeschäften oder bei Ihren anderen Interessen, so lassen Sie es mich bitte wissen.«
Nachdenklich blickte Hawkins auf seinen Portwein. »Ich werde für Sie Erkundigungen einziehen, Mr Warleggan. Die Dinge sind stets im Fluss – vielleicht ergibt sich irgendwo eine Möglichkeit, einen Wahlbezirk zu erwerben. Es ist eine Frage des Glücks, in erster Linie aber des Geldes. Geld öffnet viele Türen.«
»Geld habe ich genug«, antwortete George, »und ich werde es so anlegen, wie Sie es mir raten.«
3
Auch Ross Poldark war inzwischen zu Hause angelangt. Er war mit Demelza in der zunehmenden Dämmerung zu Fuß nach Nampara gegangen und hatte das Pferd am Zügel geführt. Die Kinder schliefen schon, und Ross wollte sie nicht wecken; er warf nur einen Blick auf die beiden und freute sich auf die Überraschung, die seine Rückkehr am nächsten Morgen bei ihnen auslösen würde. Dann aßen er und Demelza gemeinsam zu Abend, und Demelza erzählte Ross, was sich während seiner Abwesenheit zugetragen hatte.
»Was ist eigentlich mit dem Baby von Dwight und Caroline?«, fragte Ross schließlich.
»Mit Sarah? Wieso? Was soll mit ihr sein?«
»Ach, Sarah heißt sie also. Ach ja, jetzt fällt’s mir wieder ein. Ist sie irgendwie zurückgeblieben?«
»Nein – wie kommst du denn darauf? Caroline ging’s während der Schwangerschaft nicht gut, und das Kind war bei der Geburt sehr klein. Es ist immer noch klein und ziemlich zart.«
»Osborne Whitworth hat heute in der Kutsche von St. Austell etwas Derartiges angedeutet. Er behauptete, das Kind sei unterentwickelt und sabbere den ganzen Tag.«
»Alle Babys sabbern, Ross. Wie alte Männer. Und bei Sarah ist das bestimmt nicht schlimmer als bei andern. Es war einfach eine hässliche Bemerkung von Mr Whitworth.«
»Na, Gott sei Dank, dass es nur das ist. Und was ist mit der Ehe der beiden? Ist sie in Ordnung?«
Demelza blickte auf. »Wieso – glaubst du das nicht?«
»Manchmal mache ich mir Sorgen. Sie sind so ungeheuer verschieden, in allem, was sie denken und tun.«
»Aber sie lieben einander, Ross.«
»Ja. Hoffentlich ist die Liebe stark genug.«
Als sie fertig waren, räumte Jane Gimlett das Geschirr ab, und sie gingen in das alte Wohnzimmer hinüber. Ross zündete seine Pfeife an. »Du bist dünner geworden«, bemerkte er.
»So, bin ich? Vielleicht ein bisschen.«
»Trauerst du immer noch um Hugh?«
Demelza starrte ins Kaminfeuer. »Nein, Ross. Aber ich trauere vielleicht ein bisschen um meinen Mann.«
»Tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen.«
»Doch, wenn du so etwas denkst, dann sollst du es auch sagen.«
»Dann hätte ich es eben nicht denken sollen.«
»Gegen seine Gedanken kann man oft nicht an. Ich hoffe nur, du hast, während du in London warst, nicht geglaubt, dass ich die ganze Zeit um einen andern trauere.«
»Hm … ich habe etwas anderes gedacht in all dieser Zeit … und zwar, wie schwer es ist, gegen einen Schatten anzukämpfen.«
Die Kerze flackerte leicht in einem Luftzug, der vom offenen Fenster kam.
»Du brauchst gegen niemanden zu kämpfen, Ross.«
Er blickte nachdenklich auf seine Pfeife. »Wenn nicht kämpfen, so muss ich mich doch mit ihm messen.«
»Du musst dich auch nicht mit ihm messen. Hugh ist eben … für eine Zeitlang in mein Leben getreten … warum, weiß ich auch nicht. Und ich empfand Zuneigung zu ihm. Aber das ist vorbei. Mehr kann ich dazu nicht sagen.«
»Weil er tot ist?«
»Es ist vorbei, Ross. Und vergiss nicht –« Sie stand auf und stocherte im Feuer.
»Was?«
»Ich sollte es wohl lieber nicht sagen.«
»Doch, sag es. Ich habe ja auch alles gesagt.«
»Nun gut, vergiss nicht, seit ich mit dir verheiratet bin, musste ich nicht gegen einen Schatten, sondern gegen ein Ideal kämpfen – Elizabeth. Ich musste mich ständig mit ihr messen.«
»Das ist aber nun schon lange her. Hm … vielleicht hast du recht. Was dem einen recht ist –«
»Nein, nein! Du glaubst doch nicht, dass ich mir gestatte, Hugh nachzutrauern, um mich zu rächen? Das kannst du nicht denken! Ich meine … weil das mit Hugh geschehen ist, sagst du nun, du müsstest dich mit einer Erinnerung auseinandersetzen. Das muss auch ich, und musste es während meiner ganzen Ehe. Aber wir sollten nicht zulassen, dass es unser Leben und alles, was wir haben, zerstört.«
Auch er stand auf, legte die Pfeife auf den Kaminsims. »Nein, das sollten wir nicht zulassen. Darüber haben wir ja schon im letzten September gesprochen. Aber meine Tätigkeit als Abgeordneter ergab sich zur rechten Zeit. Wir waren eine Weile getrennt, hatten Zeit zum Nachdenken, über uns selbst, über unser Leben.«
»Und zu welchem Schluss bist du gekommen?«
»Und du?«
»Ich bin schon im September zu einem Schluss gekommen, und an dem hat sich nichts geändert. Jedenfalls für mich nicht.«
»Was mich betrifft«, sagte Ross, »ich … ich bin natürlich in London vielen schönen Frauen begegnet.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Und was hast du während meiner Abwesenheit getan?«
»Was ich getan habe?« Demelza blickte ihn irritiert an. »Ich habe mich um deine Angelegenheiten gekümmert und vor allem um deine Kinder! Um das Gut und was sonst noch dazugehört. Und ich habe auf deine Briefe gewartet und sie beantwortet! Ich habe gelebt wie immer – nur ohne dich!«
»Und wie oft hat Hugh Bodrugan versucht, dich während meiner Abwesenheit herumzukriegen?«
Demelza brach in Tränen aus. Sie ging zur Tür. »Lass mich in Ruhe! Lass mich vorbei!«, rief sie, als er sich ihr in den Weg stellte.
Er hielt sie an den Armen fest. »Das sollte ein Scherz sein.«
»Das war ein sehr schlechter Scherz!«
»Ich weiß. Anscheinend können wir uns keine Scherze mehr leisten, weil wir beide zu empfindlich geworden sind. Mein Gott, und es gab einmal eine Zeit – und das ist gar nicht so lange her –, da löste sich bei uns jede kleine Zwistigkeit am Ende in Gelächter auf. Anscheinend ist das ein für alle Mal vorbei.«
»Ja, das ist ein für alle Mal vorbei.«
Er zog sie an sich und versuchte sie zu küssen, doch sie wandte den Kopf ab, und er drückte seine Lippen auf ihr Haar. »Bitte lass mich«, flüsterte sie. »Du bist mir so fremd. Ich kenne dich gar nicht mehr.«
»Aber da wir noch kämpfen, haben wir offenbar noch etwas zu verlieren«, erwiderte er.
»Eine Ehe ohne Wärme, ohne Vertrauen – ein Vertrauen, das wir beide verraten haben –, wozu soll das gut sein?«
»Du hast mich noch gar nicht gefragt, wie ich meine Freizeit in London verbracht habe, mit welchen Frauen ich mich abgegeben habe.«
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen. »Vielleicht habe ich dazu kein Recht.«
»Immerhin bist du meine Frau. Und da du meine Frau bist, werde ich es dir sagen. Ich habe, am Anfang meiner Londoner Zeit, zweimal eine Frau – es waren zwei verschiedene Frauen – mit auf mein Zimmer gebracht. Doch ich war sie schon satt, bevor sie sich entkleidet hatten, und hab sie wieder weggeschickt. Natürlich haben sie mich beschimpft. Die eine behauptete, ich wäre impotent, die andere sagte, ich wäre homosexuell.«
Sie schwiegen; Ross ließ Demelza los, gab den Weg zur Tür aber nicht frei.
»Das waren Huren«, sagte Demelza.
»Ja. Aber keine gewöhnlichen.«
»Und was war mit den echten Damen?«
»Die … wurden herumgereicht. Aber ich traf keine, die mir gefiel.«
»Anscheinend hast du wie ein Mönch gelebt.«
»Das liegt daran, dass du schöner bist als alle andern.«
»Ach, Ross«, sagte sie mit schwacher Stimme, »ich hasse dich! Ich hasse dich, weil du mich belügst. Sag, dass ich wieder deine Frau sein soll, wenn du das möchtest. Dann werde ich es sein, aber lüg mich nicht an.«
»Wenn ich dich anlüge, hältst du es vielleicht für die Wahrheit, aber weil es die Wahrheit ist, glaubst du es mir nicht – stimmt’s?«
Sie zuckte wortlos die Achseln.
Stirnrunzelnd blickte er auf sie hinab. »Als ich nach Hause kam, wusste ich nicht, wie wir uns begegnen würden. Und ich weiß auch bis jetzt nicht, ob wir je wieder zusammen lachen werden, so wie früher. Ich brauche dich und begehre dich, aber ich habe immer noch mit Zorn und Eifersucht zu kämpfen und werde nur schlecht damit fertig. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann nicht versprechen, dass es morgen zwischen uns so oder so sein wird. Und du kannst das sicher auch nicht versprechen. Du hast recht, wenn du sagst, dass ich dir fremd bin. Ich bin dir fremd, aber es gibt kein Fleckchen an deinem Körper, das ich nicht kenne. Wir müssen wohl wieder von vorn anfangen.«
Ross stand schon um vier Uhr morgens auf. Leise löste er sich von Demelza, die gleichmäßig atmete, ging aus dem Schlafzimmer und die Treppe hinunter. Er trat vors Haus und blieb vor dem Fliederbaum stehen, lauschte auf das noch schläfrige Zirpen der Finken und Sperlinge. Die Luft war klar und weich, und er atmete tief. Er ging um das Haus herum, zum Strand hinunter, über den Sand, der erst weich und trocken, weiter unten, wo die Flutwellen ihn überspült hatten, hart und nass war. Ross zog seinen Morgenrock aus, warf die Pantoffeln ab und lief ins Meer. Das Wasser war eisig, schneidend, obwohl es schon Mitte Mai war. Ross fühlte, wie seine Muskeln erstarrten und gefühllos wurden. Fünf Minuten lang blieb er im Wasser, dann ging er zum Strand zurück. Er atmete mühsam, und sein ganzer Körper begann zu glühen.
In dieser Nacht hatte er seine Frau wieder in den Armen gehalten, hatte ein Recht beansprucht, das er fast verloren geglaubt hatte. Doch die Leidenschaft von ehemals war nicht aufgeflammt; sie waren nur zärtlich zueinander gewesen.
Als er ins Haus zurückkam, schliefen alle noch. Er kleidete sich an und ging wieder nach draußen. Die Sonne war nun aufgegangen, doch schon zogen sich am westlichen Himmel Wolken zusammen. Ross ging zu Wheal Grace hinüber. Unermüdlich pumpte die Maschine Wasser aus dem Schachtsumpf. Die beiden Zinnstampfmühlen klapperten. Ross hatte erst vorgehabt, mit demjenigen der beiden Curnow-Brüder, der gerade Dienst bei der Pumpe hatte, zu plaudern, besann sich dann aber anders und ging Richtung Grambler. Er fühlte sich voll dynamischer Kraft und war in einer Hochstimmung, wie er sie seit langem nicht empfunden hatte. Nampara war der äußerste Gegensatz zu den lauten, schmutzigen Straßen von London. Doch sicherlich brauchte der Mensch Kontraste, um bestimmte Dinge wieder schätzen zu können.
Will Henshawe, der die Oberaufsicht über Wheal Grace hatte, wohnte am Ende der Reihe armseliger Hütten und Häuschen, aus denen das Dorf Grambler bestand, und er war, wie Ross wusste, ein Frühaufsteher.
»Hauptmann Poldark«, sagte er überrascht, »ich wusste nicht, dass Sie schon so bald zurückkehren würden. Wollen Sie zur Mine? Ich begleite Sie gern. Wie wär’s mit einer Tasse Tee, bevor wir aufbrechen?«
Kurz vor sechs machten sie sich auf den Weg, und als sie bei der Mine ankamen, war gerade Schichtwechsel. Die Bergleute, die Ross seit langem kannten, scharten sich um ihn; es wurde geplaudert und gescherzt, Neuigkeiten wurden erzählt und Fragen gestellt, dennoch fiel Ross eine gewisse Zurückhaltung auf, die es früher nicht gegeben hatte. Der Umgang mit seinen Männern war immer ungezwungen und freundschaftlich gewesen. Nun hatte sich das unmerklich geändert, und ihm war auch klar, warum. Indem er Lord Falmouths Bitte, sich als Kandidat für Truro aufstellen zu lassen, akzeptiert hatte, war er sozial gesehen einige Stufen höhergestiegen. Er war kein einfacher Friedensrichter, der Streitigkeiten schlichtete und unter den Dorfbewohnern Recht sprach – er war nun Mitglied des Parlaments, und das Parlament verabschiedete neue Gesetze. Diese Männer aber waren sicherlich insgeheim der Ansicht, dass es im Grunde genügte, wenn der Mensch die Gesetze Gottes einhielt.
Ross hatte nicht gefrühstückt und spürte nun, wie hungrig er war, aber er spürte auch, dass er mit der neuen Schicht in die Mine hinunter musste. Nur so konnte er das alte kameradschaftliche Verhältnis wiederherstellen. Außerdem war Henshawes Bericht über die Vorgänge in der Mine nicht sonderlich positiv gewesen, und Ross wollte sich selbst vom Stand der Dinge überzeugen.
Doch er musste diesen Plan verschieben.
Während die Männer nacheinander die Leiter zu den Stollen hinunterstiegen, in denen sie acht Stunden arbeiten würden, und Ross sich noch nach Henshawe umschaute, hörte er plötzlich Schritte hinter sich. Er wandte sich um und sah Demelza, die mit Jeremy und Clowance auf ihn zukam.
»Hauptmann Poldark«, sagte sie, »hier sind zwei kleine Freunde, die Sie begrüßen möchten.«
Die Kinder stürmten auf ihn zu.
»Ich wusste nicht, ob ich dir davon erzählen sollte oder nicht«, sagte Demelza. »Mr Henshawe hat mich aufgesucht und es mir berichtet, und da er nicht gern Briefe schreibt, dachte ich, ich müsste es dir mitteilen.«
Es war bald Essenszeit; sie saßen nebeneinander auf der alten Mauer und blickten zum Strand hinab. Es war kalt geworden, und Demelza trug einen Mantel. Die Kinder waren weit unten am Strand; Betsy Maria passte auf sie auf.
»Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, halte ich die Sachlage für weniger schlimm als Henshawe. Es stimmt schon, dass die Südader – die wir zuerst entdeckten und die uns so viel eingebracht hat – nun ganz unerwartet nachzulassen scheint. Auch die Qualität des Erzes ist nicht mehr so gut wie vorher. Aber ein Jahr oder so wird sie sicher noch Erträge bringen. Und die Nordader, die eigentlich eine Sohle ist, haben wir noch bei weitem nicht ausgeschöpft – zumindest sieht es so aus. Und selbst wenn sie sich als enttäuschend entpuppt, wird sie ganz bestimmt noch für eine Reihe von Jahren Erträge bringen. Auf mehr kann ein Minenbesitzer nicht hoffen.«
»Dann war es vielleicht doch falsch, dich zurückzurufen.«
»Ich bin nicht nur aus diesem Grund zurückgekommen. Ich hatte London einfach satt. Nach einem einzigen Tag, wie ich ihn heute hier hatte, fühle ich mich wieder als neuer Mensch.«
Es war Ebbe, und der Sandstrand lag breit und schimmernd, vor ihnen. Betsy Maria und die beiden Kinder waren kleine, ferne Gestalten.
»Es ist lange her«, sagte Demelza, »seit du so mit mir gesprochen hast wie gestern Abend und heute Morgen. Vielleicht liegt das an den vielen Reden, die du im Parlament halten musst.«
»Reden … uh!«
»Erzähl mir doch davon, Wie ist es denn dort? Ist deine Unterkunft bequem?«
»Ja, sehr anständige Zimmer. Mrs Parkins ist die Witwe eines Schneiders. Die George Street ist eine Seitenstraße des Strand und einigermaßen still. Ich frühstücke meist in einem Café. Aber Mrs Parkins kocht mir auch etwas, wenn ich sie darum bitte.«
»Und wo haltet ihr eure Sitzungen ab? Im Parlament?«
»Westminster Hall ist ein schönes, vornehmes Gebäude, aber der Sitzungssaal selbst erinnert unangenehm an die Kirche von Sawle, allerdings sind die Bänke nicht auf eine Kanzel gerichtet, sondern stehen einander gegenüber, und die einzelnen Sitzreihen steigen an. Manchmal ist der Saal unerträglich überfüllt, ein andermal wieder ganz leer. Meist fangen wir um drei an und tagen manchmal bis Mitternacht. Aber oft sind die Dinge, die dort zur Sprache kommen, so provinziell, dass man nicht versteht, wieso sie nicht an Ort und Stelle geklärt werden konnten. Ich habe mich oft gefragt, was ich dort eigentlich zu schaffen habe und ob ich nicht besser daran täte, mich um meine eigenen Angelegenheiten in der Gemeinde von Sawle zu kümmern.«
»Aber es kommen doch bestimmt auch sehr wichtige Dinge zur Sprache.«
»Ja, natürlich gibt es auch wichtige Debatten. Pitt hat eine Einkommensteuer eingeführt, um damit dem zu begegnen, was er schandbare Steuerhinterziehung und skandalöse Betrügereien nennt.«
»Hast du dafür gestimmt?«
»Nein. Ich halte es für einen zu radikalen Eingriff in die Privatsphäre.«
»Ich glaube«, sagte Demelza und legte die Hand als Schirm gegen das Sonnenlicht über die Augen, »wir sollten jetzt die Kinder holen. Sonst wird es zu spät zum Essen.«
Über Grasbüschel und Felsgestein kletterten sie zum Strand hinunter. Als die Kinder sie sahen, kamen sie auf sie zugelaufen.
»Hast du Lord Falmouth eigentlich öfter gesehen?«, fragte Demelza.
»Ich war einmal bei ihm zum Essen eingeladen, und ein andermal haben wir in Covent Garden in einem Restaurant diniert. Unsere Beziehungen waren nicht immer ganz harmonisch, aber immerhin versucht er nicht, Druck auf mich auszuüben, solange ich Pitt in den Hauptpunkten unterstütze.«
Die Kinder waren nun fast herangekommen. Jeremy, der die längeren Beine besaß, hatte Clowance überholt, und Clowances Miene verriet, dass sie das krummnahm.
»Und du bleibst nun den ganzen Sommer zu Hause, Ross?«
»Ja, den ganzen Sommer. Und ich hoffe, du hast etwas Gutes zum Essen. Diese Nacht – und die frische Luft heute Morgen – haben mich hungrig gemacht.«
4
Seit die Schikanen, mit denen George Warleggan Demelzas Bruder Drake das Leben schwergemacht hatte, aufgehört hatten, ging Drakes Geschäft wieder glänzend. Selbst in Kriegs- und Notzeiten brauchten die Menschen einen Schmied und einen Stellmacher. Pally Jewell hatte schon vierzig Jahre vor Drake in der Schmiede gearbeitet, und die Leute akzeptierten Drake als seinen Nachfolger.
Drake, der sich weder um eine Frau noch um eine Familie zu kümmern hatte, arbeitete wie ein Besessener, vom Morgengrauen bis zum Anbruch der Dunkelheit, und häufig auch noch abends bei Kerzenlicht. Zu der Schmiede gehörten sechs Morgen Land, auf dem er hauptsächlich Tierfutter anbaute, das er, von Trenwith abgesehen, an die großen Güter der Umgebung verkaufte. Er hielt Hühner, Ziegen und einige Gänse. Er fertigte auch Spaten, Schaufeln und Leitern an, die ihm die Minenbesitzer abkauften. Vor kurzem hatte er zwei kleine zwölfjährige Jungen, die Trewinnard-Zwillinge, als Gehilfen angestellt. Und er zahlte regelmäßig Geld auf der Bank ein, weniger, weil er glaubte, es zu brauchen, sondern weil er es irgendwo aufheben musste.
Jeden Dienstag und Samstag kam sein Bruder Sam zu ihm herüber, und die beiden unterhielten sich und beteten miteinander. Drake gehörte zwar immer noch zur Methodistengemeinde, nahm am religiösen Leben der Sekte aber nur noch selten teil.
Eines Tages erhielt Drake einen kurzen Brief von Demelza, in dem sie ihn fragte, ob er Zeit habe, in der neuen Bibliothek eine Brandmauer einzusetzen. Ich habe dich diesen Monat noch kein einziges Mal gesehen, schrieb sie. Wir hatten viel zu tun, das Heu einzubringen. Ross ist schon aus London zurück. Magst du nicht einmal zum Essen zu uns kommen? Hier sind vier Menschen, die sich darüber freuen würden, und unter ihnen deine dich liebende Schwester Demelza.
Der Junge, der den Brief gebracht hatte, wartete auf eine Antwort, und Drake trug ihm auf auszurichten, er werde am nächsten Mittwoch nach Nampara kommen. An diesem Tag bat er Jack Trewinnard, ein Auge auf die Schmiede zu haben, und wanderte nach Nampara hinüber.
Nachdem er die Arbeit erledigt hatte, trank er in dem alten Wohnzimmer, das trotz des Umbaus noch immer Mittelpunkt des Hauses war, mit seiner Schwester Tee. Demelza sah blühend und noch hübscher aus als sonst. Nachdem er eine Weile mit den Kindern gespielt hatte, waren sie endlich allein, denn Ross war noch drüben in der Mine.
»Auf deine Kinder kannst du stolz sein, Schwester«, sagte Drake. »Die sind wohlgelungen. Und sie haben einen besseren Start im Leben, als wir ihn hatten.«
»Sie haben ja auch einen ganz anderen Vater.«
»Und eine andere Mutter. Werdet ihr Jeremy bald zur Schule schicken?«
Demelza runzelte nachdenklich die Stirn. »Im Augenblick versuche ich ihm alles beizubringen, was ich weiß, und später bekommt er vielleicht einen Lehrer. Wenn er fortgehen möchte, werde ich ihn natürlich nicht zurückhalten, aber ich finde, es ist doch hart für einen sieben- oder achtjährigen Jungen, wenn er von zu Hause fortmuss. Auch Ross ist erst nach dem Tod seiner Mutter weggegangen, und da war er zehn.«
»Ja, und Geoffrey Charles war schon elf, als sie ihn nach Harrow schickten«, sagte Drake.
Dieses Thema war so heikel, dass sie einen Augenblick schwiegen. »Da ist Ross ja«, sagte Demelza.
Ross wollte nicht, dass frischer Tee für ihn aufgebrüht wurde, und trank eine Tasse aus der Kanne, die auf dem Tisch stand. Sie plauderten eine Weile, und Ross bat Drake, an einem der nächsten Vormittage zur Mine zu kommen; er hatte eine Sendung von Werkzeugen, Schrauben, Nägeln und Drahtrollen aus Bristol erhalten und wollte seinen Verdacht, es sei schlechte Qualität, von einem Fachmann bestätigt wissen.
Drake versprach, am Montag um sieben Uhr zu kommen. Er verabschiedete sich und ging schon auf die Tür zu, da sagte Demelza: »Ach, ich glaube, Rosina Hoblyn wird auch gleich aufbrechen. Kennst du sie, Drake? Sie lebt mit ihrer Familie in Sawle. Sie arbeitet als Näherin und Putzmacherin und hat auch für mich schon Verschiedenes gemacht.«
Zögernd blieb Drake stehen. »Kann sein, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen habe.«
»Ich hab ihr einen alten Hocker von uns geschenkt – sie kann ihn zu Hause gut gebrauchen. Aber mit ihrem Bein ist er für sie eigentlich ein bisschen zu schwer.« Demelza ging zur Tür und rief: »Rosina!«
»Ja, Madam?« Rosina trat auf die Schwelle, das Nähzeug noch in der Hand. Überrascht blickte sie auf die beiden Männer.
»Sie wollten sicher gleich gehen? Sie sind doch bestimmt fast fertig.«
»Oh ja. Ich hab nur noch geschaut, ob auch alles wirklich in Ordnung ist.«
»Das ist mein Bruder, Drake Carne. Er hat den gleichen Weg wie Sie; er wohnt in der Nähe von St. Ann’s. Sicher wird er Ihnen den Stuhl gern tragen.«
»Oh Madam«, sagte Rosina, »das schaffe ich schon. Der wiegt ja nicht viel, und ich bin dran gewöhnt, schwere Wassereimer zu tragen und so.«
»Drake wollte aber auch grade gehen«, sagte Demelza rasch. »Es macht dir doch nichts aus, Drake?«
Drake schüttelte den Kopf.
»Dann machen Sie sich jetzt am besten fertig.«
Das Mädchen verschwand, kam aber gleich darauf mit ihrem Arbeitskorb und dem Hocker zurück. Demelza reichte ihn Drake, und die beiden machten sich auf den Weg, gingen über die knarrende Holzbrücke und das Tal entlang. Ross und Demelza blickten ihnen nach.
»Du nimmst wohl mal wieder jemanden unter deine Fittiche, wie?«, bemerkte Ross.
»Rosina ist ein nettes Mädchen«, antwortete Demelza, »und Drake braucht eine Frau. Ich will nicht, dass er in seiner Enttäuschung und Einsamkeit noch ganz vertrocknet. Ich möchte, dass er wieder fröhlich wird, so wie früher. Er ist mein Lieblingsbruder.«
Ross ging zum Tisch zurück und goss sich noch eine Tasse Tee ein. »Da hast du sicher recht. Aber sei nur vorsichtig: Heiratsvermittlerinnen verbrennen sich oft die Finger.«
»Ach, ich habe nicht vor, noch mehr zu unternehmen. Ich will sie bloß gelegentlich zusammenbringen, das ist alles.«
Ross nahm einen Schluck Tee. »Spricht Drake manchmal von Geoffrey Charles?«
»Ja, er hat ihn heute erwähnt. Warum?«
»Er wird Geoffrey Charles sehr verändert finden, wenn er im Sommer nach Hause kommt. Ich habe ihn eingeladen, als ich noch in London war.«
»Das wird George nicht gefallen.«
»Was kümmert mich George! Wir waren in Vauxhall, haben Musik gehört, die Dirnen ignoriert, im Garten Wein getrunken. Um sieben habe ich ihn wieder nach Hause gebracht. Er hat sich sehr verändert. Diese Jahre in Harrow haben aus ihm einen kleinen Weltmann gemacht. Ich hatte ein ganz sonderbares, sehr eindringliches Gefühl, als er neben mir ging – das Gefühl, dass sein Vater in ihm wiedergeboren ist. Geoffrey Charles ist Francis sehr ähnlich geworden. Ich mochte Francis, und ich mag Geoffrey Charles. Er ist witzig, lebhaft, vielleicht im Augenblick ein wenig labil, aber im Ganzen eine angenehme Gesellschaft.«
»Aber keine gute Gesellschaft für Drake.«
»Ich glaube nicht, dass die beiden noch viel miteinander anfangen können.«
Auch Drake und Rosina wussten, als sie über das Moorland in Richtung auf Grambler wanderten, nicht sonderlich viel miteinander anzufangen. Sie schwiegen.
Als das Schweigen drückend wurde, zwang er sich, etwas zu sagen. »Gehe ich zu schnell für Sie?«
»Nein, nein, gar nicht.«
»Sie brauchen’s bloß zu sagen.«
Damit war die Unterhaltung wieder für eine Weile am Ende. Rosina feuchtete sich mehrmals die Lippen an und sagte schließlich: »Ich gehe jetzt meistens einmal in der Woche nach Nampara. Für Mrs Poldark ist es praktischer, wenn ich hinkomme, als wenn sie mir die Arbeit schickt. Ich sticke und stopfe für sie und all so was.«
»Ich glaube, meine Schwester näht selber nicht viel«, antwortete Drake.
»Nein, sie sagt, sie ist darin nicht besonders geschickt. Aber sie hat oft gute Ideen.«
»Und von wem haben Sie’s gelernt?«
»Ach, ich hab mir das meiste selbst beigebracht.« Rosina strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Wissen Sie, ich konnte so lange Zeit nicht gut laufen, da hab ich eben angefangen, mit den Händen zu arbeiten. Und ich hab mir auch ein Buch von Mrs Odgers geliehen.«
»Können Sie denn lesen?«
»Ja. Die Wäsche, die meine Mutter von Trenwith heimbrachte, war oft in Zeitungen gewickelt. Ich gebe aber zu, es macht mir ein bisschen Mühe.«
»Ich konnte noch mit achtzehn Jahren weder lesen noch schreiben. Dann hat mir’s meine Schwester beigebracht.«
»Diese Schwester?«
»Ich habe nur eine. Und fünf Brüder.«
»Sam ist Ihr Bruder, nicht wahr? Der Prediger. Ich hab ihn schon oft gesehen. Ich glaube, er ist ein guter Mensch.«
»Sind Sie Methodistin?«
»Nein. Ich geh nur sonntags zur Kirche.«
Sie hatten nun Grambler erreicht. Eins war beiden klar: Wenn sie zusammen durch das Dorf bis nach Sawle gingen, so würde sich bald herumgesprochen haben, dass Drake Carne schließlich doch einem Mädchen den Hof machte.
»Jetzt hab ich’s nicht mehr weit«, sagte Rosina. »Das kurze Stück schaffe ich bestimmt. Der Hocker ist ja wirklich nicht schwer.«
Zögernd blieb Drake stehen; der Wind zerzauste sein Haar. »Ach … es spielt keine Rolle. Wenn’s Ihnen nichts ausmacht, begleite ich Sie noch.«
»Mir macht’s nichts aus«, antwortete Rosina.
Osborne Whitworth war so mit seinen eigenen inneren Konflikten beschäftigt, dass er Nathaniel Pearces Brief erst zwei Tage später öffnete. In letzter Zeit hatte Ossie häufig Ausflüchte gesucht, um die Einladungen des alten Mannes zu einer Partie Whist abzulehnen, da es zu häufig vorgekommen war, dass Mr Pearce an dem entsprechenden Tag unter einem Gichtanfall litt und absagen musste oder dass er allzu zerstreut spielte. Eine Zeitlang hatte Ossie dies in Kauf genommen, weil ihm daran gelegen war, die einflussreichen Klienten des Notars kennenzulernen, doch nun kannte er sie und konnte auch ohne Vermittler mit ihnen Kontakt aufnehmen. Als er sich endlich entschloss, den Brief zu lesen, stellte sich heraus, dass es gar keine Einladung zu einer Whist-Partie war. Mr Pearce war krank und wünschte dringend mit ihm zu sprechen.
Ossie schob seinen Besuch noch um weitere zwei Tage hinaus und entschloss sich erst, als er noch anderes in Truro zu erledigen hatte, Pearce einen Besuch abzustatten. Während er hinter der schlampigen Frau, die ihm die Tür geöffnet hatte, die wacklige Treppe hinaufstieg, rümpfte er die Nase über den dumpfen Geruch im Haus. Er war ihm von seinen gelegentlichen – und widerwilligen – Besuchen bei Kranken wohlvertraut und missfiel ihm.
Mr Pearce saß im Nachthemd und mit Schlafmütze im Bett. Sein gedunsenes Gesicht hatte die Farbe einer überreifen Maulbeere. Im Kamin brannte ein Feuer, das Fenster war geschlossen.
»Ah, Mr Whitworth, ich dachte schon, Sie hätten mich vergessen. Treten Sie näher. Und bitte sprechen Sie laut, die Gicht hat sich auch auf mein Gehör geschlagen.«
»Ich war sehr stark mit Gemeindeangelegenheiten beschäftigt«, trompetete Ossie und stellte sich, statt sich auf den Stuhl zu setzen, der ihm angeboten wurde, mit dem Rücken zum Feuer. »Womit kann ich Ihnen dienen?«
»Ach«, sagte Mr Pearce und blinzelte heftig mit seinen blutunterlaufenen Augen, »ich bin sehr krank, Mr Whitworth, und sicher hat Dr Behenna recht, wenn er meine Aussichten auf eine Genesung für trübe hält. Ich bin sechsundsechzig …«
»Ich bedaure sehr, dass es Ihnen so schlechtgeht«, erwiderte Ossie kalt, »und wünschte, ich könnte Ihnen helfen.«
Mr Pearce besann sich auf seine Pflichten als Gastgeber. »Ein Glas Kanarienwein? Er steht dort drüben. Bitte bedienen Sie sich. Ich glaube fast, mir würde ein Glas auch guttun.«
Ossie holte den Wein, schenkte ein, und beide tranken schweigend.
»Dr Behenna hat mir zwar gesagt, ich soll frühestens am Abend ein Glas Wein trinken, aber was macht es schon, wenn ich sowieso bald vor Gottes Angesicht trete … da wir von Gott sprechen, Mr Whitworth, möchte ich Sie daran erinnern, dass ich zu Ihrer Gemeinde gehöre. Den geistlichen Beistand des sauertöpfischen Dr Halse könnte ich nicht ertragen.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.