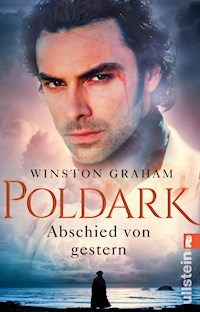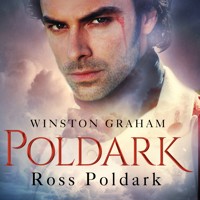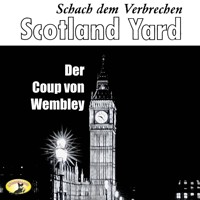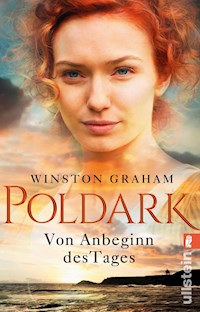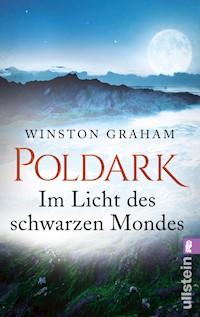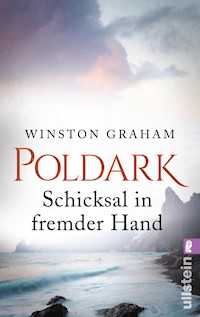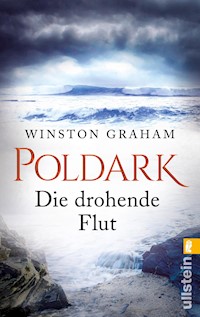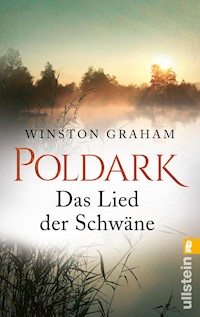
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Cornwall 1795-1797 Endlich hat es Ross Poldark zu Reichtum und Zufriedenheit gebracht. Doch immer wieder gerät alles, was ihm lieb ist, in Gefahr, weil er dem Lied der Schwäne nicht widerstehen kann – jener vier Frauen, die in seinem Leben eine Rolle spielen. Denn alle vier, seine Frau Demelza, seine alte Liebe Elizabeth, Caroline, die neue Ehefrau seines Freundes und die unglückliche Morwenna, durchleben Zeiten der Krise und des Konflikts … »Vom unvergleichlichen Winston Graham …, der all das hat, was die anderen haben, und dann noch eine ganze Menge mehr« The Guardian Der sechste Roman der großen Poldark-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Cornwall, 1795 bis 1797: Nach vielen Widrigkeiten ist Ross Poldark endlich zu Ansehen und Wohlstand gekommen und scheint glücklich zu sein. Doch schon bald muss er sich einem neuen Dilemma stellen, als sich ein junger Marineoffizier in seine Ehefrau Demelza verliebt. Doch nicht nur Demelza stehen Zeiten des Konflikts bevor. Auch Ross’ alte Liebe Elizabeth, Caroline, die neue Ehefrau seines Freundes und die unglückliche Morwenna Chynoweth müssen sich Konflikten stellen, die nicht nur ihre Ehen, sondern auch ihr Leben in Gefahr bringen.
Der Autor
Winston Mawdsley Graham, geboren 1908 in Manchester, gestorben 2003 in London, hat über vierzig Romane geschrieben, darunter auch Marnie, der 1964 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Er war Mitglied der Royal Society of Literature sowie des Order of the British Empire und lebte in London und Cornwall.
Die Poldark-Serie von Winston Graham ist in unserem Hause in chronologischer Reihenfolge erschienen:
Poldark – Abschied von gestern
Poldark – Von Anbeginn des Tages
Poldark – Schatten auf dem Weg
Poldark – Schicksal in fremder Hand
Poldark – Im Licht des schwarzen Mondes
Poldark – Das Lied der Schwäne
Poldark – Die drohende Flut
Winston Graham
Poldark
Das Lied der Schwäne
Roman
Aus dem Englischenvon Christiane Kashin
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1240-8
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© Winston Graham 1976Titel der englischen Originalausgabe: The Four Swans (Pan Books, Pan Macmillan, London 2008; first published in 1976 by William Collins Sons & Co. Ltd.)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Erstes Buch
1
Eines Abends Anfang Oktober 1795 kehrte Dr Daniel Behenna von einigen Patientenbesuchen zu seinem Haus in der Goodwives Lane in Truro zurück. Nach dem unfreundlichen Sommer waren die letzten Wochen sehr warm gewesen, und den ganzen Tag hatte es stark nach Abwässern und Müll gerochen. Doch nun war eine leichte Abendbrise aufgekommen und hatte die üblen Gerüche weggefegt.
Als Dr Behenna vor seiner Tür angelangt war, musste er erst eine kleine Gruppe von Menschen verscheuchen, die auf ihn gewartet hatten. Die weniger wohlhabenden Bürger der Stadt begnügten sich meist mit der ärztlichen Hilfe der Apotheker, und die armen behalfen sich mit selbstgebrauten Heiltränken, doch bei manchen schweren Fällen ließ Dr Behenna sich auch herab, einen Kranken ohne Honorar zu behandeln, da derartige großzügige Demonstrationen seinen Ruf förderten und sein Image als Arzt stärkten. Daher warteten vor seinem Haus ständig Bittsteller auf ihn, die hofften, ihm ein paar Fragen stellen zu dürfen. Doch heute war er nicht in Stimmung.
Er warf dem Stallknecht die Zügel seines Pferdes zu und trat ins Haus. Mrs Childs, seine Haushälterin, kam ihm entgegen. Sie wischte sich die Hände an einem schmutzigen Handtuch ab.
»Herr Doktor«, flüsterte sie. »Da ist ein Herr, der Sie zu sprechen wünscht. Im Wohnzimmer. Der ist schon an die fünfundzwanzig Minuten da. Ich wusste nicht, wie lang Sie fort sein würden, aber er hat gesagt, er will warten.«
Behenna setzte seine Tasche ab und zog den Mantel aus. Unwillig musterte er die schlampige junge Frau. »Was für ein Herr? Warum haben Sie Mr Arthur nicht gerufen?« Behennas Assistent, Mr Arthur, wohnte in einem Zimmer über dem Stall.
»Es ist Mr Warleggan«, antwortete sie.
Behenna warf einen raschen Blick in den stockfleckigen Spiegel, glättete sein Haar und klopfte ein paar Stäubchen von seiner Manschette. Dann ging er, sich räuspernd und noch immer ungläubig, ins Wohnzimmer. Aber Mrs Childs hatte sich nicht geirrt. Am Fenster stand George Warleggan, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, frisch rasiert und wie immer elegant gekleidet – einer der wohlhabendsten und einflussreichsten Männer der Stadt.
»Oh, Mr Warleggan, ich hoffe, Sie mussten nicht zu lange auf mich warten. Wenn ich gewusst hätte …«
»Das konnten Sie ja nicht wissen. Ich habe inzwischen Ihr Skelett bewundert. Wie eindrucksvoll der Mensch doch gebaut ist.« Sein Ton war kalt wie immer.
»Ich besitze es schon seit meiner Studentenzeit. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Ein Glas Kanarienwein?«
George Warleggan schüttelte den Kopf. »Ihre Haushälterin hat mir bereits etwas angeboten.«
»Dann nehmen Sie doch Platz, bitte. Was kann ich für Sie tun?«
George Warleggan setzte sich und schlug die Beine übereinander.
Einige Augenblicke schwiegen sie. Dann sagte George: »Ich möchte Sie in einer persönlichen Angelegenheit sprechen.«
Dr Behenna nickte.
»Was ich Ihnen zu sagen habe, ist streng vertraulich.«
»Alles, was zwischen Arzt und Patient besprochen wird, ist vertraulich«, antwortete Behenna.
»Für diese Angelegenheit gilt das in noch größerem Maße«, sagte George kühl. »Ich will damit sagen, dass nur Sie und ich von dieser Unterredung wissen. Sollte ich also feststellen, dass noch eine dritte Person davon Kenntnis hat, so kann sie es nicht von mir erfahren haben. Und das würde ich sehr übelnehmen, Dr Behenna.«
Der Arzt stand auf, ging zur Tür und öffnete sie. Die Diele war leer. Er schloss die Tür wieder. »Sie können offen sprechen, Mr Warleggan. Ich versichere Ihnen, niemand wird etwas erfahren.«
George nickte. »Also gut. Sie haben meiner Frau bei der Geburt unseres Kindes beigestanden. Sie sind auch seither häufig in meinem Haus gewesen. Und, soviel ich weiß, haben Sie schon bei vielen Frauen Geburtshilfe geleistet.«
»Bei Tausenden. Ich darf ohne falsche Bescheidenheit sagen, dass ich von allen Ärzten in Cornwall wohl die größte Erfahrung habe.«
George nickte. »Mein Sohn Valentin war ein Achtmonatskind, nicht wahr? Da meine Frau im achten Monat stürzte, wurde unser Kind einen Monat zu früh geboren. Richtig?«
»Richtig.«
»Sagen Sie, Dr Behenna, unter den Tausenden von Kindern, die Sie zur Welt gebracht haben, müssen doch viele Frühgeburten gewesen sein. Wie?«
»Ja, eine ganze Reihe.«
»Acht Monate? Sieben Monate? Sechs Monate?«
»Acht und sieben. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Sechsmonatskind durchkam.«
»Und was war mit den Frühgeburten, die am Leben blieben, wie Valentin? Gab es zwischen ihnen und den normalen Kindern irgendwelche Unterschiede?«
»Unterschiede? Welcher Art?«
»Das frage ich Sie.«
»Wesentliche Unterschiede gibt es nicht, Mr Warleggan. Sie dürfen da ganz beruhigt sein. Ihr Sohn ist in keiner Weise geschädigt, weil er zu früh zur Welt kam.«
»Darum geht es mir nicht.« Georges Stimme war unmerklich schärfer geworden. »Ich möchte wissen, worin sich eine Frühgeburt von einem normalen Kind unterscheidet.«
»Nun, natürlich im Gewicht. Achtmonatskinder wiegen selten mehr als sechs Pfund. Sie schreien auch nicht so laut. Und die Nägel …«
»Ich habe gehört, dass ein Achtmonatskind noch keine Fingernägel hat.«
»Das stimmt nicht. Sie sind klein und oft noch weich …«
»Man hat mir auch gesagt, die Haut eines solchen Kindes sei runzlig und rot.«
»Das ist sie bei den meisten Neugeborenen.«
»Und sie sollen noch kein Haar haben.«
»Oh, doch, es kommt vor. Nur ist es dann noch sehr dünn.«
Draußen auf der Straße ratterte ein Wagen vorbei. Als das Geräusch verklungen war, sagte George: »Vielleicht ist Ihnen der Sinn meiner Fragen inzwischen klargeworden, Dr Behenna. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen: War mein Sohn eine Frühgeburt oder nicht?«
Dr Behenna fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Er war sich bewusst, dass George ihn scharf beobachtete, und er spürte auch die Spannung, die von dem anderen ausging. Er stand auf und trat zum Fenster. »In manchen medizinischen Fragen kann man nicht ohne weiteres mit einem klaren Ja oder Nein antworten, Mr Warleggan. Lassen Sie mir ein paar Minuten Zeit, zurückzudenken. Ihr Sohn ist jetzt zwischen anderthalb und zwei Jahre alt. Warten Sie … wann wurde ich zu Ihrer Frau gerufen?«
»Am dreizehnten Februar des vorigen Jahres. Meine Frau war in Trenwith auf der Treppe gestürzt. Es war ein Donnerstagabend, gegen sechs Uhr. Ich schickte einen Boten, um Sie zu holen, und Sie trafen gegen Mitternacht bei uns ein.«
»Ach ja, ich erinnere mich. Ich untersuchte Ihre Frau noch in der Nacht und kümmerte mich auch am nächsten Tag um sie. Ich glaube, das Kind kam dann abends zur Welt.«
»Valentin wurde um Viertel nach acht geboren.«
»Richtig … wenn ich mich recht erinnere, Mr Warleggan, war bei der Geburt Ihres Sohnes nichts Ungewöhnliches. Ich habe mir damals auch keine Gedanken darüber gemacht. Warum sollte ich? Er kam eben nur einen Monat zu früh zur Welt. Trotz des Sturzes Ihrer Frau konnte ich sie von einem gesunden Jungen entbinden.«
»Aber Sie müssen sich doch an das Kind erinnern. Hatte es voll ausgebildete Fingernägel?«
»Ich glaube, ja …«
»Und Haare?«
»Ja, ein wenig dunkles Haar.«
»Und war seine Haut stark runzlig? Ich erinnere mich, dass sie nur wenig runzlig war.«
Behenna seufzte. »Mr Warleggan, Sie und Ihre Familie gehören zu meinen bedeutendsten Patienten, und ich möchte Sie natürlich nicht kränken. Aber darf ich offen sprechen?«
»Ich bitte darum.«
»Die Gründe, warum Sie mir diese Fragen stellen, sind mir unbekannt, und es steht mir auch nicht zu, danach zu fragen. Aber ich bitte Sie, vergessen Sie diese Angelegenheit. Nach so langer Zeit ist es unmöglich, jetzt noch zu sagen, ob Ihr Sohn eine Frühgeburt war oder nicht. Und die Natur lässt sich nicht derartig festlegen; sie weicht oft vom Üblichen ab.«
»Sie wollen es mir also nicht sagen.«
»Ich kann nicht. Wenn Sie mich damals gefragt hätten, hätte ich das Kind untersucht und mich sicher präzise dazu äußern können.«
George stand auf und nahm seinen Stock. »Soviel ich gehört habe, ist Dr Enys wieder zurück und wird bald wieder Patientenbesuche machen.«
Behennas Miene wurde starr. »Er ist noch immer krank und wird bald seine reiche Braut heiraten.«
»Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die viel von ihm halten.«
»Nun, das ist deren Sache. Ich persönlich schätze seine Methoden absolut nicht.«
»Tja … dann möchte ich mich jetzt verabschieden, Dr Behenna.« George musterte den Arzt mit kaltem Blick. »Ich hoffe, Sie vergessen nicht, was ich Ihnen zu Beginn unseres Gesprächs sagte.«
»Ich stehe unter ärztlicher Schweigepflicht.«
»Ich hoffe, Sie halten sich daran.« George ging zur Tür.
George Tabb fegte gerade den Hahnenkampfplatz hinter dem »Fighting Cocks Inn«, da trat der Wirt aus der Tür, rief ihn zu sich und sagte ihm, jemand wolle ihn sprechen. Tabb arbeitete schon seit geraumer Zeit als Stallknecht im Wirtshaus, und seine Frau verdiente als Wäscherin noch zwei Pfund im Jahr dazu. Die Tabbs waren die letzten Hausangestellten gewesen, die von der verwitweten Elizabeth Poldark in Trenwith entlassen worden waren.
Tabb ging nach vorn zur Straße, wo ein hagerer, schwarzgekleideter Mann, dessen eng beieinanderliegende Augen an eine Eule erinnerten, ihn erwartete.
»Sind Sie George Tabb? Ein Herr möchte mit Ihnen sprechen. Sie sind in einer halben Stunde wieder zurück.«
Verwundert fragte Tabb, worum es sich handle, doch mehr wollte der Mann ihm nicht sagen.
Es war nicht weit. Sie bogen in eine Allee ein, gingen ein Stück am Flussufer entlang und traten durch eine Tür in der Mauer auf einen Hof. Tabb blickte auf die Rückseite eines großen Hauses. Der Mann mit den Eulenaugen führte ihn in einen Raum, der wie das Büro eines Rechtsanwalts wirkte. »Warten Sie hier«, sagte er und schloss die Tür hinter sich.
Tabb wartete eine Zeitlang, dann trat durch eine andere Tür ein Mann ein. Tabb riss überrascht die Augen auf. »Mr Warleggan!«
George Warleggan nickte ihm kurz zu und setzte sich hinter den Schreibtisch. Tabb war unbehaglich zumute. Elizabeth Poldark hatte damals die Tabbs auf Mr Warleggans Wunsch hin entlassen, und die Begrüßung eben war auch recht kühl gewesen.
»Tabb«, sagte George, der in einigen Papieren blätterte, schließlich, »ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen.«
»Ja, Sir?«
George Warleggan holte zwei Münzen aus seiner Uhrtasche. Es waren Goldstücke.
»Sehen Sie diese beiden Guineen, Tabb. Sie gehören Ihnen, unter einer Bedingung.«
Tabb starrte wie hypnotisiert auf das Geld.
»Ja, Sir?«
»Ich möchte Ihnen ein paar Fragen über die letzten Monate stellen, als Sie noch in Trenwith arbeiteten. Das ist jetzt etwas mehr als zwei Jahre her.«
»Oh, ja, Sir. Ich erinnere mich noch gut.«
»Nur Sie und ich wissen von diesem Gespräch, Tabb. Sie allein werden wissen, welche Fragen ich Ihnen gestellt habe. Falls ich also feststelle, dass auch andere davon wissen, so ist klar, dass sie es von Ihnen erfahren haben.«
»Oh, Sir, ich würde nie etwas weitererzählen …«
»Tatsächlich? Da bin ich gar nicht so sicher. Ein Mann, der trinkt, hat eine lockere Zunge. Also passen Sie gut auf, was ich Ihnen sage. Wenn ich jemals hören sollte, dass andere Leute über das, was wir heute Nachmittag besprochen haben, reden, werde ich dafür sorgen, dass man Sie aus dieser Stadt hinausjagt und dass Sie nirgendwo mehr eine Anstellung bekommen. Sie werden in der Gosse verkommen. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Haben Sie das verstanden?«
»Ja, Sir. Ich werde kein Sterbenswörtchen verlauten lassen.«
»Nun gut. Ich möchte, dass Sie sich erinnern, wer in der Zeit von April 1793 bis Juni des Jahres, als Sie Trenwith verließen, dort zu Besuch war, beziehungsweise dort vorgesprochen hat.«
»Wer zu Besuch war? Um Mrs Poldark zu sehen? Oder Miss Agatha? Das waren nur wenige, Sir. ’n paar Leute aus dem Dorf, Betty Coad mit Pilchards. Der Mann mit der Zeitung. Aaron Nanfan –«
Ungeduldig winkte George ab.
»Ich meine gesellschaftliche Besuche.«
Nachdenklich rieb Tabb sein unrasiertes Kinn. »Nun, Sie natürlich, Sir. Und Dr Choake, der Miss Agatha besuchte, Pfarrer Odgers einmal in der Woche, Mr Henshawe, Hauptmann Poldark, Sir John Trevaunance vielleicht zweimal und Mrs Ruth Treneglos einmal, glaube ich. Auch Mrs Teague habe ich einmal gesehen. Aber ich war meistens draußen auf dem Feld –«
»Wie oft kam Hauptmann Poldark von Nampara?«
»Och … einmal pro Woche oder so.«
»Kam er oft abends?«
»Nein, Sir, immer am Nachmittag. Donnerstagnachmittag. Trank Tee und ging dann wieder.«
»Und wer kam abends?«
»Eigentlich niemand, Sir. Da war’s ganz ruhig. Nur Mrs Poldark und der junge Mr Geoffrey Charles und die alte Miss Agatha.«
»Aber sicher ist Mrs Poldark abends doch manchmal ausgeritten?«
»Nein, sie ist überhaupt fast nie geritten. Wir hatten ja fast alle Pferde verkauft.«
»Und wie oft ist Mrs Poldark nach Nampara hinübergeritten?«
»Nach Nampara? Nie.«
»Wieso nicht? Sie waren schließlich Nachbarn.«
»Tja … ich glaub, sie kam mit Hauptmann Poldarks Frau nicht so gut aus. Aber genau weiß ich das nicht.«
Sie schwiegen. Dann sagte George: »Versuchen Sie sich besonders an den Monat Mai zu erinnern. An die Zeit Anfang oder Mitte Mai. Wer ist da gekommen? Abends.«
»Hm … niemand, Sir. Kein Mensch ist gekommen.«
»Wann gingen Sie zu Bett?«
»Oh … um neun oder zehn. Sobald es dunkel war.«
»Und wann zog sich Mrs Poldark zurück?«
»Hm … ungefähr um die gleiche Zeit.«
»Wer hat abgeschlossen?«
»Das hab immer ich gemacht.«
»Ich fürchte, Sie haben die zwei Guineen nicht verdient«, sagte George.
»Aber, Sir, ich habe Ihnen bestimmt alles gesagt, was ich weiß und wie es war!«
»Vielleicht. Wenn abends jemand geklingelt hätte, hätten Sie das gehört?«
Tabb dachte nach. »Ich glaub nicht. Ich glaub, das hätte niemand gehört. Die Klingel war unten in der Küche, und wir schliefen alle oben.«
»Gibt es irgendeinen geheimen Eingang zum Haus?«
»Nein … nicht dass ich wüsste. Und ich war fünfundzwanzig Jahre dort.«
George stand auf. »Nun gut, Tabb. Nehmen Sie Ihre Guineen und gehen Sie. Ich verlasse mich darauf, dass Sie zu niemandem ein Wort sagen, nicht einmal zu Ihrer Frau.«
»Der sag ich bestimmt nichts«, antwortete Tabb. »Die nimmt mir das Geld sonst nämlich weg.«
Im Wohnzimmer war Elizabeth Warleggan damit beschäftigt, ein Geburtstagspäckchen für ihren Sohn aus erster Ehe, Geoffrey Charles, zu packen. Er war nun Schüler von Harrow und wurde bald elf Jahre alt. Bisher hatte sie von ihm drei ziemlich hastig hingeworfene Briefe erhalten, in denen er ihr mitteilte, dass es ihm gutgehe und er sich an die Schule gewöhnt habe. Sie bewahrte die Briefe in einer Schublade ihres Sekretärs sorgfältig auf, und immer, wenn sie einen Blick darauf warf, gab es ihr einen Stich; in Gedanken las sie zwischen den Zeilen. Ihr jüngerer Sohn Valentin aus der Ehe mit George Warleggan war noch keine zwei Jahre alt und hatte sich noch immer nicht völlig von der schweren Rachitis erholt, an der er im vergangenen Winter gelitten hatte.
Sie dachte gerade darüber nach, wie kurzweilig es war, den Winter in Truro zu verbringen, wo sie mit Freunden Karten spielen konnte, und wie lang und trübe dagegen die Winterabende in Trenwith mit Francis und nach Francis’ Tod gewesen waren. Da trat George ein.
»Warum überlässt du das nicht den Dienstboten?«, sagte er.
»Es ist ein Geschenk für Geoffrey Charles«, erwiderte Elizabeth, »und ich möchte es gern selbst einpacken. Er hat Ende nächster Woche Geburtstag, und die Kutsche, die morgen nach London abgeht, soll das Päckchen mitnehmen.«
»Dann kannst du auch gleich ein kleines Geschenk von mir mit einpacken. Ich hab’s nicht vergessen.« George trat zu einer Schublade des Schreibtisches und entnahm ihr eine kleine Schachtel. Sie enthielt sechs Perlmuttknöpfe.
»Wie hübsch!«, rief Elizabeth. »Und es ist lieb von dir, dass du daran gedacht hast. Ich werde sie gleich mit einpacken. Und meinem Brief werde ich noch eine Nachschrift beifügen und sagen, dass die Knöpfe von dir sind.«
Geoffrey Charles hatte in seinen Briefen kein Wort über seinen Stiefvater verloren. Es war beiden, George und Elizabeth, aufgefallen, aber sie hatten vermieden, darüber zu sprechen.
Als sie später allein zu Abend aßen – Elizabeths Eltern waren in Trenwith geblieben –, wurde es, wie so oft in letzter Zeit, ein schweigsames Mahl. George war ihr gegenüber stets von unveränderlicher Höflichkeit und ließ sich niemals gehen. Dennoch hatte Elizabeth gelernt, in seiner beherrschten Miene zu lesen, und ihr war klar, dass sich seine Einstellung zu ihr in den vergangenen zwei Monaten stark geändert hatte. Er schien sie ständig zu beobachten, so intensiv, dass es ihr nachgerade unerträglich geworden war. Und wenn sie aufblickte, schaute er rasch weg. Manchmal fühlte sie sich sogar durch den Dienstboten beobachtet. Und sie hatte mehrmals Briefe erhalten, die so aussahen, als habe sie jemand geöffnet und wieder versiegelt. Das Ganze war äußerst unangenehm, und sie fragte sich, ob ihre Einbildung ihr nicht einen Streich spielte.
Als die Dienstboten das Zimmer verlassen hatten, sagte Elizabeth: »Wir haben noch nicht auf die Einladung zu Caroline Penvenens Hochzeit geantwortet. Das müssen wir bald tun.«
»Mir liegt nichts daran, hinzugehen. Ich finde Dr Enys unerträglich eingebildet.«
»Vermutlich wird die halbe Grafschaft dort sein, um die Rückkehr des Helden aus der französischen Gefangenschaft zu feiern.«
»Und vor allem wird sein Retter auch anwesend sein, um sich für eine Tat feiern zu lassen, die überstürzt und völlig unüberlegt war.« George stand auf. Wieder fiel Elizabeth auf, wie stark er abgenommen hatte, und sie sann darüber nach, ob sein sonderbares Benehmen mit gesundheitlichen Störungen zu erklären war. »Sag mir doch, Elizabeth, was hältst du inzwischen eigentlich von Ross Poldark?«
Diese Frage bestürzte sie. Seit ihrer Heirat war dieser Name kaum noch zwischen ihnen erwähnt worden. »Was ich von ihm halte, George? Was meinst du damit?«
»Genau was ich sage. Du kennst ihn nun seit fünfzehn Jahren und warst mit ihm befreundet. Früher hast du ihn immer hartnäckig verteidigt und grundsätzlich seine Partei ergriffen.«
Sie fingerte nervös an ihrer Serviette herum. »Ja, das habe ich wohl … aber in den letzten Jahren hat sich meine Einstellung ihm gegenüber geändert. Ich fand es unerhört, wie er damals zu Weihnachten in unser Haus eindrang und uns beschimpfte, weil seine Frau eine Auseinandersetzung mit deinem Wildhüter gehabt hatte.«
»Er ist nicht in unser Haus eingedrungen«, antwortete George ruhig, »er hat sich auf unerklärliche Weise Eingang verschafft.« Sie zuckte die Achseln.
»Das ist doch im Grunde das Gleiche.«
»Findest du?«
»Was willst du damit sagen?«
Er ging darauf nicht ein. Nach einer Weile sagte er: »Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber manchmal scheint mir, dass diese neue Feindseligkeit, die du Ross Poldark gegenüber entwickelt hast, nicht ganz so echt ist wie deine frühere Zuneigung …«
»Da hast du recht!«, antwortete sie scharf. »So etwas solltest du wirklich nicht sagen! Wirfst du mir etwa Scheinheiligkeit oder Lüge vor?«
Sie hatten während ihrer Ehe gelegentlich Meinungsverschiedenheiten gehabt, aber nie einen wirklichen Streit. George zögerte.
»Nun …«, sagte er, »Scheinheiligkeit würde ich es nicht nennen. Vielleicht ist es eher Selbsttäuschung.«
»Habe ich dir jemals in den letzten zwei Jahren Grund zu der Annahme gegeben, dass ich mehr für Ross empfinde, als ich behaupte?«
»Nein, aber das meine ich auch nicht. Du musst zugeben, dass du ein sehr loyaler Mensch bist. Während deiner ganzen Ehe mit Francis hast du für Ross Poldark freundschaftliche Gefühle bewahrt. Wenn ich seinen Namen nur erwähnte, wurdest du eisig. Aber seit unserer Heirat lehnst du ihn plötzlich ebenso ab wie ich. Bei allen Auseinandersetzungen hast du meine Partei ergriffen –«
»Und darüber beklagst du dich?«
»Nein, natürlich nicht. Ich bin froh darüber. Ich frage mich nur, ob das deinem Charakter auch wirklich entspricht. Natürlich empfindest du es als deine Pflicht, mich zu unterstützen, aber es wäre dir sehr viel angemessener, wenn du es zögernd tätest und nicht mit der Verve, die du jetzt an den Tag legst. Ich frage mich deshalb, ob du in Bezug auf deine Gefühle nicht einer Selbsttäuschung unterliegst.«
Sie stand nun auch auf und ging zum Kaminfeuer hinüber. »Und wieso kommst du darauf gerade jetzt zu sprechen?«
»Weil wir davon sprachen, dass er bei Carolines Hochzeit bestimmt anwesend sein wird. Genügt das nicht?«
»Es genügt nicht, um solche … Beschuldigungen zu rechtfertigen. Ich habe den Eindruck, dass du mir in Bezug auf Ross schon seit langem nicht traust.«
»Ich gebe zu, ich habe von Zeit zu Zeit darüber nachgedacht.«
Sie schwiegen. Schließlich ging Elizabeth zu George hinüber. Mit ihren einunddreißig Jahren wirkte sie noch immer ganz mädchenhaft. »Du bist von einer unsinnigen Eifersucht besessen, mein Lieber. Nicht nur in Bezug auf Ross, sondern auf alle Männer. Wenn wir eingeladen sind, wage ich kaum, einen Mann unter siebzig anzulächeln, weil ich das Gefühl habe, dass du ihn sonst am liebsten ermorden würdest.« Sie legte die Hand auf seinen Arm, da er etwas erwidern wollte. »Glaub mir doch, ich mache mir nichts mehr aus Ross. Ich liebe ihn nicht, und es ist mir gleich, wenn ich ihn nie mehr sehe. Ich mag ihn nicht einmal besonders. Ich sehe in ihm jetzt nur noch einen Aufschneider, einen Mann in mittlerem Alter, der so tut, als wäre er jung, und sich dadurch im Grunde lächerlich macht.«
Sie hätte kaum bessere Argumente finden können, um ihn zu überzeugen, als diese wenigen kühlen, abschätzigen Bemerkungen. Sie taten ihm wohl.
»Vielleicht bin ich wirklich übermäßig eifersüchtig«, gab er zu. »Ich weiß es nicht. Aber du musst ja wissen, ob ich Grund dazu habe.«
Sie lächelte. »Du hast keinen Grund dazu. Ich versichere es dir.«
2
Dwight Enys und Caroline Penvenen heirateten an Allerheiligen, das im Jahr 1795 auf einen Sonntag fiel, in der Marienkirche in Truro. Zwar gehörte Killewarren, Carolines Wohnsitz, zur Gemeinde von Sawle und Grambler, aber die Kirche von Sawle wäre für diese Feier nicht groß genug gewesen; außerdem lag Truro für die meisten Gäste zentraler, und der regnerische November war keine günstige Zeit für Überlandreisen.
Es war nun doch eine große Hochzeit geworden. Dwight war noch zu schwach gewesen, um sich genügend dagegen wehren zu können. Nach der langen Gefangenschaft war es noch immer nicht sicher, ob er völlig genesen würde. Nach wie vor hatte er mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit zu kämpfen und wurde nachts von einem hartnäckigen Husten und von Atemlosigkeit gequält. Er hätte die Hochzeit am liebsten bis zum Frühling verschoben, aber Caroline war dagegen.
»Liebling«, hatte sie gesagt, »ich war nun wirklich lange genug eine alte Jungfer. Du musst Rücksicht auf meinen guten Ruf nehmen. Die Leute zerreißen sich bereits die Mäuler, weil wir während deiner Rekonvaleszenz ohne Anstandswauwau in diesem Haus zusammengelebt haben.« Das Datum der Hochzeit war also festgelegt worden, und auch in Bezug auf die Hochzeit selbst hatte Dwight nachgeben müssen. »Ich weiß, dir ist es peinlich, dass ich reich bin«, hatte Caroline gesagt, »aber das hast du schließlich vorher gewusst, und man erwartet von mir ein großes Fest.«
Tatsächlich war – wie Elizabeth vorausgesagt hatte – die halbe Grafschaft eingeladen. In der Nacht hatte es stark geregnet, doch der Hochzeitstag selbst war strahlend schön. Caroline, die ein weißes Satinkleid und ein perlenbesetztes Diadem trug, wurde von ihrem Onkel, der eigens aus Oxfordshire angereist war, zum Altar geführt. Nach der Trauung gab es einen Empfang im »High Cross«.
Elizabeth hatte George schließlich doch überreden können, der Einladung Folge zu leisten. Doch er hatte seinen alten Feind Ross Poldark rasch erspäht, der in der Nähe der beiden Verlobten stand. Nur Elizabeth merkte, wie schwer es ihm fiel, an Ross vorbeizugehen. Ross trug einen schwarzen Samtrock, ein graues Wildlederwams und enge graue Nankinghosen. Wams und Hosen waren neu, doch der Rock war noch immer derselbe, den sein Vater ihm zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Zwar hätte er sich längst einen neuen leisten können, doch war er wohl auch ein wenig stolz darauf, dass ihm der Rock in diesen vierzehn Jahren noch nicht zu eng geworden war. Immerhin hatte er darauf bestanden, seiner Frau Demelza für die Hochzeit ein neues Kleid zu schenken. Demelza war nun fünfundzwanzig Jahre alt und hatte nichts von dem schelmischen Charme eingebüßt, der die Männer so anzog. Sie trug einen mit Silberfäden bestickten grünen Damastrock und wirkte darin ebenso schlank wie Elizabeth, nur nicht so mädchenhaft.
Die Warleggans und die Poldarks nickten einander höflich zu, sprachen aber nicht miteinander. Dann gingen sie weiter zu den Brautleuten, schüttelten ihnen die Hand und wünschten ihnen Glück – George allerdings nur mit halbem Herzen. Er nahm es Dwight Enys übel, dass er, der vor seiner Heirat ein mittelloser, hart arbeitender Arzt mit mittellosen Patienten gewesen war, es abgelehnt hatte, sich von den Warleggans beeindrucken zu lassen, und nie einen Hehl daraus gemacht hatte, dass er mit Ross Poldark befreundet war. Mager und müde stand er neben seiner strahlenden rothaarigen Frau, die neben ihm wie die Verkörperung von Jugend und Glückseligkeit wirkte.
Sie gingen weiter und sprachen ein paar Worte mit Pfarrer Osborne Whitworth und seiner Frau Morwenna. Wie stets bei derartigen Anlässen war Ossie übertrieben modisch gekleidet. Auch Morwenna trug ein neues braunes Kleid, das ihr aber nicht sonderlich gut stand. Sie hielt den Blick niedergeschlagen und sprach wenig, antwortete nur höflich lächelnd, wenn sie etwas gefragt wurde, und ihrer ausdruckslosen Miene war weder etwas von der Verzweiflung und dem seelischen Elend anzumerken, die sie quälten, noch von der Übelkeit, die das Kind, das sie von Ossie unter dem Herzen trug, ihr verursachte. George und Elizabeth trennten sich bald von ihnen und gingen zu einer Ecke hinüber, wo Sir Francis und Lady Basset standen.
Etwa zweihundert Menschen, die Creme der kornischen Gesellschaft, waren hier versammelt – Edelleute, Kaufleute, Bankiers, Offiziere, Titelträger und Gutsbesitzer. Demelza wurde von Ross getrennt und begrüßte Mr und Mrs Ralph-Allen Daniell, die sich aufrichtig freuten, sie wiederzusehen, obwohl Ross damals Mr Daniells Vorschlag, sich zum Friedensrichter ernennen zu lassen, abgelehnt hatte. Bei ihnen stand ein kerniger, unauffällig gekleideter, zurückhaltender Mann von Ende dreißig, und Mr Daniell stellte die beiden einander vor: »Mylord, darf ich Sie mit Mrs Demelza Poldark bekannt machen, der Gattin von Hauptmann Ross Poldark. Viscount Falmouth.«
»Über Ihren Gatten ist in letzter Zeit viel gesprochen worden, Madam«, sagte Lord Falmouth. »Ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, ihm zu seinem gelungenen Feldzug zu gratulieren.«
»Ich hoffe nur, Mylord«, erwiderte Demelza, »all diese Glückwünsche steigen ihm nicht so zu Kopf, dass er sich gleich in ein neues Abenteuer stürzt.«
Falmouth lächelte reserviert. »Verständlich, dass Sie Ihren Gatten gern zu Hause haben. Aber Männer wie er werden von England vielleicht noch gebraucht.«
»Wenn er gebraucht wird, steht er bestimmt zur Verfügung«, sagte Demelza.
Ross und Demelza übernachteten bei Harris Pascoe, dem Bankier, und als sie beim Abendessen saßen, berichtete Demelza von ihrer Unterhaltung mit Lord Falmouth.
»Ich fürchte, ich habe keinen sonderlich guten Eindruck auf ihn gemacht«, schloss sie.
»Das spielt keine Rolle«, erwiderte Ross. »Wir brauchen seine Protektion nicht.«
»Übrigens«, warf Pascoe ein, »Hugh Armitage, der junge Leutnant, den Sie aus dem Gefängnis von Quimper befreiten, ist mit den Falmouth’ verwandt. Seine Mutter ist eine Boscawen.«
»Tatsächlich? Das wusste ich nicht. Er hat es mir nicht erzählt.«
»Die Familie verdankt Ihnen also einiges.«
»Wieso? Ich hatte nicht vor, ihn zu retten. Das hat sich nur zusätzlich ergeben.«
»Immerhin haben Sie ihn nach Hause zurückgebracht.«
»Ja, das wohl. Aber er war uns auch sehr nützlich durch seine Navigationskenntnisse.«
»Wir schulden uns also gegenseitig etwas«, sagte Demelza.
»Ich habe mich kurz mit Morwenna unterhalten«, erzählte Ross. »Aber sie ist so schüchtern und wortkarg, dass ich nicht feststellen konnte, ob sie nun glücklich oder unglücklich ist.«
»Wieso unglücklich?«, fragte Pascoe. »Als jungverheiratete Frau?«
»Sie müssen wissen«, erklärte Ross, »Demelzas Bruder Drake und Morwenna waren vor ihrer Heirat ineinander verliebt. Drake hat die Sache noch immer nicht überwunden. Ich hätte deshalb gern gewusst, ob sie in dieser Ehe, von der Drake behauptet, dass sie sich heftig dagegen gewehrt hat, nun eigentlich glücklich ist.«
Als Demelza zu Bett gegangen war, fragte Ross: »Und wie laufen Ihre Geschäfte, Harris?«
»Danke, recht gut.«
»Ich bin jetzt übrigens zu einem Viertel an Ralph-Allen Daniells neuer Zinnschmelzhütte beteiligt.«
Nachdenklich blickte Pascoe in sein Glas, in dem der Portwein dunkel schimmerte. »Daniell ist ein gewiefter Geschäftsmann. Sicher war das eine gute Investition.«
»Er selbst besitzt nur geringe Kenntnisse des Bergbaus und hat mir deshalb nicht nur diesen Anteil, sondern auch ein Mitspracherecht bei der Leitung der Mine angeboten.«
»Sehr gut.«
»Außerdem macht er keine Geschäfte mit den Warleggans.«
Pascoe lachte. »Apropos Warleggan«, sagte er, »es sieht so aus, als ob ihre Bank und Basset, Rogers und Co. eine Art Abkommen getroffen haben. Es ist noch keine Fusion, eher eine freundschaftliche Zusammenarbeit, könnte sich aber für Pascoe, Tresize, Annery und Spry ungünstig auswirken.«
»In welcher Weise?«
»Nun ja, ihr Kapital ist nun fünf- oder sechsmal so hoch wie das unsere. Kleinere Banken haben es immer schwerer, und obwohl ich mich, wie Sie wissen, vor einigen Jahren mit drei Partnern zusammengetan habe, stehen wir nun wieder unter dem Schatten von Warleggan und Basset.«
»Und gibt es niemanden, mit dem Sie sich zusammentun könnten?«
»Nicht hier in der Gegend.« Pascoe stand auf. »Nun, ich hoffe, auch so wird alles gut weitergehen.«
Elizabeth saß vor ihrem Frisiertisch und kämmte sich das Haar. George, angetan mit einem langen grünen Morgenrock, saß beim Kamin.
»Ist dir aufgefallen«, sagte er, »dass Lord Falmouth vermieden hat, mit uns zu sprechen?«
»Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Und warum sollte er?«
»Er ist von Natur unfreundlich, aber mein Vater und ich können uns die Beine ausreißen, er lehnt uns ab.«
»Ich glaube, der Tod seiner Frau hat ihn hart getroffen.«
»Er braucht doch nur zu winken, dann werfen sich ihm hundert Mädchen an den Hals. Im Übrigen genügt es ihm nicht, über seine Ländereien am Fal zu herrschen, er möchte am liebsten auch Truro beherrschen. Und wehe, man steht ihm dabei im Weg.«
»Nun, im Grunde ist er der ungekrönte Herrscher von Truro, was seinen Einfluss und seinen Reichtum betrifft. Und das funktioniert doch ganz gut.«
»Da irrst du dich«, erwiderte George. »Die Stadt ist es gründlich satt, sich wie eine Leibeigene des reichen Lord Falmouth behandeln zu lassen. Dieser Wahlbezirk war zwar nie korrupt in dem Sinne, dass die Wahlberechtigten für ihre Stimme bezahlt wurden, aber sein Benehmen macht den Wahlausschuss zu einer Zielscheibe des Spottes. Der Ausschuss hat bisher immer bereitwillig die Boscawen-Kandidaten gewählt, da wir alle so ziemlich die gleiche politische Einstellung haben, aber die Wahlberechtigten sollten doch wenigstens das Gefühl haben, frei wählen zu dürfen.«
Elizabeth glaubte zu wissen, warum Lord Falmouth und die übrigen Boscawens die Warleggans nicht schätzten. Abgesehen von dem natürlichen Vorurteil, das die Boscawens als alte adlige Familie gegen die neureichen Warleggans haben mussten, lagen auch ihre Interessen zu sehr auf den gleichen Gebieten. Und der Einfluss der Warleggans nahm ständig zu.
»In der Stadt hat sich große Unzufriedenheit breitgemacht«, fuhr George fort. »Und es ist durchaus möglich, dass Sir Francis Basset zum Mittelpunkt dieser Gruppe der Unwilligen wird. Die Bassets und die Warleggans haben eine Menge gemeinsamer Interessen. In verschiedenen Angelegenheiten arbeiten sie sogar bereits zusammen. Basset vertritt Penryn im Parlament, und ich weiß, dass er auch an den Sitzen für Truro interessiert ist. Und ich habe den Eindruck, dass ich, falls unsere Freundschaft sich noch entwickelt, einer seiner Kandidaten sein könnte.«
»Du?«, sagte Elizabeth.
»Wieso nicht?«, erwiderte er scharf.
»Aber dieser Bezirk gehört den Boscawens. Hättest du denn überhaupt eine Chance?«
»Ich glaube doch. Hättest du denn etwas dagegen?«
»Nein, das nicht. Nur … Basset ist ein Whig!« Die Chynoweths – Elizabeths Familie – waren seit eh und je Torys gewesen.
»Mir gefällt das auch nicht«, sagte George. »Aber Basset hat sich von Fox distanziert.«
Elizabeth blies eine der Kerzen aus. Eine dünne Rauchsäule stieg zum Spiegel auf.
»Und wieso ist gerade jetzt davon die Rede? Vorläufig gibt’s doch keine Wahlen.«
»An sich nicht. Aber es ist möglich, dass es eine Nachwahl gibt. Sir Piers Arthur ist schwer krank.«
»Oh, das wusste ich nicht.« Elizabeth zog die Bettvorhänge zurück.
»Von diesen Dingen darf aber noch nichts an die Öffentlichkeit dringen.«
»Ich werde es für mich behalten.«
In einem anderen Teil der Stadt rollte sich Ossie Whitworth nach dem abendlichen Beischlaf mit seiner Frau zufrieden herum, zog sein Nachthemd herunter, rückte seine Nachtmütze zurecht und sagte: »Wenn ich mich entschließe, deine Schwester herzuholen, wann könnte sie kommen?«
Morwenna bemühte sich, den Ekel, der ihr in der Kehle aufgestiegen war, hinunterzuwürgen, und antwortete mit halb erstickter Stimme: »Da müsste ich Mama schreiben und sie fragen.«
»Damit das klar ist: Sie kann nicht einfach herumsitzen, sich satt essen und dir ein bisschen Gesellschaft leisten. Sie müsste sich um die Kinder kümmern, und auch um den Haushalt, wenn das Kind da ist.«
»Ich werde es Mama schreiben.«
»Wie alt ist sie? Du hast so viele Schwestern, dass ich mir das nicht merken kann.«
»Sie war im Juni vierzehn.«
»Ist sie gesund? Hat sie Hausarbeit gelernt?«
»Sie kann nähen und kochen und hat ein bisschen Griechisch gelernt.«
Nach kurzem Schweigen sagte Ossie nachdenklich: »Der Bräutigam sah noch ziemlich krank aus. Die Braut habe ich schon öfter bei der Jagd getroffen. Eine temperamentvolle Frau.«
»Sie hat sich an mich erinnert, obwohl wir uns erst zweimal gesehen haben.«
»Das erstaunt mich. Du hast eine unglückselige Neigung, um keinen Preis auffallen zu wollen. Denke immer daran: Du bist Mrs Osborne Whitworth und hast allen Grund, in dieser Stadt deinen Kopf hochzuhalten.«
»Ja …«
»Das Fest war recht amüsant. Nur waren einige reichlich altmodisch gekleidet – vor allem dieser Hauptmann Poldark – ich möchte wissen, aus welcher Mottenkiste sein Rock stammt.«
»Er ist aber ein sympathischer Mensch.«
Ossie räkelte sich behaglich und gähnte. »Seine Frau sieht noch immer sehr hübsch aus.«
»Sie ist ja auch noch jung. Elizabeth scheint ihre Schwägerin nicht besonders zu mögen.«
»Tja, Elizabeth …« Gähnend löschte Ossie die Kerze und zog die Vorhänge zu. »Sie spricht nie schlecht über jemanden. Aber ich glaube, du hast recht.«
»Wieso sind die Poldarks und die Warleggans eigentlich so verfeindet?«
»Viel weiß ich auch nicht darüber. Elizabeth Chynoweth war früher mit Ross Poldark verlobt, heiratete dann aber seinen Vetter Francis. Später kam Francis in der Mine ums Leben, und Ross wollte das Küchenmädchen, das er inzwischen geheiratet hatte, verlassen und hoffte, nun endlich Elizabeth zu bekommen. Aber Elizabeth heiratete George Warleggan, mit dem Ross schon seit seiner Schulzeit verfeindet war …«
Es war so dunkel, dass Morwenna das Gesicht ihres Mannes kaum erkennen konnte, aber aus Erfahrung wusste sie, dass er in wenigen Minuten einschlafen und dann für die nächsten acht Stunden wie ein Toter mit offenem Mund daliegen würde. Glücklicherweise schnarchte er nicht. Seit er Morwenna geheiratet hatte, ging es ihm glänzend. Seine sexuellen Gelüste waren gestillt; Körper und Geist entspannten sich, sein Atem wurde ruhiger.
»Und ich liebe Drake Carne«, sagte Morwenna, erst leise, dann lauter. »Ich liebe Drake Carne, ich liebe Drake Carne, ich liebe Drake Carne.« Sie lauschte, ob Ossie etwas antwortete. Aber er schlief fest.
In Killewarren saß Caroline, in einen langen grünen Morgenrock gehüllt, auf ihrem Bett; Dwight, in Reithosen und Seidenhemd, stocherte müßig im Feuer herum. Horace, Carolines Mops, war aus dem Schlafzimmer verbannt worden. Nachdem er in den ersten Monaten maßlos eifersüchtig auf Dwight gewesen war, war es Dwight mit großer Geduld gelungen, seine Zuneigung zu gewinnen, und schließlich hatte sich Horace damit abgefunden, dass es noch ein zweites Wesen gab, dem sein Frauchen ihre Aufmerksamkeit schenkte.
Seit Dwights Rückkehr aus dem Gefangenenlager von Quimper hatten sie hier in Killewarren zusammengelebt. Zwar hatten sie damit, rein äußerlich gesehen, die guten Sitten verletzt, in Wirklichkeit war ihr Verhältnis aber völlig geschwisterlich gewesen. Nicht aus moralischen Beweggründen, sondern aus rein gesundheitlichen – Dwights stark geschwächte Vitalität hätte mehr nicht verkraftet.
»Liebster …«, sagte Caroline. »Nun sind wir also endlich und endgültig beisammen, kirchlich vereint. Ich muss gestehen, es fällt mir schwer, einen Unterschied festzustellen.«
Dwight lachte. »Mir auch. Ich komme mir beinah wie ein Ehebrecher vor. Vielleicht liegt es daran, dass wir so lange gewartet haben.«
»Zu lange.«
»Ja, zu lange. Aber es war nicht zu ändern.« Er legte den Schürhaken weg, ging zu ihr hinüber, setzte sich neben sie auf das Bett und legte die Hand auf ihr Knie. Sie küsste ihn. Er strich ihr mit beiden Händen das Haar aus den Wangen.
»Vielleicht sollten wir noch warten, bis du dich ganz erholt hast«, sagte sie.
»Vielleicht haben wir bereits zu lange gewartet«, erwiderte er. Das Kaminfeuer flackerte, Schatten tanzten durch das Zimmer.
»Leider kann ich dir mit meinem Körper keine Überraschungen mehr bieten«, sagte sie. »Zumindest die obere Hälfte hast du ja schon in grellem Tageslicht sorgfältig untersucht. Ich bin nur froh, dass mir in der unteren nie etwas wehgetan hat.«
»Caroline, du redest zu viel.«
»Ich weiß. Das tue ich immer. Ein Charakterfehler … den du mitgeheiratet hast.«
»Ich muss mir überlegen, wie ich ihn aus der Welt schaffe.«
»Glaubst du denn, das ist möglich?«
»Ich denke schon.«
Sie küsste ihn abermals. »Dann versuch’s.«
3
Sam Carne war ein glücklicher Mensch. Nachdem sein Vater ihn vor einigen Jahren gedrängt hatte, an einer religiösen Versammlung der Methodisten teilzunehmen, hatte sich sein Leben vollkommen gewandelt. Seine Seele hatte das Joch der weltlichen Sünden abgeworfen und sich Christus zugewandt. Nachdem Sam seinen Heimatort Illuggan verlassen und Arbeit in der Mine seines Schwagers, Ross Poldark, angenommen hatte, hatte er hier, in und um Nampara, ein weites christliches Betätigungsfeld gefunden, hatte in weniger als zwei Jahren die zerstreute methodistische Gemeinde neu aufgebaut, und sie hatten nun in gemeinschaftlicher Arbeit am Rand des Poldark-Besitzes sogar ein neues Versammlungshaus errichten können, das Platz für fünfzig Menschen bot. Sam war in Truro gewesen und hatte dort die geistlichen Führer der Methodistensekte getroffen, die ihn nun offiziell mit der Leitung seiner kleinen Methodistengemeinde betraut hatten.
Alles hatte sich mit Gottes Hilfe wunderbar gefügt, und allabendlich sprach Sam in seinen Gebeten die inständige Bitte aus, Gott möge ihn davor bewahren, in die Sünde des Stolzes und der Eitelkeit zu verfallen. Möglich, dass seine Seele noch immer nicht frei war von sündhaften Gedanken und dass er deshalb das Kreuz tragen musste, das der Kummer, den er mit seinem jüngeren Bruder Drake hatte, für ihn bedeutete. Er war der einzige Schatten auf Sams Glück.
Drake, der noch keine zwanzig Jahre zählte, war zwar nie so leidenschaftlich gläubig gewesen wie Sam, hatte sich aber schon früher als sein Bruder der Kirche zugewandt. Die beiden Brüder hatten in christlicher Liebe und Einigkeit miteinander in Reath Cottage gewohnt, bis Drake sich in Morwenna Chynoweth verliebt hatte, ein Mädchen, das einer anderen sozialen Schicht angehörte als er und das auch aufgrund ihrer andersgearteten christlichen Erziehung – sie war die Tochter eines Geistlichen – nicht die richtige Frau für einen Methodisten gewesen wäre. Im Übrigen war Morwenna gegen ihren Willen von Mr Warleggan mit Osborne Whitworth, einem ehrgeizigen jungen Geistlichen in Truro, verheiratet worden.
Im Grunde war diese Entwicklung der Dinge das Beste für alle Beteiligten, doch Drake wollte das nicht einsehen. Und diejenigen, die geglaubt hatten, er würde seine erste Liebe spätestens nach einem Jahr vergessen haben und so fröhlich und unbekümmert sein wie zuvor, hatten sich geirrt. Zwar ließ er sich seinen Kummer nicht anmerken, arbeitete fleißig und hatte sich von der Verwundung, die er sich in Frankreich zugezogen hatte, wieder erholt. Aber Sam kannte seinen Bruder gut genug, um zu wissen, dass er sich innerlich stark gewandelt hatte. Und er kümmerte sich auch kaum noch um die Methodistengemeinschaft. Er kam nur noch selten zu den abendlichen Versammlungen, und häufig machte er, statt sonntags zur Kirche zu gehen, lange Wanderungen am Strand. Abends weigerte er sich, mit Sam zu beten.
Nach seiner Rückkehr aus Frankreich hatte Drake zunächst ein paar Wochen bei seiner Schwester und seinem Schwager in Nampara gelebt, war dann aber nach Reath Cottage zu Sam zurückgekommen. Im Januar ’96 änderten sich Drakes Lebensumstände erneut.
Er arbeitete noch immer in Nampara in der Bibliothek, die Ross umbauen ließ. Anfang Dezember ’95 bat Ross ihn, zu einem Gespräch ins Wohnzimmer zu kommen.
»Drake«, begann Ross, »ich weiß, dass du schon lange gern von hier fort möchtest. Du glaubst, du kannst dich, nach allem, was geschehen ist, hier nicht in Frieden niederlassen. Aber Demelza und ich können nicht mehr mit ansehen, wie du dein Leben damit verplemperst, vergangenen Dingen nachzuhängen. Und glücklicherweise hat sich für dich nun eine Möglichkeit ergeben, dir ein eigenes Geschäft aufzubauen.«
Er nahm die letzte Ausgabe des Sherborne & Yeovil Mercury & General Adviser vom Tisch und reichte sie dem jungen Mann. Die Zeitung war bei den Anzeigen aufgeschlagen, und eine war angekreuzt. Drake las:
»Am Mittwoch, dem 9. Dezember, findet im ›King’s Arms Inn‹, Chacewater, eine Auktion statt. Versteigert wird die Schmiede des sel. Thos. Jewell, Haus und Grundstück, Gemeinde von St. Ann’s.« Es folgte eine Aufzählung der einzelnen Räume, der Einrichtung und der Felder, die dazugehörten.
Als Drake die Anzeige gelesen hatte, blickte er auf. »Ich verstehe nicht …«
»Die Sache hat auch ein paar Nachteile«, sagte Ross. »Der Hauptnachteil ist, dass St. Ann’s nur knapp zehn Kilometer von hier entfernt ist. Du wärst also noch näher bei den Warleggans, wenn sie in Trenwith sind. Und zwei der vier Minen, die im Augenblick in diesem Bezirk in Betrieb sind, gehören den Warleggans. Aber Chacewater ist das wichtigste Dorf an diesem Teil der Küste, und für einen Mann, der hart arbeitet und sich etwas einfallen lässt, gibt es sicher viele Möglichkeiten.«
»Aber ich besitze nur zwei Pfund und zwei Shilling.«
»Wenn du einverstanden bist, möchte ich die Schmiede für dich kaufen. Bei unserer Expedition nach Frankreich wurdest du schwer verwundet, und obwohl du es bestreitest, bin ich noch immer der Meinung, dass du damals dein Leben aufs Spiel gesetzt hast, um meines zu retten. Und ich schulde nicht gern jemandem etwas.« Ross sprach absichtlich kühl und sachlich, um keine sentimentale Verlegenheit aufkommen zu lassen.
»Hat Demelza –«
»Demelza hat mit der Sache nichts zu tun, aber sie ist mit meinem Vorschlag natürlich einverstanden.«
»Ich … weiß nicht recht, was ich sagen soll.«
»Tja, entscheiden musst du natürlich selbst.«
»Wie meinen Sie das?«
»Immerhin bist du noch nicht mal zwanzig. Du warst noch nie dein eigener Herr. Vielleicht ist die Verantwortung zu groß für dich …«
Drake blickte aus dem Fenster. Aber in Wirklichkeit war sein Blick nach innen gerichtet. Er dachte an die langen Jahre, die er ohne das Mädchen verbringen musste, das er liebte. Aber er musste von etwas leben.
Und alleiniger Herr einer Schmiede zu sein bedeutete eine große Herausforderung für ihn. »Ich glaub nicht, dass ich damit nicht fertig werde, Hauptmann Poldark. Aber ich würde doch gern erst drüber nachdenken.«
»Tu das. Du hast eine Woche Zeit.«
Drake ging nach Hause und besprach die Angelegenheit mit Sam. Sam war der Meinung, es sei eine große Chance, die Gott ihm geschenkt habe. Schließlich fragte Drake, ob Sam nicht mitkommen und sein Partner werden wolle?
Sam lächelte und dankte Drake für diesen Vorschlag, aber er glaube, es sei seine Pflicht, hierzubleiben. Gerade hatte man ihn zum geistlichen Führer der Gemeinde ernannt, das neue Versammlungshaus war fast fertiggestellt; seine Arbeit begann endlich Früchte zu tragen – er konnte und wollte sie nicht im Stich lassen.
Die Schmiede lag in einem schmalen, tiefen Tal nahe bei dem Weg, der von Nampara und Trenwith nach St. Ann’s führte. Um das kleine Städtchen zu erreichen, musste man auf der einen Seite einen steilen Hügel hinunter- und auf der andern einen ebenso steilen wieder hinaufsteigen. Zweieinhalb Kilometer Moorland und einige steinige Felder lagen zwischen dem Städtchen und dem Meer, mitten darin eine der Warleggan-Minen, Wheal Spinster. Hinter der Schmiede stieg das Gelände nicht ganz so steil an, und dort lagen auch die Felder, die mit zum Verkauf angeboten waren. Zwischen der Schmiede und Warleggan-Land lagen Haus und Land von Sir John Trevaunance. Auf dem Hügel, der nach St. Ann’s führte, waren ein halbes Dutzend verfallener Hütten; etwas weiter entfernt konnte man noch den Kirchturm von St. Ann’s erkennen.
Demelza hatte darauf bestanden, Drake und Ross bei der Besichtigung des Besitzes zu begleiten, und sie zeigte dabei wesentlich mehr Eifer und Interesse als die beiden Männer. Für Ross war der Kauf nur die Begleichung einer moralischen Schuld; für Drake war es ein unwirklicher Traum.
Eine niedrige Mauer umgrenzte den schlammigen Hof, in dem rostige Pflüge und allerlei andere Gerätschaften herumstanden. An dem Hof lag auch die Schmiede mit der Esse, dem Amboss und einer Wasserpumpe. Hinter ihr lag das Haus. Es enthielt eine schmale Küche, ein winziges Wohnzimmer und oben unter dem Dach zwei Schlafzimmer.
Zwei Tage später ritten Ross und Drake nach Chacewater zum »King’s Arms Inn«. Etwa zwanzig Menschen waren bei der Auktion anwesend, und Ross erwarb die Schmiede schließlich für 232 Pfund. Sieben Wochen später verabschiedete Drake sich endgültig von Reath Cottage, umarmte und küsste seinen Bruder und stieg auf das Grubenpony, das er sich eigens für diesen Zweck ausgeliehen hatte. Er führte ein zweites Pony mit sich, das mit Lebensmitteln und Hausgeräten, die Demelza aus ihrem eigenen Haushalt abgezweigt hatte, beladen war. Einsame Tage lagen vor Drake. Eine Witwe, die in einer der Hütten wohnte, hatte versprochen, ihm von Zeit zu Zeit ein warmes Essen zu bereiten, und zwei ihrer Enkel sollten ihm, wenn die Feldarbeit überhandnahm, aushelfen. Auch Sam besuchte seinen Bruder in diesen ersten Monaten, so oft er konnte, und wenn das Wetter schlecht war, blieb er über Nacht dort.
An einem kalten Februarmorgen, als Sam wieder einmal in der Schmiede übernachtet hatte, brach er zeitiger auf als sonst, um in Grambler den kranken Jim Verney zu besuchen. Jim war in der Nacht gestorben, und in dem einzigen Bett lag neben der Leiche des Vaters der jüngste Sohn, der hohes Fieber hatte; zu seinen Füßen saß der älteste, noch schwach und blass, aber bereits auf dem Weg der Genesung. In einem Waschtrog, der neben dem Bett stand, lag der mittlere Sohn; auch er war tot. Es gab nichts zu essen, kein Feuer, niemanden, der half. Sam blieb eine halbe Stunde, um der jungen Witwe beizustehen, die ihren Mann für das Begräbnis wusch und zurechtmachte. Dann ging er zu Jud Paynters Hütte, um ihm zu sagen, dass es zwei Tote für das Armengrab gebe, und machte sich anschließend auf den Weg zu Dr Choake.
Dr Choakes Haus, Fernmore, lag nur einen guten Kilometer entfernt. Sam wusste zwar, dass Choake sich wenig um die Armen kümmerte, aber immerhin war Jim Verney Choakes Nachbar und das Elend der Familie so groß, dass Choake eine Ausnahme machen konnte.
Sam ging zur Hintertür des Hauses. Auf sein Klopfen öffnete ein hochgewachsenes, kräftiges Mädchen mit blitzenden Augen und einem unerschrockenen Blick. Ihr blasser Teint stand in reizvollem Gegensatz zu dem schwarzen, schimmernden Haar.
Das Mädchen musterte ihn gründlich von Kopf bis Fuß und bedeutete ihm dann, zu warten. Bald darauf kam sie zurück und sagte: »Dr Choake sagt, Sie sollen den Leuten dies bringen. Er kommt heute Vormittag noch rüber und schaut nach ihnen. Da.« Sie reichte Sam eine Flasche mit einer dicken grünen Flüssigkeit. »Das sollen sie einreiben. Brust und Rücken. Und sie sollen schon mal die zwei Shilling für den Arzt rauslegen. Und jetzt machen Sie, dass Sie weiterkommen.«
Sam bedankte sich und ging. Als die Tür nicht hinter ihm ins Schloss fiel, wusste er, dass sie ihm nachschaute. Während er den mit Steinfliesen belegten, vereisten Weg entlangging, rang er mit einem Impuls, der immer mächtiger in ihm wurde und schließlich die Oberhand gewann. Er kehrte um. Das Mädchen stand noch auf der Schwelle, die Arme verschränkt. Sam räusperte sich und sagte: »Schwester, haben Sie sich schon mal Gedanken über das Heil Ihrer Seele gemacht?«
»Was soll das heißen?«
»Bitte um Verzeihung«, sagte er, »Ihr Seelenheil liegt mir sehr am Herzen. Hat der Heiland noch nie zu Ihnen gesprochen?«
Sie biss sich auf die Lippen. »Du meine Güte! So was wie Sie hat mir grade noch gefehlt. Auf die Masche hat’s noch keiner bei mir probiert. Sie kommen wohl vom Jahrmarkt in Redruth, wie?«
»Ich wohne in Reath Cottage«, erwiderte er unbeirrt. »Drüben in Mellin. Ich hab dort zwei Jahre mit meinem Bruder zusammengelebt. Aber jetzt hat er –«
»Ach, dann gibt’s also noch so ’ne Type wie Sie! So was ist mir noch nicht vorgekommen.«
»Schwester, wir haben dreimal in der Woche in Reath Cottage Zusammenkünfte. Dann lesen wir das Evangelium. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch kämen. Wir würden miteinander beten.«
»Das darf doch nicht wahr sein!«, rief sie. »Bilden Sie sich im Ernst ein, dass ich mich mit Betbrüdern zusammensetze?«
»Schwester, ich will Ihnen doch nur –«
»Hau bloß ab, Mann! Solche Märchen kannst du andern Frauen erzählen!«
Sie trat ins Haus zurück und knallte die Tür zu. Sam starrte einen Augenblick lang die Tür an, dann zuckte er die Achseln und machte kehrt. Er ging zu den Verneys zurück, lieferte die Flasche ab und gab ihnen auch die zwei Shilling für Dr Choake.
Als er das erledigt hatte, warf er einen Blick auf die Sonne und eilte zur Mine. Sein Partner, Peter Hoskin, wartete bereits auf ihn. Sie kletterten zu der siebzig Klafter tiefen Sohle hinunter, in der sie zurzeit arbeiteten. Sam und Peter waren schon seit ihrer Kindheit miteinander befreundet; Peter stammte aus Poole, das nahe bei Sams Heimatdorf Illuggan lag. Den ganzen Vormittag über konnte Sam sich nicht von dem Gedanken an den trotzigen, temperamentvollen Blick des Mädchens losreißen, das ihm bei Dr Choake aufgemacht hatte. In den Augen Gottes waren alle Seelen gleich kostbar, aber für Sam, der nur wenige Seelen zum Heil führen konnte, gab es da doch Unterschiede. Und es schien ihm, als sei kaum eine Seele so wertvoll wie die ihre. Vielleicht war dieser Gedanke eine Sünde – er nahm sich vor, darüber mit Gott zu sprechen. Leider hatte das Mädchen ihn brüsk zurückgewiesen. Auch aus diesem Grund musste er beten.
In der Mittagspause krochen sie den Stollen entlang zu einer Höhle im Gestein, wo die Luft besser war. Sie zogen ihre Hemden an, nahmen die Bergmannshüte ab, suchten sich einen bequemen Platz und begannen bei flackerndem Kerzenlicht zu essen. Dabei erzählte Sam, dass er heute Morgen bei Dr Choake vorgesprochen habe, um Hilfe für die Verneys zu holen. Eine Dienerin habe ihm aufgemacht, fast so groß wie er selbst, ein hübsches Mädchen mit hellem Teint und schwarzem Haar und einem dreisten, flammenden Blick. Ob Peter wisse, wer das gewesen sei?
Peter, der ein Jahr früher als Sam in diesen Bezirk gekommen war, wusste es. Das sei bestimmt Emma Tregirls gewesen, die Schwester von Lobb Tregirls, der in der Zinnstampfmühle von Sawle arbeitete, die Tochter von Bartholomew Tregirls, dem ehemaligen Seemann, der sich inzwischen bei Sally Tregothnan eingenistet habe.
»Vor Emma nimmst du dich besser in Acht«, sagte Peter. »Das ist ’ne Nummer für sich. Die hat fast alle Jungs im Dorf am Bändel.«
»Sie ist nicht verheiratet?«
»Nein, und ich glaub, die heiratet auch nicht. Die hat schon ’ne ganze Menge Männer verschnabuliert, aber ’n Kind hat sie bis jetzt nicht gekriegt, das ist direkt ’n Wunder.«
Als sie sich wieder an die Arbeit machten, blieb Sam still. Er dachte über das nach, was Peter ihm erzählt hatte. Gottes Wege waren unerforschlich … es stand ihm nicht zu, das göttliche Wirken in Frage zu stellen. Er war nur ein Werkzeug Gottes, und sicher würde sich ihm noch offenbaren, was er zu tun hatte. Und hatte es nicht eine Maria Magdalena gegeben?
4
An einem sonnigen Februarnachmittag hielt die Postkutsche, die von Bodmin nach Truro unterwegs war, noch vor der Stadt an und ließ zwei junge Mädchen an einem Weg aussteigen, der zum Fluss hinabführte. Sie wurden von einer anmutigen, schüchternen Frau begrüßt, die von einem Diener begleitet war. Sie umarmte die beiden Mädchen überschwänglich, und sie gingen zusammen den steilen Weg zum Fluss hinunter; der Diener folgte ihnen mit dem Gepäck. Sie unterhielten sich lebhaft, und der Diener, der seine Herrin bisher nur zurückhaltend und still kannte, wunderte sich über ihre Lebhaftigkeit und ihr fröhliches Lachen.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.