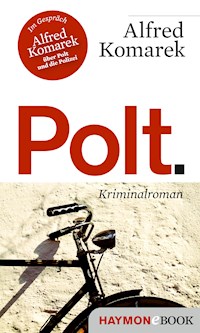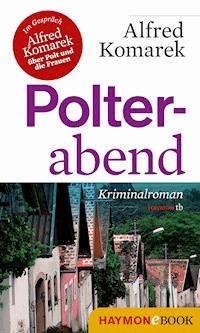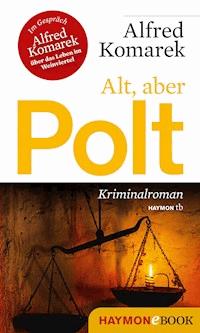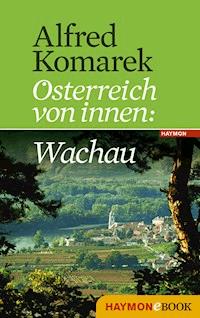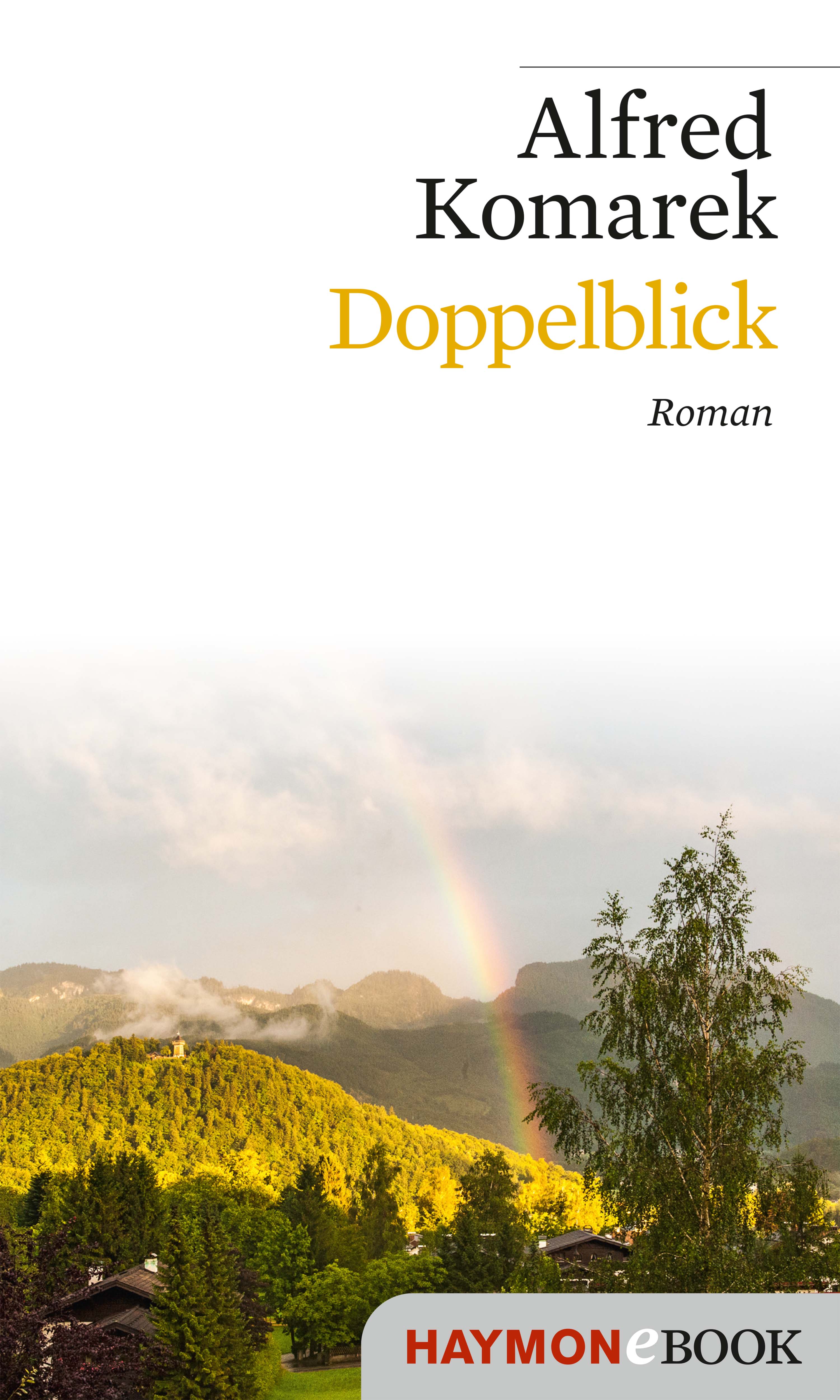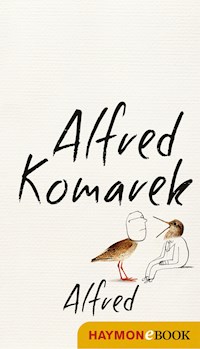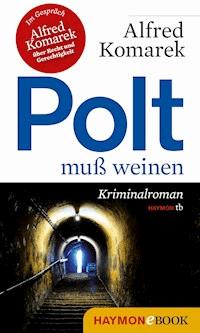
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Polt-Krimi
- Sprache: Deutsch
EIN TOTER WEINBAUER: WAR ES UNFALLTOD DURCH GÄRGAS, ODER VIELLEICHT DOCH MORD? Inspektor Simon Polt ermittelt. Das Wirkungsfeld des Gendarmerieinspektors Simon Polt ist ein niederösterreichisches Weinbauerndorf. Er gehört dazu. Umso unangenehmer ist es ihm, als Albert Hahn in seinem Weinkeller tot aufgefunden wird und sich der Verdacht aufdrängt, es könnte ein Mord gewesen sein, was zuerst wie ein Unfalltod durch Gärgas aussah. JETZT MUSS POLT ERMITTELN. Er, der fast jeden im Dorf seit Jahren persönlich kennt. Einer von ihnen könnte, ja muss es gewesen sein. Viele hatten einen Grund, das Scheusal umzubringen, dessen Tod niemand bedauert ... Alfred Komarek der Erfinder des Österreich-Krimis Alfred Komarek hat mit seinen Romanen, die ebenso Krimi wie Milieustudie sind, österreichische Krimigeschichte geschrieben. Alle fünf Fälle von Simon Polt wurden erfolgreich verfilmt, die Hauptrolle spielt Erwin Steinhauer. Besonders ist vor allem die einzigartige Ermittlerfigur Simon Polt. Mit Witz, Charme und Gemütlichkeit schreitet er unbeirrt zur Tat, wann immer es darum geht, ein Verbrechen aufzuklären. Exklusiv bietet diese Ausgabe ein Gespräch mit Alfred Komarek über Simon Polts Sinn für Recht und Gerechtigkeit. LESERSTIMME: "Ein Regionalkrimi für Kenner des Weinviertels und Weinliebhaber. Die detaillierte Beschreibung der Charaktere regt zum Schmunzeln an. Mit einem Hauch Ironie vermittelt der Autor den Charm der ländlichen Gegend und ihren Bewohnern. Sehr lesenswert!" ALFRED KOMAREKS POLT-KRIMIS: Polt muß weinen Blumen für Polt Himmel, Polt und Hölle Polterabend Polt Zwölf mal Polt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Komarek
Polt muß weinen
Kriminalroman
Inhalt
Titel
Die Leiche im Keller
Das Leben im Keller
Der Dienstweg und andere Wege
Er war ein schlechter Mensch, der Hahn
Hier unten hängt alles zusammen
Der Sturm im Weinglas
Erde zu Erde
Der Tag mit den Schmetterlingsflügeln
Unter Kennern
Inspektor Polt geht in die Knie
Hackls Erzählungen
In Höllenbauers Keller
Die Summe des Unbehagens
Der lange Schatten des Albert Hahn
Der Gendarm, das Dorf und die Schande
Bartls Nächte
Der heilige Martin und andere aufrechte Männer
Polt auf der Bettkante
Das Schlafzimmer im ersten Stock
Der Anfang vom Ende
Polt ist einsam
Polt geht zur Schule
Zu viele Mörder
Inspektor Polt muß weinen
Post für Polt
Simon Polt, Gendarmerieinspektor in Zivil
Alfred Komarek
Zum Autor
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Die Leiche im Keller
Albert Hahn lag da, als wolle er im Toten Meer den toten Mann spielen. Die Dunkelheit des unbeleuchteten Weinkellers trug sachte den schweren Körper, und nur die Wölbung eines sehr dicken Bauches ragte ins diffuse Licht, das von der Kellerstiege kam.
Gendarmerieinspektor Polt sah auf den ersten Blick, wer da unten lag. Das Tote Meer hingegen kannte er nur vom Hörensagen. In einer Illustrierten hatte er einmal ein Foto gesehen, das einen älteren Mann in schwarzer Badehose zeigte, der sich, auf dem Rücken liegend und offensichtlich schalkhaft aufgelegt, vom salzigen Wasser tragen ließ. Inspektor Polt lächelte unwillkürlich, als er sich an die Bildunterschrift erinnerte: Wahrscheinlich kann er auch mit den Ohren wackeln und andere Dinge, die Enkel erfreuen. Energisch wischte er sich die ungehörige Heiterkeit aus dem Gesicht, ließ die Stablampe aufleuchten und entzauberte die Szene. Plötzlich war der dicke Mann da unten einfach tot, schrecklich tot.
Dr. Eichhorn, der alte Gemeindearzt, war da, zwei Kellernachbarn standen stumm und hölzern neben ihm, und eine Dunstwinde blies surrend durch einen dicken Schlauch die angesaugte Kellerluft ins Freie.
„Gärgas?“ fragte der Inspektor.
Der Gemeindearzt hob ein wenig die kurzen Arme und drehte die fleischigen Handflächen nach oben, dann ließ er sie fallen. „In unserer Gegend der Vierte seit Mitte September“, sagte er verdrossen. „Leichtsinn, verdammter. Es gibt keine Unklarheiten. Habe den Totenschein schon ausgestellt.“ Der Arzt schaute ernst und irgendwie zornig zur Kellertür. „Diesmal hat es allerdings den Richtigen erwischt.“
Inspektor Polt hob den Kopf und warf dem Doktor einen verweisenden Blick zu. Er sagte aber nichts, weil er nur zu gut wußte, was gemeint war.
„Ich habe ihn gefunden“, erzählte der eine Kellernachbar ungefragt, ein langer, dürrer, faltiger Mensch, der irgendwann um die siebzig aufgehört hatte, noch älter zu werden. „Ich bin hinübergegangen, weil ich mich gewundert habe, was er so lange im Keller treibt. Er war ja sonst immer nur ein paar Minuten unten, hat ein paar Flaschen geholt und war auch schon wieder weg.“
„Und heute?“ fragte der Inspektor beiläufig.
Der Nachbar putzte umständlich die Gläser seiner klobigen Krankenkassenbrille. „Vielleicht zehn Minuten“, sagte er dann. „Ich habe erst noch zugewartet, weil ich nichts mit ihm zu tun haben wollte, du weißt ja, Simon.“
Simon Polt, der mit Friedrich Kurzbacher seit Ewigkeiten befreundet war, nickte wortlos.
„Dann bin ich in den Keller, ohne viel aufzupassen, weil ja keine Fässer unten liegen. Da habe ich schon das Gärgas gespürt, bin gerade noch heraufgekommen, bin zum Karl gerannt, mit angehaltener Luft sind wir beide noch einmal hinunter, haben den Albert ein Stück zum Ausgang geschleift und ihn dann liegen lassen, weil wir nicht mehr konnten. Dann habe ich den Dr. Eichhorn angerufen, aus der Telefonzelle im Dorf, und der Karl hat einstweilen seine Dunstwinde herübergebracht, damit man hinunter kann.“
„Ja“, fügte der Angesprochene trocken hinzu, „aber es war alles zu spät.“
„Und das Gärgas? Von einem Nachbarkeller?“ fragte Inspektor Polt.
„Ja, wahrscheinlich“, sagte Karl sachlich und schaute seinem Nachbarn ins Gesicht. „Von einem von uns.“
Der Gendarm, an die zwei Meter groß, doch ein wenig dicklich, als wäre es ihm nie gelungen, den Babyspeck loszuwerden, fühlte ein lästiges, fast schmerzhaftes Unbehagen in sich hochsteigen, obwohl er auch daran dachte, daß dieser Todesfall in Brunndorf, nein, in der ganzen Gegend, tiefe Befriedigung auslösen würde. Schweigend schaute er sich um. An sich mochte er Preßhäuser, und Weinkeller mochte er noch mehr: eine karge, archaische Arbeitswelt und gleichzeitig ein unverschämt sinnliches Männerparadies. Aber dieses Preßhaus war anders. Es roch nicht nach Most, es roch überhaupt nicht, nicht einmal nach Mäusen, was hätten sie hier auch zu suchen. Das Preßhaus war leer. Die alte Weinpresse hatte schon vor Jahren als Brennholz geendet, Bottiche und Arbeitsgerät waren verschwunden. Nur ein schmutziger, grellgelber Plastikstuhl leuchtete aus dem Halbdunkel. Inspektor Polt dachte daran, wie diesem Raum Gewalt angetan worden war, immer wieder, bis er als häßliche, sinnlose Hülle zurückblieb. Die beiden Weinbauern, die mit ausdruckslosen Gesichtern stumm und wie erstarrt dastanden, empfanden das wohl so ähnlich. In ihren eigenen Preßhäusern und Kellern fügten sie sich wie selbstverständlich ins Bild, die Füße waren vertraut mit den abgetretenen Ziegelböden, die Hände fanden sich auch im Dunkeln zurecht, alles hatte in vielen gemeinsamen Jahren seinen Platz gefunden und seinen Sinn behalten. In diesem Preßhaus hier gab es nichts Vernünftiges mehr zu tun, hier war der Wein nicht mehr zu Hause, nur ein paar gekaufte Flaschen lagen im Keller.
„Ich gehe jetzt“, sagte der Gemeindearzt in die unbehagliche Stille hinein.
„Den Totenschein habe ich ja“, antwortete der Inspektor, und der Arzt, schon halb in der Tür, nickte.
Dann machte sich wieder Schweigen breit. Alle wußten, daß sie hier nicht willkommen waren. Der Hahn, der jetzt als Leiche in seinem Keller lag, war meistens allein hier gewesen. Ganz selten brachte er irgendwelche Leute mit. Ja, und dann, letztes Jahr, an einem Samstagnachmittag, hatten zwei Buben aus dem Dorf Kirschen vom Baum vor dem Preßhaus gestohlen. Albert Hahn kam dazu, ein Bub konnte davonrennen, aber einer, der Peter Schachinger, war nicht schnell genug gewesen. Hahn dürfte ihn nicht geschlagen haben. Peter erzählte jedenfalls nichts davon, und sein Körper hatte auch keine Spuren gezeigt. Aber Hahn hatte den Buben ins Preßhaus gezerrt und in den Keller. Was dort geschehen war, blieb ungewiß. Aus dem kleinen Peter war nichts herauszukriegen. Er schwieg auf jede noch so geschickt gestellte Frage, seine hellgrauen Knopfaugen schauten hart und gläsern aus dem runden Gesicht, und die Hände waren zu Fäusten geballt. Seitdem hatte er immer wieder Albträume, fast jede Nacht, schreiend wachte er auf und fuhr erschrocken zurück, wenn ihn der Vater tröstend in den Arm nehmen wollte.
„Trinken wir was?“ fragte unvermutet der Kurzbacher.
„Aber …“, Simon Polt wies mit dem Kinn zur Kellerstiege.
„Dr. Eichhorn hat die Bestattung schon angerufen – mit so einem neuartigen Telefon“, beruhigte ihn der Kellernachbar in beiläufigem Tonfall.
„Na, dann prost“, sagte Simon Polt schon wieder heiteren Sinnes.
Das Leben im Keller
Kaum waren die drei Männer aus dem Halbdunkel des leeren Preßhauses in das goldgelbe Licht des späten Nachmittags getreten, fing sie das Leben ein, warm und fast körperlich spürbar. Es roch nach ausgepreßter Maische, die zur Zeit der Lese überall aufgehäuft lag, umtanzt von winzigen Mostfliegen. Bienen summten, von weit her klang das behäbige Tuckern eines Traktors, in das sich für ein paar Sekunden das zornige Dröhnen von Motorrädern mischte.
Friedrich Kurzbachers Preßhaus war nur ein paar Schritte entfernt. Ein mächtiger Nußbaum wurzelte dicht neben der Eingangstür, und die Schatten seiner Blätter bewegten sich spielerisch auf der weißgekalkten Mauer.
Simon Polt trat ein, als käme er nach Hause. Der Kurzbacher ging die paar Stufen zur Kellertür hinunter, öffnete sie und holte eine Doppelliterflasche hervor, die dahinter gestanden war. Er stellte die Flasche auf einen kleinen Tisch, säuberte drei Gläser im fließenden Wasser und griff zum Korkenzieher. Simon Polt fragte sich immer wieder, warum er dieses Geräusch so liebte: ein kurzes, scharf akzentuiertes Schmatzen, gefolgt von einem leisen „Plopp“, das irgendwie spöttisch klang, aber auch aufmunternd und auf eine etwas hinterhältige Weise vertraut. Friedrich Kurzbacher hob flüchtig den Stoppel zur Nase und stellte ihn dann mit achtloser Sorgfalt an den Rand des Tisches. Er füllte die drei Gläser, hielt seines ans Licht und sagte: „Rein ist er. Er spiegelt richtig, was, Simon?“
„Ja“, antwortete der Inspektor schlicht und dachte daran, daß er sich kaum eine schönere Farbe vorstellen konnte als die eines ordentlichen Grünen Veltliners. Da waren höchstens noch jene filigranen Goldplättchen, die in den Augen der jungen Dorflehrerin tanzten, wenn sie – selten genug – unbeschwert lachte und wohl auch auf eine für Simon Polt nicht nachvollziehbare Weise glücklich war. Der große, schwere Mann ertappte sich bei einem seltsamen Seufzer, einem, der erst einmal melancholisch zu Boden sank, dann aber die Flügel schlug und wie ein übermütiger Vogel den schrägen Strahlen der tiefstehenden Sonne folgte, bis er draußen im Licht verschwand. Der Inspektor strich mit der Hand über seine Augen, als wolle er Bilder wegwischen oder festhalten.
„Kopfweh?“ fragte der Friedrich nicht allzu mitfühlend.
„So etwas Ähnliches“, sagte Simon vage und hob das Glas.
Alle drei senkten kurz, aber andächtig die Nasen, freuten sich über den sauberen, fruchtigen Duft und nahmen den ersten Schluck. Karl und Friedrich schlürften erst nur ein wenig, ließen den Wein im Mund wandern und schluckten behaglich, um dann anerkennend zu nicken. Simon Polt aber leerte das Glas bis auf einen kleinen Rest. Eigentlich war ihm danach gewesen, das ganze Glas in einem Zug auszutrinken und dann ein zweites, und noch eins, bis die Welt endlich weichere Konturen hatte. Aber der Inspektor nahm sich zusammen, denn immerhin war er im Dienst. „Kellerfrisch ist eben kellerfrisch!“ sagte er höflich und aus tiefster Überzeugung. Die beiden anderen nickten und hatten dieser profunden Erkenntnis nichts hinzuzusetzen.
„Einmal muß ich dich ja doch fragen, Friedrich“, sagte der Inspektor nach einer kleinen Weile, „wie steht es mit eurem Prozeß?“ Und er wies mit einer kleinen Kopfbewegung auf das benachbarte Preßhaus.
Friedrich Kurzbacher nahm nun doch einen kräftigeren Schluck und sagte: „Jetzt ist wahrscheinlich alles anders.“ Dann schaute er zum Karl hinüber, mit dem er gut bekannt, aber nicht befreundet war. „Wir reden dann noch darüber, später.“
Eine Weile herrschte Schweigen. Alle drei spürten, daß ein ungebetener Gast in ihre Runde getreten war. Albert Hahn stand unsichtbar da, feist, mit weißlicher Haut. Man konnte meinen, seine Stimme zu hören, eine lächerlich hohe Stimme, die sich manchmal überschlug, in der aber Kälte und unendliche Bosheit lagen.
„Das wird die Bestattung sein“, sagte der Friedrich erleichtert, als er ein Auto näherkommen hörte. Die Männer stellten die Gläser auf den kleinen hölzernen Tisch, traten vor das Preßhaus und sahen auch schon den schwarz lackierten Kleinbus von Hannes Weinrich um die Ecke biegen. Der Bestatter lenkte das Auto, und neben ihm saßen dicht aneinandergedrängt zwei Helfer.
Wenn er nicht gerade angesichts einer Leiche pietätvolle Würde zur Schau trug, war Hannes Weinrich ein höchst unterhaltsamer Mensch, stets dazu aufgelegt, den Ernst des Lebens nicht allzu ernst zu nehmen. Es fing damit an, daß er seinen Beruf hauptsächlich deshalb ergriff, um seine spießigen Eltern zu ärgern, die schon alle Weichen für die Laufbahn eines höheren Beamten gestellt hatten. Er zog aufs Land, nach Burgheim, ein paar Kilometer von Brunndorf entfernt. Burgheim war eine jener kleinen Städte, die früher, als es noch rege Handelsbeziehungen mit Böhmen und Mähren gab, ganz gut leben konnten. Doch in den letzten Jahrzehnten waren dem immer grauer und stiller werdenden Städtchen die Einwohner nach und nach davongelaufen, und jene, die blieben, hatten viel Zeit und wenig Geld.
Bei Hannes Weinrich lagen die Dinge anders: Neben seinem Bestattungsunternehmen, das ebenso bescheidene wie verläßliche Gewinne abwarf, betrieb er eine Brennstoffhandlung. Es sei einfach nicht befriedigend, merkte er eines Tages dazu an, immer nur darauf zu warten, bis einer sterbe. Seinen vierzigsten Geburtstag hatte er in einem großen Festzelt neben der Friedhofsmauer gefeiert. Der Totengräber grillte, die Sargträger servierten, und die Blasmusik, nicht eben nüchtern, spielte dermaßen falsch, daß die Gäste einander erschrocken anschauten, wenn versehentlich ein sauberer Ton dazwischenrutschte.
Diesmal schaute der Bestatter ernst und gefaßt drein, wie es sich gehörte, grüßte knapp, aber freundlich, und fügte hinzu: „Liegt er noch unten, der Albert?“
„Ja“, sagte Simon einigermaßen dienstlich und versuchte nicht daran zu denken, wie er zusammen mit dem Hannes vor ein paar Monaten den Rekord im Kirchenwirt-Dauersitzen gebrochen hatte: Erst nach zweiundzwanzig durchwegs genußreichen Stunden waren sie – immer noch aufrecht – darangegangen, dem Alltag wieder ins Auge zu sehen.
„Na dann“, sagte der Bestatter und gab seinen Helfern, die inzwischen die Hecktür des Lieferwagens geöffnet hatten, mit einer müden Kopfbewegung zu verstehen, daß sie ihm folgen sollten. Es dauerte kaum zwei Minuten, dann verließ Albert Hahn, entseelt auf einer Bahre liegend, sein Preßhaus für immer. Hannes Weinrich ging auf den Inspektor und die zwei Kellernachbarn zu und sagte bedrückt: „Ich mag diesen Augenblick nicht, dieses Hineinschieben ins Fahrzeug. Es ist so schrecklich banal und dabei so verdammt endgültig. Wenn dann später im Friedhof alle heulen und die Erde auf den Sarg poltert, ist mir wieder leichter. Na ja, was soll’s. Simon, wir seh’n uns sicher noch.“
Er wandte sich zum Gehen, stieg mit seinen Begleitern ins Auto, und als das schwarze Fahrzeug hinter der ersten Biegung verschwunden war, kehrten die Zurückbleibenden mit zögernden Schritten zu ihren Weingläsern zurück.
Der Dienstweg und andere Wege
Simon Polt trank nur noch den kleinen Rest, der in seinem Glas geblieben war. Der Wein schmeckte nicht mehr ganz so kühl und frisch wie noch vor wenigen Minuten, doch der Inspektor genoß das leise Nachklingen dieses letzten kleinen Schluckes, das sich weich und elegisch an den Gaumen schmiegte. „Eigenartig ist es schon“, sagte er langsam. „Da gibt es eine ganze Menge Leute, die dem Albert Hahn zeitlebens alles mögliche heimzahlen wollten. Und jetzt ist er tot, und keiner hat auch nur einen Finger rühren müssen.“ Er schaute die beiden Weinbauern nachdenklich an.
„Ja, so geht’s manchmal eben her“, sagte der Karl, um irgend etwas zu sagen. Plötzlich hatte Simon Polt das Gefühl zu stören, und weil es im Augenblick ohnedies für ihn nichts mehr zu tun gab hier, schob er mit einer abschiednehmenden Geste das Weinglas von sich. „Schönen Tag noch“, sagte er, weil ihm nichts Besseres einfiel, wandte sich zum Gehen und lenkte wenig später den von der Sonne aufgeheizten Dienstwagen über schmale Fahrbahnen zwischen Weingärten und abgeernteten Feldern.
Er mochte dieses dicht gesponnene, für Fremde verwirrende Netz von Güterwegen, die erst seit einigen Jahren asphaltiert waren. Auf den Straßen fuhr man aneinander vorbei; kam einem aber auf dem Güterweg ein Fahrzeug entgegen, galt es, vorsichtig auszuweichen, blieb Zeit für das Erkennen eines vertrauten Gesichtes, für einen freundlichen Gruß oder ein paar beiläufige Sätze. Außerdem erwischte der Inspektor hier immer wieder besonders schlaue Trunkenbolde, die auf diesem Wege allfällige Verkehrskontrollen zu umfahren versuchten. Ganz abgesehen davon war die Landschaft dort, wo sie nicht von Mauern verstellt war, unmittelbar und intensiv zu erfahren, zum Greifen nahe: Hügelland, weich und wellig, Hebungen und Senkungen leichthin ineinander verwoben. In dieser Welt, sinnierte Simon Polt, hatte schroffe Willkür einfach keinen Platz, es sei denn, sie wurde von außen hineingetragen. Gerieten die Dinge aber einmal doch aus dem Gleichgewicht, geschah es, weil anfangs spielerisch bewegte Kräfte in Konflikt kamen oder zueinander fanden. Dann brach eben einer jener Stürme aus, die Polt fürchtete: schwer und bedrohlich in ihrer bedächtigen Leidenschaft.
Ob jemand weinen würde, bei Albert Hahns Begräbnis? Dessen Frau vielleicht, die ja aus irgendeinem Grund bei ihm geblieben war. Erstaunt stellte der Gendarm fest, daß er nicht einmal sagen hätte können, wie ihre Stimme klang, sie hatte ja kaum etwas geredet. Um Himmels willen …, wußte sie überhaupt schon, was passiert war? An der nächsten Wegkreuzung bog er Richtung Brunndorf ab und hielt Minuten später vor einem der häßlichsten Häuser des Dorfes. Albert Hahn hatte den alten, krummen Bauernhof, den er geerbt hatte, aufstocken und glatt verputzen lassen; eine nichtssagende Glastür mit eloxiertem Metallrahmen ersetzte das Hoftor, und aus den grauen Wänden glotzten neue, anmaßend große Fenster. Zwischen Plastik und Mauerwerk sah man noch den fest gewordenen Montageschaum hervorquellen wie dottergelbes Gedärm.
Der Inspektor klopfte an die Tür, hörte im gleichen Augenblick zorniges Gebell und wenig später Schritte. Frau Hahn öffnete mit einer Hand die Tür, mit der anderen hielt sie einen fetten, rotäugigen Wolfshundmischling am Halsband fest, der hechelnd die Zähne fletschte. Dann ließ sie den Hund los. „Geh“, sagte sie mit scharfer Stimme, und der Köter trottete gesenkten Kopfes und mit eingezogenem Schwanz in eine Ecke des Hofes. „Kommen Sie weiter in die Küche, Inspektor“, fuhr sie gleichmütig fort.
Simon Polt trat ein, roch den Duft von Rindsuppe, die in einem großen Topf auf dem Herd leicht vor sich hin kochte, und fühlte sich für einen Augenblick fast behaglich. Dann wurde ihm die Kehle eng. „Ihr Mann, liebe Frau Hahn“, begann er und drehte die Dienstmütze zwischen den großen Händen.
„Ist tot“, unterbrach ihn die blasse, aschblonde Frau. „Nachrichten verbreiten sich rasch auf dem Land, vor allem die guten.“
„Gut?“ entfuhr es dem Inspektor.
Frau Hahn richtete ihre grauen Augen auf ihn. „Für die meisten vermutlich schon.“
„Aber für Sie?“
„Ach was.“ Sie rückte mit einer unwilligen Bewegung einen geblümten Polster auf der Küchenbank zurecht. „Nehmen Sie Platz. Ich bin auch irgendwie erleichtert, wissen Sie?“ Im gleichen Augenblick schüttelte ein trockenes Schluchzen ihren Körper, und sie wandte sich ab, um Tränen aus dem Gesicht zu wischen.
Polt schwieg verlegen und betrachtete eingehend die Malerei auf der Küchenwand: blaßrote Bänder auf gelblichem Untergrund. Und da war Frau Hahn, nicht alt, nicht jung, in einem dieser kleingemusterten billigen Schürzenkleider, mager und unscheinbar. Sie schaute ihn jetzt wieder an. „Wollen Sie wissen, warum ich bei ihm geblieben bin?“ fragte sie, wieder ganz ruhig. Simon Polt nickte wortlos. „Er hat gesagt, er schlägt mir die Zähne ein, wenn ich gehe.“
Der Inspektor sagte noch immer nichts. Natürlich erinnerte er sich daran, daß ihm der Gemeindearzt öfter von eigenartigen Verletzungen erzählt hatte, von blauen Flecken und Blutergüssen. Einmal hatte er sogar offiziell Meldung gemacht, als Frau Hahn am ganzen Körper böse zugerichtet und mit einem gebrochenen Arm zu ihm gekommen war. Es sei im Vollrausch geschehen, gab sie damals an, irgendwann in der Nacht sei sie über die Treppe vom ersten Stock ins Vorzimmer gestürzt und erst wieder in den frühen Morgenstunden zu Bewußtsein gekommen.
„Er hat Sie geschlagen?“ fragte Polt ruhig.
„Immer, wenn ihm danach war“, gab sie mit gleichgültiger Stimme Antwort. „Und Sie haben sich nie gewehrt, nie Hilfe gesucht?“
„Mir fehlt die Kraft dazu, seit Jahren schon. Nicht einmal zum Haß hat es gereicht.“
„Und damals? Das mit der Treppe?“
Ein Lächeln lag für Sekunden auf ihrem Gesicht. „Es hat Streit gegeben im Schlafzimmer, das heißt, er hat mich beschimpft und später die Treppe hinuntergestoßen. Irgendwas war mit meinem rechten Arm passiert, denn ich konnte ihn kaum bewegen. Er hat den Arm ganz sanft genommen und ihn dann verdreht, bis es knirschte.“
„Und jetzt?“
„Kinder sind keine da. Ich werde wohl das Haus erben, das Auto und einiges Geld.“ Frau Hahn goß ein wenig kaltes Wasser in den großen Topf mit der künftigen Rindsuppe. „Irgendeine Rente wird man mir auch zusprechen, und so falle ich keinem zur Last. Gar nicht so übel, letzten Endes, was?“
Zu seinem Erstaunen hörte Polt ein kleines, boshaftes Gelächter. „Wie ist das eigentlich, wenn man so in Häuser kommt, als Überbringer von Todesnachrichten?“ fragte Frau Hahn und legte ohne Nachdruck ihre rechte Hand auf einen Unterarm des Inspektors. „Schön scheußlich?“
„Noch schlimmer.“
Polt stand auf und drückte sich die Dienstmütze aufs Haupt. „Wenn ich irgendwie helfen kann“, er war schon halb im Gehen.
„Schon gut.“ Fast klang ihre Stimme so, als wolle sie ihn trösten.
„Scheiße, verdammte Scheiße“, murmelte der Inspektor, als sich die Glastür hinter ihm geschlossen hatte.
„Hierher!“
Polt zuckte zusammen und blieb stehen, als er diesen energischen Befehl hörte. Mit leisen Schritten ging er zum Haus zurück, öffnete behutsam die Glastür und sah Frau Hahn, die wie in Trance mit einem Lederriemen auf den Hund eindrosch, der in gekrümmter Haltung dastand und winselte. Der Inspektor schloß vorsichtig die Tür, seufzte tief und zwängte sich in den Streifenwagen.
Diesmal nahm er die Bundesstraße und erreichte rasch den Ortsrand von Burgheim, wo die neuen Siedlungshäuser standen, getreue Spiegelbilder des meist erschütternden Stilempfindens ihrer Erbauer. Polts Dienststelle war in einem jener großen Häuser aus der Zeit um die Jahrhundertwende untergebracht, die den Hauptplatz umringten und wenigstens an der Fassade mit gründerzeitlichem Dekor Wohlstand und Bedeutung zur Schau stellten. Hier war auch eine Bank zu finden, das Büro des Notars, der zweimal in der Woche amtierte, und die Stadtbücherei.
Der Inspektor lächelte, als er den Dienstwagen auf seinen reservierten Platz stellte: Parkraum war so ziemlich das einzige, von dem es in dieser Gegend mehr als genug gab. Polt durchquerte den kleinen Vorraum mit dem häßlich glänzenden dunkelgrünen Schutzanstrich, und als er den Kollegen vom Journaldienst grüßte, antwortete dieser brummig, ohne den Kopf zu heben. „Der Albert Hahn ist also tot“, fügte er ohne Fragezeichen hinzu, und Polt sagte: „Ja. Gärgas.“ In einem der zwei Kanzleiräume suchte er seufzend nach einer freien Arbeitsfläche. Früher hatte er seinen eigenen Schreibtisch gehabt, ein fest umrissenes, persönliches Revier, in dem es für alles eine vertraute Ordnung gab und wo sich auch noch ein paar diskrete Laden fanden, für Dinge, die nicht jeden etwas angingen. Damit war es seit einiger Zeit vorbei: Irgendwelche Betriebsorganisationsfachleute hatten ihre Ansicht durchgesetzt, daß der vorhandene Raum effizienter genutzt werden konnte, wenn man Funktionsbereiche schuf, die von jedem je nach Bedarf in Anspruch genommen wurden. Daß der Mensch auch im Büro gerne weiß, wo sein Platz ist und wo er Wurzeln schlagen kann, wurde als unproduktive Sentimentalität abgetan. Nur der Sachbearbeiter und der Postenkommandant hatten noch eigene Schreibtische.
Umständlich machte sich Simon Polt daran, in der Angelegenheit Albert Hahn ein dienstliches Fernschreiben an das Bezirkskommissariat, die Bezirkshauptmannschaft, die Kriminalabteilung und die Sicherheitsinspektion zu verfassen. Mißvergnügt las er den Text durch, ärgerte sich wieder einmal über seine hölzernen Formulierungen. Als er diese ungeliebte Arbeit beendet hatte, war seine Dienstzeit längst vorüber. Er meldete sich ab und versuchte, wie sonst Freude am kleinen Spaziergang nach Hause zu haben.
Es war Abend geworden, noch lag eine Ahnung von Sonnenwärme in der Luft, doch auch der Herbst war schon zu spüren: frische, klare Kühle als Vorbote der grauen Nebelzeit. Die wenigen Straßen und Gassen der kleinen Stadt waren um diese Abendstunde fast menschenleer, und beim Kirchenwirt war bestimmt auch nicht viel los: Statt miteinander zu reden und zu trinken, saßen die Menschen stumm vor den Fernsehgeräten und ließen sich eine Welt aufschwatzen, die nicht die ihre war.
Simon Polt, nunmehr Privatmann, verspürte zunehmend weniger Lust, heimzugehen. Er war Junggeselle und niemand erwartete ihn, sah man von seinem präpotenten Kater namens Czernohorsky ab, der ihn nicht wirklich vermissen würde, solange es genug zu fressen gab – und dafür hatte bestimmt die alte Erna gesorgt, die Polts Haushalt vor jeder Verlotterung bewahrte. Der Gedanke an einen wohlgefüllten Futternapf verwob sich allmählich mit dem Bild eines gewaltigen Schweinsbratens, wie ihn Maria, die runde Frau des Kirchenwirtes, mit beiläufiger Meisterschaft zubereitete, und davor schob sich goldgelb, schaumgekrönt und kühl betaut ein großes, bauchiges Glas Bier.
Er war ein schlechter Mensch, der Hahn
„Oh, Herr Inspektor, meine amtsuntertänigste Verehrung!“ rief der Wirt, Franz Greisinger, auch kurz Franzgreis genannt, als er seinen neuen Gast bemerkte.
„Das Bier könnte längst dastehen“, entgegnete dieser und ging zielbewußten Schrittes in die Küche. „Weißt du, worauf ich Lust habe?“ fragte er dort Maria, die eben dampfende Knödel aus dem dampfenden Wasser hob. „Ich kann’s mir denken“, sagte die Wirtin trocken und schenkte ihm ein appetitanregendes Lächeln. Zufrieden kehrte Simon Polt in die Gaststube zurück und stellte sich an die Schank, wo schon sein Bier auf ihn wartete. Ohne Hast, doch auch ohne jede Verzögerung griff er zum Glas, hob es an den Mund und tat einen achtungsgebietenden Schluck. Franzgreis schätzte mit routiniertem Blick die Trinkgeschwindigkeit seines Gegenübers ab und griff schon einmal vorbeugend zum Zapfhahn. „Ein Hahn weniger auf dieser Welt, nicht wahr?“ bemerkte er so nebenbei.
„Lieber würde ich über etwas anderes reden“, sagte Simon Polt und nahm einen zweiten, diesmal schon etwas gemäßigteren Schluck. „Aber wenn wir schon dabei sind: Was sagen denn die Leute so?“
Franzgreis strich über seinen prächtigen Schnurrbart, der geradezu vor vitaler Borstigkeit strotzte. „Geht mich nichts an, als Wirt, weißt du? Aber was alle sagen, meine ich auch: ein viel zu schöner Tod für einen schlechten Menschen.“
Polt überlegte noch, was er darauf antworten solle, als Maria mit dem Schweinsbraten aus der Küche kam. „Mahlzeit, Simon“, sagte sie freundlich, stellte den Teller auf den Stammtisch und legte Messer und Gabel, die in eine rotkarierte Papierserviette gewickelt waren, daneben.
„Mahlzeit!“ war plötzlich von der anderen Seite der Gaststube aus zu hören. Polt, der schon Platz genommen hatte, blickte ein wenig unwillig auf und sah den alten Bruno Bartl, der offenbar eben erst aufgewacht war, das grindige Haupt hob und mit kleinen, geröteten Augen den Inspektor anschaute. Der sagte „Danke!“ und widmete sich rasch seiner Mahlzeit, um in kein Gespräch verwickelt zu werden.
Bruno Bartl war kein wirklich unangenehmer Mensch. Er war nur aus freien Stücken seit Jahrzehnten arbeitslos und hätte auch längst kein Dach mehr über dem Kopf, ließe ihn nicht ein Bauer, bei dem er selten genug und mit deutlichem Widerwillen aushalf, in einer Weingartenhütte schlafen. Die warme Jahreszeit über war das ganz angenehm für den Alten, doch im Winter, bei Minusgraden ohne jede Heizung … Offenbar hatte Bartl eine Strategie gegen das Erfrieren gefunden, wie er auch seinen exzessiven Alkoholkonsum ganz gut überlebte. Kleine Pannen gab es natürlich – wie damals etwa, als er bei einem Bauern um Heu bettelte, um die vielen gelben Kühe füttern zu können, die sich plötzlich gegen Mitternacht in seiner Hütte drängten. In den Tagen nach dem Monatsersten hatte er immer etwas Geld in der Tasche und konnte im Wirtshaus sitzen. Später war er auf die Kellergassen angewiesen, wo ihn die Bauern als Gast duldeten, weil er sich nie aufdrängte, nicht zu lange blieb und auch im ärgsten Rausch eine altmodisch gezierte Höflichkeit bewahrte.