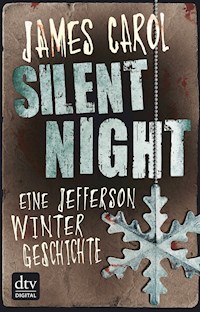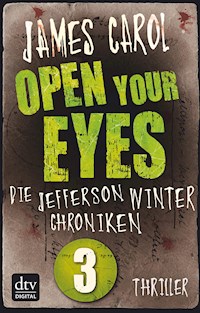4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jefferson-Winter-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Nur im eBook: die Anfänge von Jefferson Winter Die FBI-Profilerin Yoko Tanaka ist auf der Jagd nach einem Frauenmörder, der stets nach dem gleichen Modus vorgeht. Er schneidet seinen Opfern das Herz heraus und nimmt es mit ... Bei der Auswertung von Tatortaufnahmen fällt Tanaka immer wieder derselbe Mann unter den Schaulustigen auf. Es ist ein Collegestudent namens Jefferson Winter. Und wie sie herausfindet, ist sein Vater ein verurteilter Serienkiller. Wie der Vater, so der Sohn?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
James Carol
Presumed Guilty – Schuldig bis zum Beweis des Gegenteils
Thriller
Deutsch von Wolfram Ströle
Deutscher Taschenbuch Verlag
1
»Ich habe sie getötet.«
Special Agent Yoko Tanaka fuhr mit einem Ruck hoch und die Müdigkeit der vergangenen Tage war wie weggeblasen. Im ersten Moment glaubte sie, ihre Ohren hätten ihr einen Streich gespielt, aber das war nicht der Fall. Ein Missverständnis war ausgeschlossen.
Der Junge hatte soeben gestanden und dabei ganz bewusst in die Kamera in der Ecke des Verhörzimmers geblickt. Es waren seine ersten Worte, seit sie ihn vor fast sechs Stunden verhaftet hatten, und in Yokos Ohren klangen sie süßer als »Ich liebe dich«.
So unkooperativ, wie der Junge bisher gewesen war, hatte sie mit so etwas keineswegs gerechnet. Niemand hatte das. Innerlich frohlockte sie, aber nach außen zeigte sie es nicht.
Sie musterte den Jungen, der ihr am Tisch gegenüber saß. Nur sie beide waren in diesem Augenblick anwesend. Detective Charlie Dumas saß zwar auf dem Stuhl keinen halben Meter neben ihr, aber er hatte aufgehört zu existieren. Dasselbe galt für die hinter dem Einwegspiegel versammelten Kriminalbeamten.
Der Junge tat so, als ginge ihn das alles nichts an. Er hatte von Anfang an mit gesenktem Kopf dagesessen und auf seine Hände auf der Tischplatte gestarrt, der Gleichmut in Person wie ein Buddha, nur sehr viel dünner. Bei seinem Geständnis hatte er aufgeblickt, doch anschließend den Kopf sofort wieder gesenkt.
Yoko ließ sich davon nicht täuschen. Der Junge hatte sich so hingesetzt, dass er sie und Dumas aus den Augenwinkeln beobachten konnte. Das restliche Zimmer sah er im Einwegspiegel. Es wirkte vielleicht, als sei er in Gedanken anderswo, aber Yoko hätte ihr gesamtes Erspartes darauf verwettet, dass seiner Aufmerksamkeit nicht das kleinste Detail entging.
Nicht dass im Verhörzimmer viel zu sehen gewesen wäre. Nüchterne graue Wände, eine Neonröhre, die jede halbe Minute flackerte, ein Holztisch und drei rote Stühle mit Kunststofflehnen.
Und natürlich der Spiegel.
Das Zimmer sah ganz genauso aus wie alle anderen Verhörzimmer, in denen Yoko schon gesessen hatte, und das waren während ihrer achtzehn Jahre beim FBI eine ganze Menge gewesen. Diese Zimmer existierten gleichsam außerhalb von Raum und Zeit. Bundesstaat, Jahreszeit und Tag- oder Nachtzeit ließen sich an ihnen nicht ablesen.
Doch Yoko lebte fest im Hier und Jetzt, und ihr gegenwärtiges »Hier und Jetzt« war das Verhörzimmer Nr. 1 des Sheriff’s Department von Prince George’s County in Upper Marlboro, Maryland. Es war Hochsommer und kurz nach vier Uhr nachmittags.
Dumas hatte sie zu dem Fall hinzugezogen. Die lokalen Ermittlungsbehörden waren bei Serientätern oft überfordert. Ihr einschlägiges Wissen speiste sich aus dem, was die Ermittler im Fernsehen oder Kino gesehen oder in Krimis gelesen hatten, und das mochte unterhaltsam sein, war manchmal aber auch schlichtweg falsch.
Hier kam die Abteilung für Verhaltensanalyse des FBI ins Spiel. Wenn ein Serientäter zuschlug, konnten die örtlichen Behörden um Hilfe nachsuchen, und wenn das FBI Mitarbeiter freistellen konnte, half es gern.
Das Problem war das »wenn«. Denn natürlich gab es viel zu viele Verbrecher und nicht genug Profiler. Auf jeden Fall, bei dem das FBI helfen konnte, kam eine Vielzahl von Fällen, bei denen das aufgrund von Personalmangel nicht möglich war.
Yokos Chef sprach von der Serienkiller-Lotterie, ein Begriff, der das Problem für Yoko ziemlich gut traf. Im vorliegenden Fall hatte Dumas Glück gehabt und die Lostrommel hatte seine Nummer ausgespuckt.
Yoko betrachtete den Jungen eingehend. Sie hatte ihn nicht aus den Augen gelassen, seit sie ihn in seinem Zimmer im Studentenwohnheim zum ersten Mal richtig gesehen hatte. Er sah so verdammt normal aus. Das war ihr als Erstes aufgefallen und machte ihr mit am meisten zu schaffen.
Dabei hätte es sie nicht überraschen dürfen. Die meisten Killer sahen normal aus, harmlos wie Lehrer an der Sonntagsschule, was einige auch tatsächlich waren. Sich wie ein Chamäleon an die Umgebung anzupassen, war ein wichtiges Charakteristikum des perfekt organisierten Serienmörders.
Trotzdem war Yoko überrascht, was ihr inzwischen nur noch selten passierte. Denn sie hatte in ihrer Zeit bei der Abteilung so ziemlich jeden Albtraum diesseits der Hölle erlebt und noch einige mehr und war zu dem Schluss gelangt, dass Gott entweder nicht existierte oder aber aufgegeben hatte. Sie wollte an ihn glauben, brauchte einen Glauben, aber es war verdammt schwer, wenn man die meiste Zeit des Lebens mit den scheußlichsten Auswüchsen der menschlichen Psyche zu tun hatte.
Der Junge war durchschnittlich groß, von durchschnittlicher Statur, überhaupt in so vieler Hinsicht durchschnittlich, dass er schon wieder auffiel. Als hätte er es mit der Anpassung ein wenig übertrieben.
Seine ungekämmten schwarzen Haare waren ziemlich lang, er trug ein Jimi-Hendrix-T-Shirt und gerade geschnittene Jeans, wie sie derzeit alle Jugendlichen unter zwanzig zu tragen schienen, auch seine Converse-Sneakers gab es in einer Auflage in Millionenhöhe. Das einzig Auffällige an ihm waren die Augen, leuchtend grüne Augen mit von goldgelben Sprenkeln umrahmten Pupillen.
Yoko hatte diese Augen schon einmal gesehen, sogar an einem ähnlichen Ort, einem Verhörzimmer in Behördengrau mit einem am Boden verschraubten Tisch und Schalenstühlen aus Kunststoff. Die Stühle waren schwarz gewesen statt rot und der Spiegel hatte gefehlt, ansonsten gab es keine Unterschiede.
Sie hatte damals das Gefängnis San Quentin in Kalifornien besucht und die Augen hatten einem Mann gehört, der als einer der berüchtigtsten Serienmörder Amerikas galt.
Wie der Vater, so der Sohn.
Genau genommen unterschied sich der Junge auch durch das Hendrix-T-Shirt von gleichaltrigen Jugendlichen. Die meisten Jugendlichen hätten einen Musiker gewählt, der gerade angesagt war, und nicht eine tote Gitarrenlegende.
Yoko kannte das Foto, ein Klassiker des »Summer of Love«. Hendrix’ Schatten fiel über einen ramponierten Marshall-Verstärker im Hintergrund, ein denkwürdiges Bild, das Chaos und Schönheit verband, zwei hervorstechende Eigenschaften seiner Musik.
Sie hatte vor einer Ewigkeit genau dieses Bild in ihrem Studentenzimmer hängen gehabt. Sosehr sie das, was dieser Jugendliche getan hatte, verabscheute, seinen Geschmack in Rockmusik konnte sie nicht beanstanden.
Nach außen entsprach er in jeder Hinsicht dem Bild des neunzehnjährigen Collegestudenten. Er war weder extrovertiert noch introvertiert, sondern die genaue Mitte dazwischen und fiel deshalb nirgends auf, ohne dass er sich versteckt hätte.
Er trank und feierte gern, aber nicht zu sehr und erst recht nicht so exzessiv, dass er die Kontrolle über sich verloren hätte. Niemand, den sie befragt hatten, konnte sich daran erinnern, ihn je betrunken gesehen zu haben.
Dasselbe galt für sein Liebesleben. Alles war, wie man es erwarten konnte. Er hatte einige Beziehungen gehabt, die aber nie länger als einen Monat gedauert hatten, was wiederum für einen Collegestudenten ganz normal war. Warum sich an einen Stern binden, wenn es eine ganze Galaxie zu erkunden gab? Yokos Collegezeit mochte einige Zeit zurückliegen, aber manche Dinge änderten sich nicht.
Er war nie in einen Skandal verwickelt gewesen, was zu seinem Profil passte. Sich wie ein Chamäleon anpassen, kein Aufsehen erregen.
Äußerlich mochte er also dem Bild des durchschnittlichen Collegestudenten entsprechen, aber dieser Eindruck änderte sich radikal, sobald man sich mit seinem Verstand beschäftigte. Hier war nichts mehr normal. Die Universität von Maryland zog immer wieder besonders gute und intelligente Studenten an, aber dieser Junge spielte in einer eigenen Liga.
Er studierte gleich zwei Hauptfächer, Kriminalpsychologie und Musik. Und er war in beiden ein Ass und seinen Mitstudenten um Meilen voraus.
Es war schwer zu beurteilen, wie intelligent er wirklich war, aber einige Lehrer nahmen ihm ganz offensichtlich übel, dass sie neben ihm nicht besonders helle wirkten – und dass er sie das spüren ließ.
Yoko nahm vage eine Bewegung neben sich wahr. Dumas schob ein Formular über den verschrammten Tisch, eine Verzichtserklärung auf das Recht der Aussageverweigerung. Auffordernd sah er den Jungen an. Er würde keine Unterschrift bekommen.
Dumas war in New York geboren und aufgewachsen, ein forscher, lauter Mann, dem schnell einmal die Sicherung durchbrannte. Er trug die graumelierten Haare militärisch kurz geschnitten und hatte ein Alter erreicht, in dem die Muskeln erschlafften, was ihn aber nicht groß zu stören schien.
Er war der oberste Kriminalbeamte von Prince George’s County und konnte auf zwanzig Jahre Erfahrung zurückblicken. Trotzdem war er mit diesem Fall völlig überfordert und dasselbe galt auch für seine Mitarbeiter im Sheriff’s Department.
Dumas hatte den Jungen bei seiner Verhaftung in Gegenwart von Yoko über seine Rechte belehrt, dabei übertrieben deutlich gesprochen und jede Silbe artikuliert, als sei er der Hauptdarsteller in einem Shakespeare-Drama. Er hatte sich streng an die Vorschriften gehalten. Auf keinen Fall würde dieser Fall wegen einer Regelwidrigkeit vor Gericht scheitern.
Nach Dumas’ Ansprache hatte der Junge ihm ins Gesicht gesehen und gegrinst. Das Grinsen war nicht echt gewesen, der Junge hatte Dumas nur ganz unverfroren provozieren wollen. Beinahe wäre es ihm auch gelungen.
Der Moment verging und der Junge wurde abgeführt, in einen Ford Crown Victoria verfrachtet und zum Büro des Sheriffs gefahren.
Dort hatten sie fünf Stunden lang in diesem Verhörzimmer gesessen, ohne dass er ein einziges Wort gesagt hätte. Dumas hatte alles versucht, das musste Yoko ihm lassen. Er hatte sein Bestes gegeben.
Und jetzt das. Ein Geständnis aus heiterem Himmel. Sie wollte sich nicht zu früh freuen, aber es bestand definitiv die Möglichkeit, dass sie schon heute Abend wieder in ihrem eigenen Bett schlafen würde statt in einem schäbigen Motelzimmer.
Sie starrte ihn über den Tisch hinweg an und sagte: »Sie wurden über Ihre Rechte belehrt und haben aus irgendeinem Grund entschieden, dass Sie keinen Anwalt brauchen. Dass Sie die Verzichtserklärung offenbar nicht unterschreiben wollen, ist ohne Belang. Bei Ihrer Verhaftung waren ein halbes Dutzend Polizisten anwesend, die jederzeit unter Eid bezeugen können, dass Detective Dumas Sie mustergültig über Ihre Rechte belehrt hat.«
Yoko machte eine Pause, um ihre Worte wirken zu lassen, dann fügte sie hinzu: »Auch ich selbst wäre jederzeit bereit, unter Eid auszusagen, dass Sie vorschriftsmäßig belehrt wurden und dass Sie außerdem Sinn und Zweck und die Folgen dieser Belehrung in jeder Beziehung verstanden haben.«
Der Junge grinste jetzt auch sie an. Es war die erste Reaktion seit seiner Verhaftung, der erste Hinweis darauf, dass er ihre Existenz überhaupt zur Kenntnis nahm. Vier Worte und zwei Gesichtsausdrücke in sechs Stunden. Yoko war fast schon beeindruckt. Aber nur fast.
Bis eben hatte sie noch kein Wort gesagt. Sie hatte auch durch nichts zu erkennen gegeben, was sie dachte und empfand. Was das gegenseitige Kräftemessen anging, hatte der Junge zwar Talent, musste aber noch viel lernen.
»Gut.« Sie nickte. »Sie sehen den Spiegel und das rote Licht der Kamera. Sie wissen, dass unser Gespräch aufgezeichnet wird. Sagen Sie jetzt bitte für unsere Zuschauer zu Hause und hinter der Einwegscheibe, wie Sie heißen.«
Das Grinsen wurde zu einem Lächeln. Die Augen des Jungen funkelten, als hätte er sich selten so gut amüsiert.
»Mein Name ist Jefferson Winter.«
2
Winter sah Yoko über den Tisch hinweg an und sagte: »Valentino. Sie hätten sich wirklich was Besseres einfallen lassen können.«
»Mir gefällt der Name. Er passt.«
»Warum? Weil ich meinen Opfern das Herz stehle?« Er schüttelte den Kopf und schnaubte. »Das zeigt, dass Sie überhaupt keine Fantasie haben.«
»Und das ärgert Sie, Jefferson?«
»Natürlich nicht. Dafür müsste mich erst mal interessieren, was Leute wie Sie denken.«
Dumas wollte etwas sagen, aber Yoko brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen. Das war jetzt ihre Show.
»Ich weiß, es ist umstritten, aber mein Lieblingsalbum von Hendrix war immer The Cry of Love.«
Winter sah sie ungläubig an. »Von welchem Planeten kommen Sie denn? Er war tot, als das rauskam. Es wäre vielleicht sein bestes geworden, wenn er noch gelebt hätte, aber das hat er nicht, und schon deshalb kann es nicht sein Bestes sein. Niemand hat die geringste Ahnung, wie es klingen sollte.«
»Aber immerhin ist er das, der Gitarre spielt und singt. Das macht das Album für mich genauso authentisch wie die anderen drei.«
Winter schüttelte den Kopf und runzelte die Stirn. »Auf keinen Fall. Vielleicht wollte er ja wieder ein Doppelalbum wie Electric Ladyland machen. Oder sogar ein Dreifachalbum, und er hatte einfach noch nicht alle Songs fertig geschrieben. Vielleicht hätte er auch alles wieder gelöscht und von vorne angefangen. Entscheidend ist, dass wir es nie wissen werden.«
Noch ein Kopfschütteln und Stirnrunzeln. »Nein, sein bestes Album ist unbedingt Axis: Bold As Love. Little Wing, Castles Made of Sand und Spanish Castle Magic, das sind geniale Songs. Besser geht’s nicht.«
»Was soll das, verdammt noch mal?«, warf Dumas dazwischen.
Yoko sah ihn an. »Detective Dumas, wären Sie bitte so nett, uns einen Augenblick allein zu lassen.«
Der Detective öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, und Yoko hob die Augenbrauen.
Winter lächelte. »Was soll das werden? Guter Cop, dummer Cop?«
Dumas’ Gesicht rötete sich. Zwar hatte er noch nicht die Fäuste geballt, es fehlte aber nicht mehr viel. Bei der nächsten Provokation würde er über Winter herfallen.
»Nur ein paar Minuten«, sagte Yoko.
Dumas starrte Winter noch einen Augenblick lang an, dann stand er auf, marschierte aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
»Hab ich was Falsches gesagt?«, fragte Winter.
Yoko antwortete nicht. Sie griff nach ihren Zigaretten und dem Feuerzeug. Das Feuerzeug war viel benutzt und verschrammt und das Messing war im Lauf der Jahre angelaufen. Yoko wies mit einem Nicken auf das Päckchen, aber Winter schüttelte den Kopf.
»Nein danke. Diese Dinger sind tödlich.«
»Die Giftspritze auch, Jefferson.«
»War das witzig gemeint?«
»Ich fand’s lustig.« Sie zündete sich eine Zigarette an und blies eine Rauchwolke aus. »Aber ich kann verstehen, dass Sie das anders sehen. Wenn ich die Aussicht hätte, die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre in der Todeszelle zu verbringen, fände ich es auch nicht lustig.« Und sie fügte hinzu: »Das kam übrigens im letzten Bericht über mich zur Sprache.«
»Was? Dass Sie einen seltsamen Sinn für Humor haben?«
»Nein, dass es mir an sozialer Kompetenz mangelt.«
»Mir scheint, Sie machen das ziemlich gut. Der Kommentar zu Hendrix war doch ein guter Einfall. Man sucht nach Gemeinsamkeiten mit dem Verhörten, um ihn auf die eigene Seite zu ziehen. Und mir zu widersprechen war auch geschickt. Ich hasse Jasager.«
»Das kann ich nachvollziehen.«
Winter lachte. »Sehen Sie, mit Ihrer sozialen Kompetenz ist alles in Ordnung. Dass ich Jasager hasse, heißt ja noch nicht, dass man nie einer Meinung sein darf.«
Yoko nahm einen tiefen Zug. »Ich bin Ihrem Vater ein paarmal begegnet.«
Im Zimmer wurde es still.
»Ich habe keinen Vater.«
»Oh doch, Jefferson. Er heißt Albert Winter, oder Al, wie er von seinen vielen Freunden genannt wurde. Oder sind das jetzt nicht mehr seine Freunde? Als überführter Serienmörder braucht man vermutlich nicht mehr so viele Weihnachtskarten zu schreiben, was meinen Sie?«
Sie sah Winter an. Er erwiderte ihren Blick unverwandt.
»Ihr Vater hat in zwölf Jahren fünfzehn junge Frauen ermordet. Er hat sie nachts in den Wald gebracht und dann gejagt wie Tiere. Er wurde 1991 gefasst und verbringt die ihm noch verbleibenden Jahre gegenwärtig in einer Zelle im Todestrakt von San Quentin. Bei seiner Verhaftung waren Sie elf.«
»Ich habe keinen Vater«, wiederholte Winter.
»Auch wenn Sie es noch so oft sagen, davon wird es nicht wahr.«
Wieder kehrte ein unbehagliches Schweigen im Zimmer ein. Yoko rauchte und musterte den Jungen. Der Junge erwiderte den Blick genauso ungeniert.
Yoko hatte schon mit vielen bestialischen Mördern zu tun gehabt, aber dieser Jefferson Winter gehörte in eine andere Kategorie. Sie begriff immer noch nicht, wie er so gefasst und selbstsicher sein konnte.
Eine solche Selbstsicherheit kannte sie sonst nur von wirklich hartgesottenen Kriminellen. Den Lebenslänglichen, die den größten Teil ihres traurigen Lebens in verschiedenen Gefängniszellen zugebracht hatten. Wobei sie allerdings viele Jahre Zeit gehabt hatten, sich ein dickes Fell zuzulegen, während dieser Junge erst neunzehn war.
Sie drückte ihre Zigarette aus. »Sie sind ein Fan der Doors.«
»Wegen des Posters in meinem Zimmer?«
»Ich werde dafür bezahlt, dass ich so etwas sehe.«
»Was haben Sie sonst noch gesehen?«
»Sie mögen die Beatles, sind aber vor allem ein Fan von John Lennon.«
Winter neigte kaum merklich den Kopf, eine Aufforderung, fortzufahren.
»Lennon, Hendrix und Morrison sind alle tot.«
»Elvis auch.«