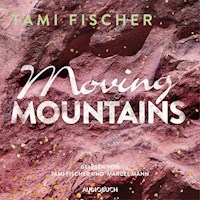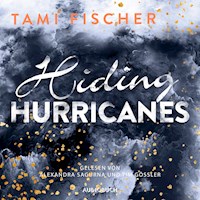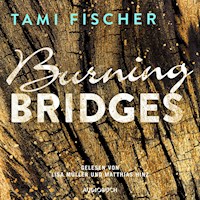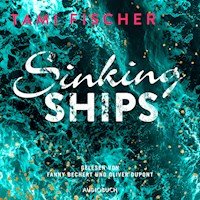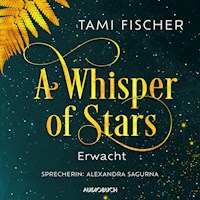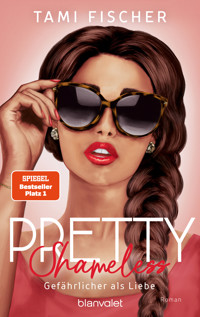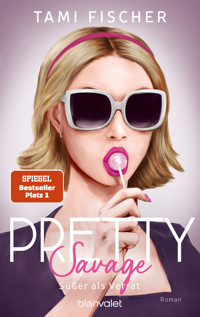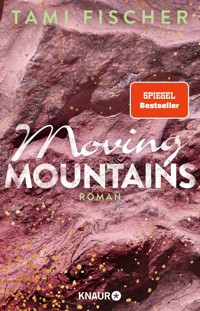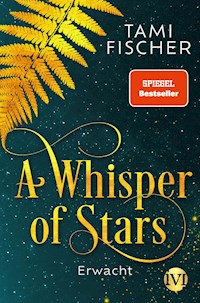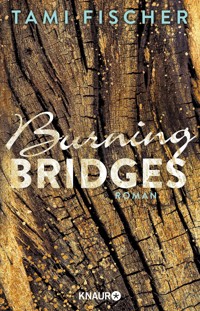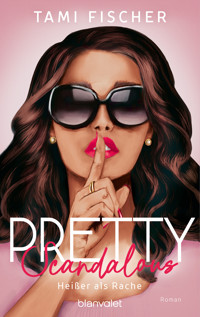
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manhattan Elite
- Sprache: Deutsch
Nichts ist heißer als Rache – außer vielleicht der reichste Bad Boy Manhattans …
Sarahs Welt bricht zusammen, als ihre Zwillingsschwester nach einem Jahr Funkstille verängstigt und mit blauen Flecken übersät wieder auftaucht. Payton wollte sich an der Columbia University in New York ihren Traum vom Architekturstudium erfüllen, doch ausgerechnet ihre elitären neuen Freunde haben sie zugrunde gerichtet. Wutentbrannt beschließt Sarah, sich als Payton auszugeben, um den verwöhnten High-Society-Zöglingen das Handwerk zu legen. Doch in New York angekommen, häufen sich die Skandale und Geheimnisse. Und dann stolpert Sarah auch noch dem attraktiven Monroe in die Arme – und dessen Lächeln könnte weitaus mehr gefährden als nur ihre Rachepläne …
Mit Playlist im Buch!
Nie war der Enemies-to-Lovers-Trope skandalöser – Die Manhattan-Elite-Reihe bei Blanvalet:
Band 1: Pretty Scandalous – Heißer als Rache
Band 2: Pretty Savage – Süßer als Verrat
Band 3: Pretty Shameless – Gefährlicher als Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Sarahs Welt bricht zusammen, als ihre Zwillingsschwester nach einem Jahr Funkstille verängstigt und mit blauen Flecken übersäht wieder auftaucht. Payton wollte sich an der Columbia University in New York ihren Traum vom Architekturstudium erfüllen, doch ausgerechnet ihre elitären neuen Freunde haben sie zugrunde gerichtet. Wutentbrannt beschließt Sarah, sich als Payton auszugeben, um den verwöhnten High-Society-Zöglingen das Handwerk zu legen. Doch in New York angekommen, häufen sich die Skandale und Geheimnisse. Und dann stolpert Sarah auch noch dem attraktiven Monroe in die Arme – und dessen Lächeln könnte weitaus mehr gefährden als nur ihre Rachepläne …
Autorin
Tami Fischer wurde 1996 geboren und lebt zusammen mit ihrer Familie und zwei faulen (aber niedlichen) Katzen in Hessen. Die gelernte Buchhändlerin ist Autorin von mehreren SPIEGEL-Bestsellerromanen, arbeitet neben dem Schreiben als Hörbuchsprecherin und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Reisen, dicken Büchern, gutem Essen oder einem Serienmarathon. Auf Instagram und TikTok tauscht sie sich zudem gern mit ihren zahlreichen Leser*innen aus und gibt Einblicke in ihren kreativen Alltag.
Weitere Informationen unter: www.instagram.com/tamifischer/ www.tiktok.com/@tamifischerr
TAMI FISCHER
Heißer als Rache
Roman
MANHATTAN ELITE BAND 1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2024 by Tami Fischer
Redaktion: Angela Kuepper
Covergestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Covermotiv: © Elm Haßfurth | birbstudio.com
DK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30165-1V003
www.blanvalet.de
Liebe Leser*innen, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet sich am Ende des Buchs eine Triggerwarnung.Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.Tami Fischer und der Blanvalet Verlag
Für Lily und LunaLetztendlich schreibe ich nur Geschichten, um euer Katzenfutter zu finanzieren. Bitte lasst euch im Gegenzug öfter von mir streicheln, danke.
Playlist
Gettin’ Wild – Silverberg, Ruelle
MoneyOnMyMind – UPSAHL, Absofacto
I’m Back – Royal Deluxe
Get On With It – Andreas Kaufmann
Violin – Cookiee Kawaii, Dear Silas
Hello Bitches – CL
Devilish – The Phantoms
Woman of the Hour – Stela Cole
Trouble – CRMNL
Blood in the Cut – K.Flay
Blinding Lights – Vitamin String Quartet
Señorita – Vitamin String Quartet
Death of Me – SAINTPHNX
Sugar Daddy – Qveen Herby
12345SEX – UPSAHL
I Did Something Bad – Taylor Swift
Hush – The Marías
You Belong With Me – Silverlake String Quartet
Vigilante Shit – Taylor Swift
Hero – Martin Garrix, JVKE
•
PROLOG Es war einmal …
Es war einmal eine Hochstaplerin, die nach Coco Mademoiselle duftete, Jimmy Choos trug und kurz davor war, an ihrer Shapewear zu ersticken.
So oder ähnlich könnte meine Geschichte beginnen, wäre das hier ein modernes Märchen mit Manhattans Upper East Side als Schauplatz. Doch es war kein Märchen. Wenn ich ehrlich war, glich mein Leben gerade vielmehr einem Albtraum. Einer Katastrophe.
Wir bewegten uns im Abendverkehr Richtung Midtown. Ich friemelte am altrosafarbenen Tüll meines bodenlangen Abendkleids und blickte aus den getönten Scheiben der Limousine. Mein Herz raste. Mehr noch, mir war kotzübel. Komm schon, befahl ich mir augenblicklich und bohrte die Finger durch den Stoff in die Knie. Jetzt reiß dich zusammen.
Mein Fahrer hielt, stieg aus und öffnete mir die Tür. Der Lärm von New York City – der Chor aus brummenden Motoren, Hupen und entfernten Sirenen – überrollte mich wie eine Flutwelle und floss wie ein Eisstrom durch meine Gedanken. Die Sonne war längst untergegangen, und die Lichter der Stadt füllten die Straße zwischen den Wolkenkratzern. Midtown war zu dieser Stunde wunderschön. Die Art und Weise, wie die Türme aus Licht den Himmel durchstachen und die Straßen voller Autos rot und weiß zu glühen begannen. Wir befanden uns nur ein paar Blocks vom Central Park entfernt, in einer Nebenstraße der 5th Avenue, in der Nähe des Rockefeller Center.
Das St. Regisragte vor mir auf in seinem zeitlosen, eleganten Beaux-Arts-Stil, umgeben von Bauten aus Stein, Metall und Glas, die mir das Gefühl gaben, klein wie eine Ameise zu sein. Und doch stach das Luxushotel hervor. Es gehörte zu den exklusivsten der Welt.
Alte weiße Männer in Anzügen halfen weißen Frauen in umwerfenden Kleidern aus prunkvollen Wagen, hauptsächlich glänzenden SUVs und Limousinen.
»Danke, Lennard«, sagte ich, ohne mich zu meinem Fahrer umzudrehen. »Ich werde Sie anrufen, wenn ich wieder nach Hause möchte.«
Er verabschiedete sich, dann war er fort.
Mit beiden Händen umklammerte ich meine pinke Clutch von Bottega Veneta. Mittlerweile brodelte es in mir wie eine nahende Naturkatastrophe. Der Eingangsbereich desSt. Regiswar überdacht und beleuchtet. Gäste in Abendkleidung strömten hinein, manche wurden sogar fotografiert. Es war ein Sehen und Gesehenwerden der High Society, wie es im Buche stand. Und ich war nun eine von ihnen.
Nur, dass das gar nicht der Fall war.
»Payton?«, erklang eine tiefe, vertraute Stimme.
Ich blickte auf und sah geradewegs in sein Gesicht. Panik durchzuckte mich, gleichzeitig erfüllte mich Wärme. Er trug einen maßgeschneiderten Smoking mit Fliege und hatte die Hände in den Taschen seiner Hose vergraben. Meine Gefühle drohten mich zu überwältigen, doch ich biss die Zähne zusammen und ignorierte den Stich in meiner Brust. Wie gerne wäre ich ihm um den Hals gefallen, um mich mit dem Gesicht an seiner Schulter vor der Welt zu verstecken. Ich wollte ihn berühren, mich an ihn lehnen. Ich wollte ihn mit jeder einzelnen Faser meines Seins, jetzt mehr denn je.
Das Wissen, dass das niemals möglich sein würde, ließ mich plötzlich gegen Tränen kämpfen.
»Hi«, brachte ich hervor. Meine Lippen formten ein Lächeln, und ich betete, dass es echt wirkte.
Er erwiderte das Lächeln auf diese träge und zugleich ansteckende Art und Weise, die mich immer zum Dahinschmelzen brachte. Das vielleicht letzte liebevolle Lächeln, das er mir je schenken würde, wenn das Unausweichliche erst einmal geschehen war. Das, was ich herbeiführen musste.
Gott. Mein Magen krampfte sich zusammen. Wir werden nie unser »für immer« bekommen.
Er trat zu mir und küsste meine Wange. Es war kein flüchtiger Kuss. Seine Lippen verweilten auf meiner Haut und strichen anschließend sanft bis an mein Ohr.
»Du siehst unglaublich aus«, flüsterte er. Dann gab er mir einen Kuss auf die Lippen. Ich gestattete es mir, mich dem Kuss hinzugeben und die Augen dabei zu schließen. Er zog sich zurück und lächelte mich an. »Na dann, wollen wir?«, fragte er und hielt mir den Arm hin.
Ich brachte kein Wort heraus. Dafür war meine Kehle zu fest zugeschnürt. Lass dir nichts anmerken. Du schaffst das. Ich ergriff seinen Arm, als wäre er ein Rettungsanker. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Die Worte liefen in meinem Kopf in Endlosschleife, doch das Mantra wurde von Minute zu Minute wirkungsloser. Die Tränen, mit denen ich so sehr kämpfte, sammelten sich in meinen Augen. Ich lächelte breiter.
Wir betraten die Lobby des Hotels, die nur so nach altem Geld schrie, und ich wusste, der umwerfende junge Mann an meiner Seite würde nun damit beschäftigt sein, nach unseren Freunden Ausschau zu halten. Deshalb gestattete ich es mir, eine einzelne Träne meine Wange hinablaufen zu lassen. Eine Träne, die um das Kommende wusste. Eine Träne voller Schmerz, der in Kürze über mich hereinbrechen würde.
Es muss sein. Es ist das einzig Richtige. Du hast keine Wahl.
Mit hoch erhobenem Kopf umklammerte ich seinen Unterarm fester und setzte das strahlendste Lächeln auf, das ich auf Lager hatte.
Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so hoffnungslos gefühlt. So leer und verdorben.
Wie hatte es nur so weit kommen können?
KAPITEL 1 Alles auf Anfang
Es war eine Kunst für sich, zu tanzen, während man zugleich gewissenhaft Auto fuhr. Ich jedenfalls war eine Meisterin darin. »Instruction« von Jax Jones und Demi Lovato wummerte durch meinen alten Ford, und ich sang aus vollem Herzen mit, während ich bergauf beschleunigte. Warmes Abendlicht fiel auf die schmutzige Windschutzscheibe, und ich fluchte, als es mir bei der nächsten Kurve direkt in die Augen schien.
Etwas langsamer lenkte ich den Wagen in die vertraute, grün bewachsene Straße in Mill Valley, einem Vorort von San Francisco, in dem ich aufgewachsen war. Ein Fiepen blieb in meinen Ohren zurück, als ich den Motor in der Einfahrt meiner Eltern ersterben ließ und auch das Radio ausging. Alles sah aus wie immer. Zwischen knorrigen hohen Bäumen reihte sich Vorgarten an Vorgarten. Der Rasen war kurz gemäht, und das Haus meiner Eltern ähnelte den anderen typisch amerikanischen Häusern in der Straße – Kolonialstil. Der Weg zur Tür war braunrot gepflastert, die Fensterläden des grauen Hauses waren dunkelblau gestrichen und die Haustür, die von zwei gestutzten Buchsbäumen flankiert war, prunkte groß und weiß.
Ich nahm das Deo aus meiner Handtasche und sprühte mich von oben bis unten ein. Meine beste Freundin und Mitbewohnerin Laurel hatte im Wagen geraucht, kurz bevor ich sie auf dem Weg hierher vor unserer Lieblingsbar abgesetzt hatte. Ganz vielleicht hatte ich ein paar Züge von ihrer Zigarette genommen. Deshalb warf ich mir noch ein Pfefferminzbonbon ein. Ein letztes Mal fuhr ich mir durch die braunen Haare mit den türkisfarbenen Strähnen darin, schlüpfte in meine Flipflops und stieg aus.
Wenige Augenblicke später öffnete mein Dad auch schon die Haustür. Er musste mich wohl kommen gehört haben. Sein silberdurchzogenes braunes Haar war ordentlich zurückgekämmt und der typische Dreitagebart verschwunden. Offenbar hatte er wieder einen Videocall mit einem Zeitungsverlag oder Chefredakteur gehabt, sonst hätte er sich bestimmt nicht in das Polo gezwängt. Er hasste die Dinger.
Nacho, unser alter Berner Sennenhund, stürmte an meinem Dad vorbei und rannte mir entgegen wie ein Welpe. Ich stolperte zurück und brachte mein Gesicht außer Reichweite seiner Zunge. Lachend küsste ich seine feuchte Schnauze und befahl ihm anschließend, zurück auf alle viere zu gehen.
»Hi, Dad«, sagte ich und umarmte meinen Vater fest. Er roch nach Kaffee und seinem Aftershave, ein Duft, der mich immer in Geborgenheit wog.
»Du stinkst nach Rauch, Sarah«, sagte er anstelle einer Begrüßung und küsste meine Schläfe. »Sei froh, dass deine Mutter noch in der Redaktion ist und nichts davon mitbekommt.«
Ich zog eine Grimasse. Verdammt, er hatte es gemerkt. Hatte das gute Deo mich so sehr im Stich gelassen? »Ich dachte, sie hat heute Deadline«, murmelte ich verlegen.
»Hat sie auch.«
Ich löste mich aus der Umarmung und folgte ihm ins Haus, während Nacho bellend um uns herumhüpfte. Meine Eltern, Caleb und Jane Quinn, waren beide im Journalismus tätig. Während mein Vater freier Wirtschaftsjournalist war, arbeitete meine Mom für den San Francisco Chronicle. Seit unserer Kindheit waren meine Zwillingsschwester und ich an den Deadlinestress gewöhnt, der unsere Eltern stets umgab.
Nacho drückte seine Schnauze immer wieder gegen mein Bein, bis ich ihn grinsend am Kopf kraulte. »Ich hab echt Hunger. Wollen wir uns Pizza bestellen?«, fragte ich und betrat nach Dad die Küche. Wäre das Haus kein Erbe meiner verstorbenen Großeltern, wären meine Schwester und ich vermutlich nie in einer Vorstadt von San Francisco aufgewachsen, besonders nicht in Mill Valley. Meine Eltern hätten es nicht zugelassen. Sie mochten es simpel und hielten nichts davon, Geld in Dinge zu investieren, die nicht absolut notwendig waren. In übermäßigen Wohlstand zum Beispiel, und damit auch in so ein großes Haus. Deshalb war fast jeder Raum weit von einer Renovierung entfernt und glich einer Zeitreise, mindestens zwei oder drei Jahrzehnte zurück.
»Ich habe etwas Besseres für dich als Pizza, Liebling«, verkündete mein Dad und öffnete den Kühlschrank mit dramatischer Geste. Er ließ eine Plastikpackung über die Kücheninsel zu mir schlittern. Gierig nahm ich sie in die Hände. Mein Lächeln erstarb jedoch, als ich erkannte, was es war. Ich verzog das Gesicht und schob die Packung mit Schwung zu ihm zurück. »Großer Gott, das sind …«
»Selleriesticks.«
»Ich brauche heiße Kohlenhydrate, am besten in Verbindung mit Käse oder Schokolade! Komm schon, Dad, ich weiß, dass du die Pizza von Papa Don genauso sehr liebst wie ich.«
Lächelnd lehnte er sich mit den Unterarmen auf die andere Seite der Kücheninsel. »Drei Dinge, Sarah-Schatz«, sagte er und hielt Zeige-, Mittel- und Ringfinger nach oben. »Erstens: Mehr bekommst du nicht, wenn du zu Hause auftauchst und dabei nach Zigaretten stinkst. Du hast geraucht! Sei froh, dass deine Strafe so mild ausfällt.«
Ich holte Luft, um zu widersprechen, doch er fuhr unbeirrt fort. »Zweitens: selbst schuld! Und drittens: Ich hoffe, dir ist bewusst, wie unverantwortlich und gesundheitsschädigend Zigaretten sind. Hast du eine Ahnung, wie so eine Raucherlunge aussieht? Und hast du dich mal damit befasst, unter welchen Bedingungen der Tabakanbau vonstattengeht? Das ist moderne Sklaverei! Die reinste Ausbeutung, Kinderarbeit und eine Sünde für unser Ökosystem. Ich kann dir Bilder zeigen, nach denen du nie wieder auch nur daran denkst, an einer Kippe zu ziehen. Außerdem sind Tabakwaren total teuer, das kannst du dir als Studentin gar nicht leisten.« Sein Gesichtsausdruck war streng und ernst, und ich zog den Kopf ein.
»Es waren nur zwei Züge«, nuschelte ich. »Das bedeutet ja nicht, dass ich so was regelmäßig mache oder eine eigene Schachtel besitze. Wirklich, Dad, mehr war es nicht. Können wir jetzt bitte wieder über das Abendessen sprechen? Du hast doch bestimmt auch Hunger! So wie ich dich kenne, hast du dich vermutlich wieder den ganzen Tag in deinem Büro verbarrikadiert und nur diese komischen Müsliriegel gegessen. Ich hatte heute nur ein kaltes Fleischbällchen, weil ich vor meiner Vorlesung kein Frühstück mehr holen konnte. Ich bin kurz vorm Krepieren, Dad.« Ich machte eine Schnute – aber keine Chance, das zog bei ihm schon seit meinem achten Lebensjahr nicht mehr.
Ungerührt hob er eine Augenbraue. »Du hättest dir auf dem Weg zum Campus etwas kaufen können. Gehst du dem Bagel-Laden bei dir ums Eck etwa immer noch aus dem Weg?«
Ein Schnauben entfuhr mir. »Es ist der letzte Tag vor den Semesterferien, ich wollte ihn einfach nur hinter mich bringen und mich nicht um ein ausgewogenes Frühstück kümmern. Und glaubst du wirklich, dass ich Lust habe, Patrick über den Weg zu laufen? Außerdem bin ich doch eine arme Studentin, schon vergessen?«
Patrick war fast ein Jahr lang mein fester Freund gewesen und nun seit etwa sechs Wochen mein Ex-Freund. Die Trennung war hässlich gewesen, und er hatte mir ein klitzekleines bisschen das Herz gebrochen. Vielleicht war es auch nur mein Stolz, der angeknackst war, denn die Beziehung war sehr körperlich gewesen und nicht sonderlich emotional. Wir hatten uns in einem Bagel-Laden in San Francisco kennengelernt, gleich nachdem Laurel und ich zu Beginn des Studiums in unsere Wohnung gezogen waren. Patrick war der Storemanager des Ladens. Wie sich aber herausgestellt hatte, waren Bagels nicht die einzigen Dinge mit Löchern, die er gerne belegte, wenn ich nicht vor Ort war.
Mein Vater gab der Packung wieder einen Stoß, und sie schlitterte zurück zu mir. »Wenn du wirklich Hunger hast, nimm das. Sehr gesund und nahrhaft. Ich muss noch etwas arbeiten, dann kümmere ich mich um das Abendessen. Vielleicht mache ich zum Sellerie noch ein paar Karottensticks und einen Hummusdip.«
»Seit wann bist du so grausam und herzlos?«, fragte ich stöhnend.
Seine Mundwinkel zuckten ein winziges bisschen. Schon klar, jetzt ging es ihm nur noch darum, mir total auf die Nerven zu gehen. Wenn er richtig sauer war, sah das ganz anders aus. »Das ist noch eine milde Strafe. Weil ich total cool und gelassen bin. Deshalb bin ich vermutlich auch der beste Dad auf der ganzen weiten Welt. Alle anderen, die unchillaxten Dads, wären an die Decke gegangen bei ihrer nach Rauch stinkenden Tochter.«
Ich schüttelte mich, auch wenn ich mir ein Lachen verkneifen musste. »Es ist peinlich, wenn du versuchst, wie die Jugend von heute zu klingen. Schön, ich esse das Zeug. Aber ganz offenbar liebst du mich nicht mehr und möchtest mich auf jede erdenkliche Art und Weise leiden sehen.« Ich tat, als müsste ich schniefen, und öffnete die Plastikpackung. Verstohlen warf ich einen Blick zu Nacho, der neben mir am Boden saß und aus Knopfaugen erwartungsvoll zu mir hochsah.
»Glaub mir, mein Junge. Das Zeug willst nicht einmal du essen, das verspreche ich dir.«
Dad lachte bellend, so wie ich es schon immer geliebt hatte. »Mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du schon zwanzig Jahre alt bist. Vielleicht hättest du doch lieber Schauspiel studieren sollen anstatt Architektur, du kleiner Quälgeist.«
»Hey!«, sagte ich entrüstet, doch ich grinste dabei. »Und stell dir vor, es gibt sogar noch eine wie mich.«
»Apropos«, sagte Dad und lehnte sich rücklings gegen die Arbeitsfläche. Noch bevor er zu sprechen begann, konnte ich an der Art und Weise, wie er die Stirn runzelte, erkennen, worum es ging.
»Hast du in letzter Zeit etwas von deiner Schwester gehört?«
Er schien sich Mühe zu geben, gelassen zu klingen, aber ich sah die Sorge in seinen Augen.
Ich setzte mich auf einen Barhocker und schüttelte den Kopf. »Payton macht sich immer noch rar. Wir sind wohl einfach nicht so cool wie ihr neues schickes Leben in New York.« Ich lächelte schief.In Wahrheit war mir aber überhaupt nicht nach Lachen zumute. Der bloße Gedanke an meine Zwillingsschwester sorgte dafür, dass mir das Herz schwer wurde. Sie war wie vom Erdboden verschluckt, seit zwei Wochen schon. Etwas, was mich erst verletzt und dann wütend gemacht hatte. Mehr, als ich vor irgendjemandem zugeben würde, auch nicht vor mir selbst. Denn ich war verletzt. Und ich war wütend auf sie. Wütend, dass sie mich einfach so vergessen hatte. Nicht nur mich, sondern auch unsere Eltern, unsere beste Freundin Laurel und ihre anderen Freunde und Freundinnen hier.
Dad seufzte tief und rieb mit einer Hand über seinen Nacken. »Bestimmt wird Payton sich bald bei uns melden. New York ist eine aufregende Stadt. Sie wird mit Sicherheit viel zu tun haben. Hat sie nicht vor Kurzem diesen Praktikumsplatz erwähnt?« Er klang hoffnungsvoll, als würde er sich selbst mit diesen Worten beruhigen wollen.
Ich starrte auf meine Hände und zuckte mit den Schultern. »Als wir zuletzt telefoniert haben, meinte sie, dass sie den Praktikumsplatz nicht bekommen hat. Ist ja auch egal.« Ich spürte, wie meine Laune in den Keller segelte. So schnell ging das, wenn ich mir erlaubte, zu lange darüber nachzudenken, warum Payton sich wohl nicht mehr meldete. Meine Unsicherheit lag mir schwer im Magen. Wieso musste ich sie auch so vermissen? Und dann noch meine Sorgen. Und meine Wut und die Enttäuschung. Das war nicht fair. Ich fühlte mich verraten, doch vor allem fehlte sie mir. Payton war nicht einfach nur mein Zwilling, sondern auch meine allerbeste Freundin. Wir hatten sie, diese legendäre Zwillingsverbindung. Ständig hatten wir gegenseitig unsere Sätze beendet, gespürt, wenn es der anderen nicht gut ging, und hatten alles gemeinsam unternommen. Manchmal hatten wir sogar die Rollen getauscht, weil wir nicht nur identisch aussahen, sondern auch genau wussten, wie wir uns in der Rolle der anderen verhalten mussten, um glaubhaft rüberzukommen. Sei es in der Middle School gewesen, um dem Schwarm einen Liebesbrief zu überreichen, um Streiche zu spielen, oder dann später manchmal sogar, um einen Test zu schreiben, für den die andere nicht gelernt hatte. Unsere ganze Kindheit und Jugend hindurch hatten wir das immer wieder getan, und nie hatte es jemand herausgefunden. Bis wir sechzehn waren, hatten wir uns zudem noch ein Zimmer geteilt. Wir waren unzertrennlich gewesen. Meine Blinddarm-OP als Neunjährige und der damit verbundene Krankenhausaufenthalt waren die längste Zeit, die Payton und ich je voneinander getrennt gewesen waren. Wir hatten uns schließlich für denselben Studiengang entschieden, um gemeinsam zu studieren. An unserer Traumuniversität: der Columbia University in New York. Doch Payton war schon immer die Fleißigere von uns beiden gewesen – und wenn man es genau nahm, war sie es gewesen, die ab und an Tests für mich geschrieben hatte, und nicht andersherum. Ich hatte meine Wochenenden lieber mit Freunden am Strand oder auf Partys verbracht, anstatt zu pauken. Letztendlich war also nur sie an der Ivy-League-Universität angenommen worden, für die wir beide so lange geschwärmt, von der wir so intensiv geträumt hatten. Es hatte mir das Herz gebrochen. Im vergangenen Jahr hatten wir uns also zum allerersten Mal so richtig voneinander getrennt. Payton hatte ihr Architekturstudium in New York angefangen und ich mein Architekturstudium an der USFCA hier in San Francisco. Seitdem hatten meine Eltern und ich Payton nur an Thanksgiving und über die Weihnachtsfeiertage gesehen. Sie hatte sich verändert. Ziemlich schnell sogar, es war kein schleichender Prozess gewesen. Das hatte ich auf Instagram mitverfolgt. Sie hatte sich von jetzt auf gleich kaum noch gemeldet. Plötzlich trug sie Designerklamotten, war verschlossener und hatte Geheimnisse. Sie hatte sich von uns allen zurückgezogen, doch am meisten von mir. Ausgerechnet von mir. Und nun war sie wie vom Erdboden verschluckt.
Ich fuhr mir mit beiden Händen durch die geglätteten Haare. Mit jedem Tag, an dem Payton sich nicht meldete, wurde mir mulmiger. Die Sorgen wurden größer und die Ruhelosigkeit stärker. Das war schlimmer als Wut, denn es tat weh. Wieso konnte ich nicht einfach nur wütend sein?
»Hey, Dad, ich gehe eine Runde mit Nacho raus. Kommst du mit?«, fragte ich. Vielleicht würde mir etwas Bewegung guttun.
Er schielte Richtung Tür und rieb sich über das Kinn. »Ich würde ja gern, aber ich habe da diesen einen Artikel …«
Lächelnd stand ich vom Barhocker auf. »Dann gehe ich eben allein. Nacho, mein Junge!« Ich drehte mich um und klatschte in die Hände. »Willst du Gassi gehen?« Als wäre ein Schalter im Kopf des alten Hundes umgesprungen, begann er zu bellen und rannte in den Flur. Dad und ich lachten.
»Warte, Sarah«, sagte Dad, als ich Nacho hinterher wollte.
Ich drehte mich zu ihm um. Da drückte er mir plötzlich eine Packung Oreos in die Hand. Vielsagend sah er mich an. »Mach dir nicht so viele Sorgen um Payton. Sie meldet sich schon noch bei uns. Und Sarah, lass in Zukunft die Finger von Zigaretten, sonst erzähle ich es beim nächsten Mal deiner Mom.«
»Jawohl, Sir. Und danke für die Kekse«, erwiderte ich, stellte mich auf die Zehenspitzen und küsste ihn auf die Wange, ehe ich Nacho in den Flur folgte.
Ich nahm die Hundeleine vom Haken neben der Tür. Dabei blieb mein Blick an ein paar eingerahmten Bildern an der Wand hängen, und ich hielt noch einmal inne. Da waren Payton und ich in unseren gelben Kleidchen – absolut identisch, mit den gleichen braunen Augen, dem breiten Lächeln und den gelockten braunen Haaren. Nicht so weiß wie unser Dad, aber auch nicht schwarz wie unsere Mom. Hellbraun. Auf den alten Fotostudiobildern, die Ende der 2000er aufgenommen worden waren, konnte uns nicht einmal unsere Mutter auseinanderhalten. Mein Blick verharrte für einen Moment auf dem aktuellsten Bild von uns, vom letzten Weihnachten. Ich, in einem schwarzen Boho-Kleid, mit brustlangen geglätteten Haaren und den türkisfarbenen Clip-Strähnen darin, Payton mit ihren langen unbehandelten Naturwellen, die sich an den Spitzen lockten, in einem fliederfarbenen Kostüm aus Bleistiftrock und Jäckchen. Der Weihnachtsbaum glitzerte im Hintergrund, und Mom und Dad hatten die Arme um uns gelegt. Wir alle strahlten in die Kamera. Und das, obwohl Mom und Payton kurz vorher heftig gestritten hatten, was früher nie passiert war. Payton hatte Chanel-Slipper getragen, als wäre es ganz normal, zum Pyjama mehrere Tausend Dollar an den Füßen kleben zu haben. Erst hatten wir beide uns gestritten, weil sie mir einfach nicht hatte sagen wollen, woher sie plötzlich all das teure Zeug hatte. Anschließend hatte Mom ihr einen vertrauten Vortrag darüber gehalten, wie toxisch Statussymbole seien. Das war dann zwischen ihnen eskaliert, und Payton hatte uns alle mit ihrem Wutausbruch schockiert. Durch die Arbeit beim San Francisco Chronicle beschäftigte unsere Mutter sich täglich mit Armut und der Ungerechtigkeit unseres Rechtssystems, ganz besonders gegenüber dem nicht-weißen Teil der US-amerikanischen Bevölkerung. Wir hatten nie Markenklamotten besessen oder die neueste Technologie. Schon seit unserer Kindergartenzeit hatte Mom in dieser ihr typischen Geste die Nase gerümpft, wann immer die wohlhabenden weißen Vorstadtmütter gefragt hatten, ob wir für ein Playdate bei ihnen vorbeikommen wollten. Sie hatte Angst gehabt, dass wir beeinflusst wurden und Dinge haben wollten, die wir nicht haben durften. Unsere Mutter war ein liebevoller Mensch, aber ein wenig eigen und manchmal auch extrem. Vielleicht gerade weil sie ein so großes Herz hatte. Sie arbeitete neben ihrem Job ehrenamtlich bei Feeding America und war als Jugendliche einmal verhaftet worden, weil sie ein Haus besetzt hatte. Dass nur sie und die anderen afroamerikanischen Mitglieder ihrer Gruppe festgenommen worden waren, hatte den Stein ins Rollen gebracht, was ihren Aktivismus betraf. Sie war leidenschaftlich in ihrem Beruf und konnte Reichtum und Luxus auf den Tod nicht ausstehen. Genauso wie unser Dad. Das perfekte Match. Deshalb auch der Streit mit Payton über ihre viel zu teuren Klamotten und den viel zu teuren Schmuck. Beim Weihnachtsessen hatten Mom und Payton kein Wort miteinander gesprochen, und die Stimmung zu Hause war auf dem Nullpunkt gewesen. Vor ihrer Abreise hatte Payton Mom schließlich ihre Chanel-Slipper übergeben, damit diese sie verkaufen konnte, um den Erlös an eine Obdachlosenunterkunft zu spenden.
Ich riss den Blick vom Foto los und legte Nacho seufzend die Leine an. Ich musste lernen, mir nicht allzu viele Gedanken zu machen. Wenn Payton so gut ohne mich zurechtkam, dann musste ich eben versuchen, es ihr gleichzutun.
Eine Weile spazierte ich durch die steilen begrünten Bilderbuchstraßen von Mill Valley. Die Sommerluft war noch warm, obwohl die Sonne nicht mehr zu sehen war, und in ein paar Vorgärten liefen Sprinkleranlagen – wie immer musste ich Nacho vor diesen Häusern besonders in Schach halten, damit er nicht zum Wasser sprang und die Blumenbeete ruinierte, in denen er sich gerne wälzte.
Im Hundepark ließ ich ihn von der Leine und setzte mich auf eine Bank. Ich zog mein Handy aus der Tasche, während Nacho mit einem befreundeten Labrador aus der Nachbarschaft spielte. Ich aß ein paar Oreos, scrollte durch Instagram und klickte mich von Profil zu Profil. Wieder aktualisierte ich Paytons Finsta – ihr geheimes zweites Instagram-Profil, das nur ihre engsten Freunde und Freundinnen kannten. Wir beide hatten zweite Accounts, hauptsächlich damit unsere zu neugierigen Investigativjournalisten-Eltern nicht überall ihre Nasen hineinsteckten. Auf Paytons »offiziellem« Instagram-Profil war vor allem ihre Liebe zur Fotografie zu sehen gewesen, bis sie den Account deaktiviert hatte. Sie hatte schon immer ein Talent dafür gehabt, alltägliche Szenen magisch aussehen zu lassen. Bevor Paytons offizielles Profil verschwunden war, hatte sie zuletzt Bilder von der Skyline Manhattans, dem Campus der Columbia, tollen Gebäuden und schönen Sonnenuntergängen gepostet. Aber auf ihrem Finsta? Dem Profil, das Mom und Dad nicht kannten? Dort strotzten ihre Posts nur so vor Luxus. Aufnahmen in Cocktailkleidern, Spiegelselfies in prunkvollen Badezimmern, funkelnder Schmuck und Tüten von Chanel, Louis Vuitton oder Hermès. Oder es waren Schnappschüsse von Payton, wie sie mit ihrem neuen Freund Donovan Händchen hielt, Kaffee trank oder mit ihren Freundinnen zusammen war und aussah, als gehörte sie auf das Vorschaubild einer neuen Staffel Gossip Girl. Schicke Partys, Champagner, edles Essen, Limousinen. Und ständig Bilder mit diesem Donovan, von dem sie mir nie viel erzählt hatte. Wer auch immer das elegante, zufriedene Mädchen auf dem Profil war, meine Schwester war das mit Sicherheit nicht. So war Payton nie gewesen. Ich meine, verdammt, unsere Eltern hatten uns so nicht erzogen. Die Payton, die ich kannte, trug keine Hollywoodwellen, Perlenketten und Handschuhe aus Spitzenstoff. Sie war in Secondhandläden shoppen gegangen, so wie alle in der Familie. Noch vor einem Jahr war sie einfach nur … sie gewesen. Nicht dieses Luxusmädchen, das sich plötzlich zu schade war, ihren Zwilling, ihre beste Freundin, an ihrem neuen Leben teilhaben zu lassen. Das Luxusmädchen, das nun ihre öffentlichen Social-Media-Profile gelöscht hatte und untergetaucht war, ohne ihre Familie wissen zu lassen, ob es ihr gut ging.
Nacho drängte seine Schnauze an mein Bein. Er hatte wohl langsam genug und wollte nach Hause.
»Du hast ja recht, Großer«, sagte ich und erhob mich. Das mit dem Vorsatz, mir nicht allzu viele Gedanken zu machen, würde ich wirklich noch üben müssen.
KAPITEL 2 Von Diamanten und Minzeis
In den ersten Wochen der Sommersemesterferien hangelten Laurel und ich uns von Party zu Party, räumten unser winziges Apartment in San Francisco auf, hingen gemeinsam am Strand ab und spielten Videospiele. Sie nutzte jede Gelegenheit, um unauffällig ihre neue Flamme Emma in unseren Freundeskreis zu integrieren. Es war das allererste Mal, dass Laurel ernsthaft verliebt war, und sie schien in der frischen Beziehung regelrecht aufzublühen. Das machte mich glücklich, besonders weil ich Emma mit ihrer quirligen Art gut leiden konnte.
Laurel war nicht nur meine beste Freundin, sondern auch Paytons und meine älteste Freundin. Wir kannten uns seit der ersten Klasse und waren wie Schwestern aufgewachsen. Sie war einer der wenigen Menschen in meinem näheren Umfeld, die meine Mutter mochte. Und das sollte etwas heißen, denn niemand war in Moms Augen anständig genug – sie wusste natürlich nicht, dass Laurel ab und an gerne Gras rauchte.
Wenn Laurel und Emma auf Raves oder zu Kochabenden von Freunden gingen, schloss ich mich meist an, um mich von der anhaltenden Funkstille zu Payton abzulenken. Die war mittlerweile schon auf zwei Monate angewachsen. Zu Beginn hatte ich die Tage gezählt, seit Payton sich zuletzt bei mir gemeldet hatte, dann die Wochen. Ich hatte ihr immer wieder geschrieben, versucht, sie anzurufen, und Sprachnachrichten hinterlassen. Nach dem ersten Monat hatte ich schließlich zu zählen aufgehört, und meine Verzweiflung war Trotz und schließlich Resignation gewichen. Wenigstens Mom und Dad hörten nach wie vor von ihr, wenn auch nur sporadisch, vermutlich, damit sie Payton nicht als vermisst meldeten.
Dennoch ertappte ich mich immer wieder dabei, wie ich das Profil meiner Schwester checkte. Es war wie ein Automatismus, von dem ich nicht lassen konnte.
So auch heute.
Es war ein besonders heißer Tag. Laurel und ich hatten uns in der Wohnung verbarrikadiert und ein paar ihrer Batiktücher vor die Fenster gehängt, um der Sonne Einhalt zu gebieten. Gleich nach unserem Einzug und unter Einfluss von zu viel Cider hatten wir es nämlich irgendwie geschafft, die Fensterläden kaputt zu machen. Nachdem ich über zwei Stunden Laurels schulterlanges Afrohaar zu kleinen Braids geflochten hatte und meine steifen Finger vor Schmerz deshalb protestierten, machten wir eine Pause.
Und genau da entdeckte ich es.
»Es ist weg!«, rief ich und setzte mich auf. Wieder und wieder versuchte ich, das Profil auf meinem Smartphone aufzurufen. Doch es funktionierte nicht. @p.quinn2412 existierte nicht länger. Payton hatte ihr Finsta-Profil deaktiviert!
Laurel erschien im Türrahmen unserer winzigen Küche, in der Hand eine Packung Eiscreme und im Mund einen Löffel. »Wad if wef ?«
Der Großteil ihres Kopfes war von Klammern bedeckt, die die ausgekämmten Haare zusammenhielten, vom restlichen Teil hingen winzige Zöpfe voller bunter Perlen herab.
Ich warf mein Handy auf das Sofa. Mein Puls hatte sich beschleunigt, und etwas in mir, der Teil, der mich schon immer mit Payton verbunden hatte, verknotete sich auf Übelkeit erregende Art und Weise. »Paytons Profil ist verschwunden. Jetzt ist sie komplett untergetaucht«, stieß ich hervor und blickte zu Laurel auf. »Was, wenn irgendwas passiert ist?«
Stöhnend verdrehte sie die Augen und ging zurück in die Küche. »Babes, bestimmt steckt da nichts dahinter. Mach dir keinen Kopf.«
»Aber ich spüre, dass etwas nicht stimmt«, beharrte ich und knabberte an meinem Daumennagel. Meine Finger pulsierten noch immer vom Flechten. Ich ließ sie einen nach dem anderen knacken.
Laurel kehrte mit einem zweiten Löffel zurück. Sie drückte ihn mir in die Hand und ließ sich neben mich auf das durchgesessene Polster fallen. »Sagt dir das eure Zwillingstelepathie?«, fragte sie.
»Ja!« Ich stach meinen Löffel in das Schoko-Minz-Eis. »Ich schwöre es dir. Etwas ist nicht in Ordnung, ich weiß es einfach.«
»Okay, na schön.« Sie entsperrte ihr Handy, tippte etwas und hielt es sich ans Ohr.
»Was tust du da?«, fragte ich und schob mir den voll beladenen Löffel in den Mund.
Laurel schnaubte. »Wonach sieht’s aus? Ich rufe Payton an.«
»Na dann, viel Erfolg. Es wird nur die Mailbox rangehen.«
Dennoch wurde ich nervös, während ich sie beobachtete. Würde meine Schwester bei ihr abheben? Lag es an mir?
Doch es dauerte nicht lange, bis ich leise die vertraute Ansage ihrer Mailbox hörte.
»Hi, Pay«, sagte Laurel nach einem langen Piepton und verzog den Mund. »Hier ist Laurel. Erinnerst du dich noch an mich? Ich glaube nämlich, wir sind Freundinnen. Krieg endlich deinen Arsch hoch und ruf zurück, hier machen sich einige Leute Sorgen um dich. Und mit einige Leute meine ich insbesondere deine Zwillingsschwester, die schwört, dass irgendwas nicht stimmt. Bitte melde dich wenigstens bei Sarah und sag ihr, dass alles in Ordnung ist und du bloß gerade eine echt miese Schwester bist. Danke. Hab dich lieb und vermiss dich, bis bald.«
Sie legte auf und hob vielsagend die Brauen.
Ich massierte meine steifen Finger. »Sag ich doch, dass sie nicht rangeht. Und ich glaube nicht, dass sie ihre Mailbox abhört.« Ich schob mir noch mehr von der Eiscreme in den Mund.
Vor den Fenstern verschwand die Sonne hinter einer Wolke, und in unserer abgedunkelten Wohnung wurde es erstaunlich finster.
»Verrät dir das auch eure Zwillingsverbindung?«, fragte Laurel.
Ich seufzte. »Das nicht, aber Payton hört meine Sprachnachrichten im Messenger nicht ab. Die Textnachrichten liest sie auch nicht.«
»Okay, du hast ja recht. Es ist schon ein wenig komisch. Aber ich versuche, positiv zu denken, Sarah. Also geh nicht immer vom Schlimmsten aus, vielleicht hat sie gerade viel zu tun und ist nur selten am Handy. Das hat vermutlich nichts mit dir oder mir zu tun.«
Das beruhigte mich ein wenig, und ich atmete auf.
»Wenn du positiv denkst, ziehst du auch Positives an. Und umgekehrt. Deshalb versuche ich, mir keine Sorgen zu machen. Es wäre viel schlimmer, wenn ich mich mit dir in Sorgen suhlen würde«, schob sie nach.
Ich pikste sie mit dem Griff des Löffels an der Schulter. »Sag das doch gleich, du Arsch. Ich dachte schon, dir ist das alles egal.«
Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Sie rutschte vom Sofa und nahm wieder auf dem bunten Pouf vor mir Platz, damit wir mit ihren Braids weitermachen konnten.
»Eine von uns muss die Dinge ja am Laufen halten. Gern geschehen, Babes.« Sie nahm den Playstation-Controller zur Hand und klickte auf »Fortsetzen«. Laurel spielte zum etwa hundertsten Mal The Last Of Us auf der alten brummenden Playstation und fuhr damit fort, infizierte zombieartige Gegner abzumetzeln.
Eine Weile sprachen wir nicht. Ich kämmte ihre Haare, teilte Strähne für Strähne, arbeitete ein wenig Öl hinein und begann wieder zu flechten.
Plötzlich erklang das wunderbare Geräusch von Regen und Wind. Endlich eine Abkühlung. Der erste Regen seit Wochen.
Ich schämte mich ein wenig, so auf meine Schwester fixiert zu sein. Mehr noch, ich ärgerte mich darüber. Durch ihr Verhalten im vergangenen halben Jahr hatte sie es nicht verdient, so viel Platz in meinem Kopf einzunehmen. Bevor Payton nach New York gezogen war, war es nie so zwischen uns gewesen. Wir waren immer ein Herz und eine Seele. Laurel schwor seit Jahren darauf, dass unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten darauf beruhten, dass Payton elf Minuten älter war als ich – dadurch hatten wir nämlich unterschiedliche Horoskope, und ihrer Meinung nach war das ausschlaggebend für die Persönlichkeit eines Menschen. Wer Payton begegnete, entwickelte früher oder später eine Art Beschützerinstinkt. Obwohl sie der selbstständigste Mensch war, den ich kannte, löste ihre sanfte und gutmütige Persönlichkeit sofort das Bedürfnis aus, sich um sie kümmern zu wollen. Sie war die Ruhigere von uns beiden, liebte Kochabende und Lesezirkel, während ich die Impulsivere war, die gerne unter Menschen ging, feierte und oftmals riskante Entscheidungen traf. Sie bevorzugte einen kleinen Kreis von engen Freunden, ich liebte es, neue Kontakte zu knüpfen und unterwegs zu sein. Nach dem Studium hofften wir, uns eines Tages den großen Traum von einem gemeinsamen Architekturbüro erfüllen zu können. Denn so gegensätzlich wir in vielen Dingen auch waren, wir waren zwei Hälften eines Ganzen. Zwei Hälften, die Träume und Sehnsüchte, unendliche Liebe und Geheimnisse teilten. Deshalb war es ja auch so beunruhigend, wie sehr sie sich verändert hatte, seit sie an der Columbia studierte.
Und jetzt? Jetzt kannte ich noch nicht einmal ihren neuen Freund Donovan. Payton hatte das Band, das uns seit der Geburt verband, einfach so zertrennt. Ich fühlte mich verloren. Einsam. Und meine Verunsicherung reichte tief.
Wenn ausgerechnet deine zweite Hälfte dich fallen lässt, würde es dann nicht auch der Rest der Welt tun?
***
Am darauffolgenden Abend kam Emma wie so oft zu Besuch und gesellte sich zu mir auf das Sofa, während ich noch immer Laurels Haare flocht. Sie redete wie ein Wasserfall und war das fröhlichste Energiebündel, das ich je erlebt hatte. Mittlerweile hatten wir die Fenster aufgerissen, um die kühle Luft in die kleine Wohnung zu lassen. Die Regenfront, die seit gestern draußen wütete, war eine Wohltat. Keine von uns störte es, dass der Boden vor den Fenstern bereits feucht war. Für die Brise war es das wert.
Laurel gab ein ächzendes Stöhnen von sich, als ich endlich fertig war. Sie warf den Controller aufs Sofa, als wäre sie diejenige, die sich tagelang die Finger wundgeflochten hatte, stand auf, streckte sich ausgiebig und ließ den Kopf kreisen. »Tausend Dank, Sarah.«
Ich lächelte erschöpft. »Du hast es doch noch gar nicht gesehen.«
»Du siehst toll aus!«, sagte Emma, während Laurel bereits ins Badezimmer rannte und das Licht einschaltete. Ein begeistertes Quietschen war zu hören, dann erschien sie im Türrahmen und warf sich in Pose. Mit gespitzten Lippen schob sie sich die kleinen Braids mit den Perlen über die Schultern. »Seht euch das an. Verdammt, ich bin heiß.«
Applaudierend stieß Emma einen Pfiff aus. Laurel grinste bis über beide Ohren, dann stürzte sie sich auf mich und küsste meine Stirn. »Danke, Babes! Ich liebe es, wirklich. Kommst du mit? Emma und ich wollen gleich im Marley’smit Will und den anderen was trinken. Ich muss die neuen Haare ja ausführen und mit ihnen angeben.«
Kurz überlegte ich, dann schüttelte ich den Kopf. »Ich bleibe zu Hause. Es ist schon fast neun.«
Zunächst blitzte Spott in Laurels Augen auf, weil mir das alles andere als ähnlichsah. Dann wurde ihre Miene mitfühlend, ihr Schmunzeln wich einem aufmunternden Lächeln, und sie drückte meine Schulter. »Okay. Wenn du dir Pizza bestellst, geht das auf mich, ja? Als erste Anzahlung für meine Haare.«
»Abgemacht«, sagte ich.
Emma und ich warteten, bis Laurel sich umgezogen hatte – als Modestudentin wählte sie oft gewagte Outfits, aber heute wurden es ihre weinrote Latzhose aus Cord, ein schwarzer Pullover und ihre alten Doc Martens.
Dann verabschiedete ich mich von den beiden und schloss die Fenster. Der Sturm draußen wurde nämlich immer heftiger.
Gähnend legte ich mich der Länge nach auf die Couch. Meine Hand zuckte in Richtung Telefon, als wäre es mir in Fleisch und Blut übergegangen, Instagram oder meinen Messenger zu öffnen. Doch ich hielt mich zurück. Stattdessen ballte ich die Hand zur Faust und kniff die Lippen zusammen. Das musste aufhören.
Eine Weile lauschte ich dem Regen, der angefeuert vom Wind gegen die Fensterscheiben schlug. Der Klang lullte mich ein, und ich erlaubte es mir, mich zu entspannen.
Ich war kurz davor einzunicken, als es an der Wohnungstür hämmerte. Vor Schreck sprang ich auf und lief zur Tür. Das Leuchten eines Blitzes erhellte die Wohnung, gefolgt von einem wütenden Donnergrollen. Ich riss die Tür auf, mehr als bereit, Laurel eine Standpauke darüber zu halten, dass sie bei diesem Sturm nicht fahren sollte. »Laurel, du solltest nicht …«
Meine Stimme versagte, und ich stolperte zurück. Denn vor mir stand nicht Laurel, die durchnässt bis auf die Knochen war und schwer atmete.
Es war Payton.
Payton.
Im nächsten Augenblick brach sie auch schon schluchzend vor mir zusammen.
KAPITEL 3 Wenn man vom Teufel spricht
Ich machte einen Satz nach vorne und fing Payton auf, bevor sie zu Boden sinken konnte. Sie weinte. So richtig. Ihre Schluchzer waren laut, und sie klammerte sich an mich.
»Payton«, sagte ich mit hohler Stimme. Sie war eiskalt und pitschnass. »Was zur Hölle? Was ist passiert? Was machst du hier?«
Ich stand stocksteif da, während sie das Gesicht an meinem Hals vergrub. Ihr Körper bebte wie Espenlaub. Sie war hier. Payton war hier!
Mir wurde schlecht, als ich endlich fest die Arme um sie schlang. Fuck. Ich hatte recht gehabt. Mein furchtbares Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte? Ich hatte recht gehabt!
Payton schaffte es kaum, Luft zu holen, so sehr weinte sie. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich sie jemals so hatte weinen sehen.
Eine drückende Sturmböe vom offenen Treppenhaus unserer Apartmenteinheit jagte mir den Regen wie feine Nadelstiche ins Gesicht und löste meine Schockstarre. Ich half Payton hinein und dirigierte sie zum Sofa. Als ich zurück zur Tür eilte, um sie zu schließen, entdeckte ich einen Koffer und eine Tasche darauf. Ich zog ihn in die Wohnung und sperrte anschließend den Regen und den heulenden Wind aus. Mit schnellen Schritten kehrte ich zu meinem Zwilling zurück, kniete mich vor sie und strich ihr die nassen Haare aus dem Gesicht. Schwarze Schlieren aus Wimperntusche überzogen ihre Wangen, und die Ringe unter ihren Augen waren tief und dunkel.
Mein Atem wurde flach. »Scheiße«, flüsterte ich. »Payton, was ist passiert? Bitte rede mit mir.« Sie sagte kein Wort und hörte nicht auf zu weinen. Mit zitternden Händen fuhr sie sich immer wieder über das Gesicht.
»… kann nicht«, stieß sie hervor. »Sarah …« Ihre Stimme erstarb, dann schlang sie erneut die Arme um mich, als würde sie zerbrechen, wenn sie sich nicht an mir festhielte.
Mein donnernder Herzschlag erfüllte meine Ohren. Ich kämpfte mich vom Boden hoch, setzte mich neben sie, ohne mich von ihr zu lösen. Eine Weile ließ ich zu, sie einfach nur zu halten, und strich ihr immer wieder über den Rücken, hauptsächlich weil mein Kopf wie leer gefegt war und ich keine Ahnung hatte, was ich sonst tun sollte. Ihr dünner Cardigan tropfte, genau wie ihr knielanges blaues Kleid.
»Komm schon, Pay«, flüsterte ich und klemmte ihr die nassen Haare hinter ein Ohr. »Du musst aus den Sachen raus und brauchst Handtücher.« Ich schnappte mir die zusammengeknüllte dünne Decke neben mir und warf sie über Paytons Schultern. Mein Blick blieb an ihrem Knie hängen. An einem Schatten.
Blitzschnell schob ich den Saum ihres Kleides nach oben und schnappte nach Luft. »Fuck!« Der blaue Fleck auf ihrer hellbraunen Haut war eine Monstrosität! Er zog sich vom linken Knie bis mittig auf die Innenseite ihres Oberschenkels. Eine lila-blaue, wütende Sturmwolke. Aber da waren noch mehr auf ihren Beinen. Kleinere. An den Knien, der Außenseite ihrer Schenkel, den Schienbeinen, den Waden.
Mein Kopf zuckte nach oben, und ich sah Payton mit aufgerissenen Augen an. Mit einem Mal schnürte mir Angst die Brust zu. Echte, eisige Angst.
»Heilige, verdammte … Payton, wie ist das passiert? Hattest du einen Unfall oder so?«
Ein düsterer Gedanke kam mir, und mein Herz verwandelte sich in Eis. Ich packte ihre Schultern, kurz davor, ebenfalls in Tränen auszubrechen. »Payton, wer war das? Woher kommen die?«, fragte ich.
Sie presste die Augen zu. Ihr Kinn zuckte, und nichts als unkontrollierte Laute lösten sich von ihren geteilten Lippen. Sie wiegte sich vor und zurück und schob den Saum wieder nach unten. Ich hob ihren Kopf an, damit sie mich ansah. Und als sie es tat, wünschte ich mir fast, dass sie es nicht getan hätte. Ihre braunen Augen waren leer. Hoffnungslos.
»Nein«, wisperte ich. Mein Mund wurde staubtrocken. »Bitte, Payton. Sag mir … sag mir, was passiert ist. Und wer das war. Wer hat das getan?«
»Alle«, flüsterte sie und schloss die Augen. »Sie alle.«
***
Es war keine leichte Aufgabe, Payton aus der nassen Kleidung zu helfen. Und diese Blutergüsse an ihren Beinen … Da waren mehr, und sie alle schienen schon einige Tage, vielleicht eine Woche alt zu sein, mit ihren grünlich-gelben Verfärbungen an den Rändern. Auf ihrem Rücken, der Hüfte, den Oberarmen und ihren Handgelenken waren auch welche. Gott, ihre Handgelenke. Die Formen der dunklen Schatten sahen verdächtig nach Fingern aus. Es zerriss etwas in mir, ihren Körper so zu sehen.
Paytons Schluchzer klangen zu einem Wimmern ab, als ich ihr ein Shirt von unserem Dad überzog, das ich mir mal stibitzt hatte, weil ich so gerne darin schlief. Dazu gab ich ihr eine meiner gemütlichsten Jogginghosen. Mehr als diese eine Frage hatte sie mir nicht beantwortet, obwohl ich es immer wieder versuchte.
Alle. Sie alle. Das war die einzige Antwort, die Payton mir gab. Es schien, als wäre sie nicht mehr richtig da, nur ihre Hülle. Ein Geist.
Sie regte sich auch dann nicht, als ich ihre Haare sanft mit einem Handtuch abtrocknete und das zerlaufene Make-up aus ihrem Gesicht wischte. Ich nahm das Handtuch anschließend mit, um die Pfützen aus Regenwasser auf dem Boden aufzuwischen. Als wir uns schließlich wieder auf das Sofa setzten, war sie ganz still. Ihr Blick glitt ins Leere. Und erst als ich das ungemütliche grelle Deckenlicht einschaltete, das Laurel und ich nur benutzten, wenn wir unsere Schlüssel suchten, sah ich es:
Paytons Pupillen waren so groß wie Untertassen.
Ich atmete tief durch und legte eine Hand auf ihre Schulter.
»Payton, bist du high?«
Erst reagierte sie nicht. Dann nickte sie langsam, ohne mich anzusehen.
»Was hast du genommen?«
Keine Antwort.
»Brauchst du ein Glas Wasser?«
Stille.
Ich gab mir große Mühe, nicht durchzudrehen. Aber fuck, Payton hatte noch nie Drogen genommen! Was war mit ihr passiert? Sie hatte noch nie in ihrem Leben auch nur an einer Zigarette gezogen, geschweige denn Gras geraucht. Betrunken war sie auch erst ein Mal gewesen. Das war zumindest der Stand, bevor sie nach New York gegangen war. Was um alles in der Welt hatte diese verfluchte Stadt mit meiner Schwester gemacht?
»Wissen Mom und Dad, dass du hier bist?«, fragte ich und zwang mich, meine Stimme ruhig klingen zu lassen. Obwohl es in mir brodelte wie der Sturm draußen.
Wenigstens kam diesmal eine Reaktion, und sie schüttelte den Kopf.
»Hast du irgendwem gesagt, dass du in San Francisco bist?«, bohrte ich weiter.
Wieder nur ein Kopfschütteln.
»Bist du vom Flughafen aus mit dem Taxi hergefahren?«
Sie nickte.
Ein Schlüssel drehte sich im Schloss, und ich sprang auf. Payton zuckte nicht mal mit einer Wimper. Lag das an dem, was sie eingenommen hatte?
Laurel stolperte lachend in die Wohnung, Emma im Schlepptau. »Rate, wer seinen Geldbeutel mal wieder vergessen …«
Sie verstummte, als sie Payton auf dem Sofa entdeckte. Dann schoss ihr Blick zum Koffer, der neben ihr an der Tür stand. »Oh.« Das war alles, was sie sagte. Und obwohl Payton nicht länger schwarze Schlieren im Gesicht hatte oder weinte, begriff Laurel schnell, dass etwas ganz und gar nicht stimmte – was entweder an Paytons mangelnder Reaktion lag, ihren verheulten Augen oder meiner aufgelösten Erscheinung.
»Oh. Oh Shit«, murmelte sie und drehte sich zu Emma um. »Hey, Em, ich glaube, wir haben hier einen kleinen Notfall. Vielleicht wäre es besser, wenn du gehst. Ist das okay für dich?«
»Kann ich irgendwas tun? Braucht ihr meine Hilfe?«, fragte Emma, den beunruhigten Blick auf Payton gerichtet.
Laurel schüttelte hastig den Kopf. »Schon okay, Baby. Ich rufe dich morgen an, ja?«
»Na gut. Aber wenn ich etwas für euch tun kann, schreib mir bitte.«
Im nächsten Moment war Emma fort, und Laurel eilte in ihren quietschenden Doc Martens zu uns. Sie setzte sich auf den Pouf und nahm Paytons schlanke Finger in die Hände. Das löste endlich eine Reaktion bei meiner Schwester aus: Sie zuckte zusammen.
»Sie ist high«, sagte ich und setzte mich wieder, bevor Laurel fragen konnte. Mein Knie wippte wie ein Presslufthammer auf und ab, und ich kaute an meinem Daumennagel. »So richtig high. Sie kann kaum sprechen.«
»Ach du Scheiße, Payton und high?« Laurel schnappte nach Luft, als sie die Blutergüsse bemerkte, und fluchte noch ausgiebiger. »Was zum …! Was ist passiert? Wer war das?«
Plötzlich schluchzte Payton wieder. Sie schloss die Augen und biss sich auf die Unterlippe.
Ich konnte nicht anders, als erneut die Arme um sie zu schlingen und sie festzuhalten. Diesmal stiegen auch mir die Tränen in die Augen. Aber ich weinte nicht. Ich bot jegliche Kraft auf, um stark zu bleiben.
»Alles wird wieder gut«, schwor ich und streichelte ihr über den Kopf. »Aber du musst uns helfen, Payton. Du musst uns sagen, was wir für dich tun können.«
Laurel schloss sich der Umarmung an. »Es wird alles wieder gut, Süße. Und sobald du wieder klar denken kannst, reden wir. Deal?«
»Ich …«, flüsterte Payton. Sie schniefte. »… nicht zurück.«
»Zurück?«, fragte ich sofort, mit einem Mal aufgeregt, endlich mehr aus ihr herauszubekommen. »Wohin? Nach New York?«
»Ich will … ich kann … ich …« Sie zitterte. »Bitte … schickt mich nicht dorthin zurück.«
Mehr bekamen Laurel und ich nicht aus ihr heraus. Es dauerte nicht lange, dann schlief meine Schwester auf dem Sofa ein. Ich deckte sie zu und stellte ein Wasserglas neben sie. Eine geschlagene Stunde tat ich nichts anderes, als neben ihr zu wachen. Schließlich zog Laurel mich mit sich in ihr Zimmer. Sie schloss die Tür, und wir setzten uns auf ihr Bett ans offene Fenster.
Mit fahrigen Bewegungen zündete sie sich eine Zigarette an und blies den Rauch mit einem schweren Stoß aus. Meine Sicht verschwamm, und ich blinzelte schnell, ehe ich mir mit beiden Händen über das Gesicht rieb. »O Gott, Laurel. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Am liebsten würde ich die Polizei rufen.«
Der Wind hatte nachgelassen, der Regen jedoch nicht. Wieder erhellte das Licht eines Blitzes die Welt. Ein Donnergrollen folgte so laut, dass es mir in den Ohren klingelte. »Vielleicht warten wir damit lieber, bis sie wieder ansprechbar ist«, sagte Laurel und nahm erneut einen tiefen Zug. »Willst du wirklich, dass eure Mom irgendwas hiervon herausfindet?«
Ich blickte in den Regen. Das hier war keine kleine Sache. Es schien mir eine Nummer zu groß, um ein Geheimnis draus zu machen. »Payton ist hergekommen«, überlegte ich laut, »sie ist nicht zu Mom und Dad gefahren. Du hast recht, wir hören uns erst mal an, was sie zu sagen hat, bevor wir irgendjemanden informieren. Du weißt ja, wie meine Eltern sind, ich kann mir schon vorstellen, wieso Payton in ihrem Zustand nicht nach Hause gefahren ist.«
Laurel nickte bedächtig. »Wohl wahr. Payton sollte entscheiden, ob sie euren Eltern davon erzählen will. Oder der Polizei.«
»Außer, wir können ihr nicht helfen«, sagte ich. »Dann habe ich keine andere Wahl, als unsere Mom anzurufen.«
Meine Kehle war so eng, dass ich kaum atmen konnte. Wir schwiegen, während Laurel sich vor Stress gleich noch eine Zigarette anzündete. Ich konnte das Beben in meiner Brust nicht länger aufhalten. Stille Tränen sammelten sich in meinen Augen, und eine rann meine Wange hinab.
»Ich hab es dir gesagt«, flüsterte ich, ohne sie fortzuwischen.
»Das hast du«, murmelte Laurel.
»Ich hab dir gesagt, dass etwas nicht stimmt.«
»Ich weiß.«
Schniefend rieb ich mir über die Nase und sah Laurel an. »Drogen. Von allen Menschen auf der Welt ist ausgerechnet Payton high. Und sie sieht aus, als ob … als wäre …« Ein Schluchzen entfuhr mir und ich presste aufgebracht die Lippen zusammen. »Gott, ich glaube, ich muss mich übergeben.«
»Echt jetzt? Brauchst du einen Eimer?«
Ich schüttelte den Kopf und atmete tief durch. Nicht zerbrechen. Keine Horrorszenarien ausmalen. Am liebsten wäre ich ins Wohnzimmer gegangen, um meine schlafende Schwester aufzuwecken und Antworten aus ihr herauszuschütteln. Gleichzeitig wollte ich sie fest umarmen und erst dann loslassen, wenn es ihr wieder gut ging.
Laurel ergriff sanft meine Hand. Es war ein seltener Anblick, so viel Angst in ihren dunklen Augen zu sehen, doch da war sie. Und sie spiegelte vermutlich meinen eigenen Gesichtsausdruck wider. »Hey, alles wird gut, Sarah. Morgen früh reden wir mit Payton, und dann überlegen wir weiter, ob wir euren Eltern Bescheid sagen oder der Polizei oder sonst wem, okay? Payton ist hier, gleich nebenan. Wir haben sie im Auge. Am wichtigsten ist jetzt erst mal, für sie da zu sein, egal, was mit ihr passiert ist.«
Ich nickte, konnte vor lauter Emotionen nicht sprechen.
Laurel drückte die Zigarette im überfluteten Aschenbecher vor dem Fenster aus. »Wieso gehst du nicht schlafen? Ich wollte sowieso noch ein paar Folgen Bridgerton schauen. Ich setze mich mit Kopfhörern ins Wohnzimmer, falls sie aufwacht. Okay?«
Ich konnte nicht anders, als sie zu umarmen. »Danke, Laurel. Du bist die Beste.«
Ich machte mich bettfertig und lag anschließend hellwach in meinem Zimmer. Payton war hier. Hier in Laurels und meiner Wohnung. Nach über einem halben Jahr sahen wir uns endlich wieder. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Universum hatte einen makabren Humor. Vorsicht mit dem, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen.
Die Dunkelheit erdrückte mich, und ich hielt die Stille im Zimmer kaum aus. Eine Träne löste sich aus meinem Augenwinkel. Weitere folgten, als ich mich auf die Seite drehte und mein Kissen umklammerte. Aber es war keine Angst, die mich wachhielt. Die mich unter Strom setzte.
Es war Wut.
Alle. Sie alle.
KAPITEL 4 Vom Regen in die Traufe
Nach einer viel zu kurzen, unruhigen Nacht kämpfte ich mich aus dem Bett. Payton schlief noch wie ein Stein. Sie schlief auch dann noch, als Laurel neben ihr mit ihrem Laptop und Kopfhörern wieder Stellung bezog und ich, frisch geduscht, in Momjeans und einem Holzfällerhemd, die Wohnung verließ, um Frühstück zu besorgen. Alles in mir sträubte sich dagegen, zum Bagel-Laden um die Ecke zu gehen, aber ich wollte nicht zu lange fortbleiben. Also sammelte ich meine innere Kraft, um mich vor der bevorstehenden Begegnung mit meinem Ex Patrick zu wappnen. Glücklicherweise war im Shop jedoch keine Spur von ihm zu sehen. Ich bestellte ein paar belegte Bagels und machte mich sofort wieder auf den Heimweg. Im Nieselregen joggte ich die steile Straße hinunter und lief das offene Treppenhaus unseres Apartmentkomplexes hinauf. Schwer atmend betrat ich die WG. Da sah ich, dass Payton in der Zwischenzeit wach geworden war. Sie saß mit angezogenen Knien auf der Couch und hatte sich Laurels Bademantel übergezogen. Sie blickte auf, die braunen Augen diesmal klar.
Der Anblick ließ vor Aufregung meinen Magen flattern.
»Guten Morgen«, sagte ich atemlos und zwang mich zu einem Lächeln. Mein Blick huschte durchs Wohnzimmer, aber von Laurel keine Spur. »Wie fühlst du dich?«
Sie wich meinem Blick aus und rieb sich mit den Händen über das Gesicht. Dann versuchte sie, durch ihre Haare zu fahren – aber keine Chance. Ich kannte es nur zu gut. So leicht unsere Locken im Gegensatz zum Afrohaar unserer Mom auch waren, sobald ich mit nassen Haaren einschlief, war das Vogelnest am nächsten Morgen perfekt. Eine Katastrophe, die ich nur mit jeder Menge Conditioner, einer Bürste und noch mehr Geduld bezwingen konnte. Payton schien zu genau diesem Schluss zu kommen, denn sie zuckte die Schultern und ließ die Hände in den Schoß sinken.
»Mein Schädel brummt«, murmelte sie mit rauer Stimme.
Ich atmete tief durch, ehe ich mich neben sie setzte und die Papiertüte hochhielt. »Ich hab uns Frühstück besorgt«, sagte ich aufmunternd.
»Und ich mache gerade Kaffee!«, rief Laurel aus der Küche.
Payton verknotete die Finger und löste sie wieder voneinander. Sie hatte die Ärmel des Bademantels fast bis zu den Fingerspitzen gezogen. Und dennoch war ich mir all ihrer Blutergüsse mehr als bewusst.
»Erst Frühstück oder eine Dusche?«, fragte ich, einen Tick zu fröhlich.
Obwohl sie nicht mehr high war von was auch immer, zuckte sie nur wieder mit den Schultern und leckte sich über die Lippen. Sie war vielleicht die Ruhigere von uns beiden, aber sie war noch nie still gewesen. Im Gegenteil. Da wir uns lange ein Zimmer geteilt hatten, war es für mich oft die Hölle gewesen, denn fast jede Nacht, wenn ich hatte schlafen wollen, hatte Payton Gespräche über Gott und die Welt angefangen, sodass ich ständig mit einem genervten Stöhnen den Kopf im Kissen vergraben hatte.
Sie räusperte sich. »Frühstück. Ja, klingt gut.«
Ich zwang mich, sie nicht zu offensichtlich anzustarren. Stattdessen präsentierte ich ihr die verschiedenen Bagels. Sie entschied sich für den mit Frischkäse. Laurel und ich besaßen keinen Esstisch, weil dafür der Platz fehlte, weshalb wir uns zum Essen immer auf den Boden am Couchtisch setzten.
Es fühlte sich seltsam an, zu dritt dort zu sitzen. Laurel, Payton und ich. Ein Bild, das selbstverständlich sein sollte, und doch fühlte es sich falsch und fremd an.
Ich rieb die schwitzigen Hände an meiner Jeans ab und trank einen großen Schluck Kaffee. Die Stille, während wir aßen, war dröhnend laut.
Laurel beobachtete Payton alles andere als unauffällig und nahm einen Bissen von ihrem Bagel. »Also, Payton. Wie, äh, war dein Flug?«
Ich bedachte sie mit einem verdrossenen Blick. Small Talk? Ernsthaft?
Als ich aber sah, wie sehr Payton sich im grauen Bademantel versteifte und Laurel plötzlich mit glasigen Augen anstarrte, war ich froh, dass sie nicht mit der Tür ins Haus gefallen und nach den Tränen, den Blutergüssen oder irgendwelchen Drogen gefragt hatte.
Langsam kaute Payton weiter. »Gut«, sagte sie dann und trank ebenfalls von ihrem Kaffee.
Laurel und ich tauschten einen raschen Blick aus.
»Du hast bestimmt einen Jetlag, oder?«, stieg ich in den Small Talk mit ein. Diesmal nickte sie bloß und nahm noch einen Bissen. Ihr Appetit war jedenfalls nicht verschwunden.
Laurel wickelte sich einen dünnen Zopf mit den bunten Perlen um den Finger. »Wie findest du meine neue Frisur? Sarah hat die letzten Tage stundenlang dran gesessen.«
»Genau«, sagte ich hastig und lächelte. »Übrigens bin ich nicht mehr mit Patrick zusammen. Er hat mich betrogen, ich hab ihn in die Wüste geschickt. Zum Glück war er nicht da, als ich eben die Bagels geholt habe.«
Wir erzählten eine Alltagsanekdote nach der anderen, während Payton nichts weiter tat, als zuzuhören und manchmal mit verschiedenen Lauten wie »Hm« oder »Mhm« ein paar Reaktionen zeigte. Es war besser, als gegen eine Wand anzureden, aber es stellte genauso wenig zufrieden. Wenigstens war sie nicht mehr so drauf wie letzte Nacht.
… oder vielleicht ließ sie es sich nur nicht mehr anmerken. Mit jedem Augenblick wurde mein Magen schwerer, bis mir schließlich vollends der Appetit verging.
Als die Kaffeetassen leer und von den Bagels der anderen nicht mehr als Krümel übrig waren, hielt ich es nicht länger aus.
Ich streckte eine Hand aus und legte sie Payton auf die Schulter. »Pay«, sagte ich langsam, darum bemüht, nicht zu eindringlich zu klingen. »Du weißt, dass ich es nicht unkommentiert lassen kann, oder?«
Sie wurde blass und senkte den Blick. »Ja. Ich weiß.« Mit einem Seufzen schloss sie die Augen. »Es tut so mir leid.«
Laurel und ich tauschten erneut beunruhigte Blicke aus. Dann nahm ich Paytons Hand in meine und schob vorsichtig den Ärmel des Bademantels höher. Mein Herz krampfte sich zusammen. Die Blutergüsse sahen bei Tageslicht noch schlimmer aus.
»Wer war das?«, fragte ich angespannt. »Von wem stammen diese Abdrücke hier?« Sie hatte von allen gesprochen. Wer war damit gemeint? Ich wollte mir nicht ausmalen, dass meine Schwester vielleicht …
Ich verscheuchte den Gedanken, so schnell ich konnte, bevor mir noch das Frühstück wieder hochkam. Das Gesetz der Anziehung. Nicht vom Schlimmsten ausgehen!
Ihre Brust hob und senkte sich unregelmäßig, und in ihre Augen traten Tränen. Es war offensichtlich, wie sehr sie zu kämpfen hatte, und es brach mir das Herz. Sie atmete tief ein und aus. Ich wollte nachhaken, wollte noch einmal fragen. Doch ein warnender Blick von Laurel sagte mir, dass ich damit zu weit gehen würde. Ich musste geduldig bleiben. Musste ihr Zeit geben. Das war das Mindeste, was ich tun konnte, um für sie da zu sein.
»Peter«, flüsterte Payton nach der langen Pause. »Das war … Er hat …« Sie schluchzte auf und presste sich gleich darauf eine Hand auf den Mund, so als wäre ihr der Laut entschlüpft, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte.
Und es löste brodelnde Wut in mir aus. Ein Name.
Peter.
Peter.
Peter.
»Okay«, sagte ich mit zitternder Stimme. »Peter weiter?«
»Darlington«, stieß Payton hervor. »Peter Darlington.«