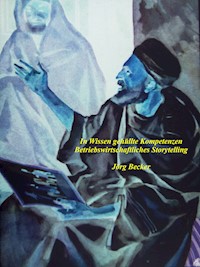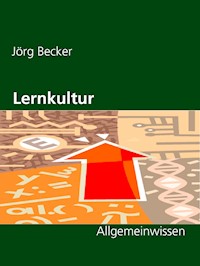Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sich vernetzend tritt der Mensch in ein Spiegelkabinett mit Myriaden technischer Agenten, die zu allen Seiten ihre unsichtbaren Fühler und Greifarme ausgestreckt haben: alles Handeln wird von einer technologischen Großstruktur umhüllt. Unfassbar sind auch die Dimensionen: für hundert Dollar Rechenleistung eines iPad wären vor siebzig Jahren noch 100 000 000 000 000 Dollar (einhundert Billionen!)aufzubringen gewesen. Die Technik ist in eine neue Undurchsichtigkeit umgeschlagen: im Hinblick auf den von vielen herbei gesehnten Decision Support brodelt bereits hinter den Bildschirmen ein Magma aus smarten Objekten. Die Konkurrenz für Führungskräfte ist härter geworden: die Globalisierung erlaubt es, aus einem viel größeren Talente-Pool zu schöpfen als früher. Es gibt Situationen, in denen Entscheidungen unter Zeitdruck schlechter sind als die in gelassener Stimmung getroffenen Entscheidungen. Oft wäre es vielleicht besser, weniger Zeit zu haben: denn je länger man nachdenkt desto stärker werden Vor- und Nachteile gegeneinander abgewägt. Vielleicht solange, bis am Ende nur noch die negativen Aspekte im Kopf herumschwirren und die Entscheidung am Ende einen bitteren Beigeschmack hinterlässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sich vernetzend tritt der Mensch in ein Spiegelkabinett mit Myriaden technischer Agenten, die zu allen Seiten ihre unsichtbaren Fühler und Greifarme ausgestreckt haben: alles Handeln wird von einer technologischen Großstruktur umhüllt. Unfassbar sind auch die Dimensionen: für hundert Dollar Rechenleistung eines iPad wären vor siebzig Jahren noch 100 000 000 000 000 Dollar (einhundert Billionen!)aufzubringen gewesen. Die Technik ist in eine neue Undurchsichtigkeit umgeschlagen: im Hinblick auf den von vielen herbei gesehnten Decision Support brodelt bereits hinter den Bildschirmen ein Magma aus smarten Objekten. Die Konkurrenz für Führungskräfte ist härter geworden: die Globalisierung erlaubt es, aus einem viel größeren Talente-Pool zu schöpfen als früher. Es gibt Situationen, in denen Entscheidungen unter Zeitdruck schlechter sind als die in gelassener Stimmung getroffenen Entscheidungen. Oft wäre es vielleicht besser, weniger Zeit zu haben: denn je länger man nachdenkt desto stärker werden Vor- und Nachteile gegeneinander abgewägt. Vielleicht solange, bis am Ende nur noch die negativen Aspekte im Kopf herumschwirren und die Entscheidung am Ende einen bitteren Beigeschmack hinterlässt.
INHALTSÜBERSICHT
Rohstoff „Wissen“ als Chefsache – ein selbstverständlicher Begriff, der so selbstverständlich nicht ist
Die Projektbeteiligten
Curling statt autoritär – alles beginnt mit Schule
Intelligence Community oder Herrschaftswissen von Datenkraken?
Algorithmengläubigkeit und virtuelle Profile - es sind die nichtfinanziellen Performancetreiber
Vor dem Projektstart: erst einmal die Ausgangslage klären
Sind alle auch wirklich fit für das Projekt?
Es ist die Strategie, die den kritischen Weg bestimmt – ein modernes Märchen der Erleuchtung
Sicherung von Erfahrung braucht den Transfer von Wissen
Das vernetzte Zusammenwirken von Business Intelligence in der Endlosschleife
Die Bereitschaft, Regeln zu ändern und der Mut, zu einem fragilen Wissen zu stehen
Philosophie des Vertrauens auf eigene Stärken
Menschliche Arbeit und Kompetenz als Quelle von allem
Auf intelligente Strukturen kommt es an – ohne dynamische Außenbeziehungen ist alles nichts
Von den kommunikativen bis hin zu den logistischen Beziehungen
Wie bei einem Eisberg – vieles liegt unsichtbar unter der Oberfläche
Unternehmenswissen bewerten –aber wie?
Auch ein Alphatier muss gegen Luftschlösser gut geerdet sein
Im unausweichlichen Sog der Digitalwirtschaft
Sharing Economy - Ökonomie des Teilens und der Vernetzung
Und endlich das Projektergebnis – Zusammenstellung und Auswertungen der Wissensbilanz
Fazit – hat sich die Sache gelohnt?
Der letzte Schliff im Fein-Tuning
Zeitfresser Meeting – damit die Sache nicht aus dem Ruder läuft
Wissenstransfer und Präsentationsfolie
Computer als Controller
Wissen – ein Projekt, das niemals endet und rückblickend jedermann persönlich tangiert
Rohstoff „Wissen“ als Chefsache – ein selbstverständlicher Begriff, der so selbstverständlich nicht ist
Der General Manager hatte sich seine Auszeit irgendwie anders, erholsamer vorgestellt. Es war nicht zum ersten Mal, dass er eine Phase beruflicher und nervlicher Überforderung zu verdauen hatte. Er wusste, dass dies ein Gefühl der inneren Leere erzeugen konnte, obwohl ansonsten jeder Tag und das ganze Leben randvoll und überquellend scheinen mochte. Er aber wurde leer von Erschöpfung. Leer, weil er glaubte, sich in einem Hamsterrad zu drehen. Und keine Gelegenheit fand, den Akku aufzuladen. Alles verschwamm ohne Perspektive. Nichts war mehr wie vorher. Hinter ihm klatschte das Wasser müde gegen die Molen, und manchmal schabten die Fender der vertäuten Fischkutter leise gegen das Holz der Anlegestelle. Der Tag war heiß und vollkommen windstill. Es roch nach Meerwasser, Schlick und Algen. In der Nähe von Wasser hatte er noch nie eine so klare Abgrenzung einzelner Gerüche erlebt. Und wenn der Wind vom Wasser herein strich, mischte sich alles wieder durcheinander. Eine schläfrige Mittagsstimmung machte sich breit. Er musterte die Spielhalle, mit der zur Straße hin weit geöffneten Glasfront. An der Bar hingen ein paar Leute herum und waren das Aufblinken der zahlenlosen roten, grünen oder blauen Lichter an den Automaten vertieft. Die ihnen einen Gewinn zumindest für einen nächsten Drink zu versprechen schienen.
Dem Manager wurde immer bewusster, dass es nur jegliche Form von Wissen ist, was das Gedächtnis seines Unternehmens ausmacht. Wissen ist das Wertvollste, was ein Unternehmen besitzt. Wissen ist der einzige Rohstoff, der sich durch Gebrauch vermehren lässt. Wissen ist in den Köpfen der Mitarbeiter gespeichert. Wissen ermöglicht durch Transfer Multiplikatoreffekte. Wissen muss geschützt und gesichert werden. Wissen muss identifiziert werden. Wissen muss bewertet werden. Wissensmanagement ist Chefsache. Was nicht gespeichert ist, hat nicht stattgefunden, ist demnach kein Wissen. Wissen wird über Datenwolken an Dritte ausgelagert. Google verfügt über die größte Wissenssammlung der Welt. Wissen, das im Internet frei verfügbar gemacht wurde, hat damit seinen Wert verloren. Information ist nicht gleich Wissen.
Wie jeden Freitagnachmittag um drei tagte im Konferenzraum der Chefetage -in einem eher unscheinbaren Gebäude der Bürostadt- das Managementteam der Firma, um sich über die wichtigsten Projekte der nächsten Zeit abzustimmen, Aktivitäten zu koordinieren und falls erforderlich, zielführenden Maßnahmen zu beschließen. Ein Projekt „Wissen“ hatte es so bisher noch nicht gegeben. Auch nicht in ähnlicher Form. Jedenfalls konnte sich niemand im Raum daran erinnern. Der Projektmanager Wissensbilanz wollte daher zunächst einiges Grundsätzliches zum Projektmanagement vortragen und eröffnete die Gesprächsrunde mit Ausführungen zu Projektzielen und Projektphasen: „Der erste Schritt bei der Lösung eines Geschäftsproblems besteht in der Modellierung eines adäquaten Lösungspfades. Denn unser geplantes Projekt kann erst zur Lösung beitragen, wenn ein Geschäftsproblem auf Beschreibungs- oder Vorhersageproblemen beruht. Zur weiteren Vorgehensweise gehört ein Phasenkonzept, das meistens eine oder mehrere Prototypstufen umfasst. Diese Prototyping Vorgehensweise ermöglicht uns, kurzfristig ein überschaubares (Teil-) System produktiv einzusetzen, um damit auch die Akzeptanz, den Datentransfer oder die praktischen Anwendungsoptionen real testen zu können. Die dabei gewonnenen Erfahrungen können beim anschließend realisierten Zielsystem berücksichtigt werden. Dieses Vorgehen ist nicht nur erheblich kostengünstiger, sondern ermöglicht auch kürzere Einführungszeiten als die konventionelle Vorgehensweise.“
Der Assistent der Geschäftsleitung, noch relativ neu in diesem Kreis, rutscht seit geraumer Zeit schon unruhig auf seinem Sitz hin und her und meldet sich jetzt auch zu Wort: „Werden für die Bewertung eine Vielzahl von Einzelkriterien innerhalb von Kriteriengruppen benotet und gewichtet, könnte sich durch die reine Addition der hieraus errechneten Bewertungsziffern aber ein Ungleichgewicht ergeben. Unter Umständen besteht die Möglichkeit, dass nicht die optimale Lösung ermittelt wird. Es sollte daher noch eine zweite Beurteilungsstufe durchlaufen werden, bei der die Kriteriengruppen als Ganzes gewichtet und mit den relativierten Gruppenbewertungsziffern multipliziert werden. Die Addition dieser Werte ergibt eine Gesamtbewertungsziffer mit höherer Aussagekraft.“
Währenddessen träumt der Informationsmanager vor sich hin: „Beim Googeln käme an einem Abend so viel an Energie frei, dass man damit im Winter sein Zimmer heizen könnte. Allerdings wird diese Energie in den Google-Centern frei. Denn Mikrochips absorbieren mit ihrem Energiehunger diverser Internetserver etwa zwei Prozent des Energiebedarfs der Menschheit. Die damit einhergehende Abwärme ist enorm.“ Doch dann konzentriert er sich schnell wieder auf das eigentliche Thema und weist auf notwendige Bearbeitungsschritte hin: “Datenauswahl-Phase: Identifikation aktueller und potentieller Daten für das Projekt. Dabei wird definiert, welche Daten idealerweise zur Verfügung stehen müssten, um anstehende Geschäftsprobleme angemessen lösen zu können. Für fehlende Datenbestände muss überlegt werden, ob diese extern beschafft werden können. Datentransformation-Phase: Generierung von Tabellen und Bearbeitung der Input-Daten, beispielsweise fehlende Werte eliminieren oder durch statistische Schätzwerte ersetzen. Datenexploration-Phase: den Endbenutzer vor der Mustererzeugung mit den zugrunde liegenden Daten vertraut machen. Generierung von Mustern, wobei die einzelnen Schritte im Wesentlichen von der benutzten Software abhängig sind. Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen automatischem und interaktivem Wissensmanagement. Im interaktiven Programm könnten verschiedene Einstellungen verändert werden (z.B. für Verzweigungskriterien, Darstellung der Ergebnisse). Phase der Ergebnisinterpretation: bevor Ergebnisse im Rahmen des Problemlösungsprozesses verwendet werden können, müssen sie validiert und interpretiert werden. Beispielsweise muss ausgeschlossen werden, ob sie vielleicht auf Fehlern bei der Datentransformation beruhen. Verteilung der Ergebnisse: das freigelegte Wissen gewinnt erst dadurch an Wert, dass die relevanten Entscheider Zugang zu den Informationen erhalten. Es sollte so etwas wie ein Datenwürfel zusammengestellt werden, der die wichtigsten Informationen an Mitarbeiter verteilt, die dann damit auch eigene, weiterführende Analysen durchführen können“.
Der Controller war jemand, der sich nur selten in die Karten blicken ließ, der bei Besprechungen oder zu Beginn eines wichtigen Projektes nie eine Meinung vertrat und trotzdem den Eindruck vermittelte, immer eine starke Problemlösung in der Hinterhand zu haben, die er je nach Bedarf jederzeit hervorziehen und auf den Tisch legen konnte. Er nahm immer in einiger Entfernung vom Besprechungstisch Platz, vermied es geschickt, sich der Runde aufzudrängen. Er ergriff das Wort und erklärte an die Runde gewandt: „Unter den verschiedenen, u.a. statischen Verfahren der Investitionsrechnung wäre eine Kostenvergleichsrechnung das einfachste Verfahren der Investitionsplanung: die Kosten der einzelnen zur Entscheidung anstehenden Alternativen werden gegenübergestellt. Als Ergebnis erhält man eine Auswahl des kostengünstigsten Projektes. Da die Information fehlt, ob die erzielbaren Erlöse über den ermittelten Kosten liegen, ist zwar ein absoluter Vorteilhaftigkeitsvergleich nicht möglich. Dafür wird durch die starken Vereinfachungen aber die Anwendbarkeit des Verfahrens erleichtert. Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Methode ist, dass die Investitionsalternativen die gleiche quantitative und qualitative Leistung abgeben. Bei den Kosten ist zu unterscheiden zwischen a) einmaligen Kosten, die nur einmal -in den meisten Fällen zu Beginn- anfallen (z.B. Investitionen für Hard- und Software, Entwicklungs-, Umstellungskosten) und b) wieder-kehrenden (laufenden) Kosten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind. Einmalige und wiederkehrende Kosten dürfen nicht einfach addiert werden, da aus den einmaligen Kosten zunächst getrennt die jährlichen Abschreibungen und die Verzinsung des investierten Kapitals ermittelt werden müssen. Und zur Rentabilitätsvergleichsrechnung: Vorteilhaftigkeitskriterium ist bei diesem Rechenverfahren die Rentabilität der analysierten Projekte. Die Rentabilität wird aus dem Verhältnis von Periodengewinn zu eingesetztem Kapital errechnet. Dabei lässt sich ermitteln, welche Rendite das durchschnittlich gebundene Gesamtkapital über die Verzinsung des Fremdkapitals und die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals hinaus erzielt. Ein Projekt ist dann vorteilhaft, wenn die durchschnittliche Überrendite > 0 ist, bei mehreren Projekten ist dasjenige mit der höchsten Überrendite am vorteilhaftesten. Zusätzlich zur Überrendite können ergänzend Kennziffern für die Gesamtkapitalverzinsung berechnet werden“.
Für den Assistent der Geschäftsleitung war die Arbeit in der Firma sein erster Job nach dem Studium. Rein zufällig war er dabei in den Sog der rasanten Karriere seines Chefs geraten. Von dessen Tempo und Anspruch fühlte er sich manchmal überfordert. Zumal er selbst noch nicht reif für die Macht war. Er war noch nicht soweit, jemand Wichtiges zu sein, die rechte Hand eines gestandenen Managers. Oder jemand, mit dem man sich gut stellen musste, um bei seinem Chef Gehör zu finden oder bei dessen Entscheidungen gehört zu werden. Aber er vertraute auf seine Fähigkeit, Hürden zu überwinden, zu lernen und sich durchzusetzen. Er sagt dazu: „Das durchschnittlich gebundene Gesamtkapital könnte man in einer Renditeformel als einfaches arithmetisches Mittel zwischen der Kapitalbindung am Anfang der 1. Nutzungsdauerperiode und der Kapitalbindung am Anfang der letzten Nutzungsdauerperiode ermitteln. Aus Vereinfachungsgründen sollte man zusätzlich die Annahme einer über die Nutzungsdauer des Projektes gleichbleibenden Finanzierungsstruktur (Verhältnis Eigen- zu Fremdkapital) machen. Während nach dem Kriterium „Überrendite“ jedes Projekt mit einer Rendite größer oder gleich Null als vorteilhaft angesehen wird, gilt nach den Kriterien „Eigenkapitalrendite“ und „Gesamtkapitalrendite“ eine Projektalternative als wirtschaftlich, wenn sie ihre Rendite über der gewünschten Mindestverzinsung (beispielsweise 10 Prozent) liegt“.
Der Controller fährt fort: „Und mit einer Amortisations- und Payback-Rechnung könnte wir die Zeitspanne messen, die notwendig ist, um unsere Projekt-Investition zu amortisieren, d.h. durch Bargeldrückfluss abzuzahlen. Dies ist somit die Zeitdauer, die bis zur Wiedergewinnung der Anschaffungsausgabe aus den Einnahmeüberschüssen des Projektes verstreicht. Wenn der Bargeldrückfluss für jedes Jahr einheitlich ist, kann die Payback-Periode durch die Teilung der Investition mit dem jährlichen Cashflow errechnet werden. Aufgrund der Durchschnittsbildung könnte der Fall eintreten, dass für unser Projekt eine sehr kurze Pay-off-Dauer errechnet wird, obwohl alle Einzahlungsüberschüsse erst gegen Ende der Nutzungsdauer anfallen. Die Amortisationsrechnung wird in der Praxis sowohl zur Beurteilung einer einzelnen Investition als auch zum Alternativenvergleich herangezogen. Bei Einzelprojekten lässt sich lediglich ermitteln, ob die Anschaffungsausgabe innerhalb der geplanten Nutzungsdauer zurückgewonnen werden kann. Zwar ist damit noch keine rechnerische Aussage über die Wirtschaftlichkeit möglich. Eine solche wird erst dadurch gewonnen, dass sich in der Praxis oft branchenspezifische Erfahrungswerte herausgefiltert haben, welche darauf hinweisen, ob ein Projekt als wirtschaftlich anzusehen ist, beispielsweise: die Pay-off-Periode darf maximal 50% der geplanten Nutzungsdauer betragen. Für unsere Entscheidung stehen bei dieser Art der Rechnung grundsätzliche Sicherheitsziele, weniger exakt quantifizierbare Einkommensziele, im Vordergrund der Betrachtung“.
An dieser Stelle meldet sich der General Manager erstmalig zu Wort. Er konnte ein unglaublich intensiver Zuhörer sein, so als wollte er die Informationen aus einem heraussaugen. Meistens versorgte er sich aus mehreren Quellen gleichzeitig. War er mit etwas einverstanden, konnte er seinem Informationslieferanten manchmal geradezu schamlos Komplimente erteilen. Jetzt trug er ein wenig zu dick auf und schien das auch selbst zu spüren, nahm sich zurück, strich wie ein Tiger um den Tisch herum und sagte zu den anderen: „Entscheidend für die Projektbeurteilung ist nicht nur die absolute Zeit der Rückgewinnungsdauer in Jahren. Diese ist zusätzlich zur technischen Lebenserwartung oder der geplanten Nutzungsdauer des Projektes ins Verhältnis zu setzen. Daraus ergibt sich die relative Pay-off-Dauer als aussagefähigerer Maßstab. Umfangreiche Projekte wie dieses hier zeichnen sich aus durch u.a. hohen Organisationsaufwand, eine möglicherweise über mehrere Rechnungsperioden hinweg andauernde Laufzeit, hohen Vorfinanzierungsbedarf. Unter den Finanzbedarf fällt unabhängig von der Deckung jede Art der Verpflichtung zur Zahlung. Der Kapitalbedarf errechnet sich als Saldo des Finanzbedarfs mit den Einzahlungen. Als Planungsinstrument wird der Projektablaufplan herangezogen, in dem die zeitliche Struktur des Projektes abzubilden ist. Nach Möglichkeit sollten bei der Aufstellung des Projektablaufplanes auch zeitliche Interdependenzen zwischen einzelnen Planungsschritten berücksichtigt werden. Zeitkritische Vorgänge, deren Verzögerung sich unmittelbar auf den Endtermin auswirken würde sollten ebenso festgestellt werden wie Schritte, in denen Pufferzeiten vorhanden sind. Allen Schritten des Projektablaufplans sollten dann auszahlungs-relevante Positionen zugeordnet werden. Hierbei finden zunächst nur die variablen Projektkosten, d.h. nur direkt durch das Projekt hervorgerufene Zahlungsströme, Berücksichtigung. Lohnzahlungen werden, falls sich das Projekt nicht unmittelbar auf den Personalbestand auswirkt, zunächst nicht mit aufgenommen. Kurzfristig von außen zugekaufte Fremdleistungen oder Manpower-Stunden sind jedoch zu erfassen. Je nach geplanter Deckung des Kapitalbedarfs können die Zahlungsströme um Fremdkapitalzinsen und Tilgungszahlungen ergänzt werden“. Manche der Anwesenden hatten schon bessere Reden und bessere Redner gehört. Aber sie hatten auch noch niemanden erlebt, der mit solch traumwandlerischer Sicherheit Fühlung mit seinen Zuhörern aufnahm.
Der Wissensmanager fragt in die Runde: „Sind nicht Wissenschaftler so etwas wie die Dichter der modernen Welt?“ Einer der Gesprächsteilnehmer antwortet ihm: „Leider liegen die Dinge noch nicht so. Es fehlt noch viel. So ist auch die Mathematik nicht die Dichtkunst, die Dichtkunst ist nicht die Mathematik der Phantasievorstellungen. Und Ingenieure sind auch nicht die Dichter der Wirklichkeit. Denn Dichtkunst ist noch immer das, was sie schon immer war: ein langsames, wenig präzises Mittel, das Unausdrückbare auszudrücken, ein oft mühsamer Prozess der Annäherung Verallgemeinerung. Und so ist auch die Wissenschaft zuerst einmal ein Mittel, sich der Wirklichkeit zu nähern“. Doch dann konzentriert er sich auf das Thema dieser Sitzung und referiert anhaltend und ohne eine Pause einzulegen: „Ein Projekt Wissen ist strategiebezogen und erfordert deshalb einen ganzheitlichen Ansatz aus Funktionen, Verantwortlichkeiten, Prozessen und Technologien. Unser Projekt weist aufgrund der Strategiebezogenheit eine im Vergleich zu anderen Projekten höhere Komplexität auf. Das Projekt Wissen erfordert deshalb eine längere Zeitdauer, intensivere Inanspruchnahme der Mitarbeiter, höheren Aufwand, stärkere Einbeziehung und Beteiligung des Managements und höhere Veränderungsbereitschaft (Change Management). Bereits vor dem Start des Projektes sollte deshalb auch das Management über die wesentlichen Ziele und zu erwartenden Projektschritte informiert werden. Während der gesamten Projektlaufzeit sollte sich das Projektteam sowohl auf die Information der betroffenen Mitarbeiter als auch auf die Einbeziehung ggf. der verschiedenen Geschäftsbereiche konzentrieren. Möglicherweise unterschiedliche Informationssysteme sollten soweit wie möglich in einer einheitlichen Softwarelösung integriert werden. Der Start des Projektes sollte nach dem „Quick-Win“-Konzept auf ein priorisiertes Teilprojekt beschränkt/ konzentriert werden. Das Projekt Wissen unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von anderen Projekten: es ist keine Insellösung, es ist immer abteilungsübergreifend umzusetzen. Die Kundensicht steht im Zentrum und erfolgt als Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb vorrangig über Prozesse (weniger über Produkte). Environmental Scanning: Mit Unterstützung durch das Projekt Wissen lassen sich gleichzeitig sowohl Qualität als auch Aussagekraft von Analyse-Datenmaterialien verbessern. Durch eine entsprechende Korrelation mit aggregierten operativen Daten kann ein erhebliches Informationsmehrwert-Potenzial erschlossen werden. In dem Projekt Wissen müssen immer auch genau die betrieblichen Umfeldfaktoren beobachtet werden. Dieses „environmental scanning“ ist besonders dann unerlässlich, wenn wir länderübergreifend agieren, um eine Vielzahl von Daten in aktuelle Informationen zur Entwicklung von strategierelevanten Umfeld-faktoren auszuwerten. Neben quantitativen indexbasierten Informationen muss auch eine große Anzahl qualitativer Informationen in das Wissenssystem eingespeist werden.
Korrelation mit externen Daten für die Informations-„Endmontage“: Unternehmensentscheidungen basieren einerseits auf unternehmensinternen Informationen (Kunden, Produkte, Zulieferer), andererseits müssen auch externe Informationen (Konjunktur-, Markt-, Konkurrenzdaten, demographische und geographische Daten) mit einbezogen werden. Dabei dient ein Datenwarehouse als „Informationslager“ für alle Arten analyse- und entscheidungsrelevanter Daten. Das Aufgabenspektrum lässt sich mit einem Zwischenlager in einem produzierenden Betrieb vergleichen: analog bis zur Weiterverarbeitung zwischen den Produktionsstufen gelagerten Halbzeugen liefern die in den operativen/ transaktionsorientierten Systemen gespeicherten Daten den Rohstoff zur „Endmontage“ der entscheidungsunterstützenden Informationsverarbeitung. Dabei werden Daten in verständliche, entscheidungsorientierte Informationseinheiten transformiert, Aggregationen vorgenommen und zugleich Unternehmensdaten aus mehreren, heterogenen und inkonsistenten Datenquellen zusammengespielt.“
Der Informationsmanager ergänzt diesen Vortrag zusätzlich aus seiner Sicht: „Zur Vorgehensweise der Projektabwicklung gehört ein klares Phasenkonzept, das auch eine oder mehrere Prototypstufen umfasst. Für den Erfolg des Projektes ist somit eine unabdingbare Voraussetzung, dass die Abfolge der einzelnen Aktivitäten in einem Vorgehensmodell genau an-/ zugeordnet werden kann. Dieser vollständige Projekt-Design umfasst in detaillierter Form Problemfeldanalyse, Zielfindung, Stakeholder-Analyse mit Machbarkeitsstudie, Planung Zeit/ Ressourcen/ Sachmittel/ Budgets, grobes Fachkonzept mit „Paketisierung“ und Priorisierung des Gesamtprojektes in Teilprojekte, Feinplanung der Teilprojekte mit detailliertem Fachkonzept, detailliertes technisches Konzept, Realisierung mit technischer/ organisatorischer Pilotierung, Einführung, Roll-out in die Organisation (z.B. mit Prototyping), Übergabe der Verantwortung an die Linie. Dabei kann jede dieser Phasen für sich gesehen auch als ein eigenes Projekt gesehen werden. Problemfeldanalyse – Initialphase: zum Beginn des Projektes muss zunächst der aktuelle Ist-Zustand aufgenommen werden. Damit wird durch die detaillierte Kenntnis der Problemstellung die für das Projekt notwendige Transparenz geschaffen: Grundlage kann die Analyse aller bereits vorhandenen Informationen aus verwandten Projekten oder vorherigen Studien bilden. Hierauf aufbauend können (z.B. in mehrtägigen Workshops, Diskussionsrunden in Kleingruppen) die aktuellen Prozesse, Stärken und Schwächen und größten Verbesserungspotenziale erhoben werden. Die Resultate aus der Erhebung können (gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit externen Beratern/ Fachexperten) zusammen-gestellt und nach ihrer voraussichtlichen Erarbeitungs- und Einführungsdauer in kurz- und langfristige Maßnahmen gegliedert und auf ihre Strategieverträglichkeit geprüft werden. Wichtig ist hierbei auch eine Stakeholder-Analyse, mit der die wesentlichen Interessenträger in dem Projekt identifiziert werden. Dieser Teilnehmerkreis sollte von einer fachkundigen Person (beispielsweise im Rahmen eines Lenkungsausschusses) moderiert werden, die selbst keine eigenen Interessen hat, beispielsweise von einem unabhängigen externen Berater. Interessenträger sind: Sponsoren welche die Projektziele aktiv unterstützen, Bedenkenträger die sich aus verschiedenen Gründen (z.B. befürchteter Kompetenzverlust) gegen das Projekt wenden. Da sich das Projekt in einem sich dynamisch verändernden, häufig zeitkritischen Umfeld bewegt, sollte auch die Stakeholder-Analyse kontinuierlich fortgeschrieben und gemäß der jeweiligen Situation aktualisiert werden, d.h.: oft wird das Beharrungsvermögen der Organisation unter-schätzt, nur ein aktives Veränderungsmanagement führt zur Adapationsfähigkeit der Organisation und damit zur Erreichung der Projektziele“.
Einige der Gesprächsteilnehmer sind am Limit ihrer Aufnahmebereitschaft angelangt und sehnen sich nach einer Vertagung oder Fortsetzung des Projektes zu einem Zeitpunkt frühestens nach einigen Tagen. Der General Manager, innerlich selbst schon längst auch dieser Meinung, beendet das Meeting zum Projekt Wissen und weist seinen Assistenten an, in den nächsten Tagen einen Fortsetzungstermin zu organisieren und alle Anwesenden hiervon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Die Projektbeteiligten
Zwar ist die digitalisierte, globalisierte Welt mittlerweile so differenziert und komplex, dass hierfür umso mehr individuelles, hochspezialisiertes Nischenwissen benötigt wird. Manchem fällt es vor solchem dynamischen Grundrauschen schwer, vorausschauend zu planen und zu handeln. Wem also gehört die Zukunft? den Spezialisten? den ganzheitlichen Generalisten? Für die Bewältigung vieler Probleme werden verschiedene Spezialisten (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, IT-Spezialisten u.a.) benötigt. Kleinere Optimierungsaufgaben können vielfach in Eigenregie bearbeitet werden. Für umfangreiche, komplexe Fragestellungen wie beispielsweise ein umfassendes Projekt Wissen müssen meist (externe) Experten hinzugezogen werden. Um ein solches Projektteam erfolgreich zu managen, braucht es dann doch eher eine Person mit mehr interdisziplinärer Ausrichtung.
Jemand, der in der Lage und fähig ist, sich in unterschiedliche Disziplinen und mit ganzheitlichen Ansätzen in die Situation eines Unternehmens hineinzuversetzen. Denn alle diese Spezialisten müssen koordiniert und gesteuert werden. Denn im Projektteam müssen individuelle Charaktere und unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen arbeiten und auf einen gemeinsamen Nenner (Leitbild) eingestimmt werde. Um hierbei (oft nicht vermeidbare) Reibungsverluste möglichst gering zu halten sollte seitens der Geschäftsführung die Zahl der Ansprechpartner und Schnittstellen ebenfalls gering gehalten werden. Wobei man beim Generalisten angelangt wäre. Denn für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht es neben der als selbstverständlich vorauszusetzenden Sozialkompetenz noch weitaus mehr: einen Teamplayer mit einem hohen Maß an Offenheit für andere „Kulturen“. Dahinter steht auch mehr als nur der berühmte „Blick über den Tellerrand“: unternehmerisches Gespür und eine (auch fachlich fundierte) Antenne für viele Teildisziplinen wirtschaftlichen Handelns (einschließlich analytische Methodenkompetenz). Hierfür braucht es nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch viel praktische Erfahrung: ein Mix aus Analyse-, Konzeptions- und Umsetzungskompetenz.
Der Mandant: zu Demozwecken ein rein fiktives Unternehmen, das überall angesiedelt sein könnte, das ein Klein-. Mittel- oder Großbetrieb sein könnte, dass in jeder nur denkbaren Branche sein könnte. Denn Wissen ist der Rohstoff der Zukunft und geht somit alle an.
Wissensmanager: Wissen ist zu wichtig, um es anderen zu überlassen. Wissen ist Chefsache. Wissen ist der entscheidende Performancetreiber. Wurde hierfür eigens eine Position geschaffen, zeigt dies, dass ein Unternehmen dies erkannt hat.
Informationsmanager: professionelle Datenanalyse und individualisierte Informationsgenerierung spielen eine immer bedeutsamere Rolle. Heutiges Management bedeutet: strategische Entscheidungen auf Basis aktueller und maßgeschneideter Informationen treffen zu können, Marktwissen und Fachkenntnis müssen auch in einem schnelllebigen Marktumfeld mit genauen Analysen unterstützt werden können. Die zielgruppengerechte Distribution und flexible Generierungsmöglichkeit für entscheidungsrelevante Ergebnisinformationen sind ein immer wichtigerer Bestandteil erfolgreichen Managements. Die besten Analysen verlieren jedoch an Wert, wenn ihre Aussagen im Unternehmen nicht verbreitet und umgesetzt werden können. Dazu müssen Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt und angepasst werden, mit diesen Daten situationsspezifische Berichte generiert werden, vertiefte statistische Analysen (bis hin zu Data Mining-Verfahren) erstellt werden, die damit gewonnenen Informationen zeitnah und kosteneffizient an die relevanten Zielgruppen verteilt werden sowie Reports, Analysen auch aktuell mit externen Zusatzinformationen angereichert werden.
Data Scientist: im Rahmen eines neuen Berufsbildes will (muss) ein Data Scientist u.a. ein tieferes Verständnis darüber gewinnen, „wie Menschen mit der digitalen Welt interagieren“ (wie sie digital ticken).
Projektmanager Wissensbilanz: Wissensmanagement-Projekte weisen aufgrund der Strategiebezogenheit eine im Vergleich zu anderen Projekten höhere Komplexität auf. Wissensmanagement-Projekte erfordern deshalb i.d.R.: längere Zeitdauer, intensivere Inanspruchnahme der Mitarbeiter, höheren Aufwand, stärkere Einbeziehung und Beteiligung des Managements und höhere Veränderungsbereitschaft (Change Management). Ein solches Projekt sollte auf wesentliche und klar definierte Prozesse ausgerichtet werden.
Senior Manager Consulting: egal, ob in der allgemeinen Öffentlichkeit, in Fernsehserien oder Kinofilmen, Berater werden in einem überwiegend ungünstigen Licht dargestellt, so u.a. als ichbezogen, karrieregeil, nur auf Geld fixiert. Kunden seien für Berater lediglich Mittel zum Zweck, sie dienten lediglich als Cash-Cow. Berater seien arbeitswütig und gewissenlos und aufgrund des von ihnen zur Schau getragenen Überlegenheitsgehabes eher unsympathisch.
Senior Consultant: praktische Arbeit und Umsetzung, denken viele seiner ehemaligen Klassenkameraden, sei nicht ihr Ding, d.h. Berater würden irgendwo hinkommen, einige Konzepte entwickeln und dann auf Nimmerwiedersehen wieder verschwinden. Ein Berater sei nur einer, der seinem Kunden auf die Uhr schaue und ihm dann erzähle, wie spät es sei. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, seien Berater einfach nur unverschämt teuer.
General Manager: manche Menschen sind geborene Führungskräfte. D.h. nicht, dass sie begnadete Selbstdarsteller sind, sondern dass sie Verantwortung übernehmen und es mögen, Beziehungen zu knüpfen und Entscheidungen zu treffen. Siebzig Prozent der Führungsaufgaben fallen in das Feld Innenpolitik. Oft werden sich Menschen erst dann klar, ob sich genau dafür eignen oder nicht, wenn sie schon im mittleren Management angekommen sind und sich vom allgegenwärtigen Druck überfordert fühlen. Exzellenz in dem was man tut, ist hierbei zwar wesentlich, aber nicht allein entscheidend. Mit Willen, Ehrgeiz und bestimmten Aspekten der sozialen Kompetenz kann man auch durchschnittliche Fähigkeiten auf der Karriereleiter wettmachen. Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen Führungsmotivation, Handlungsorientierung, Flexibilität, Kontaktorientierung, Empfindsamkeit oder Gewissenhaftigkeit. Für die Chef-Eignung sollten Führungsmotivation, Handlungskompetenz, Flexibilität und Kontaktorientierung stärker, im Vergleich hierzu Empfindsamkeit und Gewissenhaftigkeit geringer ausgeprägt sein.
Personalchef: zu seinen Hauptaufgaben zählt, Personalplanung und -kontrolle aufeinander abzustimmen. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Kompatibilität der Personalplanung mit den anderen Teilplanungen (Absatz-, Fertigungs-, Beschaffungs-, Investitions-, Finanzplanung) sowie der Unternehmensgesamtplanung sichergestellt wird. Der Personalchef muss Umweltveränderungen im Personalbereich frühzeitig erkennen und hierfür geeignete Anpassungsstrategien entwickeln. Dazu müssen Instrumente erarbeitet werden, die eine Abschätzung der Wirkungen der Personalarbeit auf die Erreichung der Erfolgsziele ermöglichen.
Personalberater: analysiert Führungspositionen im Recruitingraster. Vor dem Hintergrund von Krisen weist die Kette der Management-Fehlleistungen und – Fehlentscheidungen an zu vielen Stellen ungeklärte Lücken und Bruchstellen auf als dass man vor einer Wiederholung eines derartigen Krisengeschehens sicher sein könnte. So lange vor und hinter der Kamera die gleichen Personen, umgeben von den gleichen Wirtschaftsprüfern, Headhuntern und Aufsichtsräten, Regie führen wird sich daran wohl wenig ändern.
Unternehmensplaner: im Rahmen einer strategischen Sicherung des finanziellen Gleichgewichts muss der Unternehmensplaner der Dynamik des Wirtschaftslebens Rechnung tragen. Denn Kapitalausstattung, Kapitalbedarf, Wettbewerbsverhältnisse, Ertragslage, Einschätzung der Kreditwürdigkeit durch Außenstehende oder die finanzielle Abhängigkeit von Abnehmern ändern sich ständig. Erfahrungen und Fingerspitzengefühl können eine Planung zur Sicherung des finanziellen Gleichgewichts nicht ersetzen. Für Unternehmen aller Größenordnungen gilt uneingeschränkt die Notwendigkeit, den Blick auch über das Tagesgeschehen hinaus in die finanzielle Zukunft zu richten. D.h. neben der Formulierung von Unternehmenszielen als Umsatz-, Marktanteils- und Ertragsziele müssen auch Finanzierungsziele wie Cash-Flow-Relationen, maximaler Verschuldungsgrad oder Kapitalumschlagswerte definiert werden..
Controller: um wichtiges Wissen über Märkte, Mitbewerber, Innovationen und Veränderungen im Umfeld des Unternehmens zu erhalten muss der Controller die in einer Datenbasis abgelegten Informationen in Zusammenhänge, d.h. Relationen bringen. Dabei bilden Business Intelligence-Konzepte eine betriebswirtschaftliche Einheit. Der Schlüsselfaktor ist für ihn die Bereitschaft zur Veränderung von Spielregeln. Dazu kommt die Qualität der Umsetzung durch eine gezielte Entwicklung der inneren Schlagkraft des Unternehmens in Menschen bzw. deren Fähigkeiten und abgeleitet daraus in Strukturen, Systeme und Prozesse. Es genügt eben nicht, nur besser zu sein. Vielmehr muss der Controller die Grundrichtungen „Konzept“ und „Verwirklichung“ mit dem festen Willen zur positiven Veränderung (nicht nur Verbesserung!) gezielt verfolgen und mit gestalterischem Denken nutzen. Der Übergang zur Informationsgesellschaft hängt auch davon ab, ob auch die nichttechnischen Bedingungen erfolgreich beherrscht werden können. D.h. auch mit dem Wandel zur Informationsgesellschaft verbundene mögliche Problemfelder wie beispielsweise die Gefahren der Verwechslung virtueller Realität mit Realität oder die der Informationsüberflutung müssen ernst genommen werden. „Information ist, was man braucht zu handeln“ (Peter F. Drucker). D.h. gerade jetzt, wo die Möglichkeiten der Informationsgewinnung beträchtlich gestiegen sind, muss sich auch der Controller verstärkt auf die produktive Nutzung des Rohstoffes „Information“ als ein für den geschäftlichen Erfolg ausschlaggebendes Arbeitsmittel einstellen.
Assistent der Geschäftsleitung: ihn interessiert mehr das Morgen und Übermorgen als das gestern Gewesene. Planungsinstrumente müssen aber richtig verstanden und eingesetzt werden: sie liefern nicht automatisch sichere Aussagen über eine unsichere Zukunft. Planung heißt auch nicht, in eine Kristallkugel zu sehen, sondern ist nicht zuletzt eine Projektion der Vergangenheit, die man verstehen muss, bevor man etwas voraussagen kann. Planung als Vorausabwägen verschiedener Entscheidungsmöglichkeiten ist heute mehr denn je eine Wurzel des Geschäftserfolges. Manchmal wird einer Forderung danach der Einwand entgegen gehalten, dass eine präzise Form der Planung unmöglich sei, da niemand in die Zukunft schauen könne. Gerade aber weil diese ungewiss ist, müssen die Maßnahmenplanungen konkret gesetzt werden, um über notwendige Orientierungsmarken für grundsätzliche Entscheidungen verfügen zu können. Neben „harten“ quantitativen Daten müssen für die Geschäftsplanung auch sogenannte „weiche“ qualitative Einschätzungen - beispielsweise unter Zuhilfenahme einer Wissensbilanzbereitgestellt werden.
Strategieberater: Management-Consulting ist auch Strategieberatung. Da Strategien oft nicht von Dauer und überholt sind, wenn ein Wettbewerber des Kunden eine bessere entwickelt. Zum anderen wird es immer Nachahmer geben, die versuchen, Strategien zu kopieren (manchmal gelingt es ihnen sogar, eine Strategie erfolgreicher umzusetzen als ihr Initiator, weil aus Anfangsfehlern gelernt wurde). Das Management muss also auch erfolgreiche Strategien laufend den sich verändernden Umfeldgegebenheiten anpassen. Strategieentwicklung ist somit ein permanenter Innovationsprozess, der externe Unterstützung gut vertragen kann. Denn Managementconsulter sind gute Informationssammler und –bündeler. Weil sie permanent in verschiedenen Unternehmen über verschiedene Branchen hinweg unterwegs sind. Die Informationen, die sie dabei sammeln sind bares Geld wert. Denn aus diesen bildet sich das Wissen, das die Consulter sammeln, filtern und verarbeiten, um es dann an andere weiter zu verkaufen.
Fachjournalist: sprachliche und bildliche Darstellungskompetenz alleine sind hierfür nicht ausreichend. Es braucht dazu die sachlich-fachlichen Kompetenzen, um Vorgänge richtig einzuordnen und angemessen bewerten zu können. Es geht darum, das Wichtige im Informationschaos herauszuarbeiten. Fachjournalisten wird in diesem Umfeld so mancher Spagat abverlangt: „die einen kultivieren die Nähe zum Publikum und dilettieren in wichtigen Sachfragen; die anderen sind in den Sachfragen meist durchaus kompetent, schaffen aber einen intensiven Bezug zur Publikumsperspektive nicht“.
Leiter Fachabteilung: wenn man führen will, kann es nicht schaden, auf dem Weg des Aufstiegs auch einmal den Job zu wechseln. Um sich gezielter darauf vorzubereiten, sich in einem stetig wechselnden und immer kompetitiven Umfeld durchzusetzen. Schwierig werden könnte es für Menschen, die klare Prinzipien haben und im Verlauf ihrer Berufserfolge öfter gezwungen werden, gegen diese Prinzipien arbeiten zu müssen. Dabei ist nicht so sehr die hohe Arbeitsbelastung ein Problem, sondern die Konkurrenz des eigenen Wertesystems mit dem, in dem sie arbeiten. Der eventuelle Konflikt zum inneren Regelwerk. Ein sehr gerechtigkeitsliebender, rücksichtsvoller Mensch, der gezwungen ist, langfristig auch rücksichtslos zu agieren, muss mehr Kraft aufwenden als der Rücksichtslose. Nur ein guter Verdränger kann mit diesem Zwiespalt gut leben, alle anderen reiben sich auf, ein Burnout ist praktisch vorprogrammiert.
Marketingmanager: Marketingprozesse sind durch ein hohes Maß an Komplexität gekennzeichnet. Die Gestaltung der einzelnen Prozesse muss daran gemessen werden, inwieweit sie dazu beitragen können, relevante Markt-, Kunden- und Ressourcenpotenziale auszuschöpfen. Die Gefahr, das Unternehmen an den Marktrealitäten vorbei zu steuern besteht immer dann, wenn die Reaktionszeiten zu lang und das Informationsinstrumentarium zu sehr auf die Fortschreibung der Vergangenheit statt auf die Beherrschung der Zukunft ausgerichtet ist. Der Marketingmanager muss daher die Instrumente immer so ausrichten, dass sie ein Gleichgewicht zwischen einerseits dem Denkbaren und andererseits dem Machbaren herstellen. In der heutigen Wirtschaftswelt ist die Entwicklung und Analyse von Voraussagen und Plänen von vitaler Bedeutung. Methodisch durchdachte und daher in sich stimmige und abstimmfähige Wissensbilanzen können hierbei wertvolle Dienste leisten.
Startup-Manager: nicht umsonst hat der alte Kalauer einen wahren Inhalt, nach dem ein Selbstständiger einer ist, der ständig alles selbst machen muss. Handelt es sich bei einer Existenzgründung um einen Schritt in die Selbständigkeit, so steht und fällt ohnehin alles mit der Person des Existenzgründers. Nicht viel anders ist die Situation auch bei Gründung kleinerer Mehr-Personenunternehmen: neben einer trag- und zukunftsfähigen Geschäftsidee hängt alles von einer oder einigen wenigen Personen ab. Neben den immateriellen Werten des Unternehmens rücken damit gleichermaßen persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten, d.h. spezifische Personalfaktoren in das Blickfeld einer Existenzgründung. Jeder Existenzgründer sollte sich darauf einstellen, dass er nicht nur mit der Geschäftsidee, d.h. seinem Gründungskonzept und der Markteinschätzung seines Vorhabens einem Rating unterworfen wird. In einem Schwerpunkt dürfte sich ein solches Rating auch mit seiner Person, d.h. seinen Unternehmereigenschaften, seinen fachlichen und kaufmännischen Voraussetzungen sowie manchmal bis in den Privatbereich hinein auch mit seinen persönlichen Eigenschaften befassen.
Project-Members Nr. 1 – 6: die Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft sorgt nicht nur für partielle Veränderungen, sondern kündigt bereits die künftige Gesellschaft an. Die Halbwertzeit des Wissens sinkt dramatisch ab: nur noch ein bis zwei Jahre beträgt die Halbwertzeit des Informatikwissens. D.h. ohne regelmäßiges Aktualisieren und Auffrischen ist das Knowhow in kürzester Zeit nur noch die Hälfte wert. Bei immer kürzeren Innovationszyklen wird die Qualität der Mitarbeiter zum strategischen Erfolgsfaktor. D.h. die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens hängt nicht zuletzt von der Fähigkeit seiner Mitarbeiter ab, wie schnell diese auf neue Entwicklungen zu reagieren in der Lage sind. In der heutigen Arbeitswelt finden gewaltige Umstrukturierungen statt. Für viele neue Berufsbilder reicht technische Versiertheit alleine nicht mehr aus. Genauso wichtig sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse und künstlerische Fähigkeiten. Spezialisten sind über eine standardisierte Ausbildung jedoch kaum noch heranzuziehen. Das moderne Konzept hierfür heißt flexible Handlungskompetenz. Mit herkömmlicher Wissensvermittlung hat dieses Lernen nur noch wenig zu tun, u.a. vortragender Unterricht wird immer seltener. D.h. der Auszubildende muss sich einen zunehmenden Teil seines Wissens selber aneignen und muss Strategien im Team entwickeln. Die Ausbildung setzt dabei verstärkt auf den direkten Bezug zur Praxis, d.h. die Auszubildenden sollen weniger Zeit in den Lernstätten und mehr Zeit in den Betrieben verbringen. Potentielle Stärken lassen sich gezielter entwickeln, indem das vorhandene Wissen und die Ideen der Mitarbeiter schneller und effizienter in die tägliche Betriebspraxis umgesetzt werden: nach dem Beispiel des amerikanischen Silicon Valley, wo die Unternehmen hauptsächlich aufgrund der Kreativität der Mitarbeiter florieren. In Verbindung damit kommen auf die Mitarbeiter neue Anforderungen zu. Als besonders wichtige Qualifikationen werden von den Unternehmen das „Denken in Zusammenhängen“ und die „Gruppenorientierung/ Teamfähigkeit“ angesehen. Die veränderten Inhalte von Qualifizierungsmaßnahmen stellen die in den Unternehmen personalverantwortlichen Manager, Trainer und Lehrer ebenfalls vor veränderte Herausforderungen. Mehr denn je werden Anleitung und Hilfe zum Selbstlernen im Mittelpunkt stehen: der Trainer übernimmt die Rolle des Moderators, Tutors oder Coaches. Wenn die Qualifizierungsmaßnahmen durch die betrieblichen Abläufe und Erfordernisse gestaltet werden und im Rahmen dieses Prozesses Training, Personal- und Organisationsentwicklung immer stärker verschmelzen, muss der Trainer gleichzeitig auch Personal- und Organisationsentwickler sein. Gleichwohl wird der einzelne Mitarbeiter stärker als bisher gefordert sein. Nicht nur deswegen, weil eine kontinuierliche Weiterbildung aus eigenem Antrieb vorausgesetzt werden muss und der Mitarbeiter in Zukunft von sich aus mehr Freizeit für die eigene Qualifizierung investieren muss. Die neuen Arbeitswelten stellen den Mitarbeitern einen Wandel „von der Muss-Arbeit zur Lust-Arbeit“ in Aussicht. Von Führungskräften fordern sie gleichzeitig ein verändertes Denken, Handeln, Führungs- und Teamverhalten ein.
Curling statt autoritär – alles beginnt mit Schule
Fast schon ein kleines Wunder: der allmorgendliche Stau bei der Fahrt ins Büro bliebe dieses Mal aus. So sitzt der Senior Manager dieses Mal ganze zwanzig Minuten früher als sonst an seinem Schreibtisch, holt sich selbst seinen Kaffee und blättert abwesend in einigen Unterlagen. Und fragt sich selbst ganz so nebenbei: „Werde ich demnächst Partner und bleibe auf der Berater-Spur? Oder kommt als Nächstes etwas anderes? Etwas mit Social Return? Probleme der Gesellschaft mit dem Handwerkszeug des Managers lösen? Irgendetwas mit Skalierbarkeit und Disruption? Etwas, das noch mehr abwirft als Geld, Karriere, tolle Projekte. Vielleicht spannende Leute, spannende Themen? Etwas mit einer breiten Relevanz. Denn mittlerweile haben sich meine Prioritäten im Leben verschoben. Der Sinn einer Tätigkeit zählt mehr als die nächste Gehaltserhöhung und Bonuszahlung. Eine erfüllende Arbeit ist wichtig, die Liebe zum Arbeitgeber weniger. In Zukunft achte ich mehr auf Fairness, falsche (oder keine) Hierarchien, flexible Arbeitszeiten ohne Wochenend-Stress. Und: mir geht es nicht darum Arbeit zugunsten von Freizeit zu kürzen, sondern die Grenze zwischen Arbeit und Leben aufzuheben.“ Als nächstes unter seiner Regie abzuwickelndes Projekt hatte einer der Partner der Firma beiläufig etwas von einem Projekt Wissen erwähnt, das für einen der Mandanten angeblich von besonderem Interesse und von großer Wichtigkeit sein soll.
Währenddessen fast zeitgleich: noch bevor der morgendliche Berufsverkehr einsetzte und die Geräuschlawine der Automotoren den Gesang der im Blätterwerk sitzenden Vögel übertönte, verlässt ein Consultant aus dem Team des Senior Managers sein Hotel und trabt im Jogginganzug durch den in noch kühler Morgensonne liegenden Park. Ihn hatte der Gedanke an die während des Tages vor ihm liegenden Meetings schon in der Frühe um halb sechs an die frische Luft getrieben. Während des Laufens bündelten sich seine Gedanken aber zunächst, warum auch immer, in eine ganz andere Richtung: „Auf autoritäre, antiautoritäre Erziehungsstile folgten Helikopter und Curling - Schulalltag und elterliche Distanzlosigkeit. Vertrauensbasis in Institution Schule und Lehrerschaft – um sich selbst drehende Curlingsteine. Mit fortschreitender Industrialisierung und Arbeitsteilung gerieten autoritäre Erziehungsmethoden ins Abseits, da Selbständigkeit für den Arbeitsmarkt immer wichtiger wurde. Mit der Gegenbewegung der antiautoritären Erziehung schlug darauf das Pendel heftig in die andere Richtung aus und bewirkte auch dort so manche Klagen über Fehlentwicklungen. Bei Erziehungsmethoden scheint es wie mit Religionen zu sein: es gibt keinen objektiv richtigen Weg.“
In einen nun gleichmäßigen Trab verfallend, sein Körper nähert sich langsam der optimalen Betriebstemperatur, denkt er weiter: „Die neuen Schlagworte bemühen nunmehr Bilder vom Helikopter und Curling. Helikopter-Eltern begleiten ihre Schüler in den Unterricht, fahren sie mit dem Auto bis auf den Schulhof, nötigen Lehrern auch selbst nach Unterrichtsbeginn noch Gespräche auf, belegen reservierte Lehrerparkplätze, machen während Elternabenden Druck, erheben über Mails und soziale Netzwerke ihre Stimme zu jedem Vorfall (und sei er manchmal noch so nebensächlich). Diese einst so nicht vorstellbare Distanzlosigkeit der Eltern zum Schulalltag wird häufig von einem schwindenden Vertrauen in die Institution Schule und in die Lehrerschaft gespeist. Das Phänomen der Überbehütung belastet oft auch das Verhältnis der Eltern zur Schule.“
Der Consultant unterbricht seinen Lauf für einige kurze Dehnübungen zur Auflockerung und hängt weiter seinen Gedanken nach:“ Je deutlicher wird, dass sich Investitionen in Bildung nicht nur lohnen, sondern überhaupt erst einmal die Voraussetzung sind, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, desto mehr fördern diese Helikopter-Eltern das Fortkommen ihrer Kinder praktisch von der Stunde Null an“.
Für ihn kommt es so vor wie: „Mozart im Mutterleib, Marketing-Projektstunden auf Chinesisch und mehrmals Fußball- oder Handballtraining pro Woche. Nichts mit Freiheit und Zeit für Entfaltung in der Kindheit. Wer seine Kinder heute einfach nur in Ruhe und Frieden machen lässt, wird als Ewiggestriger schräg von der Seite angeguckt.“
Und er sagt sich: „Der gesellschaftliche Trend geht noch weiter in Richtung zu nunmehr sogenannten „Curling-Eltern“, die wie verrückt vor ihren Kindern herum wischen, damit diese wie auf einer perfekt polierten Eisfläche dahinter hingleiten können. In diesem Bild drehen sich solche Kinder wie der Curlingstein ständig um sich selbst und stoßen schließlich andere Steine aus dem Weg. Im Klartext heißt dies für mich: Curling-Eltern ziehen, kleine wettbewerbsorientierte Egoisten heran.“
Sein Teamleader im Büro gönnt sich derweil einen Rückblick auf sein Abitur vor fünfzig Jahren: „Die einen, unter anderem auch mein Jahrgang Abi 63, haben ihren Schulstress lange hinter sich. Sie können daher ganz entspannt ihr Jubiläum feiern. Die anderen aber, d.h. jene mittendrin im Schulalltag, sehen sich mit vielleicht zunehmenden, sicher aber neuen Stresssituationen konfrontiert. Bei einer Zeitreise mit Rückblicken sollte man tunlichst zu vermeiden suchen, durch eine rosarote Brille zu schauen und dabei aus altersbedingter Gefühlsduselei Vergangenes zu verherrlichen. Da unser Gehirn nun einmal so angelegt ist, Negatives im Laufe der Zeit eher auszublenden. Eine Schule mit nur positiven Gegebenheiten wäre denn wohl auch unnatürlich, der Realität wenig entsprechend und damit auch nicht glaubwürdig. Ein Urvater aller Börsenspekulationen hat auf die Frage nach seinen Erfolgen einmal geantwortet: 49 % meiner Geschäfte gehen schief, 51 % bringen Gewinn und von den 2 % Unterschied lebe ich. Dieses Bild könnte man so oder ähnlich auch auf die Schule anwenden: wichtig ist vor allem, dass das Positive überwiegt. In vielen Fällen dürfte dieses mit deutlich mehr als nur jenen 2 Prozent zu veranschlagen sein.“
Obwohl bei einer Jubiläumsfeier 50 Jahre nach dem zugrunde liegenden Abitur mögliche Negativerlebnisse im Gedächtnis verblasst ein dürften, vermag sich der Senior Manager trotzdem noch an den speziell vor Versetzungen aufgebauten psychologischen Druck erinnern: „Heute würde man von Stress sprechen, dem vor allem die sogenannten „mittelmäßigen“ Schüler ausgesetzt waren. Vielleicht dadurch gehärtet, waren es aber auch manchmal diese, die im späteren Berufsleben auf mehr Erfolge verweisen konnten. Es scheint, als würde das Bildungswesen im Zeitablauf immer stärker reglementiert. Damals: Freiräume bei der Gestaltung des Unterrichts. Dann: Lehrpläne. Heute: Bildungsstandards. Das Geschäftsmodell: eine Schule kann grundsätzlich tun, was sie mag und für richtig hält. Am Ende aber wird das Ergebnis zentral kontrolliert. Es geht um eine gemeinsame Qualitätssicherung des Abiturs.“
Das Anforderungsniveau der Abiturprüfungen soll in allen Ländern schrittweise angeglichen werden. Überwacht werden sollen Prüfungsaufgaben durch das Institut für Qualitätssicherung im Bildungswesen. Zunächst geht es dabei um die Abiturprüfungen in Deutsch, Mathe und Fremdsprachen. Vergleichbarkeit steht in direkter Korrelation mit Nivellierung. Mehr Nivellierung würde gleichzeitig eine Absenkung des Niveaus bedeuten. Nach Meinung eines Waldorfpädagogen erzeugt das Streben nach Vergleichbarkeit Druck auf die Schulen und letztendlich auch auf die Schüler selbst. Der humboldt´sche Bildungsbegriff würde im deutschen Schulsystem zunehmend ausgehöhlt. So würden Waldorfschulen, die immer bei G9 geblieben sind jetzt einen Zuwachs an G8-Flüchtlingen verzeichnen.
Hierzu nun der Senior Manager, der seine Beraterkarriere nicht leugnen kann: „Vor allem sollte man sich davor hüten, Arbeitsweisen aus der Wirtschaft in das Bildungswesen zu transferieren. Schüler kann man eben nicht wie Produkte durch Tests oder gar Ranglisten vergleichen. Viel Druck kann von Schülern genommen werden, wenn man nicht einseitig fixiert auf höchste Schulabschlüsse starrt. Man muss akzeptieren, dass auch Umwege oder sogar ein Durchhängen, früher wohl eher Sitzenbleiben genannt, zum Ziel führen können.“
Unerheblich ist, wann genau eigentlich die deutsche Sprachlandlandschaft in Bewegung geriet und Elemente fremder Sprachen aufzunehmen begann. Ein Rückblick auf frühere Schulzeiten bietet Anlass, einmal im Vergleich dazu auf heutige Verschleifungen und Versimpelungen der Umgangssprache, Sprachmischungen oder grammatische Minimalismen zu schauen. In der FAZ stand unter Bezug auf U. Hinrichs (Multi-Kulti Deutsch) zur Zukunft des heutigen Deutsch geschrieben: Kasusendungen werden abgeschliffen, grammatische Übereinstimmungen zwischen den Wörtern im Satz spielen kaum noch eine Rolle, Präpositionen stehen zur beliebigen Verwendung, das grammatische Geschlecht ist eingedampft, der Konjunktiv geht den Bach hinunter, die Satzstrukturen versimpeln. In Internet-Chats, Krawall-Shows und Vulgär-Comedies wird das Ideal der deutschen Hochsprache mit Füßen getreten. Jugendliche mischen aus verschiedenen Sprachfetzen einen sogenannten „coolen“ Slang. Grammatische Feinheiten werden brutal eliminiert, vom Formenreichtum der deutschen Sprache bleibt kaum etwas übrig. Was ein Satz bedeutet, hängt heute immer weniger von ihm selbst sondern immer stärker vom umfließenden Kontext ab. Hauptsache ist: Verständigung muss halbwegs funktionieren, für Feinheiten bleibt dabei wenig Raum. Vielleicht bietet die englische Sprache mit ihrer bereits am weitesten reduzierten Wortgrammatik Trost: „sie büßte bereits im Munde der Kelten, Wikinger und Normannen über die Jahrhunderte hinweg viele ihrer grammatischen Feinheiten ein (W. Krischke).“
Der Senior-Manager ist sich sicher: „Mein Abitur-Jahrgang aus einer Zeit vor fünfzig Jahren hat nunmehr nicht nur seine Jubiläumsfeiern, sondern auch viele, wenn nicht die meisten Stufen auf der Strecke von Wissenserwerb, Wissenssicherung, Wissenstransfer oder Wissensnutzung hinter sich gebracht“. Dieser Gedanke bietet ihm die Gelegenheit, ab und an einmal auch rückschauend über jenen so vielschichtigen Rohstoff Wissen und seine wichtige Nutzung etwas nachzudenken. Dabei kommt ihm plötzlich und unvermittelt auch das vor kurzem angesprochen Projekt Wissen in den Sinn. Er denkt: „Bei der Nutzung des Rohstoffs Wissen geht es um Menschen, die ausgebildet, informiert und flexibel sind. Um Menschen, die über das nachdenken, was sie tun und bereit sind, Initiativen zu ergreifen. Um Menschen, die bereit sind, zu lernen und offen für innovative Veränderungen sind. Um Menschen, die fähig sind, sich auf einer "Just-in-time"-Basis neues Wissen und neue Fertigkeiten anzueignen. Um Menschen, die Fachliteratur lesen und fähig sind, in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Um Menschen, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen und Mitverantwortung für das Erreichen von Zielen akzeptieren. Um Menschen, die Unternehmensprobleme als ihre eigenen betrachten“.
Einige ehemalige Abiturienten im lebhaften Gespräch. Ehemaliger 1 zu den anderen: “Wisst ihr noch, wie das damals war, zu Urzeiten der Computer? Wie das Betriebssystem MS-DOS 1981 mit dem ersten Personalcomputer von IBM auf den Markt kam? Und damit die Grundlage für einen beispiellosen Siegesszug der Digitaltechnik sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privatbereich legte? Ehemaliger 2 ergänzt sofort:“Der Computer ist heute im Smartphone und Tablet heute doch zum alltäglichen Gebrauchsgegenstand geworden“. Ehemaliger 1: “Dass es aber jemals soweit kommen konnte, daran hat MS-DOS eine großen Anteil. Denn erst mit diesem Betriebssystem wurden den Computern