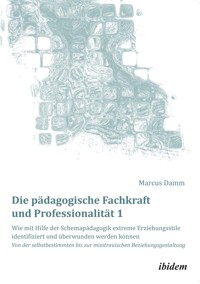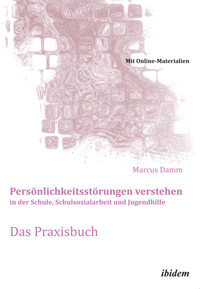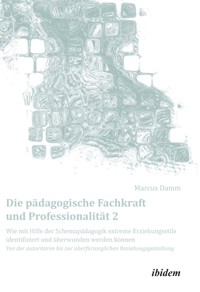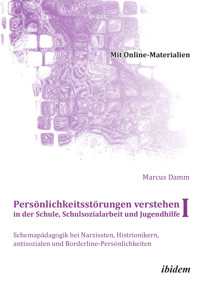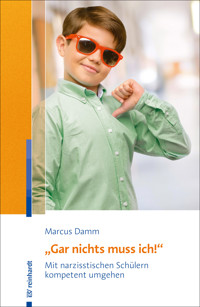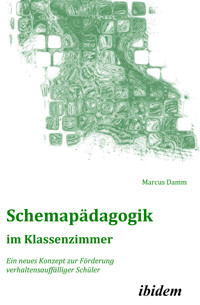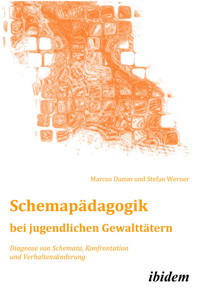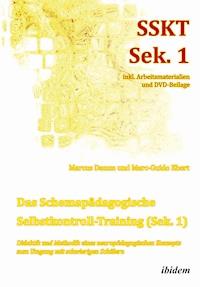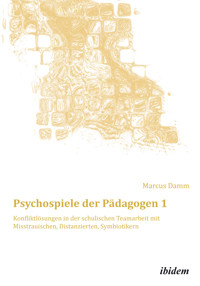
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Bildung
- Serie: Schemapädagogik kompakt
- Sprache: Deutsch
Kinder, Jugendliche und auch die Professionellen bringen unbewusst zahlreiche Verhaltensmuster mit biografischem Hintergrund mit in die alltägliche pädagogische Praxis ein. Diese Tatsache hat Auswirkungen auf der Beziehungsebene (Sympathie bzw. Antipathie). Die daraus resultierenden zwischenmenschlichen Erwartungshaltungen (Schemata) sind wahrnehmungsverzerrt. Trotzdem beeinflussen sie den Erziehungs- und Bildungsauftrag sowie die Teamarbeit im Kollegium. Die Unkenntnis dieser Phänomene ist die Regel in sozialpädagogischen und Bildungsinstitutionen. Grund: Wir Pädagogen bleiben in Hinsicht auf neuere neuropsychologische und psychotherapeutische Erkenntnisse ungeschult. Die Schemapädagogik® will diese Fachkompetenzlücke schließen. Zur Förderung der Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz wird der Fokus gelegt auf typische Schemata von Professionellen und die damit verbundenen Ich-Anteile (sog. Schemamodi) im Falle einer Aktivierung. Ferner geht es um charakteristische interaktionelle Strategien (Images, Tests, Psychospiele, Appelle). Der vorliegende Band gibt Pädagogen eine Einführung an die Hand, die es ihnen ermöglicht, das eigene Persönlichkeitskonzept schematheoretisch zu „beleuchten" (nach J. Young). Das beiliegende Arbeitsmaterial hilft dabei, den Umgang mit Heranwachsenden und Kollegen zu reflektieren und ggf. zu verbessern. Folgende Schemata sind vor dem Hintergrund der Schematherapie relevant: Emotionale Vernachlässigung, Verlassenheit, Misstrauen, Isolation, Unzulänglichkeit, Erfolglosigkeit, Abhängigkeit, Verletzbarkeit, Verstrickung. Dieses Buch wird ergänzt durch die Publikation Psychospiele der Pädagogen 2. Konfliktlösungen in der schulischen Teamarbeit mit Narzissten, Passiv-Aggressiven, Perfektionisten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem Press, Stuttgart
Inhalt
Stimmen zum Buch
1.Einleitung – Warum unsere biografisch verankerten „roten Knöpfe“ den Erziehungs- und Bildungsauftrag sabotieren2.Schemata, Schemamodi und Manipulationstechniken
2.1 Emotionale Entbehrung
2.1.1 Allgemeines
2.1.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.1.3 Kognitionen und Schemamodi
2.1.4 Spiele
2.1.5 Manipulationstechniken
2.1.6 Abwehrmechanismen
2.1.7 Psychodynamik
2.1.8 Zusammenfassung
2.2 Verlassenheit/Instabilität
2.2.1 Allgemeines
2.2.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.2.3 Kognitionen und Schemamodi
2.2.4 Spiele
2.2.5 Manipulationstechniken
2.2.6 Abwehrmechanismen
2.2.7 Psychodynamik
2.2.8 Zusammenfassung
2.3 Misstrauen/Missbrauch
2.3.1 Allgemeines
2.3.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.3.3 Kognitionen und Schemamodi
2.3.4 Spiele
2.3.5 Manipulationstechniken
2.3.6 Abwehrmechanismen
2.3.7 Psychodynamik
2.3.8 Zusammenfassung
2.4. Soziale Isolation
2.4.1 Allgemeines
2.4.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.4.3 Kognitionen und Schemamodi
2.4.4 Spiele
2.4.5 Manipulationstechniken
2.4.6 Abwehrmechanismen
2.4.7 Psychodynamik
2.4.8 Zusammenfassung
2.5 Unzulänglichkeit
2.5.1 Allgemeines
2.5.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.5.3 Kognitionen und Schemamodi
2.5.4 Spiele
2.5.5 Manipulationstechniken
2.5.6 Abwehrmechanismen
2.5.7 Psychodynamik
2.5.8 Zusammenfassung
2.6 Erfolglosigkeit/Versagen
2.6.1 Allgemeines
2.6.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.6.3 Kognitionen und Schemamodi
2.6.4 Spiele
2.6.5 Manipulationstechniken
2.6.6 Abwehrmechanismen
2.6.7 Psychodynamik
2.6.8 Zusammenfassung
2.7 Abhängigkeit/Inkompetenz
2.7.1 Allgemeines
2.7.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.7.3 Kognitionen und Schemamodi
2.7.4 Spiele
2.7.5 Manipulationstechniken
2.7.6 Abwehrmechanismen
2.7.7 Psychodynamik
2.7.8 Zusammenfassung
2.8 Verletzbarkeit
2.8.1 Allgemeines
2.8.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.8.3 Kognitionen und Schemamodi
2.8.4 Spiele
2.8.5 Manipulationstechniken
2.8.6 Abwehrmechanismen
2.8.7 Psychodynamik
2.8.8 Zusammenfassung
2.9 Verstrickung/unentwickeltes Selbst
2.9.1 Allgemeines
2.9.2 Typische Verhaltensauffälligkeiten
2.9.3 Kognitionen und Schemamodi
2.9.4 Spiele
2.9.5 Manipulationstechniken
2.9.6 Abwehrmechanismen
2.9.7 Psychodynamik
2.9.8 Zusammenfassung
3.Methoden und Interventionen
3.1 Emotionale Vernachlässigung
3.1.1 Fragebogen
3.1.2 Stühlearbeit
3.1.3 Textblatt
3.1.4 Besinnungstext
3.2 Verlassenheit/Instabilität
3.2.1 Fragebogen
3.2.2 Stühlearbeit
3.2.3 Textblatt
3.2.4 Besinnungstext
3.3 Misstrauen/Missbrauch
3.3.1 Fragebogen
3.3.2 Stühlearbeit
3.3.3 Textblatt
3.3.4 Besinnungstext
3.4 Soziale Isolation
3.4.1 Fragebogen
3.4.2 Stühlearbeit
3.4.3 Textblatt
3.4.4 Besinnungstext
3.5 Unzulänglichkeit
3.5.1 Fragebogen
3.5.2 Stühlearbeit
3.5.3 Textblatt
3.5.4 Besinnungstext
3.6 Erfolglosigkeit/Versagen
3.6.1 Fragebogen
3.6.2 Stühlearbeit
3.6.3 Textblatt
3.6.4 Besinnungstext
3.7 Abhängigkeit/Inkompetenz
3.7.1 Fragebogen
3.7.2 Stühlearbeit
3.7.3 Textblatt
3.7.4 Besinnungstext
3.8 Verletzbarkeit
3.8.1 Fragebogen
3.8.2 Stühlearbeit
3.8.3 Textblatt
3.8.4 Besinnungstext
3.9 Verstrickung/unentwickeltes Selbst
3.9.1 Fragebogen
3.9.2 Stühlearbeit
3.9.3 Textblatt
3.9.4 Besinnungstext
Ausblick
Weiterführende Literatur
Kontakt
Literatur
Anhang
Schemafragebogen©
Tabelle: Schemata, Kognitionen und Bewältigungsreaktionen
Stimmen zum Buch
Mit der Schemapädagogik hat Dr. Marcus Damm eine Schnittstelle zwischen Therapie und Pädagogik erschaffen. In diesem Buch spricht er vor allem die Persönlichkeitsstruktur von Professionellen an. Er formuliert auf den Punkt genau, wie sich verschiedenepersönlichkeitsrelevanteSituationen im Arbeitsalltag sozialer Berufe ergeben können. DieseProzesseunterlegt er mit einigen Praxisbeispielen, die sicherlich der eine oder andere durch eigene Erfahrungenbestätigen kann.
Meiner Meinung nach sollten sichvor allem Angehörige sozialer Berufe,wie etwa Sozialarbeiter,mehr mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen. Denn mal ehrlich, wer macht das wirklich tief greifend?
Wer macht sich Gedanken über eigene Verhaltensweisen, Verhaltensweisen anderer? Darüber,warum dasDilemmajetzt genauso passiert ist? Oder:Warumreagiert mein Gegenüber ausgerechnet bei mir so?
Dank guter Begriffserklärungen und genauer Beschreibung der ersten neun Schemata, die aus der Schematherapie vonJ.Young stammen, erlangt man einen guten und recht tiefgründigen Einblickin die eigene Persönlichkeitsstruktur. Denn, und das lässt sich beim Lesen nicht vermeiden,manerkennt sich oft selbst wieder. Anhand der Schemafragebögen zur Selbsteinschätzungbekommt man einen gutenEinblick indie eigenen Schemata.
Ich selbst habe in diesem Jahr mein Studium zur Sozialarbeiterin abgeschlossen und werde nun in den Berufsalltag entlassen. Doch weiß ich nicht genau,was mich erwartet. Auf welche Menschentreffeich, wie reagieren sieauf mich, wie reagiere ich auf sie?Mithilfedieses Buches gewinne ich einen Eindruck davon, was kommen kann und habe zugleich einetendenzielleLösung und Erklärungparat.
Es ist spannend zu erfahren, wie der Mensch so „tickt“ und wasgenaubestimmtes Verhalten in einem selbst auslöst. Natürlich ist es dann wichtig zu wissen: Wie gehe ich damit um?
Dr. Marcus Damm gelingt es mit Charme und einer natürlichen, nicht zu fachmännischen Ausdrucksweise sein Anliegen dem Leser nahezu bringen.Mithilfeder Vorlagen zur Selbsteinschätzung entwickelt man einen kritischen Blickauf sich und das eigene Verhalten und gelangt somit schneller zur Selbsterkenntnis.
Ich kann sehr viel für meine zukünftige Arbeit und auch für mich selbst aus diesem Buch ziehen und bin gespannt auf weitere interessante Themenaus dem Forschungsfeld derSchemapädagogik.
Berlin, im Herbst 2014
Melanie Schneider, SozialarbeiterinB.A.
Bücher über die Arbeit mit verhaltensoriginellenKindern und Jugendlichen gibt es zuGenüge. Marcus Damm widmet sich mit diesem Buch nun uns zu, den „originellen“ Pädagogen und Pädagoginnen.
Hören wir unseren Kindern und Jugendlichen in der täglichen Arbeit genau zu, so bekommen wir alle einen bestimmten Titel verliehen.
Da wäre zum Beispiel der oder die:
·„Hau den Lukas“-Pädagoge oder-Pädagogin (Schülersicht „der/die ist total streng und bei dem/derdürfen wir nicht einmal lachen“),
·der oder die„Frikadellen“-Pädagoge oder-Pädagogin (Schülersicht „stell dem/der bloß keine Frage, dann bekommst du gleich einen langen Vortrag aus seinem/ihrem Leben gehalten und gehst mit einer Frikadelle am Ohr aus dem Unterricht“) usw. Doch was steckt dahinter?
In diesem Buch beleuchtet Damm die pädagogische Fachkraft mit seinen/ihrenIch-Anteilen erfrischend klar und vor allem verständlich. Wenn wir es zulassen, bekommen wir eventuelle gesuchte Antworten oder Erklärungen,warum wir in bestimmten Situationen so sind, wie wir sind, und warum „meine“Kinder und Jugendlichen bei mir funktionieren und bei anderen nicht und umgekehrt (Lehrerzimmergespräch:„DeineKlasse war heute wieder grauenhaft!“).
Zur Förderung der Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz der pädagogischen Fachkraft bietet dieses Buch die Möglichkeit, sich seiner Bewusstseinszustände bewusst zu werden und eventuelle „spezielle“ eigene Verhaltensmuster in bestimmten Situationen zu erkennen und gegebenenfalls zu hinterfragen. Ein meines Erachtens wichtiger Baustein,um sich als professionelle pädagogische Fachkraft weiter zu entwickeln.
AndréKotecki,Jahrgang 1972, ist Bildungsbegleiter, Trainer und Ausbilder für Wirtschaft und Verwaltung in der Jugendförderung in Köln. Als Deeskalationstrainer Gewalt und Rassismus (GewaltakademieVilligst) bildet er regelmäßigSozialberufler im Rahmen der Gewaltprävention fort und führt in Schulen und Jugendeinrichtungen regelmäßig Deeskalationstrainings Gewalt und Rassismus, Anti-Mobbing-Trainings, Anti-Rassismus-Trainings und Teamtrainings durch.Weitere Infos unterwww.andrekotecki.de.
Sehr vielePraktikerinnen und Praktiker[1]im sozialenBereich sind heutzutageim Allgemeinen nicht zu beneiden. Unsere Zielgruppen werden heterogener und somit auchherausfordernder. Außerdem nehmen die psychischen Auffälligkeiten zu, was Einzelne im Gruppenraumnochverhaltenskreativermacht.
Aber in Hinsicht aufeinebestimmteSachegeht es uns auf den ersten Blick gar nicht so schlecht:Sobaldsichzwischenmenschliche Konfliktezwischen Professionellenund Heranwachsendenergeben,greift ein populärer selbstwertdienlicherpsychischer Automatismus auf Professionellenseite:Man istmit seinenKollegen schnelleiner Meinung–undsitztzudem auch nocham längeren Hebel.Dieser Umstandist für das WohlbefindenundSelbstwertgefühlein mehr alserfreulicherEffekt. Denn:Schuld an den jeweiligen Unstimmigkeiten ist natürlich immer dasan dem jeweiligen Konfliktbeteiligte Kind/der betreffende Jugendliche.Wir sind ja die Professionellen…
Aber, so muss man aus seriös-wissenschaftlicher Sicht sagen,solcheWahrnehmungsvorgänge basieren lediglich auf einemevolutionären,psychologisch-primitivenPhänomen, von dem wirwahrscheinlichalle,trotz etwaiger Fortbildungen und Selbsterfahrungsgruppen,nicht frei sind.
Dieses Geschehen schematheoretisch zu deuten und zu überwinden, ist einesvonmehrerenZielen dieser Studie.
Irrtum 1: „Schuld anschwerwiegendenKonflikten sind die Zu-Erziehenden!“
Es ist natürlich klar, zu welchem Standpunkt die Mehrheit der Professionellenin denobenskizzierten Situationenvorauseilend neigt.Klar.Man müsste nur einmal versteckte Mikrofone in Lehrer- und Teambesprechungszimmern installierenund die Gespräche in den Pausen undKonferenzen aufzeichnen.
Nach derunvoreingenommenenAuswertung würdeschnellklarwerden, wie einseitig diealltagspsychologischen Deutungen von auffälligemKinder- oder Teenagerverhaltenin der Regelausfallen.Im Prinzip kennt sicherlich jeder, der ehrlich zu sich selbst ist,diesen Rationalisierungsmechanismus.Man mussbeizwischenmenschlichenUnstimmigkeitennur lange genug nachdenken,irgendwann erkennt man ganz klar,wiesoletztlichdoch der Interaktionspartner für denjeweiligenKonflikt verantwortlich ist.Dem anderen ergeht es aber auch so!
Aber ich will hier nicht den Stab über meinen Berufsstand brechen. Die mehr oder weniger unbeholfenen Selbstrechtfertigungstendenzen bei Interaktionsproblemen sind natürlich auchüberall dortProgramm,wo irgendwer eben am längeren Hebel sitzt.Wir reden hiergleichzeitigvonallgemeinenpsychologischen Gruppenprozessen(„Wir sind die Guten –ihr seid die mit den Defiziten!“).Natürlich ist es aber auch umgekehrt so, dass diejenigen, die am kürzeren Hebel sitzen, die Sachlagejederzeitganz anders sehen.Nämlich so, dass daseigenekollektive Klima selbstwertdienlich verzerrt wird.Man sieht anhanddieser kurzen Skizze schnell: Kommunikative Prozesse, vor allem Konflikte,werden von jeder teilnehmenden Partei unterschiedlicheingeschätztundje nach Persönlichkeitsstruktur„zuerechtkonstruiert“.Diesistzwarmenschlich, allzu menschlich, führt aberkeinesfalls zur beruflichen Professionalität.
Irrtum 2: „Die Beziehungsebene (Emotionen, Sympathie, Antipathie) hatnurwenige bis keineAuswirkungen auf die Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrags!“
Wer nun meint, dass solche interaktionellenAutomatismenin der pädagogischen Praxisin Hinsicht auf das Alltagsgeschäftnur wenig Bedeutung haben, derist auf dem Holzweg.Nach aktuellen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen(GRAWE 2004; GAZZANIGA 2012; GOLEMAN 2007)verhält es sich so, dassaktuelleGefühle wieauchgrundlegendeEmotionen, die in der jeweiligen Beziehungzwischen den Parteienim Praxisfeld ausgelöst werdenoder konstant bestehen, darüberentscheiden,was gedanklich (kognitiv)beiderseitsvor sich geht.Emotionen generierensogar Kognitionen(im Guten wie im Schlechten).Daher habenz.B.Sympathie undAntipathie große Auswirkungen.Daraus resultierendeBeziehungsstörungen führensogardazu, dass der Erziehungs- und Bildungsauftrag gar nicht erfolgreichvom Professionellenumgesetzt werden kann.
Denn, soerkannteschon Arthur Schopenhauer: „Was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht ein.“Lapidar gesagt: WennKinder und Jugendlicheden Professionellen akzeptieren,respektierenundihnsogarein Stück weitmögen, dann bleibtim pädagogischen Alltagsehr viel mehr „hängen“ als im umgekehrten Fall.Hierzu einSchülerzitat: „Lehrer scheiße, Unterrichtsthema scheiße!“Nun gibt es unverständlicherweisenur sehr wenige Veröffentlichungen, die die Beziehungsebene, die emotionale Prozesse miteinbezieht,in Erziehungs-und Bildungsberufenkonkretundmethodischthematisieren. Es heißtin der sozial- und schulpädagogischen Literaturstets: „ZeigeToleranz, Akzeptanz und Kongruenz!“Nur: Wer bringt das alles auf, wenn erdie oder den HeranwachsendenXYeinfachnicht leiden kann?Und solche Fälle sind,wenn wir ehrlich sind, keine Einzelfälle, sondern die Regel.
Irrtum 3: „Ich erziehe und bilde ganz normal!“
Allgemeine Empfehlungen helfen unsdemnachnicht weiter.Die vorliegende Studie[2]nimmt sich dieserwichtigenAngelegenheit anund möchte eine konkrete Antwort auf folgende Frage geben:„Welche Themen und Verhaltensweisen bringeichaufgrundmeinerBiografie mit in den Gruppenraum und was genau sind derenunbewusstenAuswirkungen auf der Beziehungsebene?“
Denn eins istdochklar: Es gibtzustrenge pädagogische Fachkräfte,zudistanzierte,aber auchzuhilfsbereite usw. Eine Sachevereint sie aber alle:Sie wissen nicht um ihr Auftreten,ihre„wunden Punkte“, um ihre „Trigger“.(Trigger sind unbewusste „Knöpfe“, die den Professionellenregelmäßigaus dem Konzept bringen, seine Aufmerksamkeit von jetzt auch gleich beenden,seinesogenannten „typischenfünf Minuten“ auslösen.)
Die Zu-Erziehenden finden wohl sehr schnell heraus, welche Knöpfe das sind, und zwar durch das Prinzip „Lernen durch Versuch und Irrtum“.Nach meiner Einschätzung wird so gut wie jeder Professionelle auf diesem Weg hin und wiederzum steuerbaren Objekt,mal mehr, mal wenigerzur„Marionette“im Gruppenraum, und zwar unbewusst.Daher brauchen wir ein Update!
Aus diesem Grund gibt es seit 2010 das neuropädagogische Konzept namens Schemapädagogik. Vor diesem Hintergrund finden Bemühungen statt, die Beziehungen zwischen Professionellen und Heranwachsenden in sozialen und Bildungsberufen zu verbessern, um die „Herzen zu öffnen“. Denn erst dann ist bekanntlich auch der Kopf „offen“.
Ausblick
Imersten Kapitel– Einleitung – geht es um das Thema:„Rote Knöpfe der pädagogischen Fachkraft im Praxisalltag“. Hier soll gezeigt werden, wie schnell man als Professioneller „an der Front“ mit wenigAufwand von den Heranwachsenden aus demAlltagskonzept gebracht werden kann. Die persönlichkeitsspezifischen Ursachen diesbezüglich sind individuell und hängen mit der eigenen Biografie/Sozialisation zusammen.
Daszweite Kapitelführt ein in schemapädagogische bzw. -therapeutische Grundbegriffe. Danach werden die ersten neun Schemata vor dem Hintergrund der Schematherapie(YOUNG et al. 2008)thematisiert und konkret beschrieben und schließlich in den Kontext „Praxisfeld Erziehung und Bildung“ transferiert.Mit erworbenenbzw. antrainiertenSchemata – niemand ist frei von solchen neuronalenMustern – gehen „typische“Verhaltensweisen, „Schwachstellen“ und auchinteraktionelleManipulationstechniken einher, die, wie oben schon erwähnt, eben gewöhnlich unbewusst ablaufen.Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist es, sich mit den eigenen Schemata auseinanderzusetzen.Hierzu gibt es auch Fragebögen (s. Kapitel 3).
ImdrittenKapitelsind konkreteInterventionen zur Förderung der Selbsterkenntnis und Sozialkompetenzplatziert. Sie, liebe Leserin, lieber Leser,finden folgende Materialien vor: jeweils einen Fragebogen, eineschemaspezifische Stühlearbeit, ein Textblatt und einen Besinnungstext. Mithilfe dieserArbeitsblätterbzw. Anregungensollen Sieschrittweiseein Gespür für die eigene Persönlichkeitsstruktur entwickeln.
Danksagung und Sonstiges
In erster Linie bedanke ich mich bei„meinen“sechsSozialassistenten-Klassen, die ichvon8/2013 bis 8/2014 an der BBS Hauswirtschaft/Sozialpädagogikin Ludwigshafenunterrichtete. Im regen Austausch wurdeimmer mal wiederauthentisch über „guten Unterricht“,positive Lehrereigenschaftenund über die Bedingungen eines förderlichen Gruppenklimasdiskutiert, und zwar gewinnbringend.So hoffe ichzumindest.
Noch eine Bemerkung zur Sprache: Ich fühle mich trotz meiner narzisstischen und zwanghaften Persönlichkeitsanteile, von denen es nicht wenigegibt,nichtdazu genötigt, in begrifflich-intellektuelle Höhen vorzustoßen, die so manchenAutorelitärund „edel“, aberin Hinsicht auf die Alltagspraxisrelevanz unleserlichmachen. Ich muss hier keinen entsprechendenEindruckauf die Leserschaftmachen. Auch neige ich nicht zuüberlangen, komplizierten Satzkonstruktionen, die dem erwähnten erlauchtenAutorXYmeistens demselben Ziel dienlich sein sollen.
DasvorliegendeBuch soll, wie alle anderen Bände derSchemapädagogik kompakt-Reihe auch,leicht zu lesensein. Die Ausführungensollverstandenwerden und vor allemeine Hilfe für die Praxis sein.Hier geht es nicht, wie etwa bei vielenstaubtrockenenVeröffentlichungender Fall,ums„Vernünfteln“als Zweck an sich.Ichbin kein Elfenbeinturmbewohner(ich war mal einer).Mir geht esschlicht und einfachumeine erfolgreiche Pädagogik,umdie Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen imPraxisalltag,auchum dieFörderungder zwischenmenschlichen Beziehungsqualitätim Allgemeinen.Daran ist auch wohl mein stark ausgeprägter Helfer-Anteil beteiligt.
Pädagogischen Erfolg hat manlangfristignur, wenn mandie BeziehungsebenezwischendenZu-Erziehenden unddenProfessionellenberücksichtigen und(ansatzweise)positiv gestalten kann.Erst unter dieser Voraussetzung bilden sich in den Gehirnen unserer jungen Interaktionspartner neue Verknüpfungen/Schemata.Und gerade unsere „schwierigen Fälle“ benötigen diese!Hier haben wirPädagogenakuten Handlungsbedarf, da unsere „Lieben“ nicht gerade einfacher werden.Als Berufsschullehrer mit vollem Deputatan der BBSHW/SPLudwigshafensehe ich das.Und deshalbmuss man auch die Sprache derKinder, Jugendlichen und Erwachsenensprechen können, mit denen wir jeden Tag zu tun haben.Praktikerund unsere„Lieben“brauchen keine Elfenbeinturmsprache.So sei es!Ich wünsche Ihnen im Folgenden viele Aha-Momente!
Worms, imHerbst2014
Marcus Damm
Kontakt
Institut für Schemapädagogik
Dr. Marcus Damm
Höhenstr. 56
67550 Worms
Internet:http://www.schemapädagogik.de;http://www.schemapädagogik-netzwerk.de
E-Mail:[email protected]
1.Einleitung –Warum unsere biografisch verankerten „roten Knöpfe“ den Erziehungs- und Bildungsauftrag sabotieren
Fragen wie „Wer bin ich?“ – „Zu was bin ich imstande?“ – „Was sind meine Stärken und Schwächen?“ sind vor allem in dem spannenden Feld der Sozialpsychologie relevant.ZahlreicheForschungsprojekte zur Selbstwahrnehmung bzw. zum Selbstkonzeptbestätigen ein interessantes menschliches, allzu menschliches Phänomen:Wir finden uns selbst gar nicht so schlecht, genauer gesagt, in vielerlei Hinsicht sogar etwas attraktiver,talentierter, sozialkompetenterusw.als unsere Mitmenschen
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!