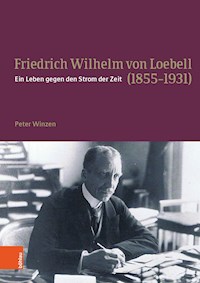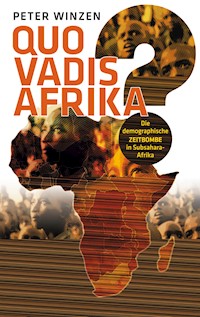
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Unter den Entwicklungspolitikern und Wissenschaftlern besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass sich das Schicksal der Menschheit in Afrika entscheidet. Dessen ist sich die Weltöffentlichkeit allerdings bis heute nicht bewusst. Unser südlicher Nachbarkontinent rückt nur immer dann in den Fokus des allgemeinen Interesses, wenn es um die Behebung der zahlreichen humanitären Katastrophen geht. Dass die Ursache der meisten Katastrophen in der äußerst dynamischen Bevölkerungsentwicklung der 49 Subsaharastaaten zu suchen ist, wird von Politik und Medien gewöhnlich verschwiegen. Gegen die Verharmlosung des aus der Bevölkerungsexplosion in Subsahara-Afrika resultierenden Bedrohungspotenzials - nicht nur für den Kontinent, sondern für die Menschheit schlechthin - wendet sich der Autor entschieden. In seiner faktenbasierten Studie wird vor dem demographischen Hintergrund jenes Gefahrenszenario eindringlich analysiert, wobei auch mögliche Auswege aufgezeigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Allen Kindern dieser Welt gewidmet
Inhalt
Prolog
Afrika vor der Kolonialzeit: Vom Recht des Stärkeren
Bevölkerungsentwicklung während der Kolonialzeit
Die politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Entwicklung Afrikas nach dem Zweiten Weltkrieg
Aktuelle Momentaufnahmen quer durch Afrika
Faktoren der Bevölkerungsdynamik in den Subsahara-Staaten
Die Ausgangssituation:
Der Teufelskreis Kinderehen:
Der Fertilitätswahn:
Rückgang der Kleinkindersterblichkeit und steigende Lebenserwartung:
Urbanisierung und das Anwachsen der Slums:
Das demographisch-politische Paradoxon:
Hilfe von außen:
Bevölkerungsexplosion und Klimawandel:
Mögliche Strategien zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums
Ausblick
Anhang
Quellenverzeichnis
Personen- und Sachregister
Zum Autor
Prolog
Schon vor vielen Jahren haben die Demographen der Vereinten Nationen Alarm geschlagen: Seit den 90er Jahren wächst die Weltbevölkerung im Schnitt um jährlich 82 Millionen Menschen, das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Deutschlands. Das bedeutet aber auch, dass die Erdbevölkerung alle zwölf Jahre um 1 Milliarde Menschen zunimmt. Bis zum Vorabend der Industriellen Revolution verlief die weltweite Bevölkerungsentwicklung noch relativ ruhig: 1800 belief sich die Weltbevölkerung gerade einmal auf geschätzt 1 Milliarde. 1950 waren es immerhin schon 2,5 Milliarden Menschen. Seitdem ist ein steiler Anstieg der Bevölkerungskurve zu verzeichnen, die ihren ersten Höhepunkt Mitte der sechziger Jahre erreichte (siehe Diagramm 1). Heute (2019) umfasst die Weltbevölkerung bereits 7,8 Milliarden Menschen. Nach der mittleren Bevölkerungsprognose der UN werden es 2050 wohl 9,7 und am Ende dieses Jahrhunderts sogar 11,2 Milliarden Erdenbürger sein, die unseren Planeten bevölkern. Das führt naturgemäß zu der bangen Frage, wie viele Menschen unser – aus Weltraumsicht – »blauer Planet« noch verkraften kann.
Mehr als 90 Prozent der weltweiten Bevölkerungszunahme findet in den Entwicklungs- und Schwellenländern statt. Während Europa seit geraumer Zeit bevölkerungsmäßig stagniert, bewegen sich die Geburtenzahlen in Afrika dank einer durchschnittlichen Fertilitätsrate von (2018) 4,6 Kindern pro Frau auf einem erstaunlich hohen Niveau. In vielen afrikanischen Staaten südlich der Sahara beträgt der jährliche Bevölkerungszuwachs deutlich über 3 Prozent. So konnte z.B. der Wüstenstaat Niger seine Bevölkerungszahl in den letzten zwanzig Jahren mehr als verdoppeln (von 1997 9.799.000 auf 2016 20.673.000), während in dem gleichen Zeitraum der Ölstaat Nigeria seine Einwohnerzahl von 117.597.000 auf 185.990.000 erhöhen konnte. Die Prognosen sind noch aufwühlender: 2050 wird einer neueren UN-Schätzung zufolge Nigeria, das noch 1950 gerade einmal 37,8 Millionen Bewohner aufwies, auf 401 Millionen, 2100 sogar auf 733 Millionen Staatsangehörige kommen und damit bald unter den bevölkerungsreichsten Staaten der Erde nach Indien und China den dritten Rang einnehmen. Wie die afrikanischen Staaten südlich der Sahara mit dem wachsenden Bevölkerungsdruck umgehen werden, steht in den Sternen.
Auf dem afrikanischen Kontinent und seinen vorgelagerten Inseln lebten 1950 227,8 Millionen Menschen. Heute (2020) sind es bereits 1.340,6 Mio. Während sich in den nächsten Jahrzehnten die Bevölkerungszunahme auf den übrigen Kontinenten merklich abschwächt oder sogar stagniert, explodieren südlich der Sahara die Bevölkerungszahlen förmlich. Für 2050 wird mit einer Verdoppelung der afrikanischen Bevölkerung gerechnet (2.489,3 Mio.). Gegen Ende unseres Jahrhunderts werden dort etwa 4,3 Milliarden Menschen leben, wenn sie sich nicht in einer riesigen, historisch noch nie dagewesenen Migrationswelle auf andere Kontinente, insbesondere auf Europa, verteilen. Dass diese Massenmigrationen im Zeitalter des Klimawandels friedlich vor sich gehen werden, ist kaum anzunehmen. War nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur jeder zehnte Erdenbürger in Afrika beheimatet, wird 2100 jeder dritte Mensch ein Afrikaner sein (siehe Tabelle 2). Allein Nigeria, obwohl flächenmäßig kaum dreimal so groß wie Deutschland, wird fast doppelt so viele Einwohner haben wie die Europäische Union, wenn der zu erwartende Massenexodus nach Europa ausbleiben sollte.
Obwohl diese Zahlen ein düsteres Zukunftsszenario erwarten lassen, schlägt sich das Problem der Bevölkerungsexplosion in Subsahara-Afrika im öffentlichen Diskurs kaum nieder. Zwar hat sich die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel angesichts der fast wöchentlichen Flüchtlingsdramen im Mittelmeer die Bekämpfung der Fluchtursachen auf ihr Panier geschrieben, doch bei der Auflistung der Fluchtursachen fehlt fast regelmäßig der Hinweis auf die rasante Bevölkerungszunahme in fast allen subsaharischen Staaten, die neben dem Klimawandel doch der eigentliche Nährboden für die zahlreichen Hungerkatastrophen, die die nördliche Staatenwelt destabilisierenden Fluchtbewegungen und unerträglichen bürgerkriegsähnlichen Zustände in West-, Zentral- und Ostafrika ist. Das bevölkerungspolitische Thema wird von den politischen Eliten der hochentwickelten Länder, aber auch von den wichtigsten Medien aus ethisch-religiösen und völkerrechtlichen Gründen totgeschwiegen oder allenfalls nur beiläufig erwähnt. Das für die Zeit um Christi Geburt noch sinnvolle Gebot des »Wachset und vermehret Euch« gehört schließlich zum Kernstück der christlichen Lehre. Und die eigenverantwortliche Entscheidung über die Zahl der eigenen Kinder und den Zeitpunkt ihrer Geburten stellt ein verbrieftes Menschenrecht dar – erstmals formuliert 1968 auf der UN-Menschenrechtskonferenz in Teheran und erneut bekräftigt 1994 auf der Internationalen UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo. Aber seinerzeit übersah man offenbar noch nicht die Tragweite dieser Beschlüsse.
Unter den Afrikanisten und selbst unter vielen Demographie-Experten scheint das Thema der in der Weltgeschichte bislang beispiellosen Bevölkerungsexplosion in Subsahara-Afrika (49 von insgesamt 54 afrikanischen Staaten) noch immer nicht angekommen zu sein, wie z.B. Leonard Hardings für die Geschichtsstudenten konzipierte Abhandlung »Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert« zeigt. Hat der renommierte Forscher noch in der 1. Auflage von 1999 in der Rubrik »Grundprobleme der Forschung« einen knappen Überblick über »Ansätze zur Erforschung der Bevölkerungsentwicklung« gegeben, verzichtet er in der dritten Auflage von 2013 gänzlich auf die Einbeziehung dieses Themas: Er hat dieses Kapitel einfach gestrichen, statt es auf den neuesten Stand zu bringen.
Ziel dieser Studie ist es, die Bevölkerungsentwicklung auf dem afrikanischen Kontinent von ihren Anfängen bis heute möglichst akkurat nachzuverfolgen und, so weit es die eher dürftige Quellenlage erlaubt, dabei das Hauptaugenmerk auf die Ursachen für die jeweilige Zunahme, Abnahme oder Stabilisierung der Bevölkerung in den verschiedenen Epochen und Regionen des Kontinents zu richten. Bei der Untersuchung der vorkolonialen Zeit wird vor allem der Frage nachgegangen, welche Grundmuster gesellschaftlichen Zusammenlebens damals dominant waren, um vielleicht Parallelen zu heutigen politischen, sozialen und kulturellen Phänomenen zu entdecken. Dabei geht es vor allem darum, mentale Kontinuitäten herauszuarbeiten, die auch die Kolonialzeit überdauert haben, um so zu einem tieferen Verständnis für die heutigen Probleme in Afrika, die in der Afrikanistik keineswegs verkannt werden, beizutragen. Am Beispiel einiger besonders auffälliger Staaten südlich der Sahara (Kongo-Kinshasa, Nigeria, Uganda, Zentralafrikanische Republik und Sudan als stellvertretend für die krisenüberfrachtete Nachkriegsgeschichte der meisten afrikanischen Staaten) wird die wechselvolle politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Entwicklung Afrikas nach dem Zweiten Weltkrieg in gebotener Kürze nachgezeichnet. Bei diesem Überblick werden aber auch Erfolgsgeschichten nicht ausgeblendet, wie sie namentlich Botswana und Mauritius aufweisen können. Anhand von aktuellen Reportagen wird dem Leser sodann die menschliche, politische und wirtschaftliche Situation in den Krisengebieten Subsahara-Afrikas, die allesamt unter einer von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbemerkten Bevölkerungsexplosion leiden, anschaulich nahegebracht. Dabei wird der Fokus auf die Suche nach den Gründen für das Abrutschen vieler subsaharischer Staaten in den permanenten Krisenmodus gelegt (systemimmanente Korruption, Abfluss des Kapitals aus Afrika, Veruntreuung der stattlichen Entwicklungsgelder durch die Eliten, mangelnde Investitionsbereitschaft, wenig Sinn der politischen Eliten für das Volkswohl, grassierende Armut, Ethnien- und Sprachenvielfalt, permanente Bedrohung der Bevölkerung durch schwerbewaffnete Rebellenmilizen mit ethnischem Hintergrund und last but not least der wachsende Bevölkerungsdruck, der die meisten Staaten südlich der Sahara schon jetzt überfordert). Besonderes Gewicht wird auf die faktenorientierte Herausarbeitung der verschiedenen Faktoren für die afrikanische Bevölkerungsdynamik gelegt und immer wieder auf die schon jetzt im Ansatz zu beobachtenden Folgen der Übervölkerung verwiesen. Schließlich wird der Versuch unternommen, mögliche Strategien zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums zu skizzieren, wie sie hin und wieder in der Publizistik angeregt worden sind und einer breiteren öffentlichen Diskussion noch harren.
Es gibt wohl kaum eine Geisteswissenschaft, die mit so vielen kontroversen Positionen behaftet ist wie die Afrikanistik. Dies zeigt schon allein die Debatte um die Bewertung der Kolonialzeit, die – je nach der politischideologischen Ausrichtung der Wissenschaftler – von der absoluten Verdammung (»das größte Verbrechen in der Weltgeschichte«) bis zu wohltuend differenzierten Urteilen reicht, die wiederum bei einigen Afrikanisten auf große Entrüstung stoßen. Vorurteile und Tabus verstellen freilich oft den Blick für die Wirklichkeit, die hinsichtlich der gegenwärtigen Situation in Afrika eher düster aussieht. Gleichwohl verbreiten viele Wissenschaftler ein ziemlich positives Afrikabild, eben weil sie wohl bestimmten Tabus verhaftet sind. Als beispielsweise bei einem öffentlichen Vortrag über das heutige Afrika ein Zuhörer die Referentin, eine Professorin für Afrikanistik, auf das Problem der zahlreichen Bürgerkriege und Kindersoldaten ansprach, runzelte diese die Stirn und meinte nur: »Das ist Rassismus«.
Dabei ist beispielsweise für viele Homosexuelle Afrika heute immer noch ein dunkler Kontinent. Homosexualität wird in 34 der 54 afrikanischen Staaten unter Strafe gestellt, in zwei von ihnen – Mauretanien und dem Sudan – steht auf nachgewiesener Homosexualität sogar die Todesstrafe. In Uganda droht Homosexuellen eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, auf der Grundlage eines noch aus der britischen Kolonialzeit stammenden Strafgesetzartikels, in dem festgeschrieben wird, dass gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr »gegen die natürliche Ordnung« verstößt. Einigen Parlamentariern in diesem ostafrikanischen Staat geht dieser Artikel noch nicht weit genug: Sie kündigten an, eine Gesetzesnovelle ins Abgeordnetenhaus einbringen zu wollen, die in Einzelfällen sogar die Todesstrafe für Homosexuelle vorsieht. Bereits vor fünf Jahren wurde in Nigeria ein Gesetz rechtskräftig, nach dem Homosexuelle, die eine dauerhafte Verbindung miteinander eingehen, mit einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren rechnen müssen. Männer, denen ein »amouröses Verhältnis« unterstellt wird, sollen zehn Jahre hinter Gitter kommen. Dank der in allen Segmenten der Gesellschaft verbreiteten Korruption in dem bevölkerungsreichsten Staat Afrikas scheint es bis heute allerdings noch keine Strafgerichtsverfahren auf der Grundlage dieses Gesetzes gegeben zu haben. Wie die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kürzlich festgestellt hat, kämen die Fälle erst gar nicht zur Anklage, weil die nigerianischen Polizisten die der Homosexualität bezichtigten Festgenommenen nach Zahlung von Bestechungsgeldern wieder auf freien Fuß setzten [Dieterich, Kölner Stadt-Anzeiger, 6.12.2019].
Die Sorge vor der ungewissen Zukunft unserer heutigen Enkelgeneration hat den Verfasser der vorliegenden Studie an- und umgetrieben. Nach dem Sammeln aller derzeit verfügbaren Daten zur Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Umweltsituation in Subsahara-Afrika hat sich in ihm der Eindruck verfestigt, dass wir heute angesichts der kontinuierlichen Zunahme der Weltbevölkerung, die vornehmlich in Afrika stattfindet, vor entscheidenden weltpolitischen Weichenstellungen stehen und dass, wenn wir den Zeitpunkt für die Einleitung sinnvoller bevölkerungspolitischer Maßnahmen versäumen, die menschliche Zivilisation schon in der nächsten Generation vor dem Aus stehen könnte. Bei den Recherchen wurde immer deutlicher, dass zwischen dem atemberaubenden Wachstum der Weltbevölkerung und dem zur Zeit vielbeschworenen Klimawandel ein stringenter Zusammenhang besteht, ja dass die Bevölkerungsexplosion und die Ideologie des Wirtschaftswachstums, mit der man die negativen Folgen einer ungehemmten Bevölkerungsvermehrung auffangen will, die eigentlichen Motoren für die menschenfeindliche Erderwärmung darstellen. Für den Fall, dass diese Motoren nicht abgestellt werden – und dafür gibt es momentan keine Anzeichen, wird der Klimawandel unumkehrbar sein und das Ende des Anthropozäns, also des Menschenzeitalters, das mit dem Ende der Steinzeit begonnen hat, unwiderruflich einläuten. Dieser Gedankengang ist nicht neu, doch im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit und vor allem in dem der politischen Eliten noch längst nicht angekommen. »Wir leben in einer Zeit der ›großen Beschleunigung‹ menschlicher Einflüsse«, heißt es in dem »Living Planet Report 2018« von WWF Deutschland. »Diese Phase ist bislang einmalig in der 4,5 Milliarden Jahre langen Erdgeschichte. Kennzeichnend sind die Bevölkerungsexplosion und ein Wirtschaftswachstum, das mit enormem Hunger nach Energie, Land und Wasser noch nie dagewesene Veränderungen nach sich zieht. Weil diese Einflüsse so tiefgreifend sind, sprechen viele Wissenschaftler von einem neuen Erdzeitalter, dem sogenannten Anthropozän.« Und jedes Zeitalter geht einmal zu Ende.
Max Frisch hat die hier behandelte Thematik schon 1957 in »Homo faber« auf den Punkt gebracht: »Die natürliche Überproduktion (wenn wir drauflos gebären wie die Tiere) wird zur Katastrophe; nicht Erhaltung der Art, sondern Vernichtung der Art. Wieviel Menschen ernährt die Erde?« [S.129]. Heute würde die alles entscheidende Frage lauten: Wie viele Menschen mag unsere Erde noch verkraften, bis es zum Kollaps der Menschheit kommt?
Afrika vor der Kolonialzeit: Vom Recht des Stärkeren
Mit einer Gesamtfläche von rund 30 Millionen km2 umfasst Afrika ein Fünftel der Landfläche der Erde, was der dreifachen Fläche Europas entspricht. Der zweitgrößte Kontinent der Erde erstreckt sich 8.000 km von Norden nach Süden und über 7.600 km von Westen nach Osten.
Nach allem, was wir heute wissen, liegt die Wiege der Menschheit in Ostafrika, wo vor 2 Millionen Jahren eine relativ kleine Gruppe entwickelter Hominiden lebte. Es handelt sich um die nur fossil überlieferten Menschenarten Homo habilis und Homo rudolfensis, die schon Steinwerkzeuge und Handäxte benutzten, aber erst die halbe Gehirngröße des modernen Menschen aufwiesen. Der anatomisch moderne Homo sapiens trat vor etwa 120.000 Jahren auf. Mit ihm begannen die Wanderbewegungen auf andere, bislang menschenleere Kontinente, wenn man einmal von den Neandertalern absieht, die Mitteleuropa zwischen 150.000 und 30.000 v. Chr. bevölkerten und bereits eine Kleidung kannten. Vor ca. 100.000 Jahren verließen unsere Vorfahren Afrika, um zuerst in West- und Südasien, dann in Ostasien zu siedeln, möglicherweise schon vor 60.000 Jahren in Australien, und seit etwa 45.000 Jahren auch in Europa. Später kamen Menschen auch nach Nord- und Südamerika, doch ist der Zeitpunkt ihrer Ankunft bis heute nicht völlig geklärt. Diese globale Ausbreitung führte zu einem Anwachsen der Menschheit auf 4 bis 5 Millionen am Ende der Altsteinzeit, also vor etwa 12.000 Jahren [Münz/Reiterer 2007: 49]. Europa war zu diesem Zeitpunkt kaum bevölkert. Eine Forschungsgruppe der Universität Köln hat kürzlich herausgefunden, dass um 42.000 v. Chr. nur etwa 3.300 Menschen den europäischen Kontinent bewohnten. In der Folgezeit gab es, je nach den Naturereignissen, trotz großer Fruchtbarkeit der Steinzeitfrauen immer wieder Schwankungen nach oben und unten, einmal scheint es sogar eine Abnahme bis auf 1.000 Menschen gegeben zu haben [Kölner Stadt-Anzeiger, 15.3.2019].
Mit der Aufgabe der nomadischen Lebensweise vor rund 10.000 Jahren trat der erste große Bevölkerungsschub in der Menschheitsgeschichte ein. Noch während der Eiszeit (115.000-12.000 v. Chr.) waren alle Menschen Jäger und Sammler, doch in einer Periode globaler Erwärmung wurden erste Menschengruppen am Ende der letzten Eiszeit sesshaft. Sie betrieben, zuerst im Nahen Osten, Ackerbau und Viehzucht mit Schafen und Ziegen, später auch mit Rindern. Daraus entwickelten sich allmählich arbeitsteilige Gesellschaften. Im Zuge dieser Entwicklung kam es auch zu stärkerem Bevölkerungswachstum, denn die sesshaft gewordenen Menschen bekamen nicht nur mehr Kinder: Die ständig verbesserte Lebensmittelproduktion ermöglichte auch mehr Menschen das Überleben. So lebten vor 7.000 Jahren bereits geschätzte 7-10 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Es war die Zeit, in der die ersten Städte bzw. Stadtstaaten entstanden – zunächst in Mesopotamien, etwas später in Indien und China, seit etwa 3.000 v. Chr. auch im unteren Niltal; damals begannen die Ägypter, ihre »heiligen Zeichen« (griechisch: Hieroglyphen) zu entwickeln. Die Schriftsprache ermöglichte eine komplexe soziale, politische und militärische Organisation und einen erhöhten Grad an Arbeitsteilung. Dies wiederum beschleunigte das Bevölkerungswachstum, so dass zu Beginn unserer Zeitrechnung rund 256 Millionen Menschen auf der Erde gelebt haben dürften.
Außerhalb Ägyptens, das im Todesjahr Kaiser Augustus' sieben Millionen Einwohner aufzuweisen hatte [Tarver 1996: 26] und der von Berbern und Lybiern bewohnten Mittelmeerregionen blieb Afrika dünn besiedelt. Für das Jahr 14 n. Chr. taxiert man die Bevölkerung Afrikas auf 23 Millionen, was etwa einem Zehntel der damaligen Weltbevölkerung entsprach. Europa hatte zu diesem Zeitpunkt noch 40 Mio., geriet aber schon 350 n. Chr. mit 28 Mio. gegenüber dem Schwarzen Kontinent (30 Mio.) ins Hintertreffen. Der Bevölkerungsrückgang in Europa war eine Folge des zivilisatorischen Rückschritts in der Spätantike, verursacht durch die Völkerwanderung. Seinen Höhepunkt erreichte er um 600 n. Chr., als unser Kontinent infolge des durch die Justinianische Pest (542-600 n. Chr.) ausgelösten Massensterbens nur noch 19 Mio. Einwohner aufwies – während Afrika zur gleichen Zeit auf 37 Mio. Bewohner kam [Tarver 1996: 19]. Zu Beginn des Hochmittelalters begann, begünstigt durch eine Klimaerwärmung, die Bevölkerung Europas wieder zu wachsen (1200: 45 Mio.; 1340: 77 Mio.). Mitte des 14. Jahrhunderts erfolgte dann aber wieder ein nachhaltiger demographischer Einbruch. Dafür kann nicht allein die von den Genuesen nach Italien eingeschleppte große Pestepidemie von 1348/50, die ganze Landschaften entvölkerte und insgesamt 25 Millionen Tote forderte, als Erklärung dienen; diese Entwicklung wurde durch regelmäßig wiederkehrende Epidemien und andere Katastrophen (z.B. Hundertjähriger Krieg) in ihrer Wirkung so gesteigert, dass bis zur Neuzeit von einer demographischen Erholung nicht die Rede sein kann. Während zwischen 1350 und 1500 die europäische Bevölkerung um 15 Mio. abnahm, legte der Schwarze Kontinent in diesem Zeitraum um die gleiche Zahl zu, von 70 auf 85 Mio. Ein Viertel aller Europäer starben an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit an den immer wiederkehrenden Seuchen, in manchen urbanisierten Regionen sogar um die Hälfte. Auf deutschem Boden wurde die Bevölkerung vor allem durch den Dreißigjährigen Krieg dezimiert: Ihm fielen zwischen 1618 und 1648 fast 40 % aller Einwohner des Landes zum Opfer [Münz/Reiterer 2016: 153]. 1650 umfasste die Weltbevölkerung eine halbe Milliarde Menschen: Davon entfielen 100 Millionen auf Afrika, 305 Mio. auf Asien und nur 75 Mio. auf Europa, zwei Mio. weniger als noch 1340.
Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in Afrika in dem Zeitraum zwischen 1650 und 1850 verrät Erstaunliches: Während sich in jenen 200 Jahren die Weltbevölkerung mehr als verdoppelte (von 516 Mio. auf 1.171 Mio.), in Europa fast sogar verdreifachte (von 75 Mio. auf 208 Mio.), reduzierte sich die Einwohnerzahl in Afrika von 100 auf 95 Mio.; 1800 erreichte sie sogar einen Tiefstand von 90 Mio. Die Gründe für den Rückgang der bis dahin kontinuierlich gestiegenen Bewohnerzahlen sind in der Forschung unumstritten: Es hat hauptsächlich mit dem seit dem 16. Jahrhundert florierenden Sklavenhandel zu tun, der in der Regel mit äußerst verlustreichen Sklavenjagden der einheimischen Potentaten verbunden war. 1713 hatte sich Großbritannien ein englisches Handelsmonopol für die Sklaveneinfuhr nach Spanisch-Amerika gesichert. Allein zwischen 1701 und 1800, dem Höhepunkt der unrühmlichen transatlantischen Sklavengeschäfte, wurden 6,1 Mio. Sklaven nach Amerika und in die Karibik deportiert. Überdies wurden von den arabischen Händlern über die Sahara und die Häfen des Roten Meeres mehrere Millionen – meist Frauen und Kinder – in den arabischen Raum verschleppt. Seriösen Schätzungen zufolge waren es insgesamt 19 Mio. Sklaven, die von afrikanischen Chiefs an europäische und arabische Händler verkauft und außerhalb Afrikas verbracht wurden. Dieser Aderlass spiegelt sich auch in der Bevölkerungsstatistik nieder. Hatte die afrikanische Bevölkerung in dem Zeitraum zwischen 1340 und 1650 noch um 30 Mio. zugelegt, nahm sie in den beiden folgenden Jahrhunderten um etwa 10 Mio. ab [Tarver 1996: 19] und erholte sich erst wieder während der Kolonialzeit.
Die Regierungen in Europa sahen dem gegen das christliche Ethos verstoßenden Sklavenhandel nicht tatenlos zu. Bereits 1807 erließ das britische Parlament ein Gesetz, das den Sklaventransport auf britischen Schiffen verbot. 1833 erfolgte die Aufhebung der Sklaverei im gesamten Britischen Empire. Zuvor hatte Napoleon Bonaparte in einem Dekret vom 29. März 1815 die Abschaffung des französischen Sklavenhandels angeordnet, wenngleich Frankreich erst während der Revolutionswirren von 1848 sämtliche Sklaven seiner Kolonien frei ließ. Die befreiten Sklaven wurden in Libreville in Gabun angesiedelt. Mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor hatte England schon damit begonnen, seine freigelassenen Sklaven in Freetown, seit 1808 Hauptstadt der britischen Kolonie Sierra Leone, anzusiedeln. Und 1820 begann man mit der Rücksiedlung befreiter US-amerikanischer Sklaven nach Liberia, das dann 1847 seine Unabhängigkeit in Form einer Republik ausrufen konnte. Wie Franz Ansprenger es formuliert hat, führten diese drei Maßnahmen »das Wort Freiheit in die Geschichte des modernen Afrika ein« [Ansprenger 2004: 50]. Freilich ging von der portugiesischen Kolonie Angola aus der Handel mit Sklaven in Richtung Brasilien fast das ganze Jahrhundert hindurch (bis 1888) munter weiter. Über arabische Händler gelangten Sklaven und vor allem Sklavinnen von Ostafrika noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in den arabischen Raum. Schon seit 900 n. Chr. standen arabische Händler, die auch die Sahara-Routen beherrschten, im Zentrum des Sklavenhandels: Nach einer vorsichtigen Schätzung liefen vom 10. bis zum 20. Jahrhundert etwa 7,2 Mio. Schwarzafrikaner durch ihre Hände [Tarver 1996: 28].
Alarmiert durch die weltweite Bevölkerungszunahme am Ende des 18. Jahrhunderts, die seiner Ansicht nach langfristig zu einer großen menschheitsbedrohenden Katastrophe führen musste, widmete sich der englische Pfarrer Thomas Robert Malthus (1766-1834) als erster Gelehrter zeitlebens der Bevölkerungswissenschaft. In seinem »Bevölkerungsgesetz«, das er erstmals in seinem 1798 anonym veröffentlichten Essay on Population vorstellte, glaubte er die naturgegebenen Mechanismen einer periodisch wiederkehrenden Bevölkerungszunahme und –abnahme entschlüsselt zu haben. Dieses Naturgesetz, so Malthus, hindere die Bevölkerung eines jeden Landes daran, »über das Maß der Nahrungsmittel, die es hervorbringen oder erwerben kann, hinauszuwachsen«. Bei einer Missachtung dieses Gesetzes träten Hungersnöte, Seuchen und Kriege auf, die die Bevölkerung eines Landes auf ein vernünftiges Maß würden reduzieren helfen. Nach solchen Katastrophen trete in der Regel ein Babyboom ein, der die vorangegangene Bevölkerungsdezimierung ausgleichen würde. Sei der Geburtenüberschuss jedoch zu stark, träten automatisch wieder jene »positive checks« in Erscheinung. Malthus' Credo war also, dass ein gesundes Bevölkerungswachstum sich an den jeweils zur Verfügung stehenden Subsistenzmitteln zu orientieren habe, und ein Überschreiten dieser roten Linie unweigerlich zu riesigen menschlichen Katastrophen führen würde. Als »vorbeugendes Hemmnis der Bevölkerungsvermehrung« empfahl Malthus seinen Lesern eine größere sexuelle Enthaltsamkeit und vor allem ein »Hinausschieben der ehelichen Verbindung aus Klugheitsrücksichten« [Malthus 1905: 466-485].
Wie berechtigt die Sorgen des Pfarrers waren, zeigt das beispiellose Anwachsen der Weltbevölkerung in den letzten Jahrzehnten. Die moderne Entwicklung deckt aber auch die Unzulänglichkeiten seines »Bevölkerungsgesetzes« auf, da die »positive checks« nicht mehr zu greifen scheinen. Selbst die beiden Weltkriege mit ihren 50 Millionen Toten, die vielen blutigen Bürgerkriege, die zahlreichen Hungerkatastrophen, immer wieder auftretende Epidemien und Pandemien wie die Spanische Grippe 1918/20 und die Immunkrankheit Aids und gezielte Geburtenbeschränkungsmaßnahmen wie in China haben das globale Bevölkerungswachstum, dessen Motor vor allem Afrika ist, nicht bremsen können. Welche Antworten hätte Malthus, Inhaber des ersten Lehrstuhls für Politische Ökonomie in England, auf unsere heutigen Probleme gehabt?
Die Bevölkerungsentwicklung in Afrika, wie er sie aus seinem Blickwinkel verfolgen konnte, schien die Gültigkeit seines »Bevölkerungsgesetzes« bekräftigt zu haben. Trotz der guten landwirtschaftlichen und klimatischen Voraussetzungen und obwohl »die Negerfrauen außerordentlich fruchtbar« seien, so führte Malthus im 8. Kapitel seines Werkes (»Über die Hemmnisse der Bevölkerungsvermehrung in verschiedenen Gegenden Afrikas«) aus, sei die demographische Entwicklung auf dem Schwarzen Kontinent ziemlich konstant geblieben, weil nach Geburtenüberschüssen immer wieder Phasen von deutlichen Bevölkerungsrückgängen zu verzeichnen seien. Bei seinen Beobachtungen stützte er sich vor allem auf die zeitgenössischen Reiseberichte des schottischen Arztes Mungo Park (1771-1806) und des Afrikaforschers James Bruce (1730-1794). Bruce hatte auf dem Weg zu den Quellen des Nil in einer langjährigen Expedition (1768-1773) Ägypten, Äthiopien und den Sudan bereist, während Park 1795 von der Mündung des Gambia aus aufgebrochen war, um im Auftrag der Londoner Afrikagesellschaft nach dem Mündungsgebiet des Niger Ausschau zu halten.
Bruce zeichnete ein düsteres Bild der von ihm bereisten Gegenden. Die ganze Küste des Roten Meeres sei höchst ungesund. Die Menschen litten ständig an heftigem Fieber, das häufig am dritten Tage mit dem Tod ende. Blattern würden überall große Verheerungen anrichten, besonders bei den Völkern an den Grenzen Abessiniens, wo sie manchmal ganze Stämme vernichteten. Der Hunger sei der ständige Wegbegleiter der Menschen: Eines Abends sei man in einem Dorfe angekommen, »dessen Einwohner im vergangenen Jahre alle Hungers gestorben waren; ihre armseligen Gerippe waren unbeerdigt und lagen über den Boden verstreut, auf dem früher das Dorf gestanden hatte. Wir lagerten zwischen Totengebeinen, da kein Platz gefunden werden konnte, auf dem es keine gegeben hätte.« Die Lebenserwartung sei sehr niedrig (in manchen Gegenden hätten 22-jährige Frauen schon als alt gegolten), die Sterblichkeit infolge der unablässigen Kriege und unzähligen bewaffneten Raubüberfälle auf friedliche Dörfer ausgesprochen hoch. Die weitverbreitete Polygamie sei ein Mittel gewesen, um die Ausblutung der Ethnien zu verhindern. Zur Überlebensstrategie gehöre vor allem der Kinderreichtum: »Die Agowfrauen beginnen mit elf Jahren Kinder zu gebären. Sie verheiraten sich im allgemeinen in diesem Alter, und etwas wie Unfruchtbarkeit ist bei ihnen nicht bekannt. In Dixan, einer der Grenzstädte Abessiniens, besteht der einzige Handel in dem Verkauf von Kindern. Es werden jährlich 500 nach Arabien verschickt und […] zu Zeiten der Not, viermal soviel.« [Malthus 1905: 150].
Von Afrikas Stolz, dem über Jahrtausende hohe Kulturmaßstäbe setzenden Reich der Pharaonen, war im 18. Jahrhundert nicht mehr viel übrig geblieben. Die Mamelucken, die seit 1249 Ägypten beherrschten, hatten das Land derart heruntergewirtschaftet, dass es zu den ärmsten Provinzen des Osmanischen Reichs gehörte. Das von den Pharaonen ausgebaute Kanalsystem, das zur Bewässerung der Uferlandschaften diente und unliebsame Überschwemmungen verhinderte, war verrottet, und das Volk stöhnte unter der Steuerlast der mameluckischen Tyrannen, die das Eigentum ihrer Untertanen nicht respektierten und sich hemmungslos bereicherten. Hinzu kam das »Übel eines beständigen Bürgerkrieges«. 1773 wurde Ägypten von der Pest heimgesucht, und in den beiden Folgejahren herrschte eine »schreckliche Hungersnot«, weil der Nil in der Regenzeit zu wenig Wasser geführt hatte. Von einem französischen Reisenden übernahm Malthus folgenden Situationsbericht: »Die Straßen von Kairo, die anfangs voll Bettler waren, waren bald von allen diesen Leuten gesäubert, die entweder zugrunde gingen oder flohen. Viele dieser Bejammernswerten zerstreuten sich, um dem Tode zu entgehen, über die umliegenden Gegenden, und die Städte Syriens wurden von Ägyptern überschwemmt. Die Straßen und öffentlichen Plätze waren angefüllt von verhungerten und sterbenden, zu Skeletten abgemagerten Menschen. Auch zu den abstoßendsten Mitteln, das Nagen des Hungers zu stillen, nahm man seine Zuflucht. Die ekelhafteste Nahrung wurde mit Heißhunger verschlungen. […] Die Entvölkerung während dieser zwei Jahre wurde auf ein Sechstel aller Einwohner geschätzt.« [Malthus 1905: 157].
Von solchen Hungersnöten wusste Park bei seinen fast dreijährigen Forschungsreisen durch Westafrika (1795-1797) nicht zu berichten. Er stieß südlich der Sahara weitgehend auf blühende Landschaften, die, obwohl überwiegend fruchtbar, nicht allzu dicht besiedelt waren. Überall begegneten ihm große, von Sklaven gehütete Viehherden und Karawanen von indigenen Kaufleuten, die auf ein reges Handelsleben schließen ließen. Der hauptsächlich von Sklaven betriebene Ackerbau sorgte meist für eine ausreichende Ernährungsgrundlage. Dagegen waren die politischen Verhältnisse in diesem Teil des Kontinents wenig übersichtlich. Westafrika zerfiel in Dutzende von kleinen Königreichen und halbautonomen städtischen Siedlungen. Feste Grenzen gab es nicht, sie verschoben sich ständig, je nach Kriegslage. Hinzu kam das Sprachengewirr, das die Verständigung zwischen den verschiedenen Potentaten erschwerte.
Kriege und räuberische Einfälle gehörten zu den ständigen Heimsuchungen der dortigen schwarzen Bevölkerung. Längere Friedensperioden waren unbekannt. »In einem Land«, schreibt Park, »welches in tausend kleine Staaten geteilt ist, die voneinander unabhängig sind, wo jeder freie Mann in den Waffen geübt ist und das kriegerische Leben liebt, wo jeder Jüngling, der Speer und Bogen von Kindheit an gehandhabt hat, nichts sehnlicher wünscht als eine Gelegenheit, seine Tapferkeit zu zeigen, ist es natürlich, daß Kriege sehr oft aus unbedeutenden Ursachen entstehen.« In Afrika, so Park weiter, gebe es zweierlei Arten von Krieg: »Derjenige, der mit unseren europäischen Kriegen die meiste Ähnlichkeit hat, heißt Killi, was herausfordern bedeutet, weil diese Kriege offene Fehden sind und vorher erklärt werden. Solche Kriege werden jedoch in Afrika durch einen einzigen Feldzug beendet. Ein Gefecht wird geliefert, die Überwundenen denken selten daran, sich wieder zu vereinen, alle Einwohner überfällt ein panischer Schrecken und die Eroberer haben nichts zu tun, als ihre Sklaven zu binden und ihre Opfer mit der anderen Beute abzuführen.« Wehrhafte Kriegsgefangene würden zu Sklaven degradiert, die irgendwann zum Verkauf anstünden, während Alte und Schwache als unverkäuflich angesehen und meist getötet würden. Dasselbe Schicksal ereile oft die Anführer der Unterlegenen. Die andere Kriegsart, die bei weitem die häufigste war, hieß laut Park »Tagria, Plündern oder Stehlen«: »Einige entschlossene Leute, die von einem mutigen Mann angeführt werden, marschieren in aller Stille durch die Wälder, überfallen in der Nacht irgendein wehrloses Dorf und führen die Einwohner mit ihrer Habe fort, ehe die Nachbarn ihnen zu Hilfe kommen können.« Diese brutalen Raubzüge, an deren Ende stets die Versklavung der brauchbaren Dorfbewohner ständen, seien besonders zahlreich gegen Ende der Regenzeit und zu Beginn der trockenen Jahreszeit, »wenn die Erntearbeit vorüber ist und es überall Lebensmittel im Überfluß gibt.« [Park 1984: 203-06]. Verständlicherweise gebe es dann Gegenreaktionen, die wiederum zu permanenten verlustreichen Fehden zwischen den benachbarten Stämmen führen würden: »Solche räuberischen Einfälle werden immer sehr bald auf dieselbe Art vergolten, und wenn man nicht zahlreiche Parteien zusammenbringen kann, so vereinigen sich einige Freunde und fallen ins feindliche Land, um zu plündern und Einwohner wegzuschleppen.« Mitunter übten auch einzelne Krieger auf eigene Faust Rache für den Verlust naher Angehöriger: »Von seinem Verlust zur Rache angetrieben geht der Gekränkte aus und verbirgt sich im Gebüsch, bis ein Kind oder eine unbewaffnete Person vorbeigeht, wie ein Tiger fällt er dann über seinen Raub her, schleppt ihn ins Dickicht und führt ihn in der Nacht als Sklaven fort.«
Das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien, die keine gemeinsame Sprache hatten – noch heute kennt man in Afrika über 2.000 Sprachen –, wurde im vorkolonialen Afrika also vom Faustrecht geprägt. Es gab keine übergeordneten Instanzen, wo man seine Rechte hätte einklagen können. Die hier und da bezeugten Gerichtsversammlungen, die sich aus den Freien der Dorfgemeinschaft zusammensetzten, beschäftigten sich mit internen Rechtsstreitigkeiten. Schuldner und Betrüger konnten von diesem Gremium aus der Gemeinschaft der Freien ausgeschlossen und wie Kriegsgefangene versklavt und anschließend versilbert werden. Schutz vor bewaffneten Raubüberfällen boten allenfalls hohe Umfriedungen aus Lehm, die in vielen größeren Dörfern und städtischen Siedlungen anzutreffen waren. Ansonsten musste die Bevölkerung mit den ständig von außen drohenden Gefahren leben so gut es ging, und sie tat es, wie Park berichtet, auf bewundernswerte Weise und ohne in Traumata zu verfallen: »Wunderbar ist es, wie schnell eine afrikanische Stadt wieder aufgebaut und bevölkert wird. […] Ist das Land verwüstet und der Feind hat die zerstörten Städte und Dörfer verlassen, so kehren alle Einwohner nach und nach zurück, bauen eiligst die verfallenen Mauern wieder auf und freuen sich, den Rauch aus ihrer Heimat wieder aufsteigen zu sehen.« Park berichtet immer wieder von Volksfesten, wo bis zum Morgengrauen viel musiziert, ausgelassen getanzt und – wenigstens in nichtmoslemischen Gemeinden – dem Met ausgiebig zugesprochen wurde.
Nach der marxistischen Ideologie erfüllten die afrikanischen Klein- und Kleinststaaten bis zum Beginn der Kolonialzeit (1880/85) alle Kriterien von »Sklavenhaltergesellschaften«, wenngleich die marxistische Geschichtsschreibung über diesen Punkt geflissentlich hinweggegangen ist. Nach den übereinstimmenden Beobachtungen vieler Afrikareisenden bestand in vorkolonialer Zeit die Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung aus rechtlosen Sklaven. Mungo Park glaubte für Westafrika beobachtet zu haben, dass die Sklaven etwa drei Viertel der Bevölkerung ausmachten. Jeder freie Mann verfügte über Sklaven, je wohlhabender er war, desto mehr Sklaven konnte er sich leisten. Er konnte sie als hörige Arbeitskräfte in seinem Hause einsetzen, auf dem Feld oder auf der Weide: »Sie haben für ihre Dienste nichts zu fordern als Nahrung und Kleidung und können gütig oder hart behandelt werden, je nachdem ihr Herr gesinnt ist« [Park 1984: 201]. Innerhalb der Sklaven gab es, ähnlich wie im antiken Rom, bedeutungsvolle Abstufungen: Die Haussklaven, d.h. diejenigen, die im Haus des Besitzers geboren wurden, genossen in der Gemeinschaft ein gewisses Ansehen; sie konnten vom Besitzer nicht ohne weiteres verkauft werden, es sei denn, es waren ihnen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren (»Palaver«) Verfehlungen nachgewiesen worden. Bei entsprechenden Verdiensten konnten Haussklaven sogar freikommen. Dagegen waren diejenigen, die im Kriege gefangen oder auf dem Markt käuflich erworben worden waren, völlig rechtlos: »Diese unglückseligen Geschöpfe werden als Fremdlinge angesehen, die auf den Schutz der Gesetze keinen Anspruch haben, der Eigentümer kann sie ganz nach seinem Belieben mit der größten Härte behandeln und an einen Fremden verkaufen. Es gibt regelmäßige Märkte, wo diese Sklaven gekauft und verkauft werden.«
Für Park war der Krieg »die ergiebigste Quelle der Sklaverei«: »Wenn der schwächere Krieger unter dem aufgehobenen Speere seines Gegners um Gnade bittet, so gibt er zugleich alle Ansprüche auf Freiheit auf und erkauft so sein Leben« [Park 1984: 203]. Aber auch Hungersnot, Schulden und Verbrechen konnten einen freien Mann in die Sklaverei treiben. Hungersnöte entstanden oft nach einem verlorenen Krieg, wenn der Feind das Land verwüstet und die Viehherden geraubt hatte: »Es gibt sehr viele Beispiele, daß Leute freiwillig ihrer Freiheit entsagen, um ihr Leben zu retten.« Häufig trennten sich verarmte Familien in Hungerperioden auch von einem Teil ihrer Kinder, um auf diese Weise zu überleben: »Da die Eltern eine fast unumschränkte Gewalt über ihre Kinder haben, so geschieht es in allen Gegenden Afrikas häufig, daß einige davon verkauft werden, um der übrigen Familie dadurch Nahrungsmittel zu verschaffen.« Afrikanische Kaufleute, die das bei ihren Nachbarn geliehene Geld nicht zurückzahlen konnten, gerieten ebenfalls leicht in die Fänge der Sklaverei, da die Gläubiger nach tradiertem afrikanischem Recht nicht nur Zugriff auf den Besitz, sondern auch auf die Person des Schuldners hatten. Mord und Ehebruch wurden ähnlich gesühnt: »Ist ein Mord begangen, so hat es der nächste Verwandte des Getöteten in seiner Gewalt, den Mörder entweder mit eigener Hand zu töten oder in die Sklaverei zu verkaufen.« [Park 1984: 208]. Bei Ehebruch wurde es »dem beleidigten Teil freigestellt, den Schuldigen entweder zu verkaufen oder ein solches Lösegeld von ihm zu fordern, daß es für das erlittene Unrecht ein Ersatz zu sein scheint«. Park erfuhr im Laufe seiner mehr als zweijährigen Erkundungsreise von manchen Fällen, in denen der Sklavenbesitzer einen verdienstvollen Sklaven wieder auf freien Fuß setzte, so z.B. wenn dieser aus einem Gefecht zwei Sklaven als Lösegeld mitbrachte. Weitaus öfter erlangten Sklaven ihre Freiheit durch die Flucht, »denn wenn es sich ein Sklave in den Kopf setzt zu entlaufen, so gelingt es gewöhnlich«, wenn auch vielleicht erst nach einigen Jahren. Um die Fluchtgefahr zu vermindern, wurden Sklaven gerne aus weit entfernten Regionen gekauft. Die sicherste Art, aus Sklaven Geld zu machen, war der aus Sicht der indigenen Sklavenhändler äußerst profitable Verkauf an die europäischen Kaufinteressenten, die sie nach Nord- und Südamerika und in die Karibik transportierten. Zu der Zeit, als Park sich in Westafrika aufhielt, scheint der transozeanische Sklavenhandel allerdings nicht besonders intensiv gewesen zu sein. Oft habe zur Verzweiflung der schwarzen Sklavenhändler monatelang kein englisches oder amerikanisches Schiff an der westafrikanischen Küste angelegt, und die jährliche Ausfuhrmenge »beträgt jetzt [1799] kaum tausend« [Park 1984: 30].
Um das Entlaufen der Sklaven zu verhindern, legten die afrikanischen Händler (»Slatis«) ihre wertvollen Verkaufsobjekte stets in Eisenketten: »Man legt gewöhnlich das rechte Bein des einen und das linke des anderen in dasselbe Eisen. Sie können gehen, wenn sie ihre Fesseln mit einem Bande in die Höhe halten, aber es geht langsam. Ebenso werden immer vier und vier mit starken Stricken von gedrehten Riemen am Nacken aneinander befestigt. Des Nachts legt man ihnen noch ein Eisen an die Hände.« Zusätzlich wurden die zum Verkauf bestimmten Sklaven nachts noch von den Haussklaven des Eigentümers bewacht. Wie Park wiederholt beobachten konnte, ertrugen einige ihr Schicksal mit erstaunlichem Gleichmut, »der größere Teil aber war sehr niedergeschlagen und saß den ganzen Tag, die Augen zu Boden geheftet, in düsterer Schwermut.« Zur Abreise wurden ihnen die Eisenfesseln abgenommen, damit sie in der Karawane als Lastträger fungieren konnten. Freilich wurden sie sicherheitshalber in Vierergruppen mit einem Strick um den Nacken zusammengebunden, ständig bewacht von mindestens einem bewaffneten Krieger. Aufsässige Sklaven wurden ausgepeitscht, in einigen Fällen sogar getötet. Des Nachts wurden den Sklaven wieder die Eisenfesseln angelegt.
Mit der Abschaffung des transozeanischen Sklavenhandels in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann auch die afrikanische Bevölkerung wieder zu wachsen. In der Forschung besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die schwarzafrikanische Bevölkerung von 1800 bis 1880 um rund 20 Prozent zulegte [Speitkamp 2009: 148]. Indes sind die absoluten Zahlen Gegenstand heftiger Kontroversen. So schwanken etwa für das Jahr 1850 die Schätzungen der Gesamtbevölkerungszahl Afrikas zwischen 100 und 190 Millionen (bei einer Weltbevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen), für das subsaharische Afrika werden sie zum Teil aber auch mit nur 50 Millionen angegeben. Die Bevölkerungszunahme erklärt sich einerseits aus dem Nachlassen von Epidemien und Pandemien südlich der Sahara, andererseits durch die strukturellen Veränderungen auf dem Sklavenmarkt. Infolge der Ächtung des Sklavenhandels durch die Europäer wurde zwar der Abfluss der Bevölkerung aus dem Kontinent entscheidend reduziert, innerhalb Afrikas nahm der Sklavenhandel aber zunächst deutlich zu, zumal bei den permanenten Kriegen immer neue Gefangene gemacht und versklavt wurden, die nun nicht mehr exportiert werden konnten. Wie schon in den Jahrhunderten zuvor, wurden auch Frauen versklavt und in die Sklavenfänger-Gesellschaften integriert, in den polygamen Staaten nicht selten als Ehefrauen. Dies führte wiederum zu einer Erhöhung der Geburtenrate, so dass in den betroffenen Regionen Schwarzafrikas die Bevölkerung zumindest vorübergehend wuchs.
Das Sklavenhandelsverbot der Europäer hatte für den Kontinent einschneidende politische und wirtschaftliche Folgen, ja es bahnte langfristig den Weg zum Kolonialismus. Die Durchsetzung der Menschenrechte führte zwangsläufig zu einer stärkeren Präsenz der Europäer an den Küsten und zu einer wachsenden direkten Einmischung in die innerafrikanischen Verhältnisse. Wie wir heute wissen, ist von den Briten zunächst der Versuch unternommen worden, einheimische Herrscher durch Verträge zum Verzicht auf den Export von Sklaven zu bewegen. Als diese wenig nützten, schritt man zur Anwendung von Gewalt. So wurde der kleine Ort Lagos, heute Millionenstadt in Nigeria, von den Engländern 1851 bombardiert, um die dortigen Herrscher, die am Sklavenhandel festhielten, aus ihren Ämtern zu jagen. Bereits 1849 hatten die Briten einen Konsul für die Bucht von Biafra eingesetzt, der, unterstützt von der Royal Navy, das Sklavenhandelsverbot überwachen sollte. Verhandlungen mit König Ghezo zur Beendigung des Menschenhandels führten zu keinem Ergebnis, wohl aber konnte der Kommandant der Royal Navy im Februar 1852 einen entsprechenden Vertrag mit kleineren Nachbarpotentaten schließen: Darin wurde die Ausfuhr von Sklaven generell verboten, und die britische Regierung behielt sich ausdrücklich das Recht vor, das Verbot mit Waffengewalt durchzusetzen. Zu diesem Zweck patrouillierten bis 1869 britische Kanonenboote vor den Küsten Westafrikas, brachten Sklavenschiffe auf und standen als wirksames militärisches Drohpotential stets zur Verfügung: »So führte die globale Abschaffung des Sklavenhandels zur faktischen Übernahme einer politischen Kontrollfunktion durch die Europäer« [Harding 1999: 17]. In Ostafrika florierte der Sklavenhandel freilich noch weit bis in das 20. Jahrhundert hinein, zumal die in den 1850er Jahren erlassenen Verbote des Sklavenhandels durch den osmanischen Sultan und den äthiopischen Kaiser wenig genützt hatten. Erst die europäische Präsenz in Ostafrika beendete dort allmählich den gewinnträchtigen Menschenhandel, wobei die Europäer anfangs noch oft genug wegschauten, wenn das Sklavereisystem sich als ökonomisch notwendig erwies. In den deutschen Kolonien scheint es nach den Untersuchungen von Horst Gründer auf den privaten Plantagen keine Sklavenarbeit mehr gegeben zu haben, wenn auch bei der Rekrutierung der dringend benötigten einheimischen Lohnarbeiter die sogenannten »Arbeiteranwerber geradezu offen Menschenraub betrieben und ihre ›Ware‹ gegen ein vorher festgelegtes Kopfgeld an der Küste ablieferten« [Gründer 1995: 167].
Die Hauptprofiteure des transatlantischen Sklavenhandels waren die afrikanischen Herrscher, die ausreichend über die notwendigen bewaffneten Einheiten verfügten, um Sklavenfang und Sklaventransport abzusichern. Die Sklaven wurden größtenteils gegen moderne Waffen getauscht, mit deren Hilfe man wiederum das Herrschaftsgebiet, über das man verfügte, durch Unterwerfung der Nachbarvölker ausbauen konnte. So stand und fiel das westafrikanische Ashanti-Reich mit dem Sklavenhandel. Sein Monarch, der Asantehene, soll zum Zeitpunkt des Verbots des Sklavenhandels 20.000 Gefangene in seiner Gewalt gehabt haben, die er nun nicht mehr verkaufen und allenfalls als Militärsklaven verwenden konnte. Andere Handelsstrukturen waren nun gefragt. Statt nach Menschen stieg nun die Nachfrage nach Palmprodukten, Palmöl und Palmenkernen, die als Grundstoffe für Seifen und Schmiermittel benötigt wurden, ferner nach Erdnüssen und schließlich nach Baumwolle sowie Kautschuk. Das bislang von den afrikanischen Herrschern beanspruchte und durchgesetzte Monopol auf den Handel ließ sich bei der veränderten Handelssituation aber nicht mehr aufrechterhalten, da jene Produkte auch von kleinen Produzenten veräußert wurden und zahlreiche neue Kleinhändler in das Vermittlergeschäft zwischen Binnenland und Küste einsteigen konnten und zu Wohlstand kamen. Den Fürsten brachen nun die Haupteinnahmequellen weg, was zu einer Erschütterung ihrer Autorität führte. Große Königtümer, wie das Ashanti-Reich, brachen zusammen, weil sie sich nicht rechtzeitig auf die neuen Erfordernisse einstellen konnten. Da der Asantehene seine Oberhoheit über die kleinen, meist tributpflichtigen Küstenstaaten nicht aufgeben wollte, die Briten aber auf den freien Handel bestanden, kam es zu einer Reihe von Konflikten und gewaltsamen Auseinandersetzungen. 1874 griffen die Briten schließlich die Ashanti-Residenz Kumasi an, besiegten den Asantehene und sicherten sich im Friedensvertrag von Formena den privilegierten Zugang zum Küstenhandel [Speitkamp 2009: 151]. In der Folgezeit wurde die Goldküste britische Kolonie.
In Nordafrika geriet Ägypten wegen seiner günstigen geographischen Lage zunehmend in den Fokus europäischer Interessen. Der Bau des Suezkanals (1859-1869), der den Seeweg nach Indien entscheidend verkürzte, stürzte das Land in eine schwere Finanzkrise, die sich vor allem in der Verschuldung gegenüber den französischen Gläubigern auswirkte. 1878 konnte die ägyptische Regierung die Zinsleistungen nicht mehr aufbringen, sodass eine internationale Kontrollbehörde die Überprüfung der ägyptischen Staatsfinanzen übernahm. Um die Indienroute zu sichern, schaltete sich England 1882 politisch-militärisch ein, indem es die Kanalzone besetzte und eine völkerrechtliche Regelung der Kanaldurchfahrt erzwang. Die von neun Staaten unterzeichnete Konvention von Konstantinopel (29.10.1888) garantierte die freie Durchfahrt durch den Suez für Handels- und Kriegsschiffe aller Flaggen in Kriegs- und Friedenszeiten. Die britische Dominanz in der Kanalregion führte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges schrittweise zum Protektorat über das um den Sudan erweiterte Ägypten. Die politischen Veränderungen in Nord- und Westafrika mündeten schließlich in die Aufteilung des afrikanischen Kontinents in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts, indem dort fast alle süd- und westeuropäischen Staaten ihren immer stärker ausgeprägten Kolonialhunger (»scramble for Africa«) befriedigten. In Angola und Mosambik war Portugal als alte Kolonialmacht fest etabliert, und in Südafrika konnte England seine 1806 gegründete Kapkolonie in der Auseinandersetzung mit den Buren wesentlich erweitern. Zwischen 1880 und 1900 wurde dann der Rest des Kontinents nach den auf der Berliner Kongokonferenz (1884/85) aufgestellten Spielregeln aufgeteilt. Neben den Engländern, Portugiesen und Franzosen waren nun die Belgier, Spanier, Italiener und Deutschen die neuen Herren des Schwarzen Kontinents. Lediglich Äthiopien und Liberia, 1847 als unabhängige Republik gegründet, behielten ihre völkerrechtliche Unabhängigkeit.
Etwa 70 Jahre nach Mungo Park, der auf seiner zweiten Expedition 1806 bei Bussa in den Stromschnellen des Niger ertrank, wagte sich der deutsche Forschungsreisende und Botaniker Georg Schweinfurth (1836-1925) von Karthum aus in die damals noch völlig unerforschte Gegend des heutigen Südsudan (1868-1871). Er tat es als Schutzbefohlener eines reichen moslemischen Kaufmanns aus Karthum, dessen Elfenbein-Karawanen am unteren Lauf des Weißen Nils er sich zeitweilig anschloss und in dessen befestigten Handelsniederlassungen (»Seribas«) er immer wieder Schutz fand. Wie Park sah sich auch Schweinfurth ständig mit dem Phänomen der Binnensklaverei konfrontiert. Während die freiheitsliebenden und kriegerischen Dinka, die von ihren riesigen Viehherden lebten, von der Sklaverei völlig verschont blieben, war das friedfertige Volk der