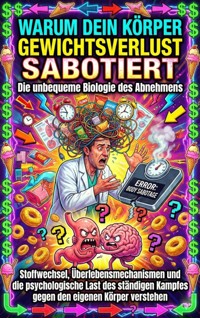19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kehrt die Geschichte zurück? Die Geschichte des rechten Terrors in Deutschland begann nicht mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten, sondern mit einer Verschwörung gegen die deutsche Demokratie und einer blutigen Mordserie vor genau 100 Jahren. Die Täter in der frühen Weimarer Republik hatten schon die gleichen Motive, Ressentiments und Ziele wie die Rechtsterroristen von heute. Ihre tödliche Entschlossenheit beruhte auf Milieus und Gefühlswelten, auf Strukturen und Netzwerken, die überall wieder möglich und nie ganz verschwunden sind. Florian Huber spürt diesen Parallelen in einer spannenden Erzählung nach, die in der spektakulären Ermordung des deutschen Außenministers Walther Rathenau gipfelt. Er zeigt, wo sich Geschichte wiederholt - oder genauso weitergeht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Von Florian Huber sind im Berlin Verlag erschienen:
Kind, versprich mir, dass du dich erschießt. Der Untergang der kleinen Leute (2015) und Hinter den Türen warten die Gespenster. Das Familiendrama der Nachkriegszeit (2017).
© Florian Huber/Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2020
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Landesarchiv Baden-Wuerttemberg Staatsarchiv Freiburg F179-4 Nr.20 Bild 9 bis 12, 14 und 16 bis 18 (5-68430-9)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Wie die Geschichte wiederkehrt
Verlierer
Unruhe in der Villa Rathenau
Heimat
Der Minister der vielen Gesichter
Verräter
Durch Berlin im offenen Auto
System
Der Reichstag: ein Leichenwagen erster Klasse
Untergrund
Scherbengericht im Plenarsaal
Taten
Der Auftritt des Assyrers
Umsturz
Die S-Kurve in der Koenigsalle
Schock
Ein Sarkophag für den Minister
Justiz
Die Geister der Villa Rathenau
Die Wiederkehr in Bildern
Zitatnachweise
Quellen und Literatur
Bildnachweise
Wie die Geschichte wiederkehrt
Vor hundert Jahren brachte eine schier endlose Mordserie die erste deutsche Demokratie an den Rand des Untergangs. Wo es bis dahin kaum politische Verbrechen gegeben hatte, geschahen sie auf einmal an jedem dritten oder vierten Tag. Im Haus, auf der Straße, im Wald oder im fahrenden Auto. Knapp vierhundert Menschen starben in nur vier Jahren, darunter waren Politiker, Arbeiter, Frauen und Kinder, eine Freiheitsikone, ein Finanzminister und ein Außenminister. Fast immer wollten die Täter ihre Heimat rächen, reinigen oder retten. »Deutschland« war ihr Motiv. Ein Jahrhundert später leben wir noch immer im Zeitalter des Rechtsterrors, aber kaum einer weiß mehr, wie es angefangen hat – und warum.
Bei dem Begriff »Rechtsterror« denkt heute kaum jemand an die Jahre vor dem Nationalsozialismus. Die ersten rechten Attentäter sind nahezu vergessen, weil der Schatten Adolf Hitlers, der den Rechtsterrorismus zur Staatsräson erhob, sie im kollektiven Gedächtnis überdeckt. Außerhalb von Fachkreisen spielen Freikorps, die »Brigade Ehrhardt« oder die geheime »Organisation Consul« keine Rolle. Niemand verbindet noch etwas mit den Namen Hermann Ehrhardt, Manfred von Killinger, Friedrich Wilhelm Heinz oder Erwin Kern. Die verblassende Geltung eines Ernst von Salomon rührt nicht von seiner Komplizenschaft beim spektakulärsten Terroranschlag der 1920er-Jahre her, sondern von seinem aufsässigen Buch über die Entnazifizierung nach 1945.
Dabei ist mit diesen Figuren ein Phänomen über Deutschland gekommen, das uns nicht wieder verlassen hat und mit dem jede Generation aufs Neue Bekanntschaft schließen muss. War es in den 1970er-Jahren der Linksterrorismus, so verbreitet seit den Achtzigern vor allem der Terror der Rechten in auf- und ablaufenden Wellen seinen Schrecken. Seit Jahrzehnten leben wir mit Anschlägen auf Ausländer und Einwanderer, Juden und Muslime, Polizisten, Politiker und Zufallsopfer. Manche dieser Ereignisse beschäftigen die Behörden und die Gesellschaft auf Jahre hinaus. Wir haben lernen müssen, dass es jederzeit und überall passieren kann und wohl niemals zu Ende geht. Darüber haben wir vergessen, wie es begann und was uns das heute zu sagen hat.
Wie rasch der Blick auf diese Anfänge in unsere Gegenwart führt, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, als ich ein altes Foto betrachtete, auf dem Motiv und Hintergrund nicht recht zusammenzupassen scheinen: zwei junge Männer, die in einem altertümlichen Himmelbett nebeneinanderliegen, hingelagert zwischen Kissen und Bettzeug, am helllichten Tag in scheinbar friedlichem Schlummer. In Wahrheit zeigt dieses Polizeifoto aus dem Juli 1922 den Schlusspunkt eines landesweit verfolgten Dramas.
Hier liegen zwei Tote nebeneinander, in einem Turmzimmer der Burg Saaleck, fünfzig Kilometer nordöstlich von Erfurt. Es sind zwei Terroristen aus dem nationalistischen Untergrund, deren Verfolgung die Bevölkerung aufgewühlt hat. Den einen hat die Polizei erschossen, der andere sich selbst. Vier Wochen zuvor hatten sie den bekanntesten Politiker des Reiches ermordet aus Überliebe zu Deutschland und aus Hass auf die angeblichen Verräter ihres Volkes. Ihre Tat sollte eine Botschaft sein, ein Fanal zum Angriff auf die Demokratie, um das Traumbild einer verlorenen Heimat in Erfüllung gehen zu lassen, autoritär, männlich und rassenrein. Die beiden wurden von einem Netzwerk aus Helfern und Gesinnungsfreunden getragen, das die Sicherheitsbehörden niemals durchdrungen haben.
Daneben schiebt sich ein zweites Bild, aufgenommen ein Jahrhundert später in Eisenach, fünfzig Kilometer westlich von Erfurt. Wieder klaffen äußerlicher Rahmen und Geschehen auseinander. In einem Wohnmobil, Symbol von behaglichem Wohlstand, liegen die Körper zweier Männer. Wieder zeigt die Polizeiaufnahme zwei junge Täter einer Terrorzelle am Ende ihres Kamikaze-Trips, der sie kreuz und quer durch Deutschland geführt hat. Der eine hat den anderen erschossen und Minuten später sich selbst. Zehn Morde haben sie verübt, weil sie ein anderes Deutschland wollten, das sein sollte wie früher: mit deutschen Werten, deutscher Sprache und deutschen Gesichtern. Ihre Botschaft ist die Tat und ihr Mittel der Mord. Hinter ihnen steht ein verzweigtes Netzwerk von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Gleichgesinnter und Unterstützer, das bis zum heutigen Tag Fragen aufwirft. Hundert Jahre, zwei Geschichten, und doch eine Erzählung vom Gestern im Heute: die Erzählung der Rache der Verlierer.
Im Lauf dieser hundert Jahre, die zwischen den Tätern der »Organisation Consul« und denen des »Nationalsozialistischen Untergrunds« liegen, haben sich die politischen Landkarten und gesellschaftlichen Wirklichkeiten grundlegend verändert. Die bundesdeutsche Gegenwart ist mit den Zuständen von Weimar nicht gleichzusetzen. Aber selbst wenn die Analogien dieses Schicksalspaars in mancher Hinsicht zufällig sein mögen, widerlegt das nicht die Erkenntnis, dass sich Phänomene der Geschichte wiederholen oder fortsetzen, über Zeiten und Räume hinweg. Weniger im historischen Detail, sondern vor allem in der Wiederkehr von Denkweisen und Sprachfiguren, von Feindbildern und Atmosphären, und in der Gewöhnung an das Skandalöse erkennen wir die Züge unserer eigenen Zeit. Wenn sich Geschichte wiederholt, dann in den Strukturen, Milieus und Mentalitäten, die in den letzten hundert Jahren nie mehr verschwunden und jederzeit möglich sind.
Die Verschwörer gegen die Republik von Weimar hatten die gleichen Ressentiments, Motive und Ziele wie die Rechtsterroristen unserer Tage. Sie waren Menschen, die ihre Heimat verloren glaubten und in ihrer Zeit kein Lebensziel fanden, die sich überflüssig fühlten und aus ihrer inneren Leere heraus dem »System« den Krieg erklärten. Viele Züge der ersten deutschen Terrorbewegung finden wir in der jüngeren Geschichte bis zur globalen Gegenwart wieder. Ihr besessener Männlichkeitskult begegnet uns in der »Wehrsportgruppe Hoffmann« und ähnlichen Kampforganisationen. Von ihrem Ziel, die Republik zu stürzen und die Demokratie abzuschaffen, träumten auch die Mitglieder der »Revolution Chemnitz« und der »Gruppe S.«. Der kalte Professionalismus der Hauptfiguren verweist auf Extremtäter wie den norwegischen Massenmörder Anders Breivik, den Christchurch-Attentäter Brenton Tarrant oder den Mörder von Hanau Tobias Rathjen, ihre Taten auf die Anatomie von politischen Mordanschlägen wie den auf Walter Lübcke. Die Rolle rechtsextremer Parteien im damaligen Reichstag erinnert an die Haltung gegenwärtiger Rechtsparteien wie der AfD.
Dieses Buch erzählt eine Geschichte von politischen Träumen und Albträumen, die sich über eine Zeitspanne von vier Jahren aufgebaut und entladen haben. Die Perspektive konzentriert sich auf eine Handvoll Männer, die in der Bewegung eine entscheidende Rolle spielten und sich später in Rechtfertigungsschriften oder anderen Selbstzeugnissen dazu erklärt haben. Zwar sind diese Erinnerungen von stark gefärbter Wahrnehmung der Ereignisse, Personen und Fakten, doch geben sie Aufschluss über die Gedankenwelt ihrer Verfasser. Ihnen gegenüber stehen die Opfer aus den Reihen ihrer Gegner, Republikaner und Demokraten, die sich jederzeit bewusst waren, was sie riskierten. An jedes Kapitel schließt sich eine Darstellung der Welt von Außenminister Walther Rathenau an, geschrieben entlang des Verlaufs seines letzten Lebenstags.
Vier Jahre und 24 Stunden – bis beide Linien aufeinandertreffen, auf einer Deutschlandreise jenseits bekannter Schauplätze. Sie beginnt an den herbstkalten Kaimauern der Marinestadt Wilhelmshaven, verläuft über revolutionsfiebrige Straßen in Frankfurt am Main bis ins Herz einer tiefschwarzen Bohème in München-Schwabing. Sie führt in Berliner Amtsstuben und hinter Villenfassaden in Grunewald. Banale Orte erlangen plötzlich Bedeutung: eine einsame Spitzkehre mitten im Schwarzwald, eine unübersichtliche S-Kurve im Großstadtverkehr, die Gemächer einer Burg über dem Saalefluss. Zur großen Bühne wird der Deutsche Reichstag. Auf seinen Fluren, in seinen Hallen und Sitzungssälen treffen jene politischen Leidenschaften und Illusionen direkt aufeinander, die aus dem politischen Drama eine Tragödie machten.
»Wir sind die letzten Deutschen«, so beschrieb einer der ersten Männer, die gegen die demokratische Republik in den Krieg zogen, ihr Lebensgefühl. Das hat sich als Irrtum erwiesen. Diese letzten Deutschen sterben nicht aus.
Verlierer
»Wir werden als Beute Stufe für Stufe die Treppe hinabgeschleift. Während unser Kopf auf jede Stufe knallt, gehen uns drei Dinge nicht aus dem Sinn: Erstens sind wir noch längst nicht ganz unten, zweitens müssen wir, sollten wir uns berappeln, Stufe für Stufe wieder hinaufsteigen, und drittens: eigentlich sind wir viel zu groß für diese Katze, die uns da hinter sich herzerrt.«
Götz Kubitschek, Verleger und Publizist der Neuen Rechten, 10. April 2017
Hermann Ehrhardt war ein Verlierer. Zum Verlierer geboren war er jedoch nicht. Als er in jungen Jahren am Anfang seines Weges stand, begriff er, was von einem Mann wie ihm gefordert wurde, um in der Gesellschaft geachtet und erfolgreich zu sein. Innerhalb ihrer Grenzen und Möglichkeiten traf er eine Wahl, die gut zu ihm passte. Er spielte nach ihren Regeln und kam weit damit. Hermann Ehrhardt, Kind seiner Zeit, wollte nichts anderes sein als das, was er war. Er konnte nicht voraussehen, dass er seine Laufbahn einer Ordnung verschrieben hatte, die sich im Herbst 1918 innerhalb weniger Wochen in Nichts auflöste.
Als damit auch die Regeln verschwanden, an denen er sich ausgerichtet, und die Privilegien, die er sich auf diese Weise verdient hatte, brach für ihn alles auseinander. In dem Modell, das danach kam, fand er sich nicht wieder. Auch wenn er selbst es nicht so gesehen hätte, weil es nicht zu seinem Bild von einem deutschen Mann passte, weil er alle Kämpfe gewonnen zu haben glaubte und zudem eine verschworene Gefolgschaft hinter sich wusste, so gehörte Ehrhardt im neuen Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zu den Verlierern. Da er aber nicht bereit war, sich mit diesem Los wie ein Versager abzufinden, beschloss er, um seine Welt zu kämpfen mit Mitteln, wie er sie gelernt hatte. Das Schicksal des Verlierers und seine Weigerung, dieses anzunehmen, sollten sein weiteres Leben bestimmen, und nicht nur das seine. Dieser Weg führte ihn und viele andere aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand und darüber hinaus.
Seine Jugend hatte Hermann Ehrhardt in einem evangelischen Pfarrhaus am Rand des Südschwarzwalds verbracht. Wie Vater und Großvater sollte er Pastor werden, doch das vertrug sich schlecht mit seinem Temperament, in dem sich Stolz und Verletzbarkeit die Waage hielten. Im großen Zeitalter des Ehrgefühls im wilhelminischen Deutschland lernten schon die Kinder, um ihrer Ehre willen in den Ring zu steigen. Als er das Gymnasium besuchte, genügte dem Schüler Hermann dafür eine herablassende Bemerkung seines Schulmeisters. »Dieser Mensch höhnte mich noch, und die Klasse hinter mir grinste!« Der Schüler ohrfeigte seinen Lehrer und flog dafür von der Schule.
Drei Jahrzehnte später ließ Ehrhardt den Münchner Schriftsteller Friedrich Freksa einen biografischen Roman über sein Leben verfassen. Der Autor lässt den Erzähler in der ersten Person von sich sprechen, als führte Ehrhardt selbst die Feder. In der Episode um seinen Rauswurf aus dem Gymnasium deutet sich an, was diesen Mann später einmal zum Machtfaktor im Spiel um Deutschlands Zukunft werden ließ. Er zeigt sich hier als jemand, der einer Demütigung seinen Trotz entgegenstellt, der auf Rache sinnt, der in der Gewalt sein Mittel sieht und Konflikte aus dem Impuls heraus löst. Rücksichtnahme auf andere und Sorge um die eigene Sicherheit spielen eine untergeordnete Rolle. Damit wurde Hermann Ehrhardt zu einem Repräsentanten seiner Generation der Übergangszeit.
Weil ihm der Schwarzwald zu eng geworden war, entschied sich Ehrhardt für die kaiserliche Marine. Ende des 19. Jahrhunderts rückte diese ins Zentrum der deutschen Außenpolitik, in der sich die Überzeugung durchgesetzt hatte, der Kampf um Weltgeltung werde auf See entschieden. Die Deutschen mit Kaiser Wilhelm II. an der Spitze, die weder eine Hochseeflotte noch ein Kolonialimperium von Rang besaßen, wollten nicht weiter abseitsstehen. Das Flottengesetz von 1898 brachte ein Schiffsbauprogramm auf den Weg, das die kaiserliche Marine der ersten Seemacht Großbritannien ebenbürtig machen sollte. Dieser Traum von Größe bot für eine kämpferisch eingestellte Jugend die Aussicht auf Bedeutung und Glanz, und Hermann Ehrhardt wollte teilhaben an diesem Aufbruch. »Der Kaiser brauchte Seekadetten. In allen Zeitungen standen Aufforderungen zur Meldung. Drei oder vier Tage waren noch Frist bis zur Aufnahme für die Marineschule. Kurz entschlossen fuhr ich nach Kiel und bestand unter Aufbietung all meines Trotzes die Prüfung glücklich. Meine gute Mutter aber weinte sehr und sagte: ›Jetzt habe ich meinen Sohn verloren.‹«
Deutschlands Zukunft, hatte der Kaiser gesagt, liegt auf dem Meer. 1899 schlug Ehrhardt seine Laufbahn als Marineoffizier ein, die ihn mit den preußischen Werten imprägnierte: Wille zur Selbstbehauptung, Bewusstsein der Stärke, Verachtung des Todes und Verleugnung der eigenen Bedürfnisse. Sein erster Krieg, der Vernichtungsfeldzug gegen die aufständischen Herero in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika 1904, infizierte ihn mit dem Virus der Gewalt »wie ein elektrischer Schlag«. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, war Ehrhardt aufgestiegen zum Kapitänleutnant, umgeben von Gleichgesinnten, mit einem gepflegten Privatleben in einem Villenviertel bei Wilhelmshaven. Der Schulversager hatte seine Heimat in der Marine gefunden, und diese konnte sich keinen besseren Gefolgsmann wünschen. Der Vater seiner Frau, die aus Hamburg stammte, war vermögend genug, dem jungen Paar in einem Villenvorort der Marinestadt Wilhelmshaven ein Häuschen zu bauen. Später zogen sie mit ihren Kindern weiter nach Kiel, wo es der Familie besser gefiel als im diesigen Wilhelmshaven. Ehrhardt war in der besten seiner Welten angekommen, und der Kaiser war ihm ein wunderbarer Herrscher.
Hermann Ehrhardt, um 1916
Männer wie er sahen im Krieg keine Bedrohung, sondern die Chance, sich auszuzeichnen und mit Deutschland zur Weltmacht aufzurücken. Ehrhardts Biograf schildert, wie er sich aus langweiligen Schreibtischpflichten heraus direkt auf ein Torpedoboot trickste. In der Seeschlacht am Skagerrak zwischen der britischen und der deutschen Flotte stieg er von seinem sinkenden Schiff auf ein anderes um und führte von dort umstandslos das Kommando weiter. Seinen eigenen Schilderungen zufolge ging Ehrhardt aus allen Gefechten als Sieger hervor. Ehrhardt der Entschlossene, der Eisenharte. Sein Ruf verbreitete sich über den Kreis seiner Männer hinaus, unter denen er höchsten Respekt genoss.
Auf einer zeitgenössischen Porträtaufnahme sieht man den zum Korvettenkapitän beförderten Ehrhardt im dramatischen Helldunkel, das an schmauchenden Pulverdampf denken lässt. Kerzengerade steht er da, die Uniform mit Ornat und drei goldenen Ärmeltressen, die Mütze mit Kokarde, Eichenlaub und Kaiserkrone wie aufs Haupt geschraubt. Senkrecht, fingerbreit der Kinnbart, ein waagerechter Strich der Schnurrbart, den Blick fest in die Linse. Für Kapitän Ehrhardt verlief alles nach Plan. Mit einer Niederlage rechnete er nicht. Verlierer sein, diese Möglichkeit hatte in seinen Vorstellungen keinen Platz.
Die meisten Deutschen hatten seit dem Sommer 1918, gebannt von den Schlagzeilen über eine Großoffensive, den Sieg vor Augen geglaubt, als die Nachrichten der ersten Novembertage sie aus ihren Illusionen rissen. Alles ging sehr schnell. In Kiel meuterten Matrosen, in München siegte die Revolution, in Berlin wurde gleich zweimal die Republik ausgerufen. In einem Wald in Nordfrankreich diktierten die Feinde den deutschen Unterhändlern den Waffenstillstand, während Kaiser Wilhelm II. in einem Sonderzug ins niederländische Exil davonrollte. Mit dem Monarchen verschwand ein System von Hierarchien aus Deutschland, das alle verinnerlicht hatten, vom Adligen und Offizier bis zum Angestellten, Arbeiter und Dienstboten. Millionen hatten sich für diese Ordnung in den Schützengräben und der Heimat aufgeopfert, um sie nun in ein paar novemberklammen Tagen zergehen zu sehen.
Das hatte etwas Unwirkliches, Unannehmbares an sich. Viele wähnten sich in einem nicht endenden Albtraum und, hinter dem Schleier der November-Ereignisse, einer Verschwörung finsterer Kräfte. Der Sohn eines kaiserlichen Beamten aus dem Berliner Villenvorort Zehlendorf schildert diese Stimmung: »Wir waren besiegt; aber das in seiner Existenz bedrohte Bürgertum und erst recht die in ihrer soldatischen Ehre gekränkten Offiziere sowie die ihrer Privilegien beraubte Aristokratie, sie alle weigerten sich, die Niederlage zu akzeptieren. Man fand sich mit der Tatsache, besiegt zu sein, nicht ab: Es grassierte die betrügerische Parole: ›Im Felde unbesiegt …‹ Man wähnte sich, durch die Machenschaften von Sozialisten und Juden, um den Endsieg betrogen. Man richtete sich in der Lebenslüge ein.«
Tief saß der Schock bei der kaiserlichen Marine. Das strategische Patt der Seemächte Deutschland und Großbritannien hatte sie im Krieg zu einer Nebenrolle degradiert. Während in den Feldern die Materialschlachten hin und her wogten, dümpelten ihre Großkampfschiffe die meiste Zeit vor Anker. Tatenlos zusehen zu müssen, wie die anderen ihren Krieg führten, hatte am Stolz der Offiziere genagt. Als wären sie damit nicht geschlagen genug, erhoben sich aus ihrer Mitte die Aufrührer, die die herrschende Klasse vom Sockel stürzten.
Mehr als tausend Matrosen der Hochseeflotte sahen allen Grund zu meutern. Obwohl der Waffenstillstand abzusehen war, hatte sich die deutsche Seekriegsleitung Ende Oktober 1918 zu einem Showdown gegen die britischen Verbände entschlossen, ein letztes Gefecht um der gekränkten Ehre willen, wodurch die Marine den Makel der Untätigkeit abstreifen konnte. Eine sinnlose Todesfahrt im Namen einer verlorenen Sache, so sahen es die Matrosen und verweigerten den Befehl. Zuerst in Wilhelmshaven und kurz darauf in Kiel, den wichtigsten Marinehäfen, erhoben sich Tausende gegen ihre Führung, was im preußisch gedrillten Militär ein Vorgang ohne Beispiel war. Bald griffen die Unruhen auf andere Städte über und führten zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten. Die Revolution war ausgebrochen in Deutschland, und die Marine war ihr Ausgangspunkt.
Hermann Ehrhardt erlebte in wenigen Tagen den Untergang seines Weltbilds. Er konnte nicht verhindern, dass bei seiner eigenen Flottillenbesatzung in Wilhelmshaven die Disziplin über Bord ging. Manche ergriffen Partei für die Meuterer, viele ergaben sich ins Nichtstun. Schlendrian, Suff, Widerworte – für den kaiserlichen Korvettenkapitän verrieten diese Männer alles, was ihm zur Natur geworden war. Ein letztes Gefecht um der Ehre willen, wie es die Admiralität wollte? Er, Korvettenkapitän Ehrhardt, wäre im knatternden Schwarz-Weiß-Rot der Kriegsflagge mit voller Maschinenkraft hineingedampft. »Aber der Verwesungsprozeß in der Flotte schritt so rasch vorwärts, daß, wer am Montag noch von einer letzten Schlacht träumte, am Dienstag sich beim Anblick der widerlich besoffenen roten Horden sagen mußte: Die Wirklichkeit ist anders als der Traum.«
Verlierer sein wird zum Schicksal, wenn es seine Macht über die Niederlage hinaus entfaltet. Die Gesellschaft fordert von Verlierern, ihre Niederlage einzugestehen, aber dann will sie keiner mehr dabeihaben. Woran sie geglaubt, was sie geliebt und wofür sie gekämpft haben, dient nur noch als Negativfolie für das Neue, das sich durchgesetzt hat. Die Geschichte, so heißt es dann, sei über sie hinweggegangen. So schreibt sich die Version der Sieger, während die der Verlierer niemand hören will. Ihnen bleibt nur, sich vom Platz zu schleichen. Man hält ihre Rolle für ausgespielt und sie selber für Gespenster von gestern.
Das ist ein Irrtum, denn der Erdboden hat sie nicht etwa verschlungen. Sie sind noch da, und mit ihnen ihr Schmerz, der nicht vergeht. Sie leben weiter Tür an Tür mit den anderen, missverstanden und abgesondert von der Gesellschaft, während kaum ein Tag vergeht, da sie dieser Schmerz nicht zwingt zu fragen, wie dieses Schicksal über sie kommen konnte: warum sie zu Verlierern wurden; wer die Schuld daran trägt; und ob dies das letzte Wort gewesen sein soll. In diesen Fragen staut sich eine zerstörerische Energie, die darauf wartet, freigesetzt zu werden.
Ehrhardts Traum vom Leben zerrann im Novemberregen an den Wilhelmshavener Kaimauern. Gemäß den Bedingungen des Waffenstillstands bekam er Weisung, seine Flottillenboote den Briten am Stützpunkt Scapa Flow vor Schottland auszuliefern. Eine kampflose Preisgabe an den Feind, nachdem er in der Schlacht nie besiegt worden war – irgendwie gelang es dem Korvettenkapitän, den Militärgouverneur ans Telefon zu kriegen, um sich mit seinem Offiziersstolz gegen diese Erniedrigung aufzulehnen. Aber Befehl war Befehl und der neue Kurs wichtiger als seine persönliche Ehre oder die der Flotte. Seinen Wurzeln entrissen und ohne Orientierung, so beschrieb Ehrhardt es später, beugte er sich dem Reflex preußischen Gehorsams und steuerte seine Flottille über die Nordsee in die Bucht von Scapa Flow.
Dort musste er auf Befehl der Engländer von Bord gehen und, Gipfel der Erniedrigung, mit dem Gepäck auf dem Rücken die Strickleiter des abgetakelten Transportdampfers emporklettern, der sie zurück in die Heimat brachte. Während der Rückkehr riss er gegen die meuternde Besatzung das Kommando an sich und steuerte das Schiff durch den Minensperrgürtel nach Wilhelmshaven. Dort fand er alles in Auflösung. Kurz entschlossen stellte er einen Stoßtrupp von Offizieren zusammen, mit denen er eine von kommunistischen Revolutionären besetzte Kaserne zurückeroberte. Der Krieg war vorbei, doch Hermann Ehrhardt hatte sein neues Feindbild: Meuterer und Revolutionäre – die Verräter des Vaterlands.
Im Januar 1919 war Ehrhardt 37 Jahre alt. Den Kaiser gab es nicht mehr und damit auch nicht jenen kaiserlichen Marineoffizier, der als Junge aus dem Südschwarzwald aufgebrochen war, um seinem Reich zu dienen. Der stand nun an der Schwelle zu einem zweiten Leben aus eigener Ermächtigung. Von nun an würde er die Dinge selbst in die Hand nehmen, ohne Kompromiss. Er würde seinen eigenen Kampf führen gegen jene, die ihm die Welt aus den Angeln gerissen hatten. Er wusste, dass es viele gab wie ihn, die auf nichts anderes brannten.
Einer von ihnen, ebenfalls Offizier, machte zur gleichen Zeit in der Marinegarnison Wilhelmshaven eines kalten Morgens eine Beobachtung, die ihm von großer Symbolik erschien. Er hielt sie in seinem Erlebnisbericht über seine Zeit mit Hermann Ehrhardt fest. Er sah, wie sich ein Revolutionssoldat auf seinem Wachtposten ganz allein im Exerzieren übte, streng nach dem preußischen Reglement. Der rote Winkel am Arm und das lässig verkehrt herum gehängte Gewehr verrieten ihn als Mitglied der »Roten Garde«. Zweifellos hatte dieser Mann mit der wilhelminischen Vergangenheit gebrochen. »Aber trotzdem man es nach diesen Feststellungen nicht vermuten sollte, übte er Parademarsch – ›Exerziermarsch‹, wie es in der Vorschrift des näheren festgelegt ist. Er zog leicht und sauber die Fußspitzen durch den Schnee, auf und ab marschierend hinter seinem Gartengitter.«
Selbst dieser Revolutionär hielt, in einem unbemerkten Moment, an den Ritualen des alten Militärstaates fest. Aus diesem Grund, so schloss der Offizier seine Betrachtung, würde der deutsche Soldatengeist bald wieder hinter der Revolution zum Vorschein kommen. Er selbst reihte sich in die Gefolgschaft von Hermann Ehrhardt ein. Mit seinem Sinnbild vom Exerziermarsch sollte er recht behalten.
Verlierersein ist keine Frage des Alters, es trifft die Älteren wie die Jüngeren. Man muss sein Leben nicht gelebt haben, um sich darum betrogen zu fühlen. Wer als junger Mensch dem Untergang der Welt seiner Eltern beiwohnt, ist mehr als nur Zeuge. Ihre Gewohnheiten, Sprache und Gefühle waren auch die seinen. Er ist aufgewachsen mit ihren Versprechungen und Erwartungen, doch nach dem Zusammenbruch bleibt von ihrem Erbe kaum mehr als ein Häuflein verbrauchter Anekdoten. Diese Erinnerungen sind noch da, aber wertlos geworden, und so taumeln die Älteren betäubt vom grellen Licht einer unbekannten Welt, während die Jungen sich darin selbst überlassen bleiben. Jenseits vom Schmerz ihrer Eltern haben sie ihren eigenen Schmerz der Desillusion. Sie waren unterwegs zu Karrieren, die es nicht mehr geben wird, und die gelernte Sprache ist nicht mehr die richtige. Dagegen können sie sich auflehnen, gegen ihre Eltern mit ihrem falschen Vorbild oder gegen die, die sich an ihre Stelle gesetzt haben. Die plötzliche Leere im Leben einer Umbruchgeneration schürt die Sehnsucht nach einem radikalen Ausweg.
Der Waffenstillstand hatte in Deutschland Scharen von jungen Soldaten in ein Weiterleben entlassen, in dem sie ihre Heimat nicht mehr so vorfanden, wie sie sie verlassen und in ihren Träumen vermisst hatten. Was sie einte, aber von den anderen trennte, war das Fronterlebnis in der Schicksalsgemeinschaft von Männern, das sich mit den Begrifflichkeiten der Heimat nicht zur Deckung bringen ließ. Diese Gemeinsamkeit suchten sie in ihren Veteranenkreisen und Männerbünden, wo sie ihrem Opfer in gemeinsamer Beschwörung einen Sinn abringen konnten. Hier waren sie nicht mehr allein mit ihrer Niederlage, die sie als unverdientes Schicksal empfanden. Im Echo der gegenseitigen Anerkennung steigerte sich ihr Drang, sich dagegen aufzulehnen. In drastischen Büchern und Bildern versuchten sie, ihre Erlebnisse zu verarbeiten und daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Der Stil dieser Erinnerungsliteratur ist durchweg düster und von fordernder Dringlichkeit. Sie richtet sich nicht so sehr gegen den Krieg, sondern gegen die Mächte des Bösen, die den Verlierern vermeintlich tiefes Unrecht zugefügt hatten.
Die Schriften des Leutnants Friedrich Wilhelm Heinz sind beherrscht von diesem untergründigen Hass. In einem seiner Bücher stellt er im Telegrammstil seinen Lebenslauf an die Stelle eines Vorworts. »Mit 16 Jahren Kriegsfreiwilliger im Garde-Füsilier-Regiment. Mit 18 Jahren aktiver Leutnant im Infanterie-Regiment 46. Somme, Flandern, Tankschlacht, Märzoffensive, Abwehrschlachten, Grenzschutz, Ehrhardtbrigade, Kapp-Putsch, Oberschlesien, Schwarze Reichswehr, Ruhrkrieg, Feldherrnhalle. Viermal verwundet. Schwerkriegsbeschädigt. Sechsmal verhaftet. Vierzehn Gefängnisse des Staates von Weimar kennengelernt. Nicht vorbestraft.« Ein solches Leben brauchte keine Erklärung, es brauchte nicht einmal vollständige Sätze. Es stand für eine Generation, jeder Name war ein Mythos, jede Station eine Auszeichnung.
Aber anders als die meisten schreibenden Veteranen beschied sich Heinz nicht damit, das Kriegserlebnis als Feuerprobe mannhaften Heldentums zu stilisieren. Für ihn bedeutete Krieg geistige Auseinandersetzung. Seine Erziehung im bürgerlichen Elternhaus schildert er als nationalistisch, antidemokratisch und kriegsbegeistert. Auf dem Schlachtfeld erfasste Heinz der Zweifel am Überlieferten. »Der alte Staat hatte uns in Schule und Heer kein Ziel gegeben, dessen schöpferischer Sinn das ganze Leben in seiner Allmacht und Fülle hätte umspannen können. Beim Einschlag der ersten Granate wußten wir, und dieses Wissen wurde mit jeder Stunde unseres Einsatzes immer bedrückender, daß alles angeblich Sichere unsicher geworden war, daß alle Berufs- und Fachhoffnungen belanglos waren vor einem ersehnten Ziel, das der Krieg der Nation gesetzt haben mußte und das allein die Opfer rechtfertigen konnte. Aber niemand gab uns dieses Ziel.«
Friedrich Wilhelm Heinz
Das Kriegsende verbrachte Heinz in einem Lazarett in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Anfang November fielen dort Matrosen aus Kiel ein und errichteten eine provisorische Regierung aus Arbeiter- und Soldatenräten. Heinz schleppte sich zum Generalkommando mit dem Vorsatz, an der Spitze eines Freiwilligentrupps der Meuterei ein Ende zu bereiten. Doch er musste erfahren, dass der Stadtgeneral in den Urlaub abgereist war. Der Befehlshaber der kaiserlichen Armee hatte, wie sein oberster Dienstherr, im Angesicht des Umsturzes seinen Posten geräumt. Wenig später wehte auf dem Generalkommando in Frankfurt die rote Fahne. Das alte Regime hatte sich in Luft aufgelöst.
Ein paar Wochen zuvor hatte sich Heinz dafür noch zusammenschießen lassen, nun musste er zusehen, wie die Revolutionäre seine Reste in Grund und Boden trampelten. Er beschrieb die meuternden Matrosen und Soldatenräte, Deserteure und Schieber, die selbstherrlich die Macht an sich rissen. »Aufrufe von Friede, Freiheit, Schönheit, Würde und Brot, deren Verfasser sich anschließend viehisch besoffen und von galizischen Großgaunern Trinkgelder schenken ließen, am nächsten Tage aber von den Fenstern des Regierungsgebäudes aus, festgehalten am Rockzipfel, Versprechungen unter das Volk warfen, die von sozialer Gerechtigkeit troffen; ein Bürgertum, das die Rolläden herunterließ, das in dumpfer Selbstaufgabe sein Schicksal erwartete; Offiziere, die schmachvoll ihren Posten verließen, Generale, die in ihrem Fahneneid nur ein Phantom, ein Nichts, eine hohle Formel sahen.«
In den Szenen der Revolution von 1918, die er in seiner Heimatstadt beobachtete, trat der Verrat als Leitmotiv in Heinz’ Leben. Seine neuen Feinde waren die Exponenten der Gegenwart, ja die Zeit selbst war ihm zum Feind geworden. Mochten sie alle den Krieg für beendet erklären, Friedrich Wilhelm Heinz wusste es besser. Für ihn war die Nachkriegsphase nichts anderes als das erweiterte Schlachtfeld der vorangegangenen Kämpfe. Vier Wochen später verließ er das Lazarett, um sich weit im Osten seinem alten Regiment anzuschließen, das sich dort im fortgesetzten Kampf um die deutschen Grenzen befand.
Der Schatten dieser Frontgeneration fiel auf jene, die nur wenig jünger als sie gewesen waren, geboren zwischen 1900 und 1910. Sie waren zu jung zum Kämpfen, und so hatte der Krieg ihre Jugend auf andere Weise dominiert. Im Kindesalter hörten sie täglich von bösen Feinden und gutem Vaterland, Volk und Nation. Das Wort »Deutschland« hatte für sie eine Aura von Gefährdung. Der im Jahr 1903 geborene Günther Gründel schrieb über seine Erfahrung, als Kind des Krieges aufzuwachsen: »Hier wurde erstmals Todesangst und vielleicht auch Haß in unsere harmlosen Kinderherzen getragen, die aus ihrer unbekümmerten Kindlichkeit mit einem Schlage hinein in die rauhe Wirklichkeit gerissen worden waren. Was die ganze Generation erlebte: den Kampf um die bedrohte Heimat im weitesten Sinne, durchlebten wir damals mit besonderer, reflexionsloser, unmittelbarster Eindringlichkeit.«
Im Kriegsverlauf kamen dieser Jugend die Vorbilder abhanden, denen sie hätten nacheifern sollen. Die Väter und jüngeren Lehrer waren an der Front, graue Ruheständler traten an ihre Stelle. Je mehr das Deutsche Reich einer trostlosen Festung glich, desto mehr stellten die Jungen die Vorgaben dieser Erzieher infrage. Am Ende brach das hergebrachte Autoritätsmodell der Gesellschaft in sich zusammen. Die Welt der alten Generation war in Konkurs gegangen.
Anfang Dezember 1918 kehrten die deutschen Kampftruppen von der Westfront heim ins Reich. Vier Jahre hatten sie unter den Gesetzen des Krieges gelebt, jetzt kamen sie zurück in eine Heimat, in der vieles nicht mehr so war wie zuvor. Deutschland war weder zerstört noch besetzt, aber der Krieg war verloren, und der Kaiser, für den sie ihr Leben eingesetzt hatten, war im Exil. Manche erinnerten sich an den August vier Jahre zuvor, als das Heer in großer Begeisterung ausgezogen war, wo sich im Deutschen Reich selbst ärgste Feinde die Hände gereicht hatten. Wie eine Siegesfeier hatte sich das angefühlt. Die jetzt zurückerwartet wurden, waren bloß Übriggebliebene. Niemand wusste so recht, wie man Verlierer empfängt.
Ein Dezembertag im nassgrauen deutschen Regenwinter von 1918. In den Straßen von Frankfurt am Main warteten die Menschen auf die Soldaten der 213. Infanterie-Division. Oben an den Häusern hingen ein paar Reichsfahnen in Schwarz-Weiß-Rot, unten sah man Mädchen mit Blumenkörben und Geschenkpaketen. Wachleute hielten eine Gasse für die Truppe frei. Eine Erregung hatte die Menge erfasst, ihr Gemurmel pflanzte sich fort, wann würden sie kommen, wie würden sie aussehen, gäbe es eine Parade?
Mitten in der Menge stand der sechzehn Jahre alte Schüler Ernst von Salomon. Auch wenn ihn die Nähe der fremden Leiber würgte, teilte er doch ihre Erregung, da er sich von den Frontsoldaten eine »Lösung« erhoffte, die Erlösung vom Niedergang der zurückliegenden Wochen, der ihn in eine Seelenkrise gestürzt hatte.
Ernst von Salomon war kein Schüler wie jeder andere. Der Sohn eines früheren Offiziers und Polizeikommissars besuchte die preußischen Kadettenanstalten in Karlsruhe und Berlin, militärische Eliteschmieden, in denen sich der Nachwuchs des Deutschen Reiches für die Offizierslaufbahn drillen ließ. Die Hauptkadettenanstalt in Groß-Lichterfelde bei Berlin, in der er sich seit 1917 auf das Abitur vorbereitete, stand im Ruf, eine der besten Militärschulen der Welt zu sein. Wer in der HKA die Ausbildung durchlief, musste sich mit Haut und Haar ihrem Gesetz unterwerfen. Die gesamte Persönlichkeit des jungen Menschen nach dem Ideal des Soldaten zu formen, das war der Anspruch, um die künftigen Führungsfiguren der kaiserlichen Armee heranzuzüchten.
In einem Buch beschrieb von Salomon später den Alltag der preußischen Kadetten in ihrer Anstalt. Abgeschottet hinter rotem Backstein begann der Tag mit dem Appell auf dem Kasernenhof. Nach dem Schulunterricht lernten sie fechten, reiten, exerzieren und schießen, und sich zu panzern gegen Gebrüll, Schmerzen und Mitgefühl. Für jedes Schlappmachen gab es einen Katalog von Strafen. Oft blieb es den Kadetten selbst überlassen, sich gegenseitig mit Stockhieben zu züchtigen. Alles war öffentlich, vom Schlafsaal bis zum Briefverkehr, alles durchgeplant im Kosmos der preußischen Erziehung. Wer zu schwach war, verschwand von heute auf morgen. Ernst von Salomon verschwand nicht. Mit zwölf war er zu den Kadetten gekommen und hatte ihre Begriffe von Ehre, Gehorsam und Loyalität zu Kaiser und Staat verinnerlicht. Die Welt des Elternhauses rückte in immer weitere Ferne. Die Kadettenausbildung hatte ihn nicht nur hart gemacht, ein Teil der Maschinerie zu sein gab ihm ein Gefühl von Heimat und Zukunft und lehrte ihn, die Ordnung zu lieben und das Chaos zu verabscheuen. Unter dem Befehl zu leben, empfand er als Glück.
Ernst von Salomon
Seit dem August 1914 sahen die jungen Offiziersanwärter ihre Bestimmung, in den Krieg zu ziehen, zum Greifen nah. Ernst von Salomon betete vergeblich darum, dass dieser nicht zu Ende gehen möge, ehe sie ihre Bewährungsprobe bekämen. Während der Herbstrevolution 1918 besetzten revolutionäre Soldaten die Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde. Sie schlossen die Schule und schickten die Kadetten nach Hause. Von Salomon beschrieb den Schock der Leere, der ihn erfasste. »Der äußerste Schmerz, der uns bewegte, war der, so gut wie ausgeschaltet zu sein, nicht mitwirken zu können, für und gegen, mit unserer wachen Kraft und Bereitschaft abseits stehen zu müssen als Reserve ohne Front, aufgespart für nichts, und unseren Willen gerichtet in eine gespensterhafte Leere, dorthin, wo soeben noch ein Staat war, und nun nichts mehr sein sollte als ein allgemeines Gefühl. Dies war unser Schrecken, es schien, als seien wir überflüssig geworden.«
Tagelang streifte er durch die Straßen seiner Heimatstadt Frankfurt: überflüssig. Er sah die roten Matrosen, die die Revolution hierhergetragen hatte. Hinter der Fahne schoben sich Haufen von wütenden Arbeitern, Soldaten und Frauen durch die Gassen. Pack und Pöbel, ging es Salomon bei diesem Anblick von Menschen und Meinungen durch den Kopf – das Gesicht der Masse, die ihn sein Kadettenkodex zu verachten gelehrt hatte. Jetzt aber, wo er nicht mehr im Gleichschritt seiner Kompanie aufgehoben war, wurde ihm die Masse gefährlich. Er sah, wie sie einem Soldaten den Kneifer ins Gesicht schlugen. Weil er selbst die Achselklappen seines Militärmantels nicht preisgeben wollte, ließ er sich blutig prügeln. Er fing an, Waffen einzusammeln, die in den Häusern seiner Bekannten herumlagen. Nachts schleppte er sie in seine Dachkammer, für einen nie geführten Einsatz. Keiner seiner Kameraden wollte ihm folgen bei dem Plan, das Hauptquartier der Roten im Polizeipräsidium hochzunehmen. Am Ende half ihm alles nichts gegen die Einsicht, dass er auf verlorenem Posten stand. Den Krieg verpasst und verloren, den Kaiser, den Staat, seinen Befehl verloren.
Jetzt stand von Salomon in der Masse im Frankfurter Dezemberregen. Was ihn ausharren ließ, war die Aussicht auf die Männer von der Front. Sie würden wieder Ordnung schaffen, Soldaten wie er. Auf einmal erfasste eine Bewegung die Menge, und er schwappte mit nach vorn gegen die Kette der Wachleute. Von fern konnte er die Helme aufblitzen sehen, die Gewehre auf den Schultern der grauen Gestalten, die in Viererreihen vorbeieilten. Keiner sprach. Die Rufe aus der Menge erstarben.
Zügig marschierten diese Männer, die Augen in Abwehr an ihnen vorbeigerichtet. Von Salomon spürte in der Kälte, die von diesen Gesichtern ausging, seinen eigenen Irrtum. »Alles schal und leer, das, worauf ich gehofft hatte, das, was ich gewünscht hatte, das, wofür ich mich begeistert hatte. Daß diese da, die Männer, die da marschierten, das Gewehr geschultert und strenge abgeschlossen von allem, was nicht ihresgleichen war, daß diese da nicht zu uns gehören wollten, das war es, das Entscheidende.«
Nicht dazuzugehören – zum ersten Mal empfand Ernst von Salomon das Grundgefühl, das sein Leben durchziehen sollte. Kompanie auf Kompanie sah er an sich vorbeimarschieren, in ihrem stummgrauen Marsch ohne Botschaft. Keine Brücke war mehr da zwischen der Heimat und diesen Soldaten, und die Parolen vom einigen Vaterland, Volk und Nation waren ungültig geworden. Die letzten stampften vorüber, als sich die Zuschauer zurück in ihre Häuser flüchteten. Nichts war gelöst, und er gehörte nirgends dazu.
Unruhe in der Villa Rathenau
Freitag, 23. Juni 1922, am Morgen
Der Himmel über Berlin ist bewölkt, und es fällt etwas Regen. In der Villa des deutschen Außenministers in Grunewald bereiten sich alle auf einen dieser langen Tage vor, die schier kein Ende nehmen wollen. Seit er vor einem halben Jahr das Amt in der Regierung angetreten hat, befindet sich der Minister von morgens bis abends im Dauereinsatz. Sein Diener Hermann Merkel, der ihm seit einem Vierteljahrhundert zur Seite steht, beobachtet das mit Sorge. Merkel lebt mit seiner Familie in einer Wohnung im Untergeschoss der Villa. Wenn der Minister ein paar Tage auf seinem Landsitz in der Märkischen Schweiz nordöstlich von Berlin verbringt, ziehen ihm die Merkels nach ins dortige Gärtnerhaus. Kaum einer ist ihm enger verbunden als sein Diener, und ganz genau vermerkt dieser die Veränderungen der letzten Zeit. Als sein Dienstherr wieder einmal in einer Nacht ohne Schlaf hinter Aktenbergen an seinem Arbeitstisch versinkt, erlaubt sich »der Hermann« den Hinweis, der Herr Doktor müsse mehr bewegt werden. So wie ein Pferd auch mal rausmuss aus seinem Stall.
Im Sommer 1922 zählt Walther Rathenau zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Weimarer Republik. Der meistbeachtete Politiker ist er ohnehin, und das nicht nur im eigenen Land. Erst vor ein paar Wochen hat er am Rande der internationalen Wirtschaftskonferenz in Genua die Welt überrascht, indem er einen Vertrag mit der Sowjetunion präsentierte, in dem das Deutsche Reich die Jahre zuvor abgebrochenen Beziehungen wieder aufnahm und den gegenseitigen Verzicht auf Kriegsreparationen erklärte. Auf der »Pyjama-Konferenz« in seinem Hotelzimmer in Genua, zu der er selbst im Schlafanzug empfing, entschloss sich die deutsche Delegation zu diesem Schritt. Obwohl unter den Vertrag von Rapallo auch der deutsche Reichskanzler Joseph Wirth seine Unterschrift gesetzt hat, sprechen alle von Rathenau.
Die Bilder, die in den illustrierten Zeitungen erscheinen, zeigen alle möglichen Politiker, aber im Gedächtnis bleibt dem Betrachter nur er. Die hochgewachsene Statur, die makellose Kleidung, der Charakterschädel mit dem markanten Profil, der Gestus eines Aristokraten, in allem überragt Rathenau seine Umgebung. Wo er auftritt, sehen alle den Mittelpunkt. Der Berliner Sebastian Haffner, zu dieser Zeit 15 Jahre alt, verzeichnet die außerordentliche Wirkung Rathenaus auf die Fantasie der Menge und seiner eigenen Schulkameraden. Zum ersten Mal seit dem Krieg, so empfinden sie es, ist Politik wieder interessant. »Rathenau wurde Wiederaufbauminister, dann Außenminister – und auf einmal fühlte man, daß Politik wieder stattfand. Wenn er auf eine internationale Konferenz reiste, hatte man zum ersten Mal wieder das Gefühl, daß Deutschland vertreten war.«
Walther Rathenau in Rapallo, 1922
Ein diplomatischer Paukenschlag ist der Vertrag von Rapallo ohne Zweifel, zwar keineswegs einhellig bejubelt, aber doch dazu angetan, Rathenaus Anspruch zu untermauern, die deutsche Außenpolitik wieder zu einem Aktivposten zu machen. Der ganzen Maschine des Auswärtigen Amtes eine Drehung zu geben, wie er sich einem Vertrauten gegenüber ausdrückt. Nach acht Jahren Stillstand wolle er jeden Tag ein Eisen ins Feuer schieben und dabei immer die Fäden in der Hand behalten. Eine übermenschliche Arbeitslast sei das, die keiner länger als sechs Monate durchhalten könne. Doch so erkennbar ihm die Strapazen dieser letzten Monate in die Züge seines ebenmäßigen Gesichts geschrieben stehen, hat er in diesen Tagen doch etwas von einem Sieger an sich. Von einem, der endlich, mit 54 Jahren, dort angekommen ist, wo er sich ein Leben lang hingeträumt hat. Auf dem Gipfelpunkt eines Aufstiegs, den er selbst vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
Als der Erste Weltkrieg zu Ende ging, war Walther Rathenau ein isolierter Mensch. Seine Verdienste, die er sich beim Aufbau der Kriegsrohstoffabteilung im Preußischen Kriegsministerium erworben hatte, waren vergessen. Im Widerspruch zur siegesgewissen Frontpropaganda hat er den Krieg stets als Verhängnis für Deutschland gesehen und sich auch öffentlich im Gegensatz zur verordneten Zuversicht ausgesprochen. In seinen Schriften beschwor er für Deutschland die Vision einer staatlichen und geistigen Erneuerung. Umso irritierender wirkte es, als er im Oktober 1918, da sich die Niederlage abzeichnete, in einem Zeitungsartikel zu einem letzten militärischen Kraftakt, ja zu einer Erhebung des gesamten Volkes aufrief, um mit der Waffe in der Hand dem Feind einen ehrenvollen Frieden abzuringen. Dieser Aufruf zur Volkserhebung, einer Art levée en masse, erregte gewaltiges Aufsehen und beschäftigte kurzfristig bis zum Reichskanzler und der Obersten Heeresleitung selbst die Spitzen des Staates. Am Ende mochte sich niemand Rathenaus Durchhaltefantasien anschließen, sodass von seinem Vorstoß nichts übrig blieb als Verbitterung über den gewendeten Zyniker, der im Angesicht des Zusammenbruchs zur Kriegsverlängerung aufgerufen hatte.
Ende der Leseprobe