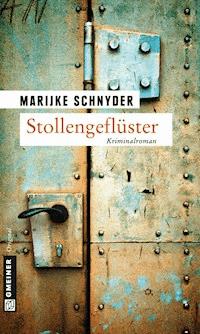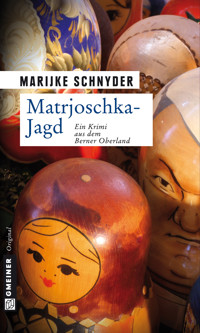Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Brand und Zoppa
- Sprache: Deutsch
In Bern wird ein junger Mann tot aufgefunden. Er war Finanzchef bei einer Firma, die kostbare Miniaturen des berühmten Zytglogge-Turms herstellt. Die Instant-Diagnose des unerfahrenen Berner Polizisten lautet: Selbstmord. Die Akte wird geschlossen, doch jetzt schalten sich Kommissarin Nore Brand und ihr Assistent Nino Zoppa ein: Wer nimmt sich schon zu Beginn einer steilen Karriere einfach so das Leben? Als ein Mädchen aus ihrem Quartier verschwindet, ahnt Nore Brand einen gefährlichen Zusammenhang …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marijke Schnyder
Racheläuten
Nore Brands dritter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Sascha F. – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4188-2
Für Christiane
»… Money makes the world go around … the world go around … the world go around. Money makes the world go around. It makes the world go ’round.«
Mit raschen Schritten entfernte sich Federico Meier von der Seniorenresidenz Lindenpark. Der Nordostwind hatte die ersten Septembertage verdorben. Meier kümmerte sich nicht darum. Ein alter Mann kam ihm mit hochgestelltem Mantelkragen entgegen. Er schob seinen Rollator vor sich her. Um seinen Hals hing ein Schal in den Farben der Young Boys. Meier wünschte ihm einen schönen Abend. Der Alte brummte etwas zurück, ohne dabei die Augen vom Kiesweg mit seinen unzähligen Hindernissen zu heben. Meier blieb einen Augenblick stehen und schaute ihm nach. Armer Kerl. Mit einem erleichterten Schwung drehte er sich ab und eilte weiter. Für ihn dauerte es hoffentlich noch eine Weile, bis es soweit war. Mit einem bißchen Glück würde ihn der Tod mitten aus seinem Leben reißen. Unvorstellbar für ihn, so dahinzuvegetieren, mit einem Horizont, der an der Gartenhecke endete. Also gab’s nur eines: voll leben und alles durchziehen, bevor sie dich an den Rollator stellen!
Durch die eisernen Stäbe des gewaltigen Eingangstors sah er das Taxi heranfahren. Ein alter mattgelber Mercedes. Der Chauffeur öffnete die Tür und schaute ihn fragend an.
»Meier?«
»Ja«, rief Federico Meier ihm zu und riss die Tür hinter dem Führersitz auf, »zum Obergericht, Länggasse.«
Den Rest des Weges bis zur Firma würde er zu Fuß gehen. Ein bisschen frische Luft um die Nase war zweifellos richtig, wenn man dabei war, einer erfolgversprechenden Sache auf den Grund zu gehen.
»Kavaliersdelikte nannte man das früher«, hatte sein Großvater gesagt und ihm zugezwinkert. »Aber heute liegt nichts mehr drin in dieser Beziehung. Alle haben Angst vor Enthüllungen. Dass alte Sachen auffliegen und dass die ganze Welt davon erfährt!«
Das muss nach dem dritten Glas gewesen sein. Er war verdammt gut gewesen, dieser Walliser, und der Großvater war sentimental geworden dabei.
»Und weil es keine Kavaliere mehr gibt, hat die Welt jetzt Probleme damit. So ist das.«
Federico Meier strich sich die Haare aus der jungen Stirn. Sein Herz klopfte aufgeregt. Das Leben hatte sich soeben auf einen Schlag verändert. Er würde diesen Problemen auf die Spur kommen und etwas Bewegung in die Sache bringen. Er musste cool bleiben und ein bisschen clever, denn er war unterwegs zu seinem Ziel, er hatte den kürzesten Weg dorthin gefunden, in ein Leben ohne Einschränkungen und Sorgen.
»Obergericht?«, wiederholte der Chauffeur. »Das hatten wir schon längere Zeit nicht mehr.« Er schaute Meier im Rückspiegel an.
»Dann war’s wieder mal an der Zeit«, erwiderte Federico Meier gutgelaunt. Der Mercedes fuhr los. Eine alte Karre, aber der Motor klang wie Musik in seinen Ohren.
Federico Meier hörte sich leise pfeifen. Money makes the world go around … Innerlich sang er die letzten paar Worte dieses komischen Liedes. It makes the world go ’round … In seinem Gedächtnis hatte dieses Lied zwar keinen Anfang, aber ein gutes Ende. Er sah seinen Musiklehrer, wie er abgewandt von der Klasse mit seinem dicken runden Rücken am Klavier saß und die Begleitung in die Tasten hämmerte. Der kleine Meier in Schuluniform schämte sich für alle anderen, die dieses Lied lauthals und fröhlich mitsangen. Die Erinnerung hatte die ganze Peinlichkeit der Situation nicht gemildert. Und jetzt waren die Worte mit der Melodie unvermittelt aufgetaucht aus seiner Vergangenheit, und es sang in ihm, bevor er es unterdrücken konnte. Die Takte hatten sich selbstständig gemacht. Unaufhörlich sang es im Kreis. »… It makes the world go ’round.«
Er pfiff laut vor sich hin. »… It makes the world go ’round.«
Ein simples Lied, das sich irgendwo in seinem Gedächtnis niedergelassen hatte, um im richtigen Moment wieder aufzutauchen. Vielleicht lag das Geheimnis der Langlebigkeit solcher Lieder darin, dass sie am Ende immer recht hatten. Am Ende ging es immer um das Geld.
Federico Meier lächelte vor sich hin. Er drehte sich nochmals um. Zu spät. Die herbstlichen Lindenbäume hatten sich vor den Blick auf die Residenz geschoben. Der alte Herr musste sich ausruhen. Eigentlich dürfte er jetzt wegdämmern. Federico brauchte ihn nicht mehr.
Das Taxi fuhr auf den Parkplatz hinter dem Obergericht und hielt an.
»Viel Glück«, sagte der Taxichauffeur mit einem bedeutungsvollen Unterton.
Federico Meier grinste, bezahlte den Chauffeur großzügig, stieg aus und schmiss die Wagentür hinter sich zu.
Er nahm die Abkürzung durch den Kanonenweg. Das Quietschen von Zugbremsen drang an sein Ohr. Sonst war es ruhig. Auch die Stadt hatte nun Feierabend. Federico Meier fühlte seit langer Zeit zum ersten Mal wieder Boden unter den Füßen. Auf diesem Boden ließ sich ein langes und sehr angenehmes Leben aufbauen. Wie gesagt, er musste nur clever sein, den nächsten Schritt gut planen.
1 Konkurrenz für Nore Brand
Nore Brand drehte sich auf die andere Seite. Es war schon hell, aber es war ihr freier Samstag. Sie wehrte sich dagegen, wach zu werden.
Aus der Ferne drang die Sirene eines Krankenwagens durch das offene Fenster. Dann war es wieder still. Sie hörte den Regen, der von der Dachrinne in das Abflussrohr gurgelte. Später würde das Wasser über die Dachrinne in den Hof hinausspritzen. Der Hauspflegedienst hatte im Frühling vergessen, die Dachrinne säubern zu lassen, und nun kam die nächste Ladung Herbstblätter und verstopfte die Rohre.
Die Zimmertür stand offen. Aus dem Wohnzimmer hörte sie, wie Jacques’ Finger über die Tastatur hetzten. Sie warf einen Blick auf den Wecker.
Doch nein, es war Samstag!
Jacques hatte sie um Asyl gebeten. Das Mehrfamilienhaus in Lausanne, in dem er seit vielen Jahren wohnte, wurde renoviert. Die Fassaden wurden frisch gemacht, die Balkons ausgebaut und die Fenster ersetzt. Man hatte die Mieter freundlicherweise über die Dauer der lärmigen Arbeiten informiert. Und natürlich über die logische Mietzinserhöhung infolge verbesserter Wohnqualität. Jacques war entsetzt gewesen, doch er wollte den Mietvertrag verlängern.
»Ich muss den See vor mir haben und in der Ferne die Savoyischen Berge. Das ist die Heimat meiner Augen.« Er brauche diese Weite vor dem Fenster, wenn er morgens mithilfe einer Tasse Kaffee langsam in diese verrückte Welt zurückkomme.
›Heimat meiner Augen!‹ das waren seine Worte gewesen.
Es kitzelte in ihren Mundwinkeln, dann stiess sie einen verärgerten Laut ins Kopfkissen. Ihr musste der Blick in eine Baumkrone genügen, von dort gingen die Gedanken auch ohne See weiter. Wohin sie immer wollten.
Sie rollte auf die andere Seite. Die Stelle, wo er geschlafen hatte, war noch warm. Sie zog die Decke über den Kopf, aber Jacques’ Tastentanz drang ungehindert durch die Daunen an ihre Ohren. Das Kissen half ein bisschen.
Wenn sie es jetzt wirklich zuließ, würde ein gemeiner Morgenschlaf sie holen und seltsame Träume, dumpfe Gefühle und unangenehme Gedanken hinterlassen.
Sie schloss die Augen und wartete trotzdem.
Vergeblich. Dieses Mal kam er nicht.
Alles wurde unzuverlässiger in ihrem Leben. Auch der Schlaf.
Und die Gedanken. Sie machten sich ohne ihre Erlaubnis an die Arbeit, irrten ins Büro und schauten sich misstrauisch um und nisteten sich ein in diesem Fall, der tatsächlich ihr gehört hätte. Doch der große Chef hatte sich in den Kopf gesetzt, dass seine Mitarbeiter, und ganz besonders seine Mitarbeiterin Nore Brand, weitergebildet werden mussten. Ihr Widerstand ging ihm seit Langem auf die Nerven. Ihre Methoden seien vorsintflutlich, hatte er Bastian Bärfuss erklärt. Bärfuss hatte herzlich darüber gelacht und es Nino Zoppa weitererzählt. Und nach einem Feierabendbier wusste es auch Nore Brand. Sie fand das gar nicht lustig.
»Warum sagt man vorsintflutlich?«, wollte Nino wissen.
»Die Antwort steht in der Bibel.«
»Ah«, sagte Nino, »was du nicht alles weißt.«
Ihr stand also eine Weiterbildung bevor. Das alles wäre irgendwie auszuhalten oder zweifellos auch irgendwie zu umgehen gewesen. Aber da war noch ein Problem.
»Der kommt direkt von der Police Academy«, hatte Bastian Bärfuss gespöttelt, »einer mit akademischen Weihen. Passt auf!«
Der Chef war restlos begeistert, bis zu jenem Morgen, als der Neue sich in einer großen Runde von Kollegen und Vorgesetzten verwundert zeigte über die veralteten Ermittlungsmethoden der Kantonspolizei. Man müsste sich ja schämen, wenn einer käme und genauer hinschauen würde.
Doch der Chef begriff, dass er ein Druckmittel in der Hand hatte. Der Neue drängte sich auf, er wisse, wie man Verbrechern das Handwerk lege. Behauptete er zumindest. Sein Auftritt war forsch und laut. Er hatte den Charme eines Laubbläsers. Er hatte Kriminalistik studiert; dies erwähnte er, sobald sich die geringste Gelegenheit dazu ergab.
Sein Blick war selbstbewusst. ›Magna cum laude‹ konnte man darin lesen. Summa wäre auch möglich gewesen, wenn es denn hätte sein müssen. Aber warum so früh im Leben schon sämtliche Qualitäten offenlegen? Man hatte schließlich noch das ganze Leben vor sich für Höchstleistungen.
Nore Brand schüttelte sich und vergrub sich noch tiefer in den Daunen.
Der Chef hatte auf der Stelle verfügt, dass alle Mitarbeiter ihr Wissen auffrischen und aktualisieren mussten. Es gab kein Entkommen, alle mussten an ihren kriminalistischen Kompetenzen feilen.
Nur einer freute sich. Nino Zoppa. »Neue Elektronik? Mega!«
So kam es, dass der smarte Kollege von der Police Academy Nore Brands Fall übernehmen musste, damit sie sich ein paar Tage auf die neuesten wissenschaftlichen Ermittlungsmethoden konzentrieren konnte. Mister Police Academy hatte ihren Fall mit Handkuss übernommen.
Der junge Finanzchef einer traditionellen und neuerdings wieder aufstrebenden Berner Firma war tot aufgefunden worden. Brisant an der Sache war, dass es sich bei ihm um den Enkel des Firmenbesitzers handelte. Doch die Ermittlungen wollten nie richtig in Fahrt kommen und liefen plötzlich auf wie ein unbeweglicher Kutter auf einer Sandbank. Das erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand, mit größter Schadenfreude selbstverständlich.
Trotzdem berief man eine Pressekonferenz ein. Der Chef hatte dem Druck nachgegeben, um der Sache vorläufig ein Ende zu setzen. Der Kollege von der Academy saß vor einem Wald von Mikrofonen und erklärte cool und geschliffen, wie sich dieser junge Finanzdirektor das Leben genommen habe. Eine tragische Angelegenheit. In der Hosentasche habe man Spuren von Antidepressiva gefunden.
»Das ist ja weitherum bekannt. Zu viele Menschen ertragen den Gedanken an den Herbst nicht. Auch Federico Meier hat seinem Leben ein Ende gesetzt«, erklärte der Neue mit bedeutungsvollem Unterton.
Seltsamerweise entfesselte sich in genau dem Moment, wo er diese düstere Erklärung abgab, der erste heftige Herbststurm. Eine Böe peitschte Regen an die Fenster, dass es krachte.
Der Mann hatte die Geistesgegenwart gehabt, kurz innezuhalten. Es war plötzlich dunkel geworden im Raum. Alle schauten zu den Fenstern hin und nickten einander zu. Kein Wunder, dass manchen Menschen dabei die Lust am Leben verging. Diese Jahreszeit hatte es in sich.
Die Blicke gingen wieder nach vorn zum Rednerpult, wo die dunkle Krawatte des Police Academy-Absolventen für die Seriosität der Ermittlungen und die Aufrichtigkeit seiner Ausführungen bürgte. Als er mit seinen Ausführungen zu Ende war, nickten alle. Es leuchtete jedem ein, dass bei Selbstmord keine Ermittlungen notwendig waren.
Der Fall hatte Aufsehen erregt, weil die Art und Weise, wie dieser junge Mann seinem Leben ein Ende gemacht hatte, erstaunlich war. Vor allem der Ort, wo er die letzten Augenblicke seines traurigen Lebens verbracht hatte.
Man hatte ihn im Bärengraben tot aufgefunden, dort, wo noch vor wenigen Jahren die Bären der Stadt gelebt hatten. Halb saß er, halb lag er da an der kalten und feuchten Mauer, den Kopf auf der Brust, die Pistole war ihm aus der Hand gerutscht.
Eine Kugel fehlte im Magazin. Der Gerichtsmediziner brauchte nicht lang, um sie zu finden.
Man unterstrich, dass es sich bei der Waffe um das Eigentum des Toten handelte, dass sie registriert war, und unterschlug die Tatsache, dass die Spurensicherung einen Fehler gemacht hatte. Ein erschrockener Assistent der Spurensicherung hatte die Waffe geputzt, weil er den blutigen Anblick nicht ertragen konnte.
Es kam nicht selten vor, dass einer die Nerven verlor und in der Folge völlig hirnlose Dinge tat. Doch der Schauplatz beschäftigte und verwirrte die Menschen derart, dass es keinem in den Sinn kam, nach Fingerabdrücken oder anderen Spuren zu fragen. Der Ort und die Umstände waren vorerst dramatisch genug.
Man überlegte sich zwar, wie denn dieser arme Kerl in den Graben gekommen war. Dem einen und anderen schien das eine knifflige Sache. Doch das allgemeine Publikum beschloss dann, die Erklärungen herzunehmen, als wäre es fast zu erwarten gewesen, dass sich mal einer aus Lebensüberdruss mit der Pistole in der Hand auf den Mauerrand des alten Bärengrabens setzen würde.
Es war wieder Herbst, und man erinnerte sich an seine unheilvollen Auswirkungen auf das menschliche Gemüt. Man verweilte kurz bei diesen Gedanken und ging dann rasch wieder zu den Geschäften des Tages über, und am nächsten Tag hatten die Zeitungen neue Geschichten zu erzählen.
Bastian Bärfuss hatte sich in dieser Sache zurückgehalten.
Immerhin hatte er Nore Brand gegenüber zugegeben, dass man da vielleicht genauer hätte hinschauen müssen. Irgendetwas sei doch seltsam an dieser Sache. Zuerst einmal, dass man so rasch von Selbstmord geredet hatte. Zugegeben, einiges deutete darauf hin: finanzielle Schwierigkeiten, Schulden hieß das, kein Wunder fand man Spuren von Antidepressiva in seinem Körper und in seiner Hosentasche. Weiß der Kuckuck, was den jungen Mann sonst noch plagte.
Der große Chef wollte offiziell einen Strich unter die Sache ziehen. Das Versagen des jugendlichen Spurensicherers durfte nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Der arme Kerl sei schließlich auch nur ein Mensch, und er wolle nicht, dass das Journalistenpack ihm in die Arbeit pfusche, wiederholte er bei jeder internen Gelegenheit.
Als jedoch der Chef der Zeitung entnehmen musste, dass der eloquente Mitarbeiter mit der dezenten Krawatte zu seinem heimlichen Nachfolger gekürt worden war, fand die Begeisterung über den Neuling ein abruptes Ende. Dem Chef platzte der Kragen. Dazu wurden plötzlich Fragen und Zweifelsäußerungen laut.
Der Chef begriff: Diese Sache war noch nicht ausgestanden.
Er bat Bastian Bärfuss, sich in dieser Sache so unauffällig wie möglich umzusehen. Nore Brand und Nino Zoppa sollten ihn dabei unterstützen.
Bastian Bärfuss schaute in seine Agenda und schüttelte bedauernd den Kopf.
»Nore Brand ist ab Montag abwesend. Du weißt ja: diese Weiterbildung. Das hast du ihr aufgebrummt. Mit ihr kannst du nicht rechnen. Nino Zoppa kannst du einsetzen. Der ist gut, und zum Glück wird er unterschätzt. Der kann ja keine Menschenseele aufschrecken, aber er bringt es noch weit. Du wirst sehen.«
Bastian Bärfuss hatte sich gewundert. Man musste also ein bisschen dranbleiben. Ein bisschen dranbleiben mit Nino Zoppa. Dabei wäre es ihm recht gewesen, wenn man einen Strich unter die Sache gezogen hätte. Sie schien doch unerwartet glimpflich abgelaufen zu sein. Die Welt war klein, und es kam vor, dass man plötzlich nicht mehr unbefangen war. Weil man Freunde und Bekannte hatte. Er wäre froh gewesen, hätte die Sache so ihr Ende gefunden.
Trotzdem: Er informierte Nore Brand. Sie hatte das Recht zu wissen, was los ist. Dass man sich weiter umsehen musste in diesem Fall. Leider ohne sie.
Er wusste, wie sie sich fühlte, und versuchte, ihr die Lage so taktvoll wie möglich zu erklären.
»Du musst mich überhaupt nicht schonen. Aber vielleicht wäre ich auch mit meinen vorsintflutlichen Methoden auf einen grünen Zweig gekommen«, erwiderte sie. »In diesem Fall haben die modernsten Ermittlungsmethoden jedenfalls nicht viel gebracht, oder?«
Bastian Bärfuss nickte bloß.
»Man könnte ja zur Abwechslung mal die richtigen Schlüsse ziehen. Vielleicht liegt’s am Ermittler und nicht an der Methode«, setzte sie wütend hinzu.
Bastian Bärfuss lachte widerwillig. Sie hatte recht. Im Grunde lag es immer am Ermittler.
Für Nore Brand führte kein Weg an der Weiterbildung vorbei.
Während da draußen einer in aller Ruhe seine Spuren verwischen konnte, war sie dazu verdammt, ihre Ermittlungsmethoden auf den letzten wissenschaftlichen Stand zu bringen.
Sie zuckte im Halbschlaf zusammen. Die Glocke der Pauluskirche erklang wie der Auftakt zum Jüngsten Gericht.
»Eléonore.« Jacques’ Stimme drang aus weiter Ferne an ihre Ohren.
Sie tat als ob schliefe.
Dann roch sie Kaffeeduft. Sie hörte, wie Jacques den Stapel Bücher zur Seite schob, die Tasse vorsichtig auf das Nachttischchen stellte und das Schlafzimmer leise verließ.
Als er weg war, warf sie die Decke von sich und griff nach der Tasse. Das würde vielleicht helfen, die morgendlichen Dämonen zu vertreiben. Ihre Dämonen hassten nichts mehr als starken Kaffee.
Sie hörte die Türklingel.
Und Jacques’ Tastentanz; er war wieder in seine Welt abgetaucht, und dort erreichte ihn nichts. Weder Klingelton noch Kanonendonner. Warum ließ sich so einer von Renovierungsarbeiten vertreiben?
Sie stand leise fluchend auf und versuchte, ihr Haar zu ordnen. Als sie die Türe öffnete, schlug ihr die dumpfe Luft des Treppenhauses entgegen.
Wilma stand da. Sie erkannte das Mädchen aus dem Nachbarhaus auch ohne Brille. Die Kleine trug ihre karierte Schiebermütze. Ein kleiner Kopf unter rosa und lila Streifengeflecht.
»Dominik ist weg!«, flüsterte sie. Ihre Beine steckten in viel zu großen Basketballschuhen.
»Dominik?«, wiederholte Nore Brand und schaute die Kleine fragend an.
Die Kleine nickte und schaute Hilfe suchend zu Nore Brand auf.
Dominik?
Die Erinnerung kam langsam.
Die Kleine war eines Nachmittags aufgetaucht, um ihr die Schildkröte vorzustellen. Undenkbar für Wilma, dass sich jemand nicht für Schildkröten interessierte. Sie stand geduldig vor der Tür, wartete, bis Nore Brand Anstalten machte, sie in die Wohnung zu bitten. Dann trottete sie ihr voraus in die Küche, zog einen Stuhl hervor und setzte sich drauf. Dominik steckte noch unter ihrem Arm.
»Willst du etwas trinken?«
»Milch«, sagte sie.
Nore Brand tat, wie ihr geheißen. Sie füllte das Glas und stellte es vor Wilma auf den Tisch. Sie schaute die Kleine an und bedauerte es, dass sie nicht viel Konversationsübung mit Kindern hatte.
»Trinkst du zu Hause auch immer Milch?«
»Nein, nur Cola oder heiße Schokolade. Unsere Milch ist nicht fein. Die schmeckt wie Wasser.«
Die Kleine schüttelte angewidert den Kopf. Sie hob Dominik auf den Tisch, nahm das Glas und trank.
»Müsstest du nicht in der Schule sein?«, fragte Nore Brand nach einem Blick auf die Uhr.
»Heute Nachmittag haben wir frei«, sagte Wilma und stellte das Glas wieder auf den Tisch. Mit einem Ruck zog sie Dominik zurück; er hatte vergeblich das Weite gesucht.
»Ist die Lehrerin denn krank?«
»Nein, die ist schwanger. Sie ist schon ziemlich fett.«
»Fett?«, wiederholte Nore Brand. »Du meinst wohl rund.«
»Das ist aber nicht das Gleiche«, erwiderte Wilma.
»Mama sagt, sie sei nie so gewesen. Mit mir im Bauch«, ergänzte sie.
Wilma hatte Milchspuren bis unter die kleine Nase hinauf.
»Nach den Sommerferien bekommen wir einen Lehrer.«
Nore Brand schaute die Kleine an. »Hast du eine Schwester oder einen …?«
»Nein«, fiel ihr Wilma ins Wort, »ich habe nur Dominik. Der schreit nicht dauernd und fällt keinem auf den Nerv.«
Dominik versuchte wieder zu entkommen, aber Wilma hinderte ihn mit einem entschiedenen Griff daran. »Sagt Mama. Sie hätte lieber eine Schildkrötenzucht als zwei Kinder.«
Dieser Besuch hatte Nore Brand fassungslos zurückgelassen.
»Dominik ist weg«, wiederholte die Kleine jetzt ziemlich ungeduldig und trat von einem Bein auf das andere. »Er war gestern allein im Garten.«
»Dominik ist weg?«, fragte Nore Brand.
Um fünf Uhr hatte sie sich frischer gefühlt. Langer Schlaf tat ihr nicht gut. Er vernebelte ihr den Kopf.
Sie schaute Wilma bedauernd an. »Ich habe Dominik leider nicht gesehen.«
Vielleicht dachte Wilma, Dominik hätte bei ihr angeklopft für eine Tasse Kaffee oder ein Schälchen Milch, weil er genau wie Wilma wässrige Milch nicht ausstehen konnte.
Wer kannte sich schon mit Schildkröten aus.
Wilma schaute sie hoffnungsvoll an. »Du bist doch bei der Polizei.« »Julius meint, das sei eine Angelegenheit für die Polizei.«
Wilma hatte tatsächlich ›Angelegenheit‹ gesagt.
Nore Brand runzelte die Stirn. »Julius?«
Die Kleine schaute sie forschend an. »Das ist mein Freund«, sagte sie dann. »Wir gehen zusammen in die Schule. Julius meint, ich könnte …«
Wilma senkte ihren Blick und schwieg.
Das Geräusch des hektischen Tastentanzes drang in die Stille.
Die Kleine horchte auf. »Ist er da?«
Wilma schaute sie an, als ob sie das natürlichste Recht der Welt auf Informationen hätte. In diesem Alter war das vermutlich der Fall.
»In seinem Haus in Lausanne werden Wohnungen renoviert.«
Die Kleine nickte. »Das macht Lärm und Dreck«, sagte sie verständnisvoll. »Wann geht er wieder?«
»In den nä…«, Nore Brand verstummte und starrte die Kleine verblüfft an. Was zum Teufel?
»Mach dir keine Sorgen«, sagte sie dann. »Dominik wird wieder auftauchen. Er hat sicher ein schönes Plätzchen gefunden, und wenn es ihm langweilig wird, dann …«
Wilma bewegte den Kopf langsam hin und her. »Vielleicht hat ihn jemand gestohlen.« Sie zog ihre runde Stirn zusammen. »Wenn du heute nicht arbeiten musst, kannst du ja auch ein bisschen suchen.«
Nore Brand fuhr sich durch die Haare.
»Dominik ist nicht schnell«, erklärte Wilma rasch. »Man muss einfach nur gut schauen.«
Nore Brand schaute die Kleine an. Sie würde nicht lockerlassen.
»Ich weiß nicht mehr genau«, versuchte sie es noch einmal, »wie er aussieht. Er ist sicher größer geworden in der Zwischenzeit.«
Wilma öffnete rasch ihre Schultasche und zog eine Zeichnung hervor.
»Das ist er.«
Eine grünbraun gemusterte Kugel mit vier Stummelbeinen. An einer Seite hing ein menschliches Gesicht. Oben rechts schaute die Sonne lächelnd durch die Wolken. Sie trug eine grellgrüne Sonnenbrille.
»Das ist eine schöne Zeichnung. Mach doch noch ein paar Zeichnungen. Die hängst du dann überall im Quartier auf. Irgendjemand muss ihn doch längst gesehen haben.«
Wilma schaute sie zweifelnd an.
»Kannst du ein …«, sie hielt inne und gab sich dann einen Ruck, »ein Sinaliment machen?«
»Ein Sinaliment?«
»Die Polizei macht immer ein Sinaliment, wenn jemand verlorengegangen ist«, sagte Wilma ungeduldig, »Julius hat mir das gesagt.«
Nore Brand gab auf. Sie nickte ergeben. »Ein Signalement also. Ich will schauen, was ich tun kann.«
Wilma atmete erleichtert aus. »Ich mache Zeichnungen, und du machst ein …«, sie zögerte kurz, »ein Signaliment.«
Nore Brand lächelte. »Ja, das machen wir.«
»Dominik ist etwa so groß«, erklärte Wilma und formte mit ihren Händen ein Hügelchen in der Luft. »Er ist größer als auf dieser Zeichnung. Und wenn du heute doch zu Hause bist, kannst du schon ein bisschen suchen helfen«, sagte sie. Sie drehte sich auf den Zehenspitzen und – erstaunlich, dass so etwas in diesen Basketballschuhen möglich war – tanzte die Treppe hinunter.
Nore Brand blieb eine Weile auf der Schwelle stehen.
Plötzlich fiel die Eingangstür mit einem lauten Krachen zu.
Also doch kein Traum.
»Am Samstagmorgen Kinderbesuch?«, fragte Jacques. Er saß am Küchentisch über den Laptop gebeugt.
Sie setzte sich zu ihm.
»Das war Wilma. Ihre Schildkröte ist verschwunden.«
»Ihre Schildkröte? Warum kommt sie denn zu dir?«
»Wir kennen uns ein bisschen.«
Nore Brand legte die Zeichnung auf den Tisch. »Seit letztem Winter. Wir hatten Schnee, sogar auf den Straßen in der Stadt. Es war an einem Mittwoch, am frühen Abend, es war dunkel. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich hatte im Quartier zu tun. Plötzlich stolperte ich über etwas. Da saß Wilma auf ihrem Schlitten, ganz allein in der Dunkelheit.«
Er nahm die Zeichnung auf und betrachtete sie.
»Wenn genug Schnee liegt, dann können die Kinder schlitteln, dann wird hier im Quartier ein Weg abgesperrt. Es ist also nichts Besonderes, ein Kind auf einem Schlitten. Aber die Kleine saß reglos da, sie schaute mich nur an. Ich wollte wissen, was los ist. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriff. Sie konnte nicht mehr gehen. Sie sagte, dass ihre Füße eingeschlafen seien. Sie ließen sich nicht mehr bewegen. Sie saß todunglücklich auf ihrem Schlitten und schämte sich dafür, dass sie nicht mehr gehen konnte.«
Nore Brand dachte an die Basketballschuhe. Kein Wunder, dass die Füße darin fast abgefroren waren.
»Und dann?«
Nore schaute ihn an. »Ich habe ihr gesagt, sie solle sich festhalten am Schlitten. Dann habe ich sie damit nach Hause gezogen.«
Jacques schaute sie zweifelnd an.
Nore schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, sie hat mich nicht reingelegt. Sie konnte einfach nicht mehr gehen.«
»Und ihre Mutter?«, wollte Jacques wissen.
»Die habe ich nicht gesehen. Als wir vor der Haustür waren, stand sie auf und ging hinein. Ich hatte das Gefühl, dass sie eine Begegnung verhindern wollte. Vielleicht war es ihr peinlich. Also ging ich wieder.«
Jacques legte die Zeichnung wieder hin.
»Ist das nicht seltsam?«
»Was? Diese Zeichnung?«
»Nein, dass du ihre Mutter nicht gesehen hast. Die Kleine hätte erfrieren können. Wenn sie das nun öfter hat?«
Das war ihr an jenem Abend auch durch den Kopf gegangen. Es waren kalte Tage und Nächte gewesen. Der Schnee war lang liegengeblieben.
»Ich habe mich auch gewundert. Zuerst. Ich nahm mir vor, meine Hausärztin zu fragen.«
Sie hatte es vergessen, wie man viel zu viel vergisst, weil der Alltag sich mit nichts aufhalten lässt.
Die Kleine war den ganzen freien Nachmittag mit dem Schlitten unterwegs, dass sie am Abend todmüde war, ist klar. Sie hat ihre Kräfte nicht eingeteilt, weil Kinder das nicht können. Und plötzlich war die ganze Energie weg, es wurde kälter und dunkel, und Wilma saß plötzlich kraftlos da, hatte kein Gefühl mehr in den Beinen und wusste nicht, was los ist. Es muss schlimm gewesen sein für sie. Dass sie sich so geschämt hat dafür, das hatte sie nicht vergessen. Warum hat sie sich für so etwas geschämt? Die arme Kleine.
Jacques strich über ihre Hand. »Ich verstehe sie. Du hast sie damals gerettet, und jetzt kommt sie zu dir, wenn sie ein Problem hat.«
Nore Brand wollte etwas erwidern, doch sein Blick war schon wieder auf den Bildschirm gerichtet.
Sie betrachtete die Zeichnung.
Hatten ihre Zeichnungen damals auch so ausgesehen? Sie erinnerte sich an den Geruch der Farbstifte, wenn sie die bunte Blechschachtel öffnete. Am liebsten hatte sie Winterlandschaften gezeichnet mit Schneemännern und Massen von Schnee auf Dächern und Tannenbäumen. Wenn der Schnee richtig weiß aussehen musste, dann gehörte ein bisschen Blau dazu.
Ihre Erinnerungen an jene Zeit waren schwach. Nur eines hatte sie nie vergessen: Die Erwachsenen damals waren Wesen aus einer anderen Welt. Sie redeten viel und laut, aber man konnte sie nicht verstehen. Sie waren andauernd mit unsichtbaren Dingen beschäftigt. Sie dachten immer an etwas und man durfte sie dabei nicht stören.
Die stärkste Erinnerung aber war der Geruch der Farbstifte, der war jederzeit abrufbar, ganz frisch und eindeutig.
2 Nino Zoppa ermittelt ganz diskret
Am Montagmorgen saß Nore Brand in aller Frühe auf dem Balkon. Es war kalt draußen, aber die Kälte tat ihr gut.
Der Zug nach Interlaken fuhr um 9.04 Uhr. Wenn sie zügig ging, dann war sie in fünf Minuten auf dem Perron.
Sie hatte Zeit.
Vor ihr lag Informationspapier für den Kurs. Beim Durchblättern war ihr die Zeichnung von Wilma entgegengekommen.
Dominik war schon am Samstagnachmittag wieder aufgetaucht. Wilma hatte ihr zugewinkt, als sie mit einem kleinen Jungen zum Spielplatz unterwegs war. Sie blieb kurz stehen. »Wir haben Dominik gefunden! Er hat ein Versteck im Garten!«, rief sie, dann winkte sie nochmals und rannte dem Jungen hinterher.
Nore Brand erhob sich und ging in die Küche, um die Zeichnung an den Kühlschrank zu hängen. Immer fehlten Magnete. Sie bekamen Beine oder Flügel und weg waren sie. Vielleicht hing einfach zu viel da. Alte Konzertflyer, eine Tageskarte der SBB, eine Mahnung der Steuerbehörden und Postkarten. Zu Weihnachten und an Ostern eine von Maria Volta. Immer die Mittelmeerinsel Pantelleria.
Und Grüße von Jacques, natürlich kulinarisch. Sie entfernte seine erste Postkarte von Rom, um Dominik Platz zu machen.
Sie trat einen Schritt zurück. Schildkröten hatten weise, uralt und ein bisschen verdrießlich in die Welt hinauszuschauen. Ihre Verdrießlichkeit war begründet. Die Welt hatte sich nicht zu ihren Gunsten verändert. Ihre Artgenossen kämpften ums Überleben.
Doch Wilma sah das offensichtlich ganz anders. In ihren Augen war Dominiks Gesicht heiter, der Mund breit und lachend.
Vielleicht brauchte es andere Augen, um dieses Tier wahrhaftig zu sehen.
Sie ging wieder hinaus.
Sie warf einen Blick auf die Uhr. Doch, es war noch Zeit für eine Zigarette.
Nore Brand fühlte sich wie das Kalb, das zur Schlachtbank geführt wird. Heute würde die Stunde der Wahrheit schlagen.
In solchen Zeiten musste man nachsichtig sein mit sich selbst.
Was sie selbst hin und wieder von sich selbst vermutete, würde auf einen Schlag ihr und zugleich allen Kursteilnehmern klar werden. Das Schicksal würde ihr die Maske vom Gesicht reißen, rücksichtslos und brutal.
Man würde sie vor einen PC setzen, so wie alle anderen. Auf allen Bildschirmen würden Dokumente, Grafiken und Statistiken mit einem Schlag freudig aufleuchten.
Auf allen, nur auf ihrem nicht. Ihr Bildschirm würde dumpf in den Raum schauen. Im allerbesten Falle vielleicht verzweifelte Signale senden: »Hier sitzt eine, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat!« In unverschämt fröhlich bewegten Schriftzügen würden diese Worte einen endlosen Reigentanz aufführen.
Die Kommissarin Nore Brand würde hilflos vor dem Bildschirm sitzen, weil sie keine Ahnung hatte, wie dieser Unsinn sich verhindern ließ.
»Gebt mir einen kniffligen Fall, und ich lege los!«, würde sie zornig rufen. »Einen Fall, bitte! Was soll ich vor einem Bildschirm?«
Der Dozent würde ihr zunicken, heiter und nachsichtig, so wie aufgeschlossene Dozenten dies zu tun hatten. »Wir sind hier mitten in einem kleinen Input, Frau Brand, eine kleine, gemeinsame Arbeitsbasis ist immer hilfreich. Die Fälle kommen später, sobald wir einen soliden Boden als gemeinsame Diskussionsbasis gelegt haben.«