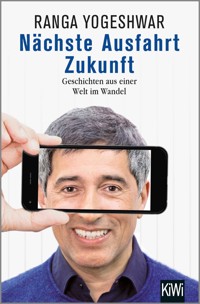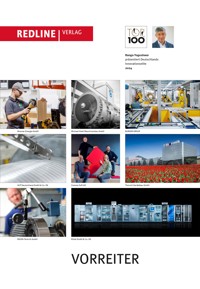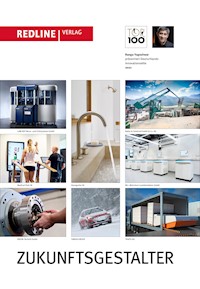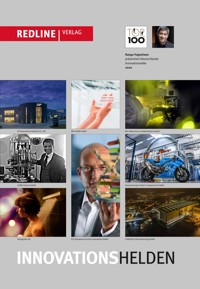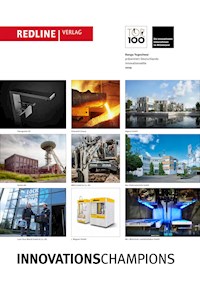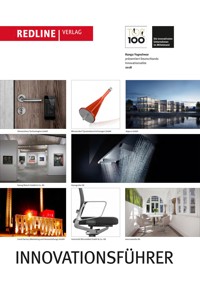9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zwei Bestseller in einem Band Warum leuchten Katzenaugen? Was haben Tulpen mit der Finanzkrise zu tun? Wieso kann es im Sommer hageln? Und: Rechnen Inder anders?In seinen beiden Bestsellern »Ach so!« und »Sonst noch Fragen?« löst Ranga Yogeshwar auf unterhaltsame Weise Rätsel des Alltags, beantwortet Fragen aus allen Bereichen des Lebens und zeigt überraschende Zusammenhänge auf. Vor allem macht er Lust aufs Fragenstellen, Erforschen und Weiterdenken!Dieser Doppelband enthält alle Fragen der beiden Bücher – ein ganz großes, intelligentes Lesevergnügen: Mehr Spaß kann Wissen nicht machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ranga Yogeshwar
Rangas Welt
Ach so! & Sonst noch Fragen?
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Ranga Yogeshwar
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Ranga Yogeshwar
Ranga Yogeshwar, geboren 1959, Studium der Physik, arbeitet seit 1987 für den WDR. Er entwickelte zahlreiche Sendungen, in denen Wissenschaft populär vermittelt wird, und moderiert unter anderem »Quarks & Co«, »Die große Show der Naturwunder« und »Wissen vor 8«. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, darunter der Georg-von-Holtzbrinck-Preis für Journalistik (1998), der Grimme-Preis (2003) und der Preis als Journalist des Jahres – Kategorie Wissenschaft (2007). 2009 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Wuppertal verliehen. Seine beiden Bücher »Ach so!« und »Sonst noch Fragen?« standen jahrelang auf der Bestsellerliste und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Warum leuchten Katzenaugen? Was haben Tulpen mit der Finanzkrise zu tun? Wieso kann es im Sommer hageln? Und: Rechnen Inder anders?
In seinen beiden Bestsellern »Ach so!« und »Sonst noch Fragen?« löst Ranga Yogeshwar auf unterhaltsame Weise Rätsel des Alltags, beantwortet Fragen aus allen Bereichen des Lebens und zeigt überraschende Zusammenhänge auf. Vor allem macht er Lust aufs Fragenstellen, Erforschen und Weiterdenken. Dieser Doppelband enthält alle Fragen der beiden Bücher – und ein praktisches Register zum Nachschlagen.
Inhaltsverzeichnis
Sonst noch Fragen?
Widmung
Vorwort
Danke
Warum haben Frauen kalte Füße?
1 Warum werden die Finger runzelig, wenn man lange badet?
2 Was sind Blutgruppen?
3 Werden in Vollmondnächten mehr Kinder geboren?
4 Warum sehe ich unter Wasser ?
5 Mögen Stechmücken Käsefüße?
6 Wie entsteht Muskelkater?
7 Warum klingt eine Stimme hoch, eine andere tief?
8 Warum setzt der Verstand bei Sonderangeboten aus?
9 Was bedeutet »Blutdruck 120:80«?
10 Warum vertragen manche Menschen keine Milch?
11 Was ist »gefühlte Temperatur«?
12 Warum kribbelt es manchmal in Händen und Füßen?
13 Warum bekommt man Gänsehaut?
14 Was passiert beim Niesen?
15 Ist Gähnen ansteckend?
16 Warum haben Frauen kalte Füße?
17 Wie sehen wir räumlich?
Warum funkeln Sterne?
18 Warum ist der Himmel blau?
19 Woher hat der Regenbogen seine Farben?
20 Wie entstehen Wolken?
21 Wie entsteht Nebel?
22 Warum funkeln Sterne?
23 Was ist die Milchstraße?
24 Warum wird es leise, wenn es schneit?
25 Warum hat der Mond so viele Krater – die Erde aber nicht?
26 Sehen wir alle denselben Mond?
27 Warum dreht sich unsere Erde?
28 Wie kommt es zu Ebbe und Flut?
29 Können 50.000 springende Menschen ein Erdbeben auslösen?
30 Was ist eine Sternschnuppe?
31 Wann beginnt der Frühling?
32 Warum ist eine Sonnenfinsternis so selten im Vergleich zu einer Mondfinsternis?
33 Warum zieht es oft in der Nähe von Hochhäusern?
34 Kann man im Moor untergehen?
35 Wie entsteht Schwerelosigkeit?
Kann ein Aufzug abstürzen?
36 Hilft es, am Automaten die Münze zu reiben?
37 Kann ein Aufzug abstürzen?
38 Macht es einen Unterschied, ob ich gegen einen Baum oder gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug pralle?
39 Warum gibt es Hochspannungsleitungen?
40 Der Schuss in die Luft – wie schnell ist die Kugel beim Fall?
41 Wird der Traum vom Beamen irgendwann Wirklichkeit?
Warum haben Elefanten so große Ohren?
42 Was steckt hinter dem Vogel-V?
43 Warum fliegen Motten zum Licht?
44 Warum haben Elefanten so große Ohren?
45 Warum leuchten Katzenaugen?
46 Warum sind Fliegen so schwer zu erwischen?
47 Warum sind manche Eier braun und andere weiß?
48 Warum fallen schlafende Vögel nicht vom Ast?
49 Warum frieren Enten auf dem Eis nicht fest?
Warum fällt der Toast immer auf die Marmeladenseite?
50 Warum ist das Taschentuch quadratisch?
51 Wer hat das Schmiergeld erfunden?
52 Was mache ich, wenn der Blitz einschlägt?
53 Woher kommt die Schultüte?
54 Woher stammt der Begriff 08/15?
55 Wie funktionieren Sonnencremes?
56 Warum ist die Deutschlandfahne schwarz-rot-gold?
57 Woher stammt der rote Teppich?
58 Was bedeutet DIN-A4?
59 Warum hat man manchmal auf Fotos rote Augen?
60 Bewerbungsgespräch oder Warum sind Kanaldeckel rund?
61 Warum dreht sich der Uhrzeiger immer rechts herum?
62 Warum fällt der Toast immer auf die Marmeladenseite?
Gab es Literatur als olympische Disziplin?
63 Wieso ist ein Marathon genau 42,195 Kilometer lang?
64 Warum hat ein Golfball Dellen?
65 Wie begann das Doping?
66 Gab es Literatur als olympische Disziplin?
67 Was bedeute Love:15?
Warum wird einem übel, wenn man als Beifahrer liest?
68 Was ist Normal? Und was Diesel?
69 Warum wird einem übel, wenn man als Beifahrer liest?
70 Woher stammt der Begriff »Blog«?
71 Wie viel CO2 produziert ein Auto?
72 Was passiert bei Aquaplaning?
73 Wie funktioniert ein Airbag?
74 Wie kommt die Straße ins Navigationsgerät?
75 Kann die Tragfläche eines Passagierflugzeugs brechen?
76 Wo ist die Zeit geblieben?
Wie kommen die Perlen in den Champagner?
77 Wie kann Müsli Leben retten?
78 Woher stammt das Croissant?
79 Warum »donnert« es im Cappuccino?
80 Was ist das Geheimnis von Speiseeis?
81 Wo reifen die Bananen?
82 Wie konservieren Zucker und Salz?
83 Warum brennt Schokolade?
84 Was ist der Unterschied zwischen H-Milch und pasteurisierter Milch?
85 Wie errechnet sich das Mindesthaltbarkeitsdatum?
86 Wie kommen die Perlen in den Champagner?
87 Mineralwasser oder Trinkwasser aus der Leitung – worin liegt der Unterschied?
88 Warum flockt die Milch im Kaffee aus?
Was ist das Geheimnis der tanzenden Wassertropfen?
89 Warum wird der Keller im Sommer feucht?
90 Klobrille gegen Spültuch – Wo ist es im Haushalt am schmutzigsten?
91 Warum trocknet Plastikgeschirr nicht in der Spülmaschine?
92 Warum wird es sauberer mit Seife?
93 Was ist das Geheimnis der tanzenden Wassertropfen?
94 Warum wölbt sich der Duschvorhang beim Duschen immer nach innen?
95 Wie dreht der Strudel in der Badewanne?
96 Was tut man gegen Kopfläuse?
97 Warum landen die Strümpfe beim Waschen im Bettbezug?
98 Wie groß muss ein Spiegel mindestens sein, damit man sich ganz darin sehen kann?
Warum sollte man im Lotto nie 1, 2, 3, 4, 5, 6 tippen?
99 Woher kommt die Null?
100 Was macht die 13 so besonders?
101 Was heißt digital?
102 Warum wird es beim Ratenkauf teuer?
103 Warum rechnet man in der Seefahrt in Seemeilen?
104 Warum sollte man im Lotto nie 1, 2, 3, 4, 5, 6 tippen?
105 Wie zuverlässig ist der »Publikumsjoker«?
106 Wo liegt Deutschlands Mitte?
107 Können Sie rechnen?
108 Warum hat dieses Buch 108 Kapitel?
Ach so!
Widmung
Vorwort
Warum drehen sich Knödel im Topf?
1 Warum drehen sich Knödel im Topf?
2 Warum bildet sich Haut auf der erhitzten Milch?
3 Was passiert beim Popcorn?
4 Warum kochen die Profis mit Kupfer?
5 Was bedeutet »rostfrei«?
6 Warum verändert sich der Ton, wenn man im Cappuccino rührt?
7 Die Isolierkanne: Warum bleibt Heißes heiß und Kaltes kalt?
8 Warum tränen die Augen beim Zwiebelschneiden?
9 Warum brennen Chilis und Peperoni so?
10 Was macht die Hefe im Hefeteig?
11 Warum wird Ketchup flüssig, wenn man ihn schüttelt?
12 Warum braucht der Eierkocher weniger Wasser, wenn mehr Eier erhitzt werden?
13 Warum ist es so schwer, ein perfektes Ei zu kochen?
Warum kann Mehl explodieren?
14 Warum kann Mehl explodieren?
15 Wie gefährlich ist ein Autocrash mit Tempo 100?
16 Was tun, wenn der Blitz ins Wasser einschlägt?
17 Wie funktioniert ein Feuerlöscher?
18 Warum sollte man brennendes Öl niemals mit Wasser löschen?
19 Warum darf man an der Tankstelle kein Handy benutzen?
20 Ist das eingeschaltete Handy an Bord eines Flugzeugs gefährlich?
21 Was passiert, wenn während des Fluges ein Triebwerk ausfällt?
22 Warum kann es im Sommer hageln?
Warum soll man Blumen anschneiden?
23 Warum soll man Blumen anschneiden?
24 Was verbirgt sich hinter Tiefenrausch und Taucherkrankheit?
25 Was ist das Kindchenschema?
26 Warum summen Mücken?
27 Ist es im Weltraum laut?
28 Warum stinkt Hundekot, Pferdemist aber nicht?
29 Warum hat der Schmetterling bunte Flügel?
30 Warum halten sich Knochen so lange nach dem Tod?
31 Warum bekommen Spechte keine Kopfschmerzen?
32 Warum sind Krankenhauskeime so gefährlich?
33 Was verbirgt sich hinter dem Lotuseffekt?
34 Lebt das Kopfkissen?
35 Warum fällt der Apfel vom Baum?
36 Wieso wird CO2 freigesetzt, wenn man einen Baum fällt?
Warum ist der Luftdruck in einem Fahrradreifen höher als im Autoreifen?
37 Warum ist der Luftdruck in einem Fahrradreifen höher als im Autoreifen?
38 Wie funktioniert ein Handwärmer?
39 Warum spritzt es bei der Arschbombe?
40 Rechnen die Inder anders?
41 Warum starten Weltraumsonden immer in der Nähe des Äquators?
42 Was bedeutet Meereshöhe?
43 Warum vertauscht der Spiegel rechts und links, jedoch nicht oben und unten?
44 Wie kann man Steuerbetrüger entlarven?
45 Wie viel Flüssigkeit passt in eine Babywindel?
46 Wie funktioniert eine Hochrechnung?
47 Warum ist Glas durchsichtig?
48 Warum knallt eine Peitsche?
49 Warum wandern Teppiche?
50 Warum herrscht bei Tiefdruckgebieten schlechtes Wetter?
Warum schwimmt ein tonnenschweres Schiff?
51 Warum schwimmt ein tonnenschweres Schiff?
52 Wie entstehen Querrillen auf unbefestigten Straßen?
53 Warum machen Autoreifen auf manchen Fahrbahnen so einen Lärm?
54 Was hat das Fahrrad mit einem Vulkanausbruch zu tun?
55 Hält das Fliegen jung?
56 Wie funktioniert die Bordtoilette eines Flugzeugs?
57 Kann man ein Ei auf der Motorhaube braten?
58 Wie funktioniert eine Fata Morgana?
Was hat Politik mit Kuscheltieren zu tun?
59 Was hat Politik mit Kuscheltieren zu tun?
60 Woher stammt der Begriff »Vogel-Strauß-Politik«?
61 Woher stammt der Begriff »SPAM«?
62 Was bedeutet »Google«?
63 Was bedeutet Schuhgröße 42?
64 Was ist der Unterschied zwischen einem See und einem Meer?
65 Wann verlieren Worte ihren Sinn?
Sollte man bei kleinen Wunden ein Pflaster benutzen?
66 Sollte man bei kleinen Wunden ein Pflaster benutzen?
67 Wie kommt es zur Schlaftrunkenheit?
68 Warum bekommen wir alle dieselbe Medizin?
69 Warum wirken Medikamente ohne Wirkstoff?
70 Schläft man bei Vollmond schlechter?
71 Warum werden die Haare grau?
72 Wie kommt es zur elektrostatischen Aufladung?
73 Warum gibt es mehr Rechtshänder?
74 Warum klingt die Stimme auf einer Aufnahme so anders?
75 Sollte man sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen lassen?
Was haben Tulpen mit der Finanzkrise zu tun?
76 Was haben Tulpen mit der Finanzkrise zu tun?
77 Wieso sollte man keiner Statistik trauen?
78 Was bewirken Vorurteile?
79 Sind Tiere wirklich so anders?
80 Wie sahen die Dinosaurier wirklich aus?
81 Warum übertreiben wir ständig?
82 In der Schule lernen wir fürs Leben – oder?
83 Dürfen wir unserer Erinnerung trauen?
84 Welche Rolle spielt der Zufall in der Wissenschaft?
85 Warum reden alle von heißer Luft?
Was ist der Preis für unsere Ungeduld?
86 Was ist der Preis für unsere Ungeduld?
87 Was tun wir gegen den Klimawandel?
88 Wie viel Energie verbrauchen unsere Computer?
89 Warum sind Feler manchmal gut?
90 Warum ist Perfektion manchmal hinderlich?
91 Leiden wir unter zunehmendem Realitätsverlust?
92 Warum lieben wir exotische Kulturen?
93 Wohin führt die digitale Durchsichtigkeit?
94 Wie wild ist die Natur?
95 Warum sind Computerspiele so gefährlich anziehend?
96 Warum sind Funklöcher so wohltuend?
97 Lässt sich unser Geschmackssinn täuschen?
98 Warum brauchen wir immer Ausreden?
99 Fragen ohne Antwort
Sonst noch Fragen?
Warum Frauen kalte Füße haben und andere Rätsel des Alltags
Meinem Vater, der mir die Lust am Fragen schenkte
Vorwort
»I was like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.«
Isaac Newton
Unsere Welt ist voller Wunder. Magnolienbäume wissen genau, wann sie ihre Blüten ins Frühjahr entlassen, und Stubenfliegen reinigen ihre durchsichtigen Flügel mit ihren Hinterbeinen. Katzen träumen tagsüber mit zuckenden Pfoten, doch niemand weiß, wovon. Winzige Einzeller fächern eifrig in ihrer stillen Mikrowelt und schweben wie Raumschiffe durch den Ozean eines Wassertropfens.
In der Geschäftigkeit unseres Alltags vergessen wir allzu leicht, in welch wunderbarer Welt wir leben, einer Welt voller großer und kleiner Rätsel und Geheimnisse.
Warum wandern die Tautropfen einer sonnigen Herbstwiese immer ans obere Ende des Grashalms? Warum kleben Spinnen nicht an ihrem Netz fest, so wie die Fliegen? Wo man auch hinschaut, überall verstecken sich Fragen, doch viele davon versprechen keine praktische Antwort. Kein Gewinn für den Alltag, keine Geschäftsidee, kein effektiver Nutzen!
Doch gerade diese scheinbar unpraktischen Fragen haben mich seit jeher fasziniert. Schon als Kind konnte ich stundenlang einem Regenwurm beim Essen zuschauen und vergaß dabei schon mal die Hausaufgaben. Es war ein Hochgenuss zu beobachten, wie Wolken in den Himmel wuchsen und dabei ihre Form veränderten. Manche erzählten Geschichten, und ihre Gesichter alterten, bis sie sich im Blau auflösten. Wenn ich meinen Kopf nur tief genug in eine Sommerwiese steckte, eröffnete sich mir ein weiteres Universum winziger Insekten, die sich ihren Weg durch eine Stadt aus Gräsern und Erdwurzeln bahnten. Alle waren ständig in Bewegung, doch woher wussten sie, wohin sie laufen sollten?
Immer wieder begegneten mir Fragen, die nutzlos erscheinen in einer Welt, die dem Wissen um die verschiedenen Gewindedurchmesser von Wasserleitungen oder der Einteilung in Steuerklassen mehr Bedeutung zuspricht als dem Phänomen tanzender Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte.
Später begriff ich, dass es wohl keine Aufteilung in »wichtige« und »unwichtige« Fragen gibt, denn jede einzelne Frage ist es wert, ernst genommen zu werden. Meine Lexika und Schulbücher strahlten hingegen eine überhebliche Sicherheit aus, denn sie erzählten nie von den vielen Zweifeln und Fehlversuchen, von den Unsicherheiten und Irrwegen, von falschen Hypothesen und Theorien, von den zahllosen historischen Umwegen, die den Pfad der Erkenntnis säumten. Die Formeln, Gesetze und Phänomene wurden uns in diesen Büchern als unumstößliche Wahrheiten vermittelt, als absolute Fakten, die es niemals zu hinterfragen galt. Der Satz des Pythagoras glich einem Glaubensbekenntnis und Generationen von Schülern unterwarfen sich voller Ehrfurcht einer schulischen Inquisition, die nur zwischen »richtig« und »falsch« unterschied. Für mathematische Rechnungen gab es nur einen einzigen Weg, wählte man einen anderen und erreichte womöglich schneller das Ziel, drohte die Exkommunizierung. Wir lernen nicht, wir büffeln, und selbst nach 20 Jahren Schulbank können die meisten von uns noch nicht einmal einfachste Fragen beantworten: »Wie groß muss ein Spiegel sein, damit man sich ganz darin sieht?« (Ich verrate es Ihnen in diesem Buch!)
Erkenntnis ist nie ein endgültiges Ergebnis, sondern allenfalls eine Zwischenbilanz auf einem langen und überraschenden Weg des Hinterfragens.
Fortschritt ist das Resultat von sehr viel »Spinnerei« und lebt von neugierigen Menschen, die sich trauen, eigene Wege zu gehen. Wahrscheinlich haben viele Mitmenschen Luigi Galvani seinerzeit für verrückt erklärt. Im 18. Jahrhundert studierte er die genaue Ursache zuckender Froschschenkel! Er hatte beobachtet, dass sie beim Berühren des Skalpells reagierten – obwohl die Frösche tot waren! Das Phänomen trat jedoch nur auf, wenn Kupfer und Eisen des Skalpells miteinander in Kontakt standen. Während andere Zeitgenossen sich den »wichtigen« Dingen des täglichen Lebens widmeten, experimentierte der italienische Biologe mit verschiedenen Metallen, Drähten, Skalpellen und Fröschen und bahnte sich einen Weg in den noch unbekannten Kontinent der Elektrizität. Heute wird er als ein Wegbereiter des Fortschritts gefeiert.
Der indische Physiker Sir C.V. Raman fuhr im Sommer 1921 per Schiff nach Europa. Wahrscheinlich hatte er viel Zeit und genoss die intensive Farbe des Ozeans, doch im Gegensatz zu den anderen Passagieren ließ ihm das tiefe Blau des Mittelmeers keine Ruhe. Als er in seine Heimatstadt Kalkutta zurückkehrte, studierte er das Phänomen und stieß eine weitere Tür der Erkenntnis auf im Verhalten von Lichtwellen. 1930 erhielt er den Nobelpreis für seine Arbeit an der Molekularen Streuung des Lichts.[1] Die Raman-Streuung bildet heute die Grundlage vieler moderner Diagnoseverfahren.
Zuckende Froschschenkel, die besondere Farbe des Meeres …
Auf scheinbar »unwichtige« Fragen gibt es manchmal überraschend »wichtige« Antworten, auch wenn es nicht immer die sind, die man suchte, doch das ahnt man zuvor nicht. Wie oft haben abstruse Fragestellungen, Fehlversuche und Zweifel am zementierten Wissen zu spektakulären Fortschritten geführt, wie oft haben Außenseiter unsere Welt verändert! Sie haben ehrlich gefragt und mit derselben Ehrlichkeit nach einer Antwort gesucht und sich dabei nicht vom Offensichtlichen täuschen lassen. Jeder ihrer Wege war geprägt von Unsicherheit und Einsamkeit, doch auch von dem wunderbaren Gefühl, sich der Natur und ihren Geheimnissen zu nähern.
Neugier beginnt mit einer Frage und kennt kein Ende. Die wahre Schönheit unserer Welt offenbart sich demjenigen, der bereit ist, den Weg selbst zu gehen, um selbst zu entdecken und zu staunen. Der Lohn sind dabei nicht Nobelpreise oder technische Geräte, sondern die Erkenntnis an sich. Es ist gar nicht so wichtig, ob man der Erste ist, der ein Phänomen entschlüsselt; entscheidend ist die Hingabe und die Erfüllung, die man dabei empfindet. Jeder von uns entdeckt diese Welt zum ersten Mal! Es gibt den ersten Sternenhimmel, das erste Gewitter, das erste Ballett der Fruchtfliegen und das erste Mal, wo einem die Haut auf der warmen Milch auffällt. Und jedes Phänomen beschenkt uns mit derselben Faszination: Der Glanz des Regenbogens hat sich in Jahrtausenden nicht abgenutzt und der aufgehende Mond verzaubert die Nacht so, als hätte es ihn nie zuvor gegeben. Wenn wir unsere Augen öffnen, werden wir in jeder Sekunde mit einer Einzigartigkeit beschenkt.
Dieses Buch ist bestenfalls ein kleiner Wegweiser in unsere aufregende und überraschende Welt. Wenn Sie links oder rechts davon etwas Spannendes aufspüren, dann verlassen Sie den Pfad und entdecken Sie selbst!
Danke
Dieses Buch war für mich eine besondere Herausforderung. Die einzelnen Kapitel sollten kurz und dennoch verständlich sein. Viele Themenbereiche sind jedoch so reichhaltig, dass die Versuchung für mich groß war, doch noch mehr ins Detail zu gehen, um der Schönheit des jeweiligen Sujets gerecht zu werden. Wo setzt man die Prioritäten, was lässt man bewusst weg, welche Metaphern und Modelle nutzt man zur Erklärung? Ich habe viel gelernt, denn im Rahmen der Fernsehsendungen »Quarks & Co«, der »Show der Naturwunder« und natürlich dem Kurzformat »Wissen vor 8« stand und stehe ich vor demselben Problem. Ich darf mich glücklich schätzen, dass aufmerksame Redakteure und Kollegen, aber auch engagierte Zuschauer mir immer wieder mit guten Ratschlägen und kritischen Einwänden bei der Kunst des »Verdichtens« geholfen haben. Ihnen möchte ich danken, für die intensive Zusammenarbeit und ihre vielen konstruktiven Vorschläge und Einfälle.
Vielen Dank daher an meine WDR-Kollegen von »Quarks & Co«, der WDR-mediagroup, dem SWR, an die Mitarbeiter von First Entertainement und Colonia Media. Besonderer Dank gebührt meiner Regisseurin Birgit Quastenberg, die meine Gedanken in einzigartiger Weise versteht und bereichert, sowie Marcus Anhäuser, der mich bei der Recherche einiger Themen unterstützte, und Tilmann Leopold, der mir in allen vertraglichen Fragen ein kompetenter und freundschaftlicher Ratgeber war.
Frank Schätzing half mir bei der Entscheidungsfindung für diesen herausragenden Verlag. Helge Malchow ermutigte mich in seiner herzlichen und offenen Art zu diesem Projekt. Auf einfühlsame Weise hat Martin Breitfeld vom Lektorat mich bei der Entstehung des Buches begleitet. Seine Anmerkungen und seine Unterstützung bei der Gesamtstruktur waren eine wertvolle Hilfe. Danke!
Viele Autoren fühlen sich einsam, doch ich habe das Glück einer großen und wunderbaren Familie. Von meinen Kindern lerne ich immer wieder, unsere Welt mit offenen und neugierigen Augen zu betrachten und auf unscheinbare und doch wichtige Details zu achten.
Beim Schreiben hat mich meine Frau Uschi auf intensive Weise unterstützt. Ihre Einwände waren von bestechender Klarheit und in unschlüssigen Momenten zeigten mir ihre Anregungen einen beschwingenden Ausweg.
Meiner Katze danke ich für die Momente der Ablenkung, in denen sie sich zwischen Tastatur und Bildschirm setzte, um meinen Blick auf andere Dinge zu lenken …
Hennef 2009
Warum haben Frauen kalte Füße?
Mit Sinn & Verstand: Wie unser Körper funktioniert
1Warum werden die Finger runzelig, wenn man lange badet?
»Papa, meine Finger haben ganz viele Wellen, ist das eine Krankheit?«, fragte unsere Tochter besorgt nach dem Baden. »Geht das wieder weg?«
Sicher, Sie lächeln jetzt, natürlich geht das wieder weg. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum nur Hände und Füße vom »Schrumpeln« betroffen sind und nicht etwa der Bauch? Was ist da anders? Unsere Haut ist eine perfekte Verpackung, die sich ständig erneuert. Etwa alle 27 Tage werden wir äußerlich runderneuert. Die äußere Schicht, die sogenannte Oberhaut, ist eine Art Schutzschild. Außen befinden sich mehrere Lagen abgestorbener Zellen, die verhornt und miteinander verklebt sind, ein wirksamer Schutz gegen mechanische und chemische Reize. Von unten wachsen ständig neue Zellen nach. Die Oberhaut ist normalerweise nur etwa 0,1 Millimeter dick, doch an stark beanspruchten Körperstellen, an Händen und Füßen, ist sie bis zu 5 Millimeter dick und nennt sich Hornhaut.
Im Vergleich zu den anderen Hautzellen besitzen die Hornzellen eine höhere Salzkonzentration, und diese Salze sind ausschlaggebend für das Schrumpeln der Haut. Sie ziehen Wasser in die Hornschicht hinein, wodurch die einzelnen Zellen aufquellen. Die Zellen brauchen mehr Platz und die Haut wellt auf. Da Hände und Füße mehr Hornhaut besitzen, werden vor allem diese schrumpelig. Außerdem sorgen Talgdrüsen, die es an Händen und Füßen nicht gibt, für einen fetthaltigen Schutzfilm der restlichen Hautpartien. Erst wenn wir längere Zeit im Wasser liegen, wird dieser Schutzmantel aus Fett durchlässig und das Wasser kann eindringen.
Die Ursache für das Schrumpeln der Haut ist also der Konzentrationsausgleich zwischen dem salzarmen Leitungswasser und den salzhaltigen, aber wasserarmen Hornzellen. Man nennt diesen Konzentrationsausgleich auch Osmose. (Das Phänomen begegnet Ihnen auch im Kapitel Wie konservieren Zucker und Salz?). Sie können einen einfachen Test machen: Nehmen Sie zwei Schalen, füllen Sie die eine mit normalem Leitungswasser, die andere mit Salzwasser. Und jetzt tauchen Sie etwa 20 Minuten Ihre Hände ein. Das salzarme Leitungswasser dringt in die Hornzellen, lässt sie aufquellen und die Hand wird runzelig. Im Salzwasser hingegen gibt es ein Gleichgewicht der Konzentrationen. Hier kommt es also nicht zur Osmose und die Haut bleibt glatt. Beim Baden im salzigen Meerwasser ist der Runzeleffekt aufgrund des Gleichgewichts des Salzgehaltes also geringer. Sie können stundenlang im Salzwasser des Toten Meers baden, ohne dass die Haut zu schrumpeln beginnt.
Nach dem normalen Baden trocknet die Hornhaut mit der Zeit wieder, das Wasser entweicht, die Haut zieht sich zusammen und die Runzeln verschwinden wieder. Diese Erklärung hat auch meine Tochter beruhigt. Meine Frau wunderte sich allerdings nach dem nächsten Planschvergnügen über den Salzstreuer im Badezimmer.
2Was sind Blutgruppen?
Die Vielfalt der Natur ist überwältigend. Kein Lebewesen gleicht dem anderen. Jeder von uns ist einzigartig, besitzt unterschiedliche Hände, eine charakteristische Nase, eine ganz besondere Augenfarbe, und auch das Blut unterscheidet uns. Obwohl unsere roten Blutkörperchen vom Grundaufbau her gleich sind, findet man entscheidende Unterschiede von Mensch zu Mensch: An der Oberfläche der Blutkörperchen gibt es eine charakteristische Vielfalt von Kohlenhydrat- und Eiweißstrukturen. Ihre Kombination macht den Unterschied aus. Blutgruppen sind ein Beispiel dafür, wie die Natur durch eine einfache Kombination von Grundbausteinen Vielfalt erzeugt. Man kann sich die Molekülstrukturen vereinfacht als runde, dreieckige und rechteckige Merkmale vorstellen.
Findet man an der Oberfläche die »runden Moleküle«, heißt die Gruppe A; sind die »dreieckigen« da, nennt man die Blutgruppe B; sind beide Varianten vorhanden, ergibt sich die Kombination AB. Manchmal taucht noch eine zusätzliche Kombinationsmöglichkeit auf, der Rhesusfaktor. Ist der Rhesusfaktor vorhanden, spricht man von Rhesus+, ist er nicht vorhanden, spricht man von Rhesus–. Wenn Ihr Blut also alle drei Bestandteile aufweist, zählen Sie zur Blutgruppe AB Rh+ oder AB+. Ist keines der Merkmale vorhanden, dann sind Sie weder A noch B, also 0, und auch der Rhesusfaktor ist nicht vorhanden, also 0–. Natürlich sind noch viele andere Kombinationen möglich: 0+, A–, A+, B–, B+ und AB–. Aus nur 3 Grundmerkmalen ergeben sich also insgesamt 8 verschiedene Blutgruppen.
All das ist wichtig, wenn Sie Fremdblut erhalten, denn Ihr Blut ist eigensinnig und akzeptiert nur Bekanntes, das Fremde wird abgestoßen. Wenn Sie zum Beispiel die Blutgruppe A+ besitzen, dann klappt es mit Spenderblut A–, denn Ihr Körper kennt A; der nicht vorhandene Rhesusfaktor kann nicht als fremd wahrgenommen werden. Umgekehrt allerdings würde eine Spende von A+ zu A– nicht funktionieren, da der Rhesusfaktor für A– unbekannt ist und als fremd abgelehnt wird.
Ebenso ist eine Spende von Blutgruppe A zu B oder umgekehrt nicht möglich, denn Ihr eigenes Blut weist diese Molekülkombination nicht auf, und somit wird eine Transfusion gefährlich. Ihr Blut akzeptiert also nur, was es kennt.
So ist es einleuchtend, dass 0– das ideale Spenderblut ist, denn es ist quasi »neutral«. Menschen mit 0– sind sogenannte Universalspender. Das ist gut für die anderen, doch Universalspender können nur eine einzige Blutgruppe empfangen, nämlich 0–. Besitzen Sie hingegen AB+, dann haben Sie Glück, denn Ihr Blut enthält alle drei Bestandteile: Sie können jede Blutkonserve empfangen, allerdings werden Sie als Spender nicht sonderlich gefragt sein, da Sie nur an AB+ spenden können.[2]
Je nach Region kann man sogar eine bevorzugte Häufigkeit von Blutgruppen beobachten: In Europa zum Beispiel zählt A zur häufigsten Blutgruppe, in Peru hingegen besitzt die Mehrzahl aller Menschen die Blutgruppe 0–. Diese Unterschiede haben sich im Laufe der Evolution herauskristallisiert. Blutgruppen gewähren uns auf diese Weise sogar einen Einblick in die Völkerwanderungen der Vergangenheit!
3Werden in Vollmondnächten mehr Kinder geboren?
Meine Frau hatte es mir verschwiegen, doch meine Tochter kann keine Geheimnisse für sich behalten: »Wir waren bei der Zauberfrau …« Bei Vollmond hatte sie ein rohes Stück Fleisch auf die kleine Warze meines Töchterchens gelegt. »Sie ist weg!«
In solchen Momenten fühle ich mich im Zugzwang, denn offen gesagt glaube ich nicht an diesen Hokuspokus! Das Verschwinden einer Warze kann viele Gründe haben und daher ist es schwer, die genaue Ursache dingfest zu machen. Es ist unglaublich, welche Macht der Mond ausüben soll: Bei Vollmond, so heißt es zum Beispiel, sollen die Geister besonders aktiv sein, Äpfel, die bei Vollmond geerntet werden, schmecken angeblich besser, und, so heißt es, bei Vollmond werden mehr Kinder geboren. Was Geister, Äpfel und Warzen betrifft – hier kann wohl allein der Glaube Berge versetzen, doch bei der Geburtenhäufigkeit kann man das Phänomen überprüfen: Hier hat die Wissenschaft eine Chance!
Gemeinsam mit Hebammen und Ärzten habe ich in der Neugeborenenstation unseres Krankenhauses einen Kalender aufgehängt. Immer dann, wenn ein Kind geboren wurde, gab es einen bunten Punkt. Blaue Punkte standen für Jungen, rote Punkte für Mädchen. Nach einem Jahr war es Zeit für eine Bilanz: Sollte der Mond tatsächlich einen Einfluss haben, musste man das an einer besonderen Häufung der Punkte erkennen können. Die Vollmondtage waren auf dem Kalender besonders gekennzeichnet. Den Hebammen, den Ärzten und auch mir wurde beim Nachzählen sehr schnell deutlich: Es gibt keine nennenswerten Auffälligkeiten bei Vollmond. Es werden weder mehr Kinder als sonst geboren, noch gibt es mehr Jungen oder mehr Mädchen, die in diesen Nächten zur Welt kommen.
Dies war übrigens nicht der einzige Versuch. Weltweit gibt es immerhin über 100 Untersuchungen zu diesem Thema! Österreichische Forscher der Universität Wien haben zum Beispiel alle gemeldeten Geburten in Österreich zwischen 1970 und 1999 in einer großen Studie zusammengefasst. Sie schauten sich 371 Mondzyklen an. Und auch ihr klares Ergebnis lautet: Es gibt keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den Mondphasen und der Geburtenhäufigkeit.
Wissenschaftlich gesehen gibt es also eine eindeutige Antwort: Bei Vollmond werden nicht mehr Kinder geboren.
Dennoch hält sich der Aberglaube. Es ist absurd wie viel in unserer angeblich so aufgeklärten Industriegesellschaft gependelt und gedeutet wird. Trotz aller Technik vertrauen viele Menschen auf die Kräfte von magischen Kristallen, legen Karten oder lassen sich von Wunderheilern behandeln. Gerade dann, wenn ein Phänomen oder eine Krankheit von vielen Ursachen beeinflusst wird, lässt sich kein einfacher Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung herstellen. Und genau hier entfaltet der Hokuspokus seine Angebote. Nur weil es einem nach dem »Besuch« bei ihr besser geht, beweist das noch lange nicht die heilende Kraft der Zauberfrau. Und doch bringen wir gerne unbewusst Dinge in einen Zusammenhang, die oft absolut nichts miteinander zu tun haben. Wenn es klappt, glauben wir prompt daran. »Siehst du, es hilft doch …!« Leider lässt sich auch selten der klare Gegenbeweis erbringen, denn auch hier erlaubt die Vielzahl der Einflüsse keine einfache Überprüfbarkeit. Das Beispiel der Geburten bei Vollmond ist daher eine willkommene Ausnahme. Es ist einfach und leicht überprüfbar. Es gibt keinen Zusammenhang! Die Warze meiner Tochter hingegen wurde von der Zauberfrau geheilt … Eines aber weiß ich genau: Meine Tochter wurde nicht bei Vollmond geboren!
4Warumsehe ich unter Wasser?
Wahrscheinlich haben Sie es in der Badewanne oder im Schwimmbad schon ausprobiert: Wenn man ins Wasser abtaucht und die Augen öffnet, dann sieht man alles unscharf. Warum ist das so?
Unser Auge ist ein Linsensystem, das für das Außenmedium Luft optimiert ist. Die Lichtstrahlen werden beim Übergang von der Luft in das Auge gebrochen und das Abbild der Wirklichkeit landet dann genau auf unserer Netzhaut – wir sehen scharf.
Wenn nun Wasser das Auge umspült, verändert sich die Lichtbrechung. Das kann man mit einer Lupe einfach demonstrieren:
In der Luft vergrößert sie die Buchstaben, doch wenn ich die Lupe unter Wasser tauche, verschwindet die Vergrößerungswirkung. Entscheidend für die Lichtbrechung ist nämlich immer der Übergang zwischen zwei Medien: Bei der Lupe ist das der Übergang zwischen Luft und Glas. Dann vergrößert sie. Beim Übergang von Wasser zu Glas nicht.
Bei unseren Augen passiert etwas Ähnliches: Beim normalen Übergang zwischen der Luft und der gekrümmten Hornhaut werden die Lichtstrahlen korrekt gebrochen – wir sehen scharf. Unter Wasser hingegen erfahren die Lichtstrahlen den Übergang von Wasser zur Hornhaut. Doch da der optische Unterschied zwischen Wasser und Hornhaut sehr gering ist, fällt die Lichtbrechung weit schwächer aus. Die Folge: Das scharfe Abbild der Wirklichkeit wird nun nicht mehr auf die Netzhaut projiziert, sondern landet dahinter: Unter Wasser sind wir daher weitsichtig und sehen unscharf.
Dennoch können auch wir unter Wasser scharf sehen – mit der Taucherbrille. Dann ist nicht mehr Wasser, sondern Luft vor unseren Augen und die Lichtbrechung stimmt wieder.
Fische sehen auch unter Wasser scharf – und bei ihnen funktioniert das ohne Tauchermaske. Ihre Hornhaut ist nämlich nicht wie unsere stark gekrümmt, sondern flacher. Die entscheidende Lichtbrechung geschieht in den Fischaugen durch eine kugelförmige Linse.
Unsere Augen sind optimal auf unseren Lebensraum angepasst: Ein Mensch unter Wasser ist weitsichtig und der Fisch an der Luft ziemlich kurzsichtig!
5Mögen Stechmücken Käsefüße?
»Wenn der Abend kam und der Straßenverkehr beklemmend wurde, erhob sich aus den Sümpfen eine Gewitterwolke blutgieriger Mosquitos, und ein zarter Dunst von Menschenscheiße, lau und trist, wühlte im Seelengrund die Todesgewißheit auf …«
Gabriel García Márquez
Sie können einem den lauen Sommerabend verleiden. Seit 170 Millionen Jahren plagen sie ihre Opfer und übertragen in tropischen Ländern gefährliche Krankheiten: Stechmücken. Doch streng genommen stechen nur die Weibchen. Stechmücken sind nämlich Vegetarier und ernähren sich von Nektar und Fruchtsäften. Doch nach der Befruchtung durch die Männchen benötigen die Weibchen bestimmte Eiweißstoffe, um ihre Eier zu bilden, und die finden sie im Blut ihrer Opfer. Die Blutmahlzeit ist also unverzichtbar für die Fortpflanzung dieser Insekten.
Um an den Leben spendenden Saft zu kommen, treibt die Mücke ihren Stechrüssel in die Haut. Er ist so fein, dass wir oft kaum Notiz davon nehmen würden, wäre da nicht anschließend das Jucken an der Einstichstelle. Um zu verhindern, dass das Blut gerinnt, spritzt die Mücke nämlich bestimmte Eiweißstoffe in die Saugstelle, und diese gerinnungshemmenden Proteine verursachen anschließend den nervigen Juckreiz und können sogar Allergien auslösen.
Seit Jahren untersuchen Wissenschaftler, wie die sechsbeinigen Winzlinge ihre Opfer ausfindig machen. Die Körperwärme spielt eine Rolle, und auch das ausgeatmete Kohlendioxid scheint sie anzuziehen, doch in Sachen Geruchsortung stehen manche Stechmücken auf Unerwartetes: getragene Socken! Unser Fußschweiß enthält nämlich einen Cocktail an Substanzen, zu denen zum Beispiel Buttersäure gehört. Was für uns Menschen stinkt, ist für die Mücke offensichtlich ein anziehender Duftstoff!
Ich hatte Gelegenheit, es selbst am Internationalen Insekten-Forschungsinstitut (ICIPE) in Kenia zu testen. In einem speziellen Zelt wurden zwei Mückenfallen aufgebaut: In eine der beiden Fallen legten wir meine getragene Socke, in die andere zur Kontrolle eine frisch gewaschene, ungetragene Socke. 200 Mücken hatten danach eine Nacht lang die Wahl zwischen meiner getragenen und der ungetragenen Socke. Am nächsten Tag wurde nachgezählt. Das Ergebnis: Bei der sauberen Socke waren nur 2 und bei der getragenen Socke 80 Mücken in die Falle getappt! Ein klarer Beweis: Getragene Socken ziehen Mücken an. Die kenianischen Wissenschaftler arbeiten an neuartigen Mückenfallen und hoffen so, die Übertragung der gefährlichen Malaria-Krankheit einzudämmen. In Ländern wie Kenia könnten auf diese Weise, ohne den Einsatz chemischer Insektengifte, viele Menschenleben gerettet werden.
Vielleicht können auch wir von diesem Wissen profitieren. Locken Sie die Plagegeister doch auf eine falsche Fährte: Socken ausziehen und vor die Schlafzimmertür hängen. Weibliche Stechmücken stehen darauf!
6Wie entsteht Muskelkater?
Man bewegt sich, treibt Sport, tut etwas für seine Gesundheit und prompt wird man abgestraft – mit Muskelkater! Wie kommt es dazu? Jahrelang hat man geglaubt, das Phänomen habe mit der Übersäuerung der Muskeln zu tun: Durch übermäßige, ungewohnte Anstrengung entstehe zu viel Milchsäure im Muskel, diese könne nicht so rasch abgebaut werden und führe zu dem bekannten Phänomen: Muskelkater.
Doch in den vergangenen Jahren lieferte uns die Wissenschaft eine ganz andere Erklärung: Muskeln entfalten ihre Kraft dadurch, dass sie sich zusammenziehen. Die Muskelkraft ergibt sich aus der Summe unzähliger mikroskopischer Kontraktionen.
Die kleinsten Einheiten im Muskel sind die Sarkomere. Aus ihnen sind die einzelnen Muskelfasern aufgebaut. Die Sarkomere gleichen einem Federsystem aus zwei Teilen: Die sogenannten Myosinmoleküle greifen wie kleine Widerhaken in die Aktinfäden und ziehen sie aufeinander zu. Dadurch schieben sich die Myosin- und Aktin-Proteine ineinander wie Teile einer Teleskopantenne.
Das einzelne Sarkomer verkürzt sich dabei nur um weniger als ein Tausendstel Millimeter. Obwohl diese Längenänderung minimal ist, summieren sich die Kontraktionen der Abertausenden Sarkomere, aus denen jede einzelne Muskelfaser besteht. In der Summe macht sich das bemerkbar, der Muskel zieht sich zusammen und so können wir unsere Beine bewegen oder ein Gewicht heben.
Beim Muskelkater hat man nun etwas Interessantes beobachtet. Unter extremer Vergrößerung erkennt man Risse in den kleinsten Muskeleinheiten: Die Sarkomere wurden beschädigt. Muskelkater ist demnach eine Mikroverletzung im Muskel. Die Schäden, so vermutet man, entstehen, weil diese kleinsten Einheiten stärker gedehnt werden, als der Trainingszustand des Muskels es zulässt. Die Muskelfasern werden überdehnt und dabei geschädigt. Und das tut weh!
Kann man Muskelkater verhindern, zum Beispiel durch Dehnübungen vor dem Sport? Die Übersichtsstudien sagen zumeist: nein. Man kann ihn nicht verhindern. Und danach? Wegtrainieren oder »Drübertrainieren«? Ganz schlecht, denn dann heilen die kleinen Verletzungen noch langsamer. Massage im Nachhinein? Macht’s auch schlimmer.
Es ist frustrierend, doch Muskelkater muss man eben aushalten. Einen Trost gibt es: Am Ende entstehen mehr Fasern und man wird kräftiger! Wie heißt es doch so schön in den Sportstudios: »no pain, no gain« – Kein Schmerz, kein Gewinn!
7Warum klingt eine Stimme hoch, eine andere tief?
Als Kind dachte ich immer, je größer ein Mensch ist, desto tiefer klingt seine Stimme. Doch so ganz konnte das nicht stimmen, denn als ich das erste Mal die Oper besuchte, bemerkte ich: Der Bass klang tief, der Tenor hoch, doch beide Männer waren gleich groß! Warum aber klang eine Stimme hoch und eine andere tief?
Selbst die schönste gesungene Mozart-Arie ist physikalisch betrachtet nichts anderes als schwingende Luft! Diese Schwingungen entstehen an den Stimmlippen, die den Luftstrom aus der Lunge in kleine Luftscheiben mit mehr und weniger Druck zerhacken. Die zerhackte Luft nehmen wir als Schallwelle wahr.
Zunächst sind die Stimmlippen über der Luftröhre geschlossen. Mithilfe des Zwerchfells wird in unserer Lunge Druck aufgebaut, der irgendwann stark genug ist, dass Luft durch die Stimmlippen strömen kann. Die hinausströmende Luft erzeugt in der entstehenden Lücke jedoch einen Unterdruck, und so verschließen sich die elastischen Stimmlippen wieder von selbst. Wenn sich genug Druck in der Lunge aufgebaut hat, gehen sie erneut auf und die nächste Luftwelle tritt aus. Dieses Hin und Her geschieht mehrere Hundert Mal pro Sekunde und so entstehen regelmäßige Druckschwankungen, die wir als Töne wahrnehmen. Durch das Spannen der Stimmlippen erfolgt das Auf und Zu schneller, der Ton klingt höher. Schwingen die Stimmlippen hingegen langsamer hin und her, klingt unsere Stimme tiefer.
Jeder Mensch besitzt seine natürliche Tonlage: Der Unterschied zwischen Tenor und Bass liegt dabei in der jeweiligen Dicke der Stimmlippen: Je dicker sie sind, desto langsamer können sie hin und her schwingen und desto tiefer klingt die Stimme. Bei Erkältungen schwellen unsere Stimmlippen ebenfalls an, werden dicker und jeder hört dann an der tiefen Stimme, dass wir krank sind. Die Stimmlage hängt also nicht von der Körpergröße ab, sondern ganz direkt von der Dicke unserer Stimmlippen.
8Warum setzt der Verstand bei Sonderangeboten aus?
Einkaufen ist für mich purer Stress. Überall werden wir zum Kaufen verführt: »Jetzt zugreifen!«, »Sonderangebot«, »Reduziert« oder »Rabatt« – was meinen Sie: Lassen wir uns davon beeinflussen oder behalten wir im Dschungel der Angebote einen kühlen Kopf?
Gemeinsam mit meinen Kollegen von »Quarks & Co« habe ich etwas Interessantes ausprobiert: Inmitten einer Fußgängerzone bauten wir einen Verkaufsstand auf. Auf dem Tisch gab es diverse Putzutensilien zu erwerben. Unterstützt wurden wir von einem professionellen Verkäufer: Zunächst ging er auf die Menschen ein, verwickelte die potenziellen Kunden in ein Gespräch und dann gab es folgende Wahl: Entweder die Produkte einzeln für jeweils 0,59 € oder aber alle zusammen im Dreierpack für 1,99 €. Bei unseren Käufern machten wir eine interessante Beobachtung: Viele entschieden sich für das Angebot im Dreierset – obwohl es tatsächlich teurer war! Die Teile einzeln gekauft ergaben einen Kaufpreis von nur 1,77 €. Das Dreierset war also 22 Cent teurer.
Natürlich haben wir im Nachhinein alle Kunden darauf hingewiesen. Doch warum fallen so viele von uns auf solche »Rabattkäufe« herein? Bonner Wissenschaftler haben sogar mit einem Kernspintomographen untersucht, wie Testpersonen auf Rabattschilder reagieren: Den Probanden wurden per Videobrille unterschiedliche Produkte gezeigt. Neben dem Preis gab es bei einigen Bildern auch den Hinweis »Rabatt«. Und überraschenderweise stellten die Forscher fest, dass beim Betrachten von Produkten mit Rabatthinweis ein Teil des Belohnungssystems, das sogenannte Striatum, besonders aktiv ist, wohingegen andere Areale, die Teil des Kontroll- und Verstandzentrums sind, eine reduzierte Aktivität aufweisen.
Das Zauberwort »Rabatt« scheint also unbewusst unsere Gehirnaktivität zu beeinflussen. Die Vorstellung, ein Schnäppchen zu ergattern, ist für unser Belohnungssystem wohl so attraktiv, dass wir sogar vergessen nachzurechnen. Der Effekt wird noch verstärkt, wenn uns eine künstliche Verknappung der Ware durch Schilder wie »Nur heute« oder »So lange Vorrat reicht!« vermittelt wird. Wenn an den Schnäppchenjäger in uns appelliert wird, setzt der Verstand aus!
9Was bedeutet »Blutdruck 120:80«?
Kontrolle des Blutdrucks. Mit ernster Miene wird gepumpt und gehorcht, und dann entspannt sich das Gesicht des Arztes: »120 zu 80, alles in Ordnung«. Doch was bedeuten diese beiden Zahlen?
Durch das Messen des Blutdrucks kann sich der Arzt ein Bild vom Zustand unseres Gefäßsystems machen. Unser Körper ist durchzogen von einem verästelten Netzwerk von Arterien und Venen, in denen das Blut transportiert wird. Als Pumpe fungiert das Herz. Der Gefäßdruck im Körper ist wichtig, denn fällt zum Beispiel der Druck in den Arterien ab, kann das Blut unser Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen; wir verlieren die Besinnung. Wenn Gefäße altern, werden sie spröde und verlieren an Elastizität. Es ist vergleichbar mit einem neuen und einem alten Wasserschlauch. Wenn man den neuen Schlauch zusammendrückt, gibt der elastische Schlauch nach und kann den Wasserdruck abfangen. Beim alten Schlauch hingegen passiert das nicht und der Wasserdruck im Schlauch steigt deutlich an.
Bei der Messung des Blutdrucks legt der Arzt eine Druckmanschette um den Oberarm und pumpt sie auf. Dabei wird die Arterie so weit zugeschnürt, bis das Blut darin nicht mehr weiterfließen kann. Stellen Sie sich vor, Sie drücken einen Wasserschlauch zu, bis kein Wasser mehr fließt. Beim Blutdruckmessen kann der Arzt das hören: Denn im Stethoskop, welches er etwas weiter unten positioniert, hört das Pochen auf. Dann beginnt der Arzt langsam, den Druck in der Manschette zu senken und wartet, bis das Pochen wieder anfängt. Stellen Sie sich vor, Sie fassen den Schlauch ein bisschen lockerer. Das Wasser beginnt langsam wieder zu fließen. Beim Blut ist das genau der Moment, in dem der Kreislauf mit seinem Druck den Gegendruck der Manschette überwinden kann. Dieser systolische arterielle Druck, wie er auch genannt wird, ist der Maximaldruck, den das Herz im Moment der Kontraktion aufbauen kann. An der Anzeige kann man den Druck ablesen: In unserem Beispiel 120. Dann wird weiter Luft abgelassen. Noch immer presst die Manschette gegen die Arterie und stört den Blutfluss. Sie öffnen den Schlauch weiter, das Wasser spritzt ungleichmäßig, und auch beim Blut in unserer Arterie kommt es zu kleinen Verwirbelungen, die sich durch ein typisches Zischgeräusch im Stethoskop verraten. Irgendwann ist jedoch der Ruhedruck in den Arterien ausreichend, um den Manschettendruck völlig zu kompensieren. Das Blut kann dann ungehindert fließen und das Zischgeräusch verschwindet. Erneut wird der Druck notiert, die zweite Zahl, oft diastolischer Druck genannt: zum Beispiel 80.
Es handelt sich bei den Zahlen »120 zu 80« also um Druckangaben. Da die Messmethode über 100 Jahre alt ist, verwendet man in der Medizin immer noch die traditionelle Druckeinheit mm Quecksilbersäule.
In jungen Jahren sind unsere Gefäße noch elastisch und dehnbar; dadurch kann sich im Adernsystem kein so hoher Druck aufbauen, doch je älter wir werden, desto fester und spröder werden unsere Arterien und desto höher ist der Blutdruck. Das Herz muss dann stärker arbeiten und das ist auf Dauer ungesund. Patienten mit zu hohem Blutdruck bekommen daher blutdrucksenkende Medikamente. Der Blutdruck schwankt jedoch auch im Laufe eines Tages, je nachdem, welche Aktivität gerade ausgeübt wird. Bei körperlicher Anstrengung, Stress und Aufregung steigt er an, in körperlichen und seelischen Ruhephasen sinkt er ab.
Als optimal gilt ein Blutdruck von 120:80, ab einem Wert von 140:90, sollte man seinen Blutdruck regelmäßig prüfen lassen. Dann wird wieder gepumpt und gehorcht, mit ernster Miene verkündet …
10Warum vertragen manche Menschen keine Milch?
In der Anfangsphase unseres Lebens werden wir gestillt und ernähren uns exklusiv von Muttermilch. Schließlich enthält sie alles, was wir zum Wachsen und Gedeihen benötigen.
Im Laufe der Entwicklung haben wir Menschen es verstanden, Tiere zu domestizieren und ihre Milch zu trinken. Streng genommen betreiben wir Menschen Mundraub an unzähligen Kälbchen, Zicklein und Lämmchen. Die Milch ist ihre Babynahrung! Doch ganz ungestraft kommen wir nicht davon. Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen und Durchfall sind häufig die Folge.
Bei den meisten Säugetieren geht die Fähigkeit, Milchzucker zu verdauen, nach dem Abstillen verloren. Das ist verständlich, denn Milch gibt es bei Tieren nur im Säuglingsalter von der Mutter. Auch jeder Mensch verträgt Milchzucker, solange er gestillt wird. In dieser Phase produziert der Körper das Enzym Laktase. Es ist eine Art chemische Schere, die den schwer verdaulichen Milchzucker in seine zwei leicht verdaulichen Zuckerteile, Glukose (Traubenzucker) und Galaktose (Schleimzucker) zerlegt.
Weltweit leidet die Mehrheit der Menschen unter einer Milchunverträglichkeit. In Deutschland geht es nur einer Minderheit so – etwa jedem Sechsten –, an anderen Orten der Welt ist dies jedoch der Normalfall. Wer zum Beispiel in China ein Glas Milch trinkt, ist ein Exot, denn 99 % der Chinesen vertragen keine Milch. Auch in Afrika gibt es Regionen, in denen praktisch niemand Milch verträgt, aber auch vereinzelt Gegenden, in denen davon nur jeder Zehnte betroffen ist.
In Europa gibt es bei diesem Phänomen ein Nord-Süd-Gefälle: In Schweden und Dänemark bekommen weniger als 10 % der Bevölkerung Probleme mit Milch, in Frankreich und Spanien sind es etwa 50 %, in Sizilien sogar 70 %.
Die Fähigkeit, auch im Erwachsenenalter Milchzucker aufzuspalten, hat sich in der Evolution erst vor etwa 7.000 Jahren entwickelt, also sehr spät. In dieser Zeit begannen unsere Vorfahren Rinder, Ziegen und Schafe zu halten. Milch und Milchprodukte wurden allmählich zu einem Nahrungsmittel erwachsener Menschen. Das war neu und unser Körper musste sich umstellen. In genetischen Analysen können Wissenschaftler diese immer noch andauernde Entwicklung und Ausbreitung nachvollziehen.
Wer weiß, vielleicht ist die Milchunverträglichkeit ja auch nur ein weiterer Trick der Natur, um die Säuglinge vor dem Mundraub zu schützen? Theoretisch besteht nämlich die Gefahr, dass erwachsene Tiere den Babys die Milch rauben. Eine abstruse Vorstellung: Väter trinken die Mütter leer und für den Nachwuchs bleibt nichts übrig! Die Natur hat jedoch hier vorgesorgt, mit dem wohl raffiniertesten Schloss, das ich kenne: Aufgrund des kleinen Mundraums und des ohnehin ausgeprägten Saugreflexes schaffen die Kleinen es, einen weit höheren Saugdruck zu erzeugen als die Großen. Obwohl sie viel kleiner und schwächer sind: Saugen können sie besser.
Ist es nicht erstaunlich: An einem Glas Milch erkennt man, dass die Evolution der Menschheit immer noch in vollem Gange ist!
11Was ist »gefühlte Temperatur«?
Vielleicht ist Ihnen der folgende Unterschied auch schon einmal aufgefallen: Wenn Sie bei einer Temperatur von 30 °C im Schatten in der Sonne liegen oder bei einer Wassertemperatur von 30 °C im Hallenbad schwimmen, kommen Ihnen die 30 °C in der Sonne viel wärmer vor als die im Wasser: Warum ist das so? Sind 30 °C nicht immer gleich?
In der Tat gibt es in dieser Hinsicht große Unterschiede zwischen Luft und Wasser. Wasser leitet die Wärme etwa 20-mal schneller ab als Luft. Wenn wir im Wasser liegen, wird unser Körper ständig umspült. Unsere Körpertemperatur beträgt normalerweise 37 °C, doch das Wasser ist mit 30 °C deutlich kälter. Wir geben zum Ausgleich ständig Wärme an das Wasser ab und beginnen mit der Zeit zu unterkühlen. Kleine Kinder erkälten sich leicht, wenn sie stundenlang im warmen Pool planschen, denn sie verlieren zu viel Wärme.
Taucher ziehen daher selbst in warmen Gewässern einen Neoprenanzug an. Der ist zwar nicht wasserdicht, doch der Anzug hält das vom Körper angewärmte Wasser fest, der Wärmeaustausch ist geringer – man bleibt länger warm.
An der Luft sieht das ganz anders aus. Luft ist ein hervorragender Isolator und leitet die Wärme sehr schlecht. Die Lufttemperatur ist nur ein Faktor bei dem, was man »gefühlte Temperatur« nennt. Der Wind und auch die Luftfeuchtigkeit spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Bei Windstille baut sich unmittelbar über unserer Haut ein Polster aus warmer Luft auf. Wir tragen also ein unsichtbares Luftkleid und fühlen uns wohlig warm. Das ist auch der Grund, warum Vögel sich aufplustern und Daunenjacken besonders warm halten, denn je mehr stehende Luft zwischen uns und der Außenwelt ist, desto geringer ist der Wärmeverlust. Durch das Gefieder oder den Pelz wird die warme Luft auch bei Wind festgehalten. Weht der Wind, dann wird das schützende Luftpolster um uns ständig zerstört. Immer wieder kommt unsere Haut mit neuer, kühler Luft in Berührung, und die führt immer wieder Wärme ab. Das ist der Grund, warum wir uns selbst bei warmem Wetter erkälten, wenn wir im Durchzug sitzen.
Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst ebenfalls die gefühlte Temperatur. Minus 10 °C in trockener Luft bei Windstille sind erträglicher als plus 5 °C bei windigem Regen.
Im Gegensatz dazu wird Hitze bei hoher Luftfeuchtigkeit noch unerträglicher. Jeder Saunabesucher weiß, wie brennend heiß die Luft nach einem Aufguss werden kann. Besonders unerträglich empfand ich die feucht-heißen Monsunmonate während meiner Kindheit in Indien. Die Luftfeuchtigkeit ist dann so hoch, dass auch das Kühlsystem unseres Körpers versagt: Der Schweiß verdunstet nicht mehr und erzeugt dadurch keine lindernde Kälte. Selbst nachts fällt das Thermometer nie unter 30 °C. Das gesamte Leben verfällt während dieser Zeit in eine Lethargie, und auch die Stubenfliegen fliegen wie in Zeitlupe. Hitze ist schlimmer zu ertragen als Kälte: Während der Kolonialzeit zog sogar die gesamte Regierung Britisch-Indiens in den Sommermonaten aus dem schwülen Kalkutta und Delhi in das kühle Shimla am Fuße des Himalajas. Gefühlt und gemessen ist eben doch ein Unterschied!
12Warumkribbelt es manchmal in Händen und Füßen?
Ein komisches Gefühl: Sie sitzen länger, stehen auf und nach einem ersten Taubheitsgefühl kribbelt es fürchterlich in den Füßen. »Meine Füße sind eingeschlafen«, lautet dann die Diagnose.
Etwas Ähnliches geschieht, wenn wir unbequem sitzen und die Beine kaum bewegen können, oder nachts, wenn der Arm unter dem Kissen verschränkt war und man von einem furchtbaren Kribbeln geweckt wird: Arm oder Hand sind dann wie taub. Was ist passiert?
Unser Körper ist von einem langen Netz von Nerven durchzogen und diese geben ständig Informationen aus den verschiedenen Körperregionen an das Gehirn weiter. Unser Körpergefühl ergibt sich aus der Summe dieser Nervenimpulse. Durch eine falsche Körperhaltung kann es geschehen, dass die Nervenbahnen gequetscht und so beeinträchtigt werden, dass sie die Signale nicht mehr weiterleiten können. Den Signalfluss innerhalb der Nerven kann man sich als eine Kaskade aus elektro-chemischen Reaktionen vorstellen. Wenn dieses stetig und koordiniert passiert, erhält das Gehirn einen gleichmäßigen Fluss von Signalen, der unser Gefühl für Arme und Beine entstehen lässt. Wird dieser Signalfluss zum Gehirn unterbrochen, weil die Reizweiterleitung durch die betroffenen Nerven unterdrückt wird, haben wir zunächst Probleme, das betroffene Bein oder den betroffenen Arm zu bewegen. Wir fühlen nichts.
Die Nervenimpulse, die üblicherweise sowohl sensorische Informationen der Nervenenden des Körpers zum Gehirn weitergeben als auch Befehle des Gehirns an die verschiedenen Körperteile übermitteln, sind dann gestört. Die betroffenen Körperteile kommen uns wie Fremdkörper vor. In einigen Fällen wird diese Störung auch noch durch eine abgeklemmte Blutversorgung verstärkt. Auf Dauer kann das sogar zu Schäden führen, doch der Körper reagiert und gibt uns das Signal: »Bitte Position ändern!«
Wenn wir uns dann bewegen, lösen wir den Druck. Das Blut fließt erneut und auch die Signalkette der Nerven kommt wieder in Gang. Doch zu Beginn läuft sie noch ungeordnet ab und es braucht etwas Zeit, bis sich die Nerven erholen und die Signale wieder wie gewohnt weiterleiten. In dieser Regenerierungsphase empfängt unser Gehirn ein nervöses Rauschen, und das spüren wir als Kribbeln und Stechen. Oft folgt auch noch eine Art Brennen.
Es gibt eine Vielzahl von Nervenbahnen in unserem Körper. Dabei werden die Informationen für »Gefühl« oder für »Bewegung« über unterschiedlich dicke Nervenfasern übertragen. Diese wachen auch nacheinander wieder auf. Daher können wir zum Beispiel schon wieder unsere Füße bewegen, obwohl sie sich noch taub anfühlen.
Das Kribbeln in den Beinen und Händen ist also streng genommen ein Kribbeln im Kopf. Und dann gibt es noch das Kribbeln im Bauch, aber das ist eine andere Geschichte …
13Warum bekommt man Gänsehaut?
Kennen Sie das noch: Der Lehrer schreibt etwas an die Tafel, die Kreide rutscht ab und es quietscht entsetzlich. Viele haben von dem Geräusch wahrscheinlich Gänsehaut bekommen. Auch ein Musikstück kann sie bewirken, ebenso wie der Anblick einer Spinne oder das Ende eines spannenden Films: Gänsehaut kann man nicht bewusst steuern. Wovon hängt es ab, wenn sie uns überkommt? Neben Erregung und Angst ruft vor allem auch Kälte dieses Phänomen hervor. Dabei kommt es zu einem leichten Anschwellen der oberen Haut, die unzählige Erhebungen ausbildet. Durch diese Unebenheiten vergrößert sich die Oberfläche unserer Haut, und wenn man bei Aufregung oder Stress schwitzt, läuft es einem »kalt den Rücken herunter«. Wenn man die Haut näher betrachtet, kann man erkennen, dass sich bei der Gänsehaut feine Härchen aufrichten. Das ist die Folge der sogenannten Haarbalgmuskeln, die in der Haut sitzen, sich zusammenziehen und dann die Haare aufrichten. Bei den pelzigen Vierbeinern schützt das Aufrichten der Pelzhaare vor Kälte, denn hierdurch wird das eingeschlossene Luftpolster dicker und verbessert die Isolationswirkung. Obwohl der dichte Pelz unserer Vorfahren sich im Laufe der Evolution zu einer dünnen Behaarung veränderte, blieb dieser Reflex offensichtlich erhalten. Statt eines dicken, wärmenden Fells bleibt uns nur noch die nackte Gänsehaut. Dass wir also Gänsehaut bekommen, wenn uns kalt ist, scheint eine nackte Tatsache zu sein.
Warum aber auch Gefühle bei einigen Menschen Gänsehaut bewirken, ist bis heute wissenschaftlich nicht vollständig geklärt. Offensichtlich spielen genetische Faktoren eine Rolle, denn nicht jedem läuft es kalt den Rücken herunter, wenn jemand mit der Kreide an der Tafel abrutscht.
14Was passiert beim Niesen?
Es gibt diese besonderen – oft ungünstigen – Momente im Leben, in denen … Haaatschhhhiii … man niesen muss. Wie kommt es dazu?
Die plausible Erklärung lautet: Wir reinigen die Nase und befreien sie von Staub oder anderen Fremdkörpern. Beim Niesen führt ein Reiz in der Nasenschleimhaut zu einem reflexartigen Ausstoß von Luft durch Nase und Mund. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass es im verlängerten Rückenmark sogar ein Nieszentrum gibt, in dem unter anderem die Signale aus der Nasenschleimhaut, aber auch aus dem Großhirn zusammengeführt und verarbeitet werden. Die verschiedenen Nervensignale beeinflussen sich sogar gegenseitig, und so machen wir dabei automatisch die Augen zu. Doch noch bevor man »Gesundheit« oder »God bless you« hört, heißt es »Hand vor den Mund«, und das hat Gründe:
Im Rahmen einer Sendung haben wir den Prozess des Niesens mit einer Superzeitlupenkamera aufgenommen. Die Produktion war eine Qual, denn mein Kollege musste auf Kommando richtig niesen. Mit Staub und Pfeffer gelang es nach mehreren Anläufen. Von den Bildern waren wir alle überrascht:
Man sieht eine Explosion winziger Tröpfchen, die in den Raum geschleudert werden. Beim Niesen bauen wir zunächst einen Druck auf (das ist die Haaaa-Phase!), der sich dann entlädt (…tschiii): Die ausgestoßene Luft ist dabei bis zu 160 km/h schnell! Die Weitenmessungen ergaben, dass selbst größere Tröpfchen drei Meter weit geschleudert werden. Bei Erkältungen muss man öfter niesen und kann auf diesem Wege dann bequem alle Umstehenden anstecken. »Hand vor den Mund!« – das hilft, doch jetzt kleben die Viren an der Handinnenfläche und werden so fein über all das verteilt, was wir anfassen, von der Türklinke über Telefon und Tastatur bis zu – »Guten Tag, Frau Schulz«.
Die klare Botschaft lautet daher: Wer niest, sollte sich anschließend die Hände waschen.
Man muss übrigens nicht unbedingt krank sein, wenn man niest. Etwa jeder Vierte von uns muss unwillkürlich niesen, wenn er in eine starke Lichtquelle schaut. Hat man sich jedoch ans Licht gewöhnt, erlahmt dieser Reflex. Bei diesem Phänomen sucht die Wissenschaft sogar noch immer nach einer vollständigen Antwort: Nach bisherigem Wissen scheint der Licht-Nies-Reflex sogar vererbt zu werden, doch wenn die Wissenschaft sich unsicher ist, versteckt sie sich hinter komplizierten Begriffen, und so heißt das Phänomen: ACHOO-Syndrome (Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outbursts of Sneezing) – Gesundheit!
15IstGähnen ansteckend?
Ist Ihnen das vielleicht auch schon mal passiert: Sie sitzen am Tisch, Ihr Gegenüber gähnt und prompt gähnen auch Sie. Ist Gähnen ansteckend? Und wenn ja, warum?
Häufig wird behauptet, Gähnen habe mit Sauerstoffmangel zu tun, doch dem ist nicht so. Denn Tests haben bewiesen: Bei schlechter Luft mit erhöhter Kohlendioxidkonzentration und auch bei erhöhtem Sauerstoffgehalt in der Atemluft ändert sich nichts am Gähnverhalten. Gähnen ist auch nicht immer Ausdruck von Müdigkeit. Olympiasportler gähnen zum Beispiel auffällig häufig vor dem Wettkampf. Es kann also auch ein Hinweis auf eine anstehende Aktivität sein. Die Wissenschaft hat das Rätsel des Gähnens noch nicht völlig gelöst. Was zum Beispiel passiert, wenn es unser Gegenüber erwischt? Ist Gähnen wirklich ansteckend?
In einem Experiment haben wir das Phänomen getestet: Mitten in Bremen wurden Passanten zu einem Versuch eingeladen. Ihnen wurde gesagt, es ginge um einen Aufmerksamkeitstest, doch das war nur ein Vorwand. Unsere Teilnehmer mussten sich Bilder merken. Einer Gruppe zeigten wir zwischendrin immer wieder Einblendungen von gähnenden Menschen. Und prompt reagierten sie: Unbewusst begann jeder Zweite (57 %) daraufhin selbst zu gähnen. Bei der Vergleichsgruppe fehlten die Einblendungen und kaum ein Teilnehmer gähnte. Interessanterweise klappt dieser Versuch auch bei Menschenaffen: Bei Schimpansen ist das Gähnen ebenfalls ansteckend. Gähnen könnte also eine Art Gruppensignal sein.
Die aktuelle Erklärung stammt aus der modernen Gehirnforschung: Man entdeckte vor einigen Jahren ein besonderes Netz von Nervenzellen.[3] Diese sind nicht nur aktiv, wenn wir selber eine Aktion durchführen, sondern auch dann, wenn wir diese nur sehen. In unserem Gehirn spiegeln wir offenbar ständig, was um uns herum passiert. Diese Nervenzellen werden daher auch Spiegelneuronen genannt. Wenn wir jemanden gähnen sehen, dann gähnt unser Gehirn also mit, und wenn jemand sich schneidet oder lacht, dann leiden oder lachen wir im Gehirn mit. Wir erleben unsere Außenwelt also weit intensiver, als bislang bekannt war. Vielleicht haben wir es jedoch schon lange vor der Entdeckung der Spiegelneuronen geahnt. Darauf deutet das Wort Sympathie hin, welches wörtlich übersetzt Mitleiden heißt!
Diese Kopplung der Gehirnzellen ist sehr intensiv, nicht nur beim Gähnen. Mütter öffnen zum Beispiel den Mund, wenn sie ihr Kind füttern. Das Kind sieht die Bewegung, das Gehirn spiegelt unbewusst, und das Mündchen geht auf.
Jetzt wissen Sie es also: Wenn Sie nächstes Mal beim Gähnen erwischt werden, haben Sie die beste Ausrede: Ihr Gehirn fühlt mit!
16Warum haben Frauen kalte Füße?
»Kalte Füße sind lästig, besonders die eigenen.«
Wilhelm Busch
Frauen leben länger als Männer, das ist statistisch belegt. Doch vielleicht gibt es ja so etwas wie Gerechtigkeit im Leben. Da wäre nämlich noch dieser Unterschied zwischen Mann und Frau: 80 % aller Frauen klagen über kalte Füße.
Betrachtet man den Wärmehaushalt der Geschlechter, so sind Männer deutlich im Vorteil. Denn gemessen am Gesamtgewicht besteht ein Mann zu 40 % aus Muskeln. Wenn ein Muskel arbeitet, investiert er nur ein Drittel der Energie in die tatsächliche Arbeit, der große Rest wird als Wärme abgegeben. Muskeln sind die Heizung unseres Körpers. Wenn uns kalt ist, zittern wir – und heizen durch die scheinbar überflüssige Muskelarbeit unseren frierenden Körper.
Der Muskelanteil bei Frauen beträgt jedoch nur 23 % und ist damit ungefähr halb so groß wie der der Männer. Die »Körperheizung« der Frauen ist also wesentlich schwächer angelegt.
Hinzu kommt der Wärmeverlust. Entscheidend hierfür ist unsere Körperoberfläche. Sie kennen das: Wenn uns kalt ist, kuscheln wir uns zusammen und minimieren so unsere Oberfläche. Dadurch geben wir weniger Wärme an die Umgebung ab.
Bei der jeweiligen Körperoberfläche findet man einen kleinen Unterschied zwischen Mann und Frau: Wenn beide gleich groß sind, hat sie, bedingt durch ihre Brüste, eine größere Hautoberfläche und strahlt mehr Wärme ab.
Höherer Wärmeverlust und kleinere Heizung – das ist ungünstig. Wenn uns kalt ist, reagiert unser Körper mit einem unangenehmen Sparmodus: Um die lebenswichtigen Organe und das Gehirn auf 37 °C zu halten, werden andere Körperteile wie Arme, Beine oder unsere Nase weniger durchblutet. Die Wärme konzentriert sich auf den Körperkern. Bei Kälte verengen sich daher die Blutgefäße der Frau in den Füßen schneller. Und wo kein Blut fließt, da ist auch keine Wärme. Bis auf 8 °C kann die Temperatur in den Zehen sinken! Die kalten Frauenfüße sind also eine biologische Überlebensstrategie.
Einer der seltenen Fälle übrigens, so scheint’s, bei denen Männer besser helfen können als die Natur …
17Wiesehen wir räumlich?
Anfangs dachte ich, die Besucher des berühmten Dalí-Museums in Figueres seien völlig durch den Wind. Sie starrten auf eine Bilderwand, schielten und verfielen sogleich in bewundernde Gefühlsausbrüche. Und dann traf es auch noch meine Tochter: »Unglaublich … Ohhhh … das gibt’s nicht! … und alles scharf …«
Kurz danach verfiel auch ich den stereoskopischen Bildern von Salvador Dalı´. Seltsame bunte Muster entpuppten sich plötzlich als räumliche Gebilde. Der Blick tauchte vom flachen zweidimensionalen Bild in eine sonderbare Welt neuer Einsichten – im wahrsten Sinne: Ich sah mich in Bilder hinein – und nach einer Stunde Silberblick litt ich an Kopfschmerzen.
Die Magie hat weniger mit unseren Augen als mit unserem Gehirn zu tun, denn Bilder entstehen im Kopf. Sehen ist ein komplexer Lernprozess, bei dem sich unser Gehirn nach und nach auf die Informationsflut einstellen muss.
Da beide Augen ein etwas anderes Bild wahrnehmen, kann unser Gehirn daraus den Abstand eines Objekts ermitteln. Hierbei spielt aber auch die Bildschärfe eine Rolle. Der Zusammenhang zwischen Schärfe und Blickwinkel hat sich in unserem Gehirn über Jahre hinweg durch Erfahrung gefestigt. Die optische Vortäuschung der dritten Dimension gründet vor allem auf dieser Erfahrung. Wir wollen die Dinge scharf sehen und das klappt nur dann, wenn wir leicht schielen. Durch diesen Trick nehmen beide Augen aber ein leicht unterschiedliches Bild wahr und bei der Suche nach einer plausiblen Antwort interpretiert unser Gehirn das Seherlebnis als dritte Dimension.