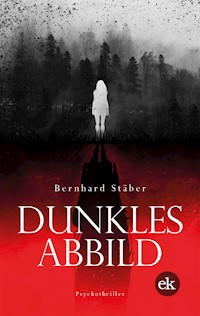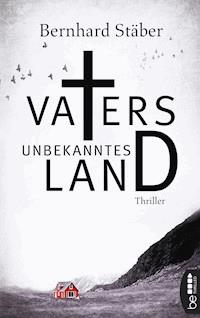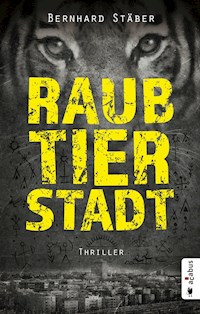
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sara Elin Persen aus dem indigenen Volk der Samen kommt vom Polarkreis nach Oslo, um mehr über den Tod ihres Bruders herauszufinden. Sie glaubt nicht, dass der Umweltaktivist bei einer zufälligen Kneipenschlägerei erstochen wurde. Sara kommt in einer Künstler-WG im Bezirk Grünerløkka unter. Als einer ihrer Mitbewohner bei einem Einbruch getötet wird, gerät die junge Samin ins Visier eines Mannes, der vor nichts zurückschreckt, um ein antikes Wikinger-Artefakt in seinen Besitz zu bringen. Abgeschnitten von ihrer Familie in der Arktis und heimgesucht von den Erinnerungen an ihren toten Bruder bleibt Sara nur eines, um in Oslos Großstadtdschungel zu bestehen: Sie wird selbst zum Raubtier und jagt ihre Verfolger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Stäber
Raubtierstadt
Thriller
Stäber, Bernhard : Raubtierstadt. Hamburg, acabus Verlag 2019
Originalausgabe 2019
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-652-0
Print-ISBN: 978-3-86282-650-6
Lektorat: Lea Oussalah, Hannah Göing, acabus Verlag
Satz: Lea Oussalah, acabus Verlag
Cover, Runen: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: © www.pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2019
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
I once heard of a Spanish feast:
into the ring they first released
A horse of country stature;
and then a tiger from its cage;-
it prowled awhile in silent rage,
then leapt right at its capture.
…
I don’t know who won finally;
because that country horse is me,
the fight too has no ending; –
the town you know where this takes place,
that laughter, clapping would embrace –
its name needs no appending!
(Bjørnstjerne Bjørnson: »Sidste Sang«)
für Jeannine, die keine Verwendung für das Wort »aufgeben« hat.
Schnee taumelt in wenigen großen Flocken zwischen den Bäumen herab, die einzige Bewegung im beinahe völlig finsteren Dämmerlicht. Kein Windhauch regt die Zweige der dunkelgrünen Fichten und kahlen Birken. Die Stille ringsum ist so vollständig, dass Jarl Lohne den Tinnitus in seinen Ohren so deutlich wie das Zirpen von Grillen in Sommergras vernehmen kann.
Das beständige Hintergrundgeräusch begleitet ihn schon so lange, dass er nicht mehr genau sagen kann, wann es ihm zum ersten Mal aufgefallen ist. Vielleicht fing es vor fünf Jahren an, als er zusammen mit seinen Freunden Lars und Arild in Lars’ Scheune auf eine Reihe Bierflaschen feuerte. Es hatte in Strömen geregnet, die drei hatten gemeinsam eine Flasche polnischen Grasovka geleert, und keiner von ihnen hatte Lust darauf gehabt, sich zum Zielschießen hinaus in das Dreckswetter zu begeben. Natürlich hatte keiner von ihnen einen Ohrenschutz getragen.
Normalerweise fällt Jarl der Tinnitus gar nicht auf. Es sind immer viel zu viele andere Geräusche um ihn herum, hinter denen das hohe Sirren verschwindet. Jarl arbeitet im Zentrum von Oslo in der Anwaltskanzlei seines Onkels, Lohne & Magnussen. Tagsüber ist er die meiste Zeit von den beständigen Geräuschen der Großstadt umgeben, die er für gewöhnlich ebenfalls nur wahrnimmt, wenn er sich auf sie konzentriert. Aber hier, im frühwinterlichen Waldgebiet der Østfold zwischen Norwegen und Schweden, hört er keinen Laut – außer dem leisen Summen in seinen Ohren.
Er zuckt heftig zusammen, als er neben sich im Schnee eine Bewegung bemerkt. Der Mann, den er hierherführen musste, hat sich bestimmt eine halbe Stunde nicht gerührt, trotz der Kälte. Mehr als das: Er hat Jarl das Gefühl gegeben, er wäre alleine, als befände sich neben ihm nichts weiter als ein Stück Fels.
Der Mann mit dem eigenartigen Namen hat in die linke Tasche seiner dicken Fleece-Winterjacke gegriffen. Jetzt hält er in seiner Bewegung inne. Sein Kopf wendet sich langsam Jarl zu. Als Jarl den Mann vom Flughafen Oslo Gardermoen abgeholt und ihm zum ersten Mal in die Augen geblickt hat, haben sie in der Nachmittagssonne in einem leuchtend tiefen Blau geschimmert. Heute, drei Tage später, ist bereits die Nacht angebrochen, und die Augen des Mannes sind zwei dunkle Flecken in einem fahlen, langen Gesicht. Seine eigentlich vollen Lippen haben sich zu einem Strich zusammengezogen.
Jarl zuckt entschuldigend die Achseln. Er glaubt nicht, dass seine erschrockene Bewegung irgendein Tier aufgescheucht hat – dann hätte man etwas gehört. Selbst Schleichern gelingt es nicht immer, sich lautlos in einem völlig stillen Winterwald zu bewegen. Trotzdem kann es nicht schaden, dem Mann mit dem eigenartigen Namen gegenüber vorsichtig zu sein. Etwas stimmt nicht mit ihm. Der Mann ist irgendwie unheimlich.
»Verzeihung, Mr. Mithothin«, flüstert er kaum vernehmbar.
Sein Begleiter starrt ihn regungslos an, ohne etwas auf seine Entschuldigung zu erwidern.
Jarl weiß, dass der Mann nicht wirklich Mithothin heißt. Der Kollege seines Vaters aus London, der ihm den Kontakt vermittelte, hat gleich beim ersten Gespräch erwähnt, dass seinem Klienten Anonymität äußerst wichtig sei. Er hat Jarl nur einen Platzhalter genannt, wie Smith oder Miller. Der wirkliche Name des Mannes ist in dessen Jagdlizenz vermerkt, aber die hat Jarl nicht zu sehen bekommen.
Der eigenartige Name seines Begleiters weckt eine unbestimmte Erinnerung in ihm, die er nicht greifen kann. Der Mann spricht Englisch mit britischem Akzent, doch da ist etwas Skandinavisches in der Art, wie er redet. Jarl glaubt allerdings nicht, dass er einen Landsmann neben sich hat. Vielleicht ist er ein Schwede oder ein Isländer. Verdammt, er campt hier seit drei Tagen völlig allein mit einem bewaffneten Mann, den er überhaupt nicht kennt!
Mr. Mithothin mustert ihn weiter regungslos mit hartem Blick. Die beiden dunklen Augenflecke, die in dem gespenstisch bleichen Gesicht schwimmen, lassen Jarl an die Augenhöhlen eines Schädels denken. Auf einmal ist sein Mund staubtrocken. Er tastet unauffällig mit der linken Hand nach seiner Remington, die neben ihm auf der dicken Isomatte liegt. Die Berührung verspricht Sicherheit. Aber im selben Moment, als er das Holz des Griffs durch den Handschuh spürt, wendet der unheimliche Fremde neben ihm seinen Blick wieder von ihm ab. Erleichtert atmet Jarl aus. Er beobachtet, wie Mr. Mithothin ein kleines Nachtsichtgerät aus der Tasche zieht und es sich vor die Augen hält.
»Ich dachte, ich hätte direkt vor uns eine Bewegung wahrgenommen«, murmelt er, als würde er mit sich selbst sprechen. »Aber da war nichts. Nein, alles unverändert.«
Seine Stimme ist tief und sonor. Obwohl er kaum mehr als flüstert, kann Jarl ihn gut verstehen.
Er selbst besitzt kein Nachtsichtgerät, nur einen ganz normalen Feldstecher, aber von guter Qualität. Die hilft bei fortschreitender Dunkelheit allerdings auch nicht viel. Dennoch hält Jarl sich das Fernglas vor die Augen. Er will vor dem Fremden nicht wie jemand dastehen, der nicht einmal vernünftige Ausrüstung zu einem Jagdtrip mitgenommen hat. Dabei ist er es ja, der für diesen Ausflug an die schwedische Grenze verantwortlich ist, er und Frederik Harner.
Die Londoner Kanzlei, für die Harner tätig ist, hatte in der Vergangenheit mit der seines Vaters zu tun. Einer der Klienten des britischen Anwalts hat gehört, dass Norwegen in diesem Jahr bis zum Wintereinbruch in der Region Østfold neun Wölfe zum Abschuss freigegeben hat. Dieser Klient, dessen Namen Harner als Mr. Mithothin angab, hat sich für den Abschuss eines Wolfs um eine Jagdlizenz bemüht.
Normalerweise würden bei der Verteilung dieser Lizenzen einheimische Jäger den Vorzug bekommen. Aber Harner hat sich bei Jarls Vater Erik für seinen Klienten eingesetzt, und der wiederum hat bei der lokalen Jägervereinigung ein gutes Wort für den Ausländer eingelegt. Unterstützt von einer großzügigen Spende hat sich Mr. Mithothin das Recht erworben, auf dem Grund der Familie Lohne, wo sich nahe der schwedischen Grenze mehrere zusammenhängende Waldstücke befinden, einen Wolf zu jagen. Wenn er ihn lokalisieren kann.
»Vielleicht hat der Wolf uns gerochen oder gehört«, flüstert er. »Könnte doch sein, dass er längst über die Grenze abgewandert ist.« Er hat in den letzten Tagen immer wieder versucht, Smalltalk mit dem schweigsamen Mann zu führen. Jarl ist es nicht gewohnt, die Jäger auf dem Besitz seines Vaters zu begleiten. Zu jagen ist etwas anderes, als auf Flaschen zu schießen. Er mochte das Gewese seiner Familie um die Jagd schon als Kind nicht, und der Gedanke, eine weitere Nacht schweigend neben dem Fremden zu sitzen, hängt wie eine schwere Regenwolke über ihm.
Aber der Job ist nun einmal an ihm hängengeblieben. Sein Vater hatte wegen einer Geschäftsreise keine Zeit, und seine Schwester hat sich geweigert. Und wenn Ingrid etwas nicht will, hat noch nie jemand sie umstimmen können, schon gar nicht ihr Vater.
Während Jarl auf eine Erwiderung wartet, sucht er mit dem Feldstecher den Waldrand am anderen Ende der Lichtung ab, die sie etwas höher gelegen von Westen aus überblicken. Aber das Tageslicht hat bereits zu stark abgenommen, um in den beiden Objektiven des Fernglases mehr als eine finstere Masse aus Dickicht und einzelnen Baumstämmen zu erkennen.
Er rechnet schon gar nicht mehr damit, dass Mr. Mithothin ihm antworten wird, als plötzlich neben ihm seine geflüsterte Stimme ertönt. Sie hört sich beinahe amüsiert an.
»Wölfe sind klug, und ihr Lernfaktor ist enorm. Wenn einem ein Wolf erst einmal entkommen ist, wird es beim nächsten Mal umso schwieriger, ihn zu erwischen.«
Es ist keine Antwort auf seine Frage, aber Jarl ist schon zufrieden, dass der Fremde überhaupt ein Gespräch mit ihm führt. Er lässt den Blickwinkel des Feldstechers etwas nach unten wandern. Der Elchkadaver in der Mitte der Lichtung erscheint unvermittelt so plastisch und groß wie ein meterhoher Berg aus Fell und Fleisch vor seinen Augen. Dabei ist es nur ein Kalb, und noch nicht einmal gut genährt. Wahrscheinlich war es schon seit längerem von seinem Muttertier getrennt.
Der Wolf hat große Bissen an Muskelmasse aus dem Bauch des Tieres herausgerissen. Die einbrechende Dämmerung hat dem Blut um die Wunden herum die Farbe geraubt. Dennoch lässt Jarl der Anblick des frisch getöteten Tiers nicht kalt. Darum ist er als Kind nicht mit seinem Vater auf die Jagd gegangen. Was da im Schnee liegt, besaß noch vor wenigen Stunden ein warmes, pochendes Herz.
»Denken Sie …«, sagt er langsam, um das Thema zu wechseln, »… dass er schon einmal jemandem entkommen ist? Dass er klug ist? Wir haben ihn in den letzten drei Tagen kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Nichts anderes als seine Spuren im Schnee und das tote Kalb. Genauso gut könnte man einen Geist jagen.«
»Er kommt«, erwidert Mr. Mithothin mit der ruhigen Gewissheit von jemandem, der etwas Unausweichliches wie die Gezeiten ankündigt. »Er hat gejagt, er hat gefressen, jetzt ist er wieder hungrig, und die Nacht ist angebrochen. Er kommt.«
Jarl hat den Feldstecher wieder abgesetzt. Sich am Rand dieser Talsenke mitten im Schnee den Hintern abzufrieren ist etwas, das viel besser zu seiner Schwester Ingrid passen würde. Die ist so ein Outdoor-Typ, wie es der Mann neben ihm offensichtlich ebenfalls ist, und jagen geht sie auch, aber Elche und hin und wieder Wildgänse, weiter im Norden an der Westlandsküste. Nur keine Wölfe. Ganz im Gegenteil: Sie wird wütend, wenn sie hört, dass Wölfe geschossen werden.
»Was ich jage, wird zu Essen verarbeitet«, hat Jarl sie mehr als einmal sagen hören. »Die Typen, die Wölfe schießen, sind Trophäenjäger. Das sind Wichser ohne Respekt vor dem, was sie töten.«
Jarl kennt keine Trophäenjäger, aber das Wenige, was der Mann bisher zum Thema Jagd von sich gegeben hat, klang ganz danach, als ob er Wölfen eine beinahe ehrfürchtige Achtung erweisen würde. Und dann die Sache mit der Waffe, die er von seinem Flug aus London mitgebracht hat! Erst hatte Jarl kaum glauben wollen, dass sein Gast sie tatsächlich einsetzen wollte. Er dachte, der Mann würde einen Scherz machen. Aber Mr. Mithothin ist kein scherzhafter Mensch, das hat Jarl schnell begriffen.
»Sie können dieses Ding nicht für die Jagd auf einen Wolf benutzen«, hat er dem Fremden gesagt, als sie ihr Lager für die erste Nacht aufgeschlagen hatten. »In diesem Land gibt es Regeln für die Jagd auf Großwild. Sie können einen Wolf nur mit einer Rifle erlegen.« Er hat ihm die Remington seines Vaters unter die Nase gehalten. »Benutzen Sie die hier.«
Mr. Mithothin hat ihn kalt angeblickt und nach kurzem Zögern das Jagdgewehr ergriffen, um das Magazin zu überprüfen.
»Expandierende Kugeln, die mindestens neun Gramm wiegen«, hat Jarl ihm erklärt. Er ist sich dabei wie ein Papagei vorgekommen. Als sein Vater ihn gebeten – nein, aufgefordert – hat, Mr. Mithothin auf der Jagd zu begleiten und zu unterstützen, hat er den ganzen Formalkram schnell auswendig gelernt, wie im Studium. »Das ist die Munition, die von der Jagdbehörde verlangt wird.«
Mr. Mithothin hat ihm die Remington zurückgegeben, ohne eine Miene zu verziehen. »Ich kenne die Regeln«, hat er gesagt. »Ich kann sogar eine aktuelle schriftliche Bestätigung vorweisen, dass ich mit einer Rifle umgehen kann. Wird das in Ihrem Land nicht ebenfalls verlangt?«
Jarl hat genickt, das Jagdgewehr eingepackt und die Sache auf sich beruhen lassen. Etwas in der Art dieses eigenartigen Mannes duldet keinen Widerspruch. Er ist jemand, der bekommt, was er haben will. Und, so entschuldigt Jarl sein eigenes Einknicken, es sieht ja nicht einmal so aus, als würde Mr. Mithothin tatsächlich dazu kommen, sein mitgebrachtes Spielzeug einzusetzen. Dazu müssen sie den Wolf, der sich seit einiger Zeit in diesem Teil des Waldes an der Grenze zu Schweden herumtreibt, erst einmal stellen.
Als wollte ihn seine Intuition Lügen strafen, richten sich Jarl mit einem Mal die Haare im Nacken auf. Er kann dem Gefühl keine Worte verleihen, aber ihm ist, als ob das lange Ausharren in dem unwirtlichen, kalten Gelände etwas in ihm ausgelöst hätte, etwas Altes, Urtümliches. Als hätte sich ein Teil von ihm mit dem Wald verbunden, ein komplexes Gefüge aus verborgenem Leben um ihn herum in der Nacht. Er fühlt, dass etwas passieren wird, bald schon. Etwas kommt.
Mr. Mithothin scheint es ebenfalls zu spüren. Vielleicht haben sich die beiden Männer in den letzten Tagen wie zwei empfindliche Saiteninstrumente aufeinander eingestimmt. So langsam, dass Jarl die Bewegung neben sich mehr ahnt als tatsächlich wahrnimmt, bewegt Mr. Mithothin sein Nachtsichtgerät wieder vor das Gesicht.
Jarl kneift die Augen bis auf einen Spalt zusammen, um genauer sehen zu können. Er verzichtet auf den Feldstecher, dessen Objektive bereits zu viel von dem kaum noch vorhandenen Licht schlucken. Erst ist er sich nicht sicher, ob er sich die Bewegung am anderen Ende der Lichtung nur einbildet. Vielleicht täuscht ihm sein angestrengtes Starren auf den dunklen Fleck zwischen zwei Kiefernstämmen nur vor, dass sich dort etwas verbirgt.
Doch dann – kein Zweifel! Etwas schiebt die niedrigen Zweige zur Seite. Ein langgezogener Kopf erscheint, dann ein Rumpf.
Jarls Herz hat heftig zu schlagen begonnen. Verdammt, das ist kein Fuchs, kein Luchs, und auch kein streunender Hund. Es ist der Wolf, den sie schon seit Tagen verfolgen! Sie haben ihn tatsächlich aufgespürt – das lange Warten hat sich doch gelohnt! Der Adrenalinschub lässt Jarl die Kälte und seine steifen Glieder vergessen. Seiner Meinung nach ist das Jagdhobby eigentlich ein archaisches Ritual, das im 21. Jahrhundert so anachronistisch erscheint wie der Glaube an einen Gott, der Kains Brandopfer höher schätzte als Abels Feldfrüchte. Aber in diesem Augenblick hat ihn das gleiche uralte Fieber gepackt, mit dem schon steinzeitliche Jäger auf der Lauer gelegen haben müssen.
Der Wolf hat seine Deckung verlassen und ist mit scheuen, vorsichtigen Bewegungen ganz auf die Lichtung hinausgetreten. Seine Art ist keine Bedrohung für den Menschen, denkt Jarl, sie war es nie. Das Tier, das etwa so groß wie ein Schäferhund ist, hebt den Kopf und nimmt Witterung auf. Gleichzeitig bemerkt Jarl, dass ein leichter Nachtwind aufgekommen ist, der ihm kalt gegen die Stirn weht. Eine weitere Welle aus beinahe fiebriger Begeisterung beschleunigt seinen Herzschlag: Der Wind, der ihnen aus der Richtung ihrer Beute entgegenkommt, ist wie ein gutes Zeichen: Der Wolf kann sie so nicht riechen! Momentan können Jarl und sein Begleiter am Rand der Senke, die in die Lichtung hinabführt, nur gesehen und gehört werden. Und da der abnehmende Mond von Wolken verhangen ist, haben sie einen weiteren Vorteil. Zum ersten Mal, seitdem sie sich auf die Spur des Wolfs gemacht haben, glaubt Jarl daran, dass es ihnen tatsächlich gelingen könnte, ihn zu schießen.
Neben ihm ist Mr. Mithothin wieder zu einer Statue erstarrt. Jarl duckt sich mit dem Oberkörper so flach auf den Boden, als wolle er sich durch seine Isomatte hindurch und ins gefrorene Erdreich drücken. Er hofft, dass er von der Lichtung aus nicht mehr zu sehen ist. Vorsichtig wälzt er sich auf die linke Seite, ergreift sein Jagdgewehr und wälzt sich wie in Zeitlupe, um kein Geräusch zu verursachen, mit der Rifle in der Hand zurück. Er legt das Gewehr neben Mr. Mithothin, damit dieser es sofort zur Hand hat.
Als Jarl einen Blick über den Rand der Senke riskiert, sieht er, dass der Wolf sich dem Elchkadaver genähert hat und Fleisch aus seiner Beute herausreißt. Er ist abgelenkt. Jetzt ist die Gelegenheit.
Dann geht alles so schnell, dass Jarls Verstand den Eindrücken nicht mehr hinterherkommt. Mr. Mithothin hat sich in einer einzigen fließenden Bewegung zu voller Größe aufgerichtet. Beinahe gleichzeitig hat er unter die Thermodecke neben sich gegriffen und den fast mannshohen Eibenbogen gepackt, der zusammen mit zwei Pfeilen griffbereit darin verborgen gelegen hatte.
Der Wolf hat seinen Kopf in der Seite des Elchs vergraben. Obwohl Mr. Mithothin beim Aufstehen kaum ein Geräusch von sich gegeben hat, hält das Tier im Fressen inne und hebt den Kopf.
Der angelegte Pfeil zielt im gleichen Moment auf den Wolf, als dieser zu ihnen hinaufblickt. Das Tier wirbelt herum, und der Pfeil löst sich mit einem kaum hörbaren Schnalzen.
Ein hohes, abrupt abreißendes Jaulen hallt über die Lichtung. Der Wolf wird wie von einer unsichtbaren Hand zwei Meter zur Seite in den Schnee geschleudert. Mit offenem Mund starrt Jarl Mr. Mithothin an, der mit dem riesigen Eibenbogen in der Hand in die Senke hinabblickt. Nun liegen zwei Tierkörper reglos auf der Lichtung.
»Ich … ich … verdammt, ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie diese Waffe hier nicht benützen dürfen!«, stammelt Jarl. Eine innere Stimme fragt ihn höhnisch, was er denn denkt, wieso sein Begleiter den Bogen dann mit auf diesen Jagdtrip geschleppt hat – als Glücksbringer etwa? Er wollte ihn von Anfang an verwenden, und das hat er auch getan.
»Sparen Sie sich Ihre Vorträge!«, sagt Mr. Mithothin. Die Pupillen in seinem fahlen Gesicht wirken wie zwei harte, schwarze Kiesel. »Ich habe gutes Geld dafür bezahlt, ihn mit diesem Bogen zu erschießen.«
Als sei damit alles gesagt, wendet er sich von Jarl ab und stapft durch den tiefen Schnee die Senke hinab und auf die Lichtung. Jarl steht langsam auf. Der Moment der Begeisterung, ein seltenes Tier gestellt zu haben, ist verschwunden und hat nichts weiter als eine betäubende Kälte zurückgelassen.
Mr. Mithothin ist bei dem toten Wolf angekommen. Beinahe achtlos legt er den Bogen neben sich in den Schnee. Jarl, der den Fußstapfen folgt, weil das im tiefen Schnee einfacher ist, sieht ihn sich in einer langsamen, merkwürdig ehrfürchtig anmutenden Bewegung vor dem Tier auf ein Knie herablassen.
Erst bei diesem Anblick erinnert Jarl sich an die Kamera, die er auf den Rat seines Vaters hin auf den Jagdtrip mitgenommen hat. Jäger wollen Bilder von sich und ihrer erlegten Beute haben, und Mr. Mithothin soll erhalten, wofür er bezahlt hat. Jarl zieht sich die Handschuhe aus, stopft sie in die Seitentasche seiner Outdoor-Jacke und zückt seine Digitalkamera. Vor zwei Jahren hat er sich die Leica für Ausflüge angeschafft, klein, aber dafür handlich. Schritt für Schritt nähert er sich von hinten dem Mann, der eben den Pfeil aus dem Körper des toten Wolfs herausgezogen und neben sich in den Schnee geworfen hat.
Mr. Mithothin beugt sich mit dem Rücken zu Jarl über den Kadaver. In seiner Rechten hält er ein Jagdmesser mit breiter Klinge. Jarl zoomt im Sucher seiner Leica den Wolf heran. Der Kopf des toten Tiers tritt im letzten Dämmerlicht vor dem Hintergrund aus matt schimmerndem Schnee leicht verschwommen hervor, die Lefzen wie im Aufbäumen vor dem unvermeidlichen letzten Atemzug zurückgezogen, sodass seine Zähne gut sichtbar sind. Jarl drückt den Auslöser.
Das Blitzlicht taucht den am Boden liegenden Wolfskopf in ein unnatürlich grelles Licht, das in allen Schneeflocken ringsum ein diamantenes Feuer entzündet. Für einen Moment glaubt Jarl, die Augen des Tiers würden in den Höhlen herumrollen und ihn ansehen. Erschrocken schnappt er nach Luft, die ihm kalt in den Rachen dringt.
Mr. Mithothin wirbelt herum. Er ist ebenso schnell auf die Beine gekommen, wie vorhin, als er den Bogen auf den Wolf abgefeuert hat. Seine Rechte hat sich so fest um sein Jagdmesser gekrampft, dass Jarl selbst in dem dämmrigen Licht die Fingerknöchel weiß unter der Haut hervortreten sehen kann. Instinktiv versucht der junge Mann vor dem Fremden zurückzuweichen, aber seine Beine bleiben im tiefen Schnee stecken.
»Keine Fotos!«, herrscht Mr. Mithothin ihn wütend an. Seine Augen sind zwei dunkle Steine, aus denen man Funken schlagen könnte. Einen Lidschlag lang glaubt Jarl, dass es dieselben Augen wie die des Wolfs am Boden sind, tot und dennoch von kaltem Leben erfüllt.
Er ringt nach Worten, doch bevor er etwas herausbringen kann, reißt der Mann ihm die Leica aus der Hand. Er holt aus und schmettert sie mit voller Wucht gegen einen hüfthohen Felsen, der neben ihnen aus dem Schnee ragt. Einmal, zweimal ertönt ein mahlendes Krachen, als das Gehäuse der Leica auf den nackten Stein trifft. Dann schleudert Mr. Mithothin die Kamera aus der Lichtung hinaus ins dunkle Unterholz. Schwer atmend wendet er sich wieder dem jungen Mann zu, dessen Blick von dem wütenden Gesicht vor sich hinab zu dem Jagdmesser in der Hand seines Gegenübers irrt. Plötzlich ist Jarl sich sicher, dass dieser Verrückte zustechen wird. Er kann deutlich vor sich sehen, wie sich die Klinge durch die Kleidung und in seinen Bauch bohrt, als würde sein Verstand der Zukunft um wenige Sekunden vorauseilen.
»Es … es … hören Sie, es tut mir leid!«, bricht es hilflos aus ihm heraus. »Ich wusste nicht, dass …«
»Keine Fotos von der Beute!«, schneidet ihm Mr. Mithothin hart das Wort ab.
Ein Lichtstrahl tanzt zwischen den Bäumen hinter ihnen herüber und richtet sich schließlich auf die beiden Männer. Vor Erleichterung beginnt Jarl zu zittern.
»Das darf doch nicht wahr sein!«
Die klare, hohe Stimme hallt aus Richtung der Lichtquelle über die Lichtung. Schon beim Klang der Worte weiß Jarl, wer das ist. Zwei Gestalten kommen über den Rand der Senke zu ihnen herabgestiegen. Eine von ihnen ist eine stämmige junge Frau, die eine Stabtaschenlampe hält. Die andere Gestalt folgt in ihren Spuren.
»Ihr habt den Wolf also tatsächlich aufgespürt«, sagt Ingrid Lohne verhalten. Ihr dunkelblondes Haar ist zu einem dicken Zopf geflochten. Schnee liegt auf der braunen Uschanka, deren Rand ihr beinahe über die Augenbrauen reicht.
»Jepp, das haben wir«, antwortet Jarl mit hohler, verwunderter Stimme, aus der immer noch die Panik herauszuhören ist, die ihn bis vor wenigen Sekunden gelähmt hat. Nach drei Tagen ohne eine andere Gesellschaft als seinen wortkargen, furchteinflößenden Gast hat es für ihn etwas Unwirkliches, so unvermittelt seiner Schwester gegenüberzustehen. Aus den Augenwinkeln bemerkt er, dass Mr. Mithothin sich wieder zu dem Kadaver am Boden umgedreht hat.
Jarl kommt Ingrid ein paar Schritte entgegen, froh über jeden Meter Abstand, den er zwischen sich und den Fremden in seinem Rücken bringen kann. »Wie … wie habt ihr uns gefunden? Was zum Teufel macht ihr hier?«
Ingrid deutet auf den Mann hinter sich, der mit mühsamen Schritten zu ihr aufholt. »Er da hat eine wichtige Nachricht für Vaters Jagdgast. Er will unbedingt persönlich mit ihm sprechen. Ich hab ihm gesagt, dass der Mann bestimmt verärgert sein wird, wenn wir euch stören und das Wild vertreiben. Aber er hat darauf bestanden. Also sind wir den Spuren eurer Schneescooter gefolgt und den Rest des Wegs zu Fuß –«
Sie bricht stirnrunzelnd ab. Jarl folgt ihrem Blick. Der Schein ihrer Stabtaschenlampe hat sich auf den riesigen Eibenbogen im Schnee und den blutigen Pfeil daneben gerichtet.
»Also deshalb haben wir keinen Schuss gehört«, sagt Ingrid. Sie holt tief Luft. »Heh, Sie!«, ruft sie empört. Sie stapft an Jarl vorbei und auf Mr. Mithothin zu, der sich nicht umgedreht hat und weiterhin nur auf das tote Tier vor sich im Schnee achtet. »Was Sie hier getan haben, ist verdammt noch mal illegal! Einen Wolf mit Pfeil und Bogen zu erlegen, das ist – das ist nicht nur verboten, das ist Tierquälerei!«
Mr. Mithothin dreht sich immer noch nicht zu ihr um.
»Lass es gut sein!«, zischt Jarl seine Schwester an. Er will nicht, dass sie diesen unheimlichen Kerl provoziert, er will nur noch, dass der Mann seine Beute einsammelt und so schnell wie möglich wieder von hier verschwindet.
»Ich rede mit Ihnen!«, herrscht Ingrid ihn an, ohne auf ihren Bruder zu achten. »Verdammt, ich hab gute Lust, Sie bei der Polizei anzuzeigen!«
»Das sollten Sie besser nicht tun«, ertönt die Stimme der zweiten Gestalt, die neben Jarl stehengeblieben ist. Der junge Mann kommt erst jetzt dazu, im Licht von Ingrids Stabtaschenlampe den Neuankömmlig genauer in Augenschein zu nehmen. Es ist ein Mann Ende Zwanzig, dessen Augen hinter einer Hornbrille mit schwarzem Rand auf seine Schwester gerichtet sind. Schneeflocken schmelzen in seinem dunklen, exakt gescheitelten Haar. Im Gegensatz zu den drei anderen trägt er keine Outdoorkleidung, sondern einen Wintermantel aus tiefblauem Tweed, dessen Kragen er hochgeschlagen hat.
Der Mann wirkt mit seiner modischen Erscheinung an diesem Ort so deplatziert, dass Jarl für einen winzigen Moment daran glaubt, sich die Gestalt im Dunkel nur einzubilden. Dann erinnert er sich an das Gespräch mit dem Londoner Anwaltskollegen seines Vaters, und auf einmal weiß er, wen er vor sich hat. Er hat mit ihm telefoniert.
Ingrid hat sich zu Frederik Harner umgedreht. »Was haben Sie gesagt?«
»Ich sagte«, wiederholt der britische Anwalt ungerührt, »Sie sollten das besser nicht tun. Meinen Klienten bei der Polizei anzeigen.«
»Und weshalb nicht?«, schnappt Ingrid herausfordernd.
»Miss Lohne«, erwidert Harner, ohne dass seine leise, aber deutlich zu verstehende Stimme an Schärfe zunimmt, »Mr. Mithothin ist niemand, den Sie sich zum Feind machen möchten. Aber wenn Sie ihn wegen Fehlverhaltens bei dieser Jagd anzeigen, dann passiert genau das. Mein Klient nimmt solche Dinge sehr ernst.« Er blinzelt sie durch die Gläser seiner Hornbrille an, und Jarl durchfährt ein Frösteln. Plötzlich wirkt der in dem dunklen Waldstück so völlig deplatzierte Mann mit seinem perfekt frisierten Haar und dem Harris-Tweed nicht weniger unheimlich als sein eigenartiger Klient.
»Wissen Sie was?«, fährt Ingrid auf. Das Weiße in ihren Augen schimmert. »Es ist mir verdammt egal, wie gut mein Vater und Sie miteinander bekannt sind. Ich lasse mir weder etwas vorschreiben, noch mich von Ihnen bedrohen. Ich …«
Sie bemerkt Jarls entsetzte Miene und fährt herum. Ihre Lippen bewegen sich, versuchen den angefangenen Satz zu beenden, aber ohne Erfolg. Ihr erschrockener Blick richtet sich auf den Mann, den ihr Bruder in den Wald ihres Vaters geführt hat.
Mr. Mithothin hat seinen mannshohen Eibenbogen aufgehoben und sich umgedreht. Im Schein von Ingrids Stabtaschenlampe glänzt sein Gesicht dunkel und nass von dem Blut des toten Wolfs, das er sich auf Stirn und Wangen geschmiert hat. Der Lichtstrahl zittert, weil Ingrids Hand bebt, was den Zügen des Mannes vor ihnen ein grässliches, fratzenhaftes Aussehen verleiht. Mit dem blutverschmierten Gesicht und der mittelalterlichen Waffe in seiner Hand erinnert Mr. Mithothin an einen Krieger, der sich über ein Schlachtfeld voller Leichen zu ihnen durchgeschlagen hat. Er achtet gar nicht auf die beiden Männer und die Frau im Schnee. Seine tief in den Höhlen liegenden Augen sind auf etwas gerichtet, das nur er sehen kann.
»Herzlichen Glückwunsch zu der gelungenen Jagd«, sagt sein Anwalt mit ruhiger Stimme. Abwartend mustert er ihn.
Mr. Mithothins Blick fokussiert sich, als würde es ihm erst jetzt auffallen, dass der Mann sich direkt vor ihm befindet, anstatt in einer Londoner Kanzlei. »Warum sind Sie hier?«
»Sie waren telefonisch nicht erreichbar, daher habe ich sofort den nächsten Flug nach Norwegen genommen«, antwortet Frederik Harner. Er senkt seine Stimme, sodass Jarl nur mit Mühe verstehen kann, was er seinem Klienten sagt. »Sie erinnern sich bestimmt noch an die Angelegenheit mit dem Sanday-Hort vor gut zehn Jahren?«
Mr. Mithothin antwortet nicht, aber das Aufleuchten in seinem Blick ist Reaktion genug.
»Sie wollten sofort persönlich benachrichtigt werden, wenn sich eine neue Situation ergeben sollte. Jemand von damals ist wieder auf unserem Radar aufgetaucht.«
Mr. Mithothin zieht ein Mobiltelefon aus der Tasche seiner dicken Outdoor-Tarnjacke und schaltet es ein. »Wir kehren am besten so schnell wie möglich nach Oslo zurück. Erzählen Sie mir alles, was Sie in Erfahrung gebracht haben.«
»In Ordnung«, sagt Harner. Mit großen Storchenschritten folgt er Mr. Mithothin in der Schneespur, die zum Rand der Senke hinaufführt, wo die Ausrüstung der beiden Jäger liegt.
»He, Sie!«, schreit Ingrid ihm hinterher.
Mr. Mithothin dreht sich zu ihr um, als nähme er jetzt erst wahr, dass sie existiert.
Ingrid deutet auf den Wolfskadaver. »Was ist mit ihm? Sie haben ihn verdammt noch mal geschossen. Wollen Sie ihn nicht mitnehmen? Darum ging es Ihnen doch, oder etwa nicht? Ihn zu erlegen, damit Sie ein Foto von sich mit ihm machen und sein Fell an die Wand hängen können!«
»Ich bin kein Trophäenjäger«, entgegnet Mr. Mithothin kühl. »Machen Sie mit dem Kadaver, was Sie für richtig halten. Was ich von dem Wolf wollte, das habe ich bereits bekommen.«
Ohne ein weiteres Wort dreht er sich wieder um und stapft zum Rand der Senke hinauf, gefolgt von seinem Anwalt.
Ingrid stößt Luft aus ihrem Mund, die einen Augenblick lang als kaum sichtbare Atemwolke vor ihrem Gesicht hängt. Sie klingt genervt, aber Jarl glaubt unter dem Ärger noch etwas anderes wahrnehmen zu können. Sie ist heilfroh, dass Mr. Mithothin, oder wie auch immer er tatsächlich heißt, den Grund und Boden ihrer Familie wieder verlassen wird.
»Wir müssen den Wolf für DNA-Proben mitnehmen«, sagt er leise an seine Schwester gerichtet. »Ich kann einen Schuss auf die Wunde abfeuern, dann fällt es nicht auf, dass er zuvor von einem Pfeil getroffen wurde. Er …« Jarl zögert und nickt in Richtung Kadaver. »Jedenfalls hat er nicht gelitten. Er war sofort tot.«
Ingrid erwidert nichts. Jarls Blick schweift an ihr vorbei in die Dunkelheit des Waldes jenseits der Lichtung, die mit jeder weiteren Minute näher an sie heranrückt.
Einer der neun Wölfe, die eine Gruppe von Bleistifttätern in einem Bürogebäude in Oslo als diesjährige Quote festgelegt hat, ist tot. Wo sich die anderen acht wohl gerade verbergen, hinter denen Hunderte von lizensierten und illegalen Jägern her sind? Wenn sie schlau sind, fliehen sie weit nach Osten über die schwedische Grenze. Norwegen ist kein gutes Land für Wölfe. Zu viele andere Raubtiere.
1
Die Farbe meiner Vergangenheit ist Orange.
Wenn ich Worte höre, sehe ich Farben, so war es schon immer. Als ich noch ein Kind war, dachte ich, es würde allen Menschen so gehen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand nicht so empfand. Es wäre mir wie Blindheit vorgekommen.
Bei manchen Wörtern wirft etwas in meinem Kopf einen Eimer Farbe um, der meinen Verstand ausfüllt. Ich höre oder lese das Wort »Mutter« und sehe vor meinem inneren Auge das warme Goldbraun von Akazienhonig.
Ich höre das Wort »Vater« und ich denke an das Blau der Gákti-Tracht meiner Familie, ein so tiefes und gleichzeitig so leuchtendes Blau, dass es auf Fotos aussieht, als hätte man die Aufnahmen durch mehrere Instagramfilter gejagt.
Ich höre den Namen meines Bruders, Atle, und ich sehe die gleiche Farbe wie bei dem Wort »Schnee«. Es ist nicht das gleißende Weiß eines sonnigen Wintertags, das die Hochebene der Finnmark bis zum Horizont schier explodieren lässt, sodass man die Augen zusammenkneifen muss, um nicht geblendet zu werden. Es ist das stumpfe, tote Weiß von wolkenverhangenen Tagen im Februar, wenn der Schnee bleich und schwer wie die Steinplatten auf Gräbern über dem Land liegt.
Ich vermisse die weiten, schneebedeckten Ebenen der Arktis. Momentan gehören sie zu meiner Vergangenheit, aber es ist nicht die Farbe von Schnee, an die ich denke, wenn mir meine Kindheit in den Sinn kommt. Die Farbe meiner Vergangenheit ist die satte, leuchtende Farbe kleiner Beeren, eine Vielzahl winziger Sonnen, verstreut in der Tundra.
Manchmal, aber nicht immer, erlebe ich diese synästhetische Wahrnehmung andersherum. Genau jetzt zum Beispiel. Ich bin in Oslo Gast auf einer Party. Auf dem Wohnzimmertisch vor mir steht eine Glasschale mit mehreren Orangen. Der Schein der Kerzenflammen über ihnen lässt sie in einem warmen Licht erstrahlen. Ich starre auf die runden Früchte in der Schale, und die laute Musik der Stereoanlage und das Stimmengewirr der Partygäste im Raum um mich herum verblassen wie Details eines vergilbten Zeitungsfotos. Das leuchtende Orange katapultiert mich zurück in einen längst vergangenen Sommer.
Ich knie im Moos nahe einem schmalen Bach, dessen Ränder so von hohem Gras überwuchert sind, dass ich den Verlauf seines dunklen Bandes mehr erahnen als sehen kann. Der Boden ist weich und nachgiebig, er fühlt sich an, als würde ich auf meiner Bettmatratze herumlaufen. Um mich herum leuchten die orangefarbenen Multebeeren. Sie stechen wie kleine Scheinwerfer aus dem satten Grün hervor.
Ich bücke mich und pflücke eine von ihnen, die gerade so reif ist, dass sie sich vom Stängel löst, ohne dass ich lange an ihr ziehen muss. Ich stecke sie in den Mund, schmecke ihren leicht mehligen Geschmack. Sie sind die einzigen Beeren, die frisch gepflückt wie fertige Marmelade aus dem Glas schmecken. Nicht jeder mag sie. Meine beste Freundin Siri aus dem Kindergarten verzieht das Gesicht, wenn wir bei ihr zu Hause spielen und ihre Mutter uns Multebeeren und Zucker auf eine Scheibe Weißbrot schmiert. Sobald wir wieder allein sind, bekomme ich ihr Brot mit dem orangefarbenen Aufstrich hingeschoben. Ich nehme es gerne.
Aber am liebsten esse ich sie direkt da, wo ich sie pflücke. Ich beuge mich vor und strecke meinen rechten Arm so weit wie möglich aus, um eine der Beeren zu erreichen, die an ihrem langen Stängel baumelt und über den Rand des Bachs hinauswächst. Jetzt höre ich deutlich das dumpfe Glucksen des Wassers. Ich ziehe mein rechtes Bein nach vorn, um noch näher an die Beere heranzukommen, aber mein Fuß versinkt im Gras, ohne festen Grund zu finden, und ein Schwall Wasser schwappt über den Rand meines Gummistiefels, so unerwartet und eiskalt, dass ich überrumpelt aufkeuche.
Hinter mir rührt sich etwas. Ein Paar Hände packt mich und reißt mich hoch, heraus aus dem trügerischen Untergrund. Ich werde herumgeschwenkt und wie eine Puppe auf einen halbrunden Stein gestellt. Er ist so stark von Gras und Blaubeerpflanzen überwuchert, dass von ihm nicht viel mehr als eine Erhebung auf dem Boden zu sehen ist. Jedenfalls ist es sicherer Grund.
Atle blickt mit einem breiten Grinsen auf mich herab. Ich bin längst nicht mehr im Kindergartenalter, doch so sieht er in meiner Erinnerung immer aus, hochgewachsen, ein Riese, für dessen Anblick ich meinen Kopf in den Nacken legen muss, wenn ich direkt vor ihm stehe. Er ist keine Schönheit: ein rundes, pausbäckiges Pfannkuchengesicht, Sommersprossen und etwas schief stehende Vorderzähne, die man zwar nur dann zu sehen bekommt, wenn sich seine Lippen zu einem Lachen zurückziehen, aber er lacht gerne und viel. Damals jedenfalls.
»He, Multemonster, pass auf, dass du vor lauter Gier nicht in den Bach fällst«, sagt er gutmütig.
»Ich bin kein Multemonster«, gebe ich wie automatisch zurück. Es ist ein altes Spiel zwischen uns: Er nennt mich fast nie bei meinem richtigen Namen. Stattdessen gibt er mir alle möglichen Spitznamen, und ich weise jeden von ihnen zurück, halb im Spaß und halb ernsthaft beleidigt, denn keiner von ihnen ist mein Name.
Atles Grinsen ist unerschütterlich. »Klar bist du das Multemonster.«
»Bin ich nicht. Ich bin Sara.«
Mühevoll kämpfe ich meinen Fuß aus dem nassen Gummistiefel. Ich balanciere auf einem Bein, während ich mich mit einer Hand an Atle abstütze und mit der anderen das Wasser aus dem Stiefel schütte. Mit der grandiosen Geste eines Bühnenmagiers zieht er einen frischen, weißen Wollsocken aus seinem Rucksack hervor und hält ihn mir entgegen.
»Hier, zieh den an.«
»Du hast extra Socken mitgenommen?« Ich schaue ihn staunend an.
»Bei welcher Villmarksregel waren wir stehengeblieben?«, fragt er trocken zurück.
Ein weiteres Spiel zwischen uns. Villmark, das ist das wilde Land außerhalb von Kautokeino, wo wir wohnen. Atle legt Wert darauf, dass ich weiß, wie ich mich hier draußen verhalte. Seine Villmarksregeln. Ich merke mir nicht die Nummern, ich bin mir nicht einmal sicher, dass die Reihenfolge tatsächlich eine Rolle spielt.
»Hundertundelf?«, frage ich.
»Könnte hinkommen«, sagt er, die Stirn in gespielter Nachdenklichkeit gerunzelt. »Also, Villmarksregel Hundertundelf: Du hast immer ein Extrapaar Socken dabei, für alle Fälle.«
»Okay.« Ich ziehe den frischen Socken über. Mein Gummistiefel ist zwar immer noch feucht, aber der Wollstoff ist so dick, dass ich die Nässe kaum spüre.
»Jetzt kann ich wieder Multe sammeln«, verkünde ich zufrieden und stampfe auf dem weichen Moos auf, wie um meinen Worten Nachdruck zu verleihen.
»Psst!«, macht Atle. Nervös blickt er zum Kamm des flach ansteigenden Hügels hinauf, an dessen Fuß wir stehen. Ich recke den Hals und folge seinem Blick, um zu sehen, was er sieht, aber ich kann nicht erkennen, was seine Aufmerksamkeit geweckt hat.
»Was ist …«, flüstere ich, aber bevor ich meine Frage beenden kann, legt Atle einen Finger an den Mund. Seine Augen funkeln mich eindringlich an. Und jetzt sehe ich es ebenfalls: Auf dem Hügelkamm bewegt etwas die Zweige der niedrigen Bergbirken, die so klein und verwachsen sind, dass sie fast wie Gebüsche aussehen. Es tritt zwischen zwei freie Bäume, ein dunkler Schemen vor dem sonnigen Nachmittagshimmel, groß und unförmig.
Wie in Zeitlupe wendet Atle sich mir zu und hebt mich langsam hoch.
»Das ist ein Bär«, flüstert er an meinem Ohr. Seine Stimme klingt ruhig, aber ich kenne meinen Bruder trotz meiner fünf Jahre bereits zu gut. Ich kann die Anspannung unter seiner Gefasstheit ahnen. »Keine Sorge, Sara, alles ist gut. Mach genau das, was ich sage.«
Er hat mich bei meinem Namen genannt. Plötzlich muss ich vor Aufregung dringend pinkeln.
Von einem Augenblick auf den anderen ist die Erinnerung an meine Kindheit wieder verschwunden. Das Orange der reifen Multebeeren, dessen Leuchten meinen Verstand ausgefüllt hat, verblasst wie unter einem gleißenden Sonnenstrahl.
»Mach das Scheißlicht aus!«, schimpft Odd, der Gastgeber der Party und der Mann, in dessen Altbauwohnung im Bezirk Grønland ich für den Moment untergekommen bin, bis ich eine eigene Wohnung hier in Oslo gefunden habe. Er ist ein hochgewachsener, breitschultriger Kerl, dessen blondes Haar jetzt schon, mit Mitte Zwanzig, so schütter geworden ist, dass er es bis auf die Stoppeln abrasiert hat. Seine blassrosa Geheimratsecken glänzen im grellen Licht eines Deckenstrahlers direkt über ihm wie Speck. Er wehrt den plötzlichen Schein, der den eben noch dunklen Raum überflutet hat, mit einer Hand an den Augen ab. Ärgerlich funkelt er einen Typen an der Tür zum Wohnzimmer an, der sich gerade mit dem halb überraschten, halb belustigten Blick eines schwer Betrunkenen von der Wand abstößt, wo er sich an den Lichtschalter gelehnt hatte.
»Ja, Licht aus, Mann!«, raunzt jemand hinter mir, wo sich eine Handvoll Leute mit Bierdosen in den Händen an einem der hohen Fenster drängt, um Zigarettenrauch auf die dunkle Straße zu blasen. Die Winterluft weht mir kalt über den Rücken.
»Sorry«, sagt der Typ. Durch den Vorhang seiner strähnigen, blonden Haare, die ihm tief ins Gesicht fallen, wirft er Odd einen verlegenen Seitenblick zu. Er drückt auf den Schalter. Sofort ist der Raum wieder in trübes, honigfarbenes Licht getaucht, das von einem Teller mit brennenden Kerzen auf dem niedrigen Wohnzimmertisch ausgeht. Erleichtertes Lachen brandet auf. Ich werfe noch mal einen Blick auf die Schale mit den Orangen vor mir, aber das Fenster in die Vergangenheit hat sich für den Moment geschlossen. Ich weiß nicht, ob ich froh darüber sein soll oder nicht.
Odd kommt mit zwei Whiskygläsern in der Hand auf mich zugesteuert. Die Drinks, die in ihnen umherschwappen, sehen allerdings nicht nach Whisky aus. Er hält mir eines der Gläser entgegen. »Hier!«, ruft er mir über die laut losdonnernde Musik seiner Anlage hinweg zu, die nach einer kurzen Pause gerade wieder eingesetzt hat. »Kann doch meine neue Mitbewohnerin nicht auf dem Trockenen sitzen lassen!«
Ich rieche an dem undefinierbaren schwarzen Inhalt des Glases. Der Geruch von Lakritz steigt mir in die Nase, während sich ein lautes Black-Metal-Gitarrensolo aus den Lautsprechern höher und höher schraubt. Ich weiß weder, was für eine Band gerade spielt, noch, was genau ich da trinken soll.
»Was ist das?«, schreie ich über den Gesprächslärm und die Musik hinweg Odd zu.
»Black Magic. Wodka mit zerstoßenem Lakritz.«
Er grinst breit, als ich ohne weitere Erwiderung mein Glas gegen seines klirren lasse und einen tiefen Schluck nehme. Wahrscheinlich ist es ein Test, um zu sehen, ob ich wirklich so viel vertrage, wie man es den Nordlendingern, den Nordnorwegern, nachsagt. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand versucht, mich unter den Tisch zu trinken.
»Gar nicht so schlecht«, sage ich. Ich weiß nicht, ob Odd mich gehört hat, aber er leert wie zur Zustimmung sein Glas in einem Zug und verzieht halb genießerisch, halb angeekelt das Gesicht.
Ich hatte erwartet, dass er gleich zum nächsten seiner zahlreichen Gäste weiterwandern würde. Heute Abend haben wir kaum eine Handvoll Sätze miteinander gewechselt. Stattdessen bleibt er neben mir stehen und lehnt sich mit dem Hintern gegen die Tischplatte. Offenbar nähert sich eine Unterhaltung. Ich kenne Odd nicht einmal wirklich. Dass ich im Gästezimmer seiner Wohnung untergekommen bin, verdanke ich meiner alten Freundin Siri Gaup. Seit zwei Jahren haben die beiden eine Beziehung, und vor kurzem ist sie sogar bei Odd eingezogen. Etwas früh, wenn man mich fragt, aber man hat mich nicht gefragt. Siri ist schon kurz nach ihrem Schulabschluss nach Oslo gegangen. Der Norden war nichts für sie. Sie hatte sich in Kautokeino nie wohl gefühlt. Ein wenig kann ich sie verstehen. Auf dem Land kennt jeder jeden. Die Tundra ist weit wie der offene Himmel, aber wenn es um Menschen geht, um die Familien und ihre vielfältigen Verstrickungen, ist das Leben in Finnmark so eng wie die schließfachgroßen Einzimmerwohnungen in Tokio, die ich in Dokumentarsendungen im Fernsehen gesehen habe. Ich bin ebenso wenig ein Familienmensch wie Siri, aber ich hatte diesen Nachteil immer in Kauf genommen. Woanders als in Finnmark zu leben, hätte ich mir nie vorstellen können.
Siri dagegen wollte weg. Als ich vorgestern in Oslo ankam und sie mich am Flughafen abholte, sah ich sie zum ersten Mal seit vier Jahren wieder. Sie hat sich kaum verändert, nur ihr Haar trägt sie nicht mehr so lang wie früher, sondern modisch kurz.
Wo ist sie eigentlich? Unwillkürlich sehe ich mich nach ihr um.
»Na, was hältst du von Oslo?«, ruft Odd mir zu. Die Musik dröhnt mir so laut in den Ohren, dass ich ihn kaum verstehe. Ich überlege mir, in die Küche zu gehen, wo es hoffentlich ein wenig ruhiger ist.
»Ich hab noch kaum was von der Stadt gesehen!«, gebe ich mit erhobener Stimme zurück. Das stimmt nicht ganz – ich habe in der kalten Januarluft ein paar Spaziergänge entlang der Uferbänke des Flusses Akerselva hinter mich gebracht, weil ich das Gefühl hatte, in Odds Wohnung wie in einem Luftschutzbunker eingesperrt zu sein. Aber noch ist mir Norwegens Hauptstadt so fremd wie die abgewandte Hälfte des Mondes. Einmal war ich hier auf Klassenfahrt. Damals war ich zwölf, und ich habe kaum noch Erinnerungen daran, außer, dass es verregnet war und das trübe Wetter das Königsschloss wie einen riesigen, hässlichen Ziegelstein aussehen ließ, ganz anders als auf den Bildern der 17.-Mai-Paraden im Fernsehen.
Odd nickt auf meine Antwort, wobei er auf seine Schuhe starrt. »Wirst dich hier schon zurechtfinden!« Seine Stimme klingt überzeugt von dem, was sie sagt. Sie hat denselben Ton, mit dem Leute verkünden, dass Katzen irgendwie immer auf ihren Füßen landen.
»Siri hat mir das mit deinem Bruder erzählt«, sagt er. »Heftige Sache.«
Bei dem Wort »Bruder« treibt Schnee vor meinen Augen zu Boden, weiß und glanzlos wie Gips. Mein Inneres, das eben noch von dem Salzlakritz-Wodka erwärmt wurde, verwandelt sich in Eiswasser. Ich setze das Glas an meinen Mund und leere es ruckartig in einem Zug. Ich höre kaum, wie Odd weiterredet, irgendwas von herzlichem Beileid. Auf einmal möchte ich am liebsten weg von hier. Es ist mir alles zu viel, mein Umzug von Nordnorwegen in den Süden nach Oslo, die vielen Leute, der Lärm und die Enge.
Wie zur Erklärung halte ich Odd mein leeres Glas vors Gesicht. »Ich hol mal eben Nachschub.«
Er nickt, sichtlich erleichtert, dass er seine Kondolenzen so schnell hinter sich bringen konnte. Während ich mich auf den Weg in die Küche mache, sehe ich, wie er sich auf die Tanzfläche schwingt, die freigeräumte Mitte des Wohnzimmers, wo sich schon zwei Typen und eine Frau zu den wummernden Gitarrenriffs wiegen, als wäre es ein kuschliger Song von The Cure.
In der Küche finde ich Siri. Sie steht an einer langen Arbeitsplatte und schnippelt Zitronenscheiben für Tequilashots. In den beiden Tagen, seitem ich in Oslo angekommen bin, habe ich gesehen, wie sie sich um den Haushalt ihres Freundes gekümmert hat, beinahe wie ihre Mutter früher um ihre riesige Familie. Sie kommen aus völlig verschiedenen Welten und haben eine klare Aufgabenverteilung. Odd hat seine Autowerkstatt und seinen Biker-Club, sie hat die Wohnung und ein Anglistikstudium, von dem ihr Freund vermutlich denkt, dass es so eine Art Hobby ist, nicht etwas, womit sie tatsächlich irgendwann Geld verdienen will. Vielleicht denkt Siri insgeheim dasselbe.
»Soll ich dir helfen?«, frage ich sie.
»Danke, aber ich bin schon so gut wie fertig«, erwidert sie und wischt sich die Hände an einem Geschirrtuch ab. »Die Jungs vom Club schreien schon nach einer neuen Runde Tequila. Wenn das nächste Mal einer von denen Geburtstag hat, sollen sie gefälligst wieder im Clubhaus feiern – Renovierarbeiten und ausgefallene Heizung hin oder her. Das mache ich nicht noch mal mit. Vollidioten, die ganze Bande.«
Sie setzt sich die halbvolle Tequilaflasche direkt an den Mund und nimmt einen Schluck, bevor sie mir die Flasche hinhält. Ich nehme ebenfalls einen Schluck, ohne mir die Mühe zu machen, etwas von dem Tequila in eines der kleinen Gläser zu gießen, die aneinandergereiht wie Zinnsoldaten auf der Arbeitsplatte stehen. Ich bin noch nie ein Fan von Trinkritualen gewesen. Das ganze Getue um Salz auf dem Handrücken und Beißen in die Zitronenscheibe lenkt doch nur von dem ab, worum es geht: trinken.
Als ich absetze, kreuzen sich unsere Blicke, und zum ersten Mal, seitdem ich sie vor zwei Tagen in der Ankunftshalle von Oslo Gardermoen wiedergesehen habe, ist es wieder wie früher, als sei tatsächlich keine Zeit vergangen. Bilder aus der Vergangenheit blitzen wie unter Stroboskoplicht durch mein Bewusstsein: Siri in einem scheußlichen rosa Pyjama auf dem Bett in meinem Kinderzimmer mit einer Spange über den Vorderzähnen. Siri und ich hinter dem Holzschuppen ihres Elternhauses, wo die Fische zum Trocknen hängen und es nach dem bitteren Rauch von Wachholderholz riecht, während wir uns unsere erste Zigarette hin und her reichen. Siri, den Kopf hochrot wie ein reifer Apfel, wie sie auf der Bühne des Gemeindehauses begeistert zu Wonderwall von Oasis Karaoke singt, während wir sie johlend anfeuern.
Als hätte sie in meinen Kopf hineingesehen, fängt Siri prustend an zu lachen, und ich stimme mit ein.
Jemand wummert an die Wohnungstür. Es klingt so laut, dass wir es sogar über die Musik hinweg in der Küche hören können. Ich frage mich, ob der Partylärm einem der Nachbarn allmählich auf die Nerven geht. Aber dann vernehme ich laute, erfreute Stimmen, eine davon ist die von Odd. Er kommt mit einem Mann im Schlepptau in die Küche, der noch größer ist als er selbst. Der Riese hat im Gegensatz zu ihm strähniges, langes Haar, das ihm bis über die Schultern auf seine dunkelbraune Lederjacke hinabfällt.
»Das ist Asbjørn«, stellt Odd ihn mir vor. Er grinst verschwörerisch. »Wir haben gehofft, dass er kommen würde.«
Tatsächlich habe ich an diesem Abend mit halbem Ohr ein paar gebrüllte Unterhaltungen von Leuten aus Odds Club mitgehört, in denen es darum ging, dass sie noch auf jemanden warten, den sie den Schneemann nennen. Der Name hört sich an, als stamme er direkt aus einem dieser schlechten Filme aus den Achtzigern, die im Fernsehen im Nachtprogramm laufen. Offenbar ist er einer der Leute, von denen Odd und seine Bikerfreunde Drogen beziehen, auch wenn er nicht zu ihnen gehört.
»Und hier bin ich«, sagt Asbjørn an Odd gerichtet und blickt zu mir herab. Er lächelt, aber ich kann keine Freundlichkeit in seinen Augen finden. Sie sehen aus wie die von toten Fischen, dunkel und stumpf.
»Sara ist eine Freundin von Siri aus Kautokeino«, erklärt Odd. »Sie ist frisch hier in Oslo angekommen.«
Asbjørns Lächeln verbreitert sich, ohne dass es ihn mir sympathischer macht. »Sara aus Kautokeino«, sagt er mit gespielt hoher Stimme, wobei er die vorletzte Silbe betont, ein ziemlich schlechter Versuch, Finnmarkdialekt nachzuahmen. Bestimmt kommt gleich ein Spruch, dass ich wie eine typische Samin aussehe, was auch immer das bedeuten soll. Wir alle sehen so unterschiedlich aus, blond, dunkelhaarig, asiatisch, kaukasisch. Dabei gibt es durchaus etwas, das uns eint, aber das findet man nicht im Aussehen, es ist nichts, worauf man mit dem Finger deuten könnte. Es liegt zwischen den Gesichtern.
»Was macht denn eine von euch hier, so weit weg vom Moralkreis?«
Ich muss mir auf die Zunge beißen, um ihm nicht zu entgegnen, was ich von Typen halte, die jemandem aus dem Norden gleich bei der ersten Begegnung diesen bescheuerten Ausdruck ins Gesicht klatschen. Er ist immerhin Odds Freund. Böse Zungen nennen den Polarkreis manchmal Moralkreis, weil sie der Meinung sind, wir würden es hoch oben in Finnmark bei vielen Dingen im Umgang miteinander weniger streng halten. Wahrscheinlich stellen sie sich vor, dass dort ganze Dörfer miteinander rammeln wie die Kaninchen.
Als ich nicht antworte, blickt er von Odd zu Siri.
»Ich … ich hab mal eine Luftveränderung gebraucht«, stoße ich schnell hervor, bevor sie etwas sagen können. Das Letzte, was ich gerade will, ist, dass einer der beiden Asbjørn gegenüber meinen Bruder erwähnt.
»Luftveränderung«, wiederholt er. Dabei schiebt er das Wort in seinem Mund herum, als wäre es ein Schluck Wein, dessen Geschmack er herausfinden will. »Na, dann bist du hier gerade richtig. Wenn du mal eine Stadtführung brauchst, zeig ich dir gerne die besten Ecken.«
Er zwinkert mir mit ausgebreiteten Armen zu, und ich weiß nicht, ob ich angesichts seines plumpen Auftritts lachen soll.
»Komm, wir lassen die beiden alleine«, kommt Siri mir zu Hilfe. Sie hat zwei Whiskygläser halb mit Tequila gefüllt. Jetzt hakt sie mich bei sich unter und zieht mich aus der Küche. Asbjørn sieht mir kurz nach, dann wendet er sich wieder Odd zu.
»Danke für die Unterstützung«, murmele ich im Flur.
»Schon gut. Asbjørn ist nicht jedermanns Sache.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ überhaupt jemandes Sache ist.«
Siri wiegt den Kopf hin und her und seufzt. »Ich weiß. Aber die Jungs aus Odds Club kriegen ihr Zeug von ihm.«
»Zeug? Was für Zeug? Gras, Crystal, Heroin?«
»Doch kein Heroin!« Sie hört sich erschrocken an, und ich verkneife mir die Bemerkung, ob Crystal denn viel harmloser wäre. Sie blickt an meiner Schulter vorbei. Ich drehe mich kurz um und sehe hinter uns einen grauhaarigen Mann Mitte Vierzig im Flur stehen. Er muss einer der Ältesten unter den Gästen sein. Mit seinem dunkelgrünen Parka sieht er aus, als sei er eben gekommen oder wolle gerade gehen. Er trinkt aus einer Bierflasche und sieht durch die offenstehende Tür zum Wohnzimmer den Tanzenden zu.
»Ecstasy und Crystal«, höre ich Siri mit leiser Stimme sagen und wende mich ihr wieder zu. »Ich bin auch nicht begeistert davon«, sagt sie wie zur Entschuldigung. »Du kennst mich, ich nehm so was nicht. Aber Odds Kumpels sind anders drauf.«
»Und was ist mit Odd?«, frage ich.
»Hin und wieder kauft er Ecstasy von ihm. Ich will nicht, dass er Meth nimmt. Ich hab ihm gesagt, dass ich mich dann von ihm trennen würde. Aber …« Ihre Stimme verklingt.
»Du bist dir nicht sicher, ob er nicht doch heimlich etwas von ihm kauft.«
»Ich bin nicht dabei, wenn er was mit seinen Kumpels unternimmt. Das ist seine Welt, und ich hab meine. Aber er hat eine Menge Schulden bei Asbjørn, das weiß ich. Deswegen hofiert er ihn in der letzten Zeit auch ständig. Lädt ihn ein, lässt ihm alles durchgehen, egal, wie daneben er sich aufführt.«
Sie seufzt und zuckt kaum merklich die Schultern. In dieser kleinen Geste liegt all das verborgen, was sie nicht ausspricht, die Risse in der Fassade ihrer Beziehung zu Odd, die Dinge, die Paare hinnehmen, so als würde das, was einen am anderen stört, irgendwie von selbst wieder verschwinden, wenn man nur die Augen fest zukneift, oder als würde man sich schon irgendwie daran gewöhnen, weil man ja schließlich immer Kompromisse machen muss. Bis man vor lauter Kompromissen irgendwann nicht mehr erkennbar ist.
Ich würde ihr gerne etwas sagen. Etwas wie: »Du musst für dich einstehen. Wenn Odds Schulden und die Drogen eure Beziehung belasten, kannst du das nicht einfach so hinnehmen.«
Aber ich weiß nicht, ob gerade der richtige Moment ist. Wir sind beide angetrunken, und ich habe das Gefühl, dass der Grauhaarige in dem Parka uns genau zuhört, während sein Blick ins Wohnzimmer gerichtet ist. Jetzt bin ich es, die den Arm meiner Freundin ergreift. Ich ziehe sie an ihm vorbei in den Raum.
»Wer ist der Typ im Flur?«, frage ich sie.
»Das ist Geir. Kein Freund von Odd, sondern von mir. Er ist in Ordnung.«
»Ich hatte das Gefühl, dass er uns beobachtet.«
Siri lächelt. »Keine Sorge, er ist kein creep. Er steht immer irgendwo herum und beobachtet die Leute. Das kommt bei ihm wahrscheinlich mit dem Beruf. Er hat Kunst studiert.«
»Was macht er denn?«
»Er hält sich mit Malereien und Installationen über Wasser. Du würdest seine Sachen wahrscheinlich mögen. Sie sind irgendwie … mystisch.«
Ich glaube zu wissen, was sie damit meint. Im Gegensatz zu mir hat Siri sich nie besonders für die Mythen unserer Vorfahren interessiert. Das alles ist für sie ebenso wie das Christentum immer nur religiöser Hokuspokus gewesen.
»Geir kennt sich mit den alten Sagen aus«, fährt Siri fort. »Im letzten Sommer hat er von Odd eine Auftragsarbeit angenommen. Er hat ihm dieses Pferd aus der nordischen Mythologie auf den Tank und die Seitenverschalung seines Bikes gemalt, als Airbrush-Art.«
»Sleipnir?«
»Ja, ich glaube, das war der Name.«
Ich bin nie tief in die nordische Mythologie eingetaucht, mein Interesse galt immer mehr den Traditionen meines eigenen Volkes. Wir Samen haben nie die nordischen Götter verehrt. Als man meinen Vorfahren den Segen der Zivilisation einprügelte, geschah das im Zeichen des Kreuzes. Aber natürlich kenne ich das achtbeinige Pferd, mit dem Odin durch die neun Welten reist. Ich muss unwillkürlich grinsen, während die Farbe Schwarz vor meinen Augen aufblüht, das Schwarz von Rabenfedern. Sleipnir ist ein stimmiges Motiv für ein Motorrad.
Siri reicht mir eines der beiden Gläser mit dem Tequila. Sie nimmt einen tiefen Schluck und legt die Stirn in Falten. »Ich kann gut verstehen, dass du nach der Einäscherung raus aus Kautokeino musstest. Haben Sie’s dir schwergemacht?«
Ich nehme ebenfalls einen Schluck von dem Tequila und blicke auf die fremden Menschen im Raum. »Du machst dir keine Vorstellung.«
Aus dem Augenwinkel sehe ich sie nicken. »Du hättest nach dem Studium nicht wieder nach Hause gehen sollen. Du bist eine ausgebildete Therapeutin!«
»Was hätte ich machen sollen?«, entgegne ich ihr müde. Die Diskussion habe ich selbst mit mir so oft geführt. »Mama und Marja haben mich nach Papas Tod gebraucht.«
Trotz des Lärms im Raum höre ich sie seufzen. »Ich weiß ja. Vergiss, was ich gesagt hab. Jetzt bist du hier, und das ist es, worauf’s ankommt.«
Eine Weile sitzen wir schweigend auf der breiten Couch in der Mitte des Wohnzimmers, trinken mehr Tequila und lauschen der Musik und dem lauten Stimmengewirr im Raum. Ein warmes Gefühl der Erleichterung breitet sich in mir aus. In den zwei Tagen seit meiner Ankunft in Oslo hatten wir kaum Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Siri hatte lange Vorlesungen. Aber jetzt verbringen wir Zeit miteinander, und auf einmal ist es gar nicht mehr wichtig, sich zu unterhalten. Wir sitzen nebeneinander, wie früher. Ich kann sie riechen, und ich erinnere mich.
Der Tequila streckt die Zeit. Erst als sich eine Frau mit langen tiefroten Haaren direkt vor Siri stellt und sie mit rauer Stimme in ein Gespräch über deren anstehende Masterarbeit verwickelt, tauche ich von einem Moment auf den anderen aus dem Dunst aus Müdigkeit und Angetrunkenheit empor. Meine Blase meldet sich, und ich mache mich auf den Weg ins Bad.
Als ich wieder in den Flur trete, sehe ich die Tür zum Treppenhaus offenstehen. Die Luft in der Wohnung ist heiß und stickig, deshalb will ich auf die Straße hinausgehen und etwas kalte Luft auf dem Gesicht spüren.
Schon vor der ersten Treppenstufe vernehme ich undeutliche Stimmen. In der unteren Etage stehen zwei schattenhafte Gestalten vor den Fenstern, durch die ein wenig vom gelben Schein der Straßenbeleuchtung ins Treppenhaus dringt. Die Größe des einen der beiden ist unverkennbar. Es ist Asbjørn.
»Ausreden«, sagt er ungehalten, das erste Wort, das ich klar verstehen kann. Seine Stimme klingt tiefer als oben in der Küche. »Du hältst mich hin, Alex.«
»Nein, ehrlich!«, höre ich den anderen sagen. Ich vergesse nie eine Stimme, ebenso wie ich mich an das Gesicht von jedem Schauspieler erinnern kann, den ich einmal im Fernsehen gesehen habe. Es ist der betrunkene Typ, der sich gegen den Lichtschalter gelehnt hat. Seine Hände sind wie zur Abwehr erhoben. »Ich halte dich nicht … das ist keine Absicht!«
Asbjørns Arm schnellt vor. Er packt Alex und klatscht ihn hart mit dem Rücken gegen die Wand. Schräg über ihm auf der Treppe zucke ich erschrocken zusammen.
»Erzähl das meiner Bank! Die interessiert’s nicht, ob es Absicht war oder nicht. Die interessieren nur Zahlen. Hast du mein Geld oder nicht?«
»Ich …« Ich höre Alex schlucken.
Blitzschnell packt Asbjørn mit der freien Hand die des jungen Mannes. Ich höre das Knacken von Knochen, das hohl durch das Treppenhaus hallt. Beinahe im selben Moment schreit Alex hoch und schrill auf. Sein Oberkörper will sich nach vorne krümmen, aber Asbjørns andere Hand an seinem Hals hindert ihn daran. Er ringt nach Luft, hustet und schreit erneut auf.
»Das war der erste Finger«, erklärt Asbjørn trocken, als ob der höllische Schmerz nicht Hinweis genug für Alex wäre.
»Bist du völlig irre?«, kreischt Alex. Keuchend versucht er sich von Asbjørn zu lösen. »Scheiße, ich … ich sollte morgen bei meiner neuen Band vorspielen! Die nehmen mich nicht, wenn ich den Bass nicht anschlagen kann!«
Asbjørns Griff um Alex’ Hals und Hand lockert sich nicht. »Dann müssen die wohl ohne dein Talent auskommen. Zu blöd für dich. Also noch mal: Kannst du zahlen oder nicht? Jedes Mal, wenn ich die Frage stellen muss, breche ich dir den nächsten Finger.«
Alex stöhnt mit schmerzverzerrter Stimme auf. Mein Herz schlägt hart gegen meinen Brustkorb, aber ich nehme endlich meinen Mut zusammen.
»Lass ihn in Ruhe!«, rufe ich atemlos ins Treppenhaus hinab.
Asbjørn dreht sich zu mir um, als hätte er alle Zeit der Welt. Sein Gesicht liegt vor dem hellen Rechteck des Fensters im Schatten, aber ich glaube, eine verärgerte Miene ausmachen zu können.
»Die Kleine aus Kautokeino«, sagt er langsam. Er wirkt kaum überrascht, mich zu sehen. »Das geht dich nichts an, also misch dich nicht ein!«
»Und ob ich mich einmische!«, erwidere ich. »Du hast dem Jungen einen Finger gebrochen. Lass ihn sofort los, oder ich ruf die Bullen!«
Meine Hand fährt in meine Jeanstasche. Da steckt nichts weiter drin als mein Portemonnaie. Mein Mobiltelefon ist weg. Wahrscheinlich habe ich es im Wohnzimmer auf dem Tisch liegen lassen, in meiner Aufregung kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber das weiß Asbjørn nicht. Er lässt Alex los, der sich schnell an der Wand entlangbewegt und die Treppe hochhastet. Schnaufend stellt er sich hinter mich, als wäre ich allen Ernstes so etwas wie seine Beschützerin in weißer Rüstung.
Asbjørn starrt mich wütend an, während er mit schweren Schritten Alex hinterher und auf mich zustapft. Seine Lippen zucken, und schon als er den Mund öffnet, ist mir, als wüsste ich genau, was er mir entgegenschleudern wird.
»Du kleine Samischlampe!«
Das Wort explodiert in meinem angetrunkenen Kopf. Eine scharlachrote Wolke aus Hass füllt mein Denken aus, so physisch fühlbar wie Hitze, die von einem angeheizten und geöffneten Ofen ausgeht.
Ich schwanke und verliere beinahe mein Gleichgewicht. Asbjørns Arm schnellt auf mich zu und ergreift den meinen. Er reißt ihn aus der Hosentasche heraus, so schnell, dass ich noch um ein Haar Zeit genug habe, mein Portemonnaie loszulassen. Seine Augen richten sich auf meine leere Hand. Ich höre ihn hustend auflachen. Mit einem Ruck zieht er mich so dicht zu sich, dass ich den harten Alkohol riechen kann, den er ausdünstet. Jetzt scheint ihm das Licht der Straßenlaterne durch die Fenster ins Gesicht. Ich bin so fasziniert von seinem wütenden Ausdruck, wie ich davon entsetzt bin.