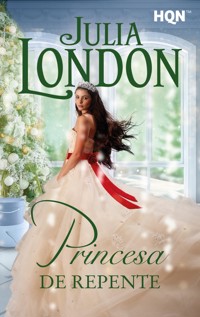12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Schicksal einer Familie in der stürmischen Regentschaftszeit: Die Romantik-Saga »Regency Passion« von Julia London jetzt als eBook bei venusbooks. Kann eine Familie stolzer Schotten im London des 19. Jahrhunderts glücklich werden? Als seinem Clan ein kostbares Erbstück gestohlen wird, steht für den hitzköpfigen Liam Lockhart sofort fest: Das wird er diesen Engländern nicht durchgehen lassen! Um den Dieb zu finden, präsentiert er sich auf den rauschenden Bällen des versnobten englischen Adels als vollendeter Gentleman, gibt sich sogar der Lächerlichkeit des Tanzens preis und macht den eitlen Damen schöne Augen. Er hat allerdings nicht mit Lady Ellen gerechnet, die ihn sofort zu durchschauen scheint und mit Charme und einer gehörigen Portion Skrupellosigkeit in ein riskantes Spiel verwickelt. Und während Liam bald schon nicht mehr weiß, ob er die englische Lady verwünschen oder verführen soll, stürzen sich auch sein stürmischer Bruder Griffin und seine gewitzte Schwester Mared in ungeahnte Abenteuer … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die Familiensaga »Regency Passion« von New-York-Times-Bestsellerautorin Julia London vereint ihre »Lockhart Clan«-Trilogie mit den Bänden »Feuer der Leidenschaft«, »Sturm der Sehnsucht« und »Fesseln des Verlangens«. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1600
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kann eine Familie stolzer Schotten im London des 19. Jahrhunderts glücklich werden? Als seinem Clan ein kostbares Erbstück gestohlen wird, steht für den hitzköpfigen Liam Lockhart sofort fest: Das wird er diesen Engländern nicht durchgehen lassen! Um den Dieb zu finden, präsentiert er sich auf den rauschenden Bällen des versnobten englischen Adels als vollendeter Gentleman, gibt sich sogar der Lächerlichkeit des Tanzens preis und macht den eitlen Damen schöne Augen. Er hat allerdings nicht mit Lady Ellen gerechnet, die ihn sofort zu durchschauen scheint und mit Charme und einer gehörigen Portion Skrupellosigkeit in ein riskantes Spiel verwickelt. Und während Liam bald schon nicht mehr weiß, ob er die englische Lady verwünschen oder verführen soll, stürzen sich auch sein stürmischer Bruder Griffin und seine gewitzte Schwester Mared in ungeahnte Abenteuer …
Über die Autorin:
Julia London ist eine »New York Times«- und »USA Today«-Bestsellerautorin und hat bislang mehr als 30 Romane veröffentlicht. Aufgewachsen in Texas, arbeitete die passionierte Hundebesitzerin viele Jahre lang in Washington für die amerikanische Regierung. Als sie ihre Liebe zum Schreiben entdeckte, machte sie diese jedoch zum Hauptberuf. Für den besten historischen Liebesroman erhielt sie bereits den »Romantic Times Book Club Award« und war sechs Mal unter den Finalistinnen für den begehrten »RITA Award«. Heute lebt sie wieder in Texas.
Mehr Informationen zu Julia London finden Sie unter julialondon.com.
Bei venusbooks veröffentlichte sie ihre »Highland Passion«-Trilogie, die in diesem Sammelband enthalten ist, sowie ihre »Regency-Kisses«-Trilogie mit den Bänden:»In den Fesseln des Dukes«»Gefangen von einem Lord«»In den Händen des Earls«Die Reihe ist auch im Sammelband »Fairchild – Die Regency-Schwestern« erhältlich.
***
Sammelband-Originalausgabe März 2022
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2022 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Bände finden Sie am Ende dieses eBooks.
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images sowie © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96898-167-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regency Passion« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Julia London
Regency Passion
Die große Saga in einem Band
venusbooks
Highland PassionFeuer der Leidenschaft
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Hartmann
Er hat geschworen, niemals einer Engländerin zu trauen – doch sie nimmt sein Herz gefangen … Die schottischen Highlands 1860. Vor vielen Jahren geschah das Unfassbare: Das kostbare Familienjuwel des stolzen Lockhart-Clans wurde von den englischen Besatzern geraubt. Nun schmiedet der stürmische Liam Lockhart einen gewagten Plan, um es zurückzugewinnen. Doch dafür muss er nach London reisen und sich mitten unter seine Feinde begeben. Dabei ahnt er nicht, was dort die größte Gefahr für ihn bedeuten wird: Die ebenso schöne wie geheimnisvolle Ellen Farnsworth. Ein Blick von ihr setzt sein Highlanderblut in Flammen – und Liam weiß: Er muss sie um jeden Preis für sich gewinnen. Aber wird er dafür alles riskieren müssen, was er liebt?
Prolog
In der Nähe von Aberfoyle,
im zentralen Hochland von Schottland, 1449
In Loch Chon und Umgebung sprach man noch viele Jahre lang davon, wie die schöne Lady of Lockhart wie eine Verrückte gelacht hatte, als ihr Gatte ihren Geliebten bangte – und das am Vorabend ihrer Verabredung mit dem Beil des Henkers.
Ein böser Wind fuhr im Herbst des Jahres 1449 über die Highlands und brachte zuerst den Tod des feisten Earl of Douglas, dessen Herz, nicht mehr in der Lage, die Belastungen durch seine Völlerei zu ertragen, schließlich stehenblieb. Derselbe böse Wind brachte seinen Sohn William in den Titel. Doch William war im Gegensatz zu seinem Vater stark und tüchtig – so tüchtig sogar, dass die Berater des jungen Königs James sich bedroht fühlten, besonders als James, an der Schwelle zum Mannsein, ihre weisen Ratschläge gewohnheitsmäßig ablehnte. Und in diesem Zwiespalt zwischen dem König und den Ratgebern sah William Douglas dann auch die Chance zum Ausbau seiner Macht. Die ergriff er, indem er den Berater Chrichton statt des Beraters Livingstone unterstützte, was bedeutete, dass alle, die auf Livingstones Seite standen, dem Untergang geweiht waren …
Unglücklicherweise gehörte zu jenen auch Anice of Lockhart, eine Frau, die von Loch Katrine bis Ballikinrain sowohl für ihren Verstand als auch für ihre Schönheit berühmt war. Dem Vetter Williams, Eoghann, dem Laird of Lockhart, mit einer Mitgift von zwanzig Sauen zur Frau gegeben, entdeckte Anice bald, dass Eoghann sich weder von ihrem Charme betören ließ noch ein liebevoller oder treuer Gatte war, sondern die rauhe Jagd und Hurerei vorzog. Dennoch gebar Anice dem unwürdigen Foghann fünf Söhne und eine Tochter. Während Foghann mit Letzterer nichts anfangen konnte, vergötterte er seine Söhne und ließ Anice und die Tochter; Margaret, häufig allein. Die schöne Anice führte ein derart erbärmliches Leben, dass es kaum überraschte, als sie sich in den hübschen Kenneth Livingstone verliebte.
Manche behaupteten, die bösen Winde jenes Herbstes hätten Kenneth Livingstone, einen Krieger und Neffen des engsten Beraters des Königs, zur Burg der Lockharts geweht. Und obwohl er zehn Jahre jünger war als Anice, reichte ein Blick in ihr schönes Gesicht aus, und Kenneth Livingstone wusste, dass er für diese Frau sterben würde.
Anice ihrerseits glaubte, diese Gelegenheit zur Liebe verdient zu haben; so viel vertraute sie ihrer Zofe Inghean an; und sie suchte voller Freude Kenneth’ Liebe, lebte tollkühn und verfolgte ihre ehebrecherische Affäre offen und für jedermann zu sehen – außer für Foghann, der sie wie gewohnt kaum beachtete.
Vielleicht hätte Anice ihr Glück noch viele Jahre auskosten können, wäre William nicht Earl of Douglas geworden. Wenngleich er es Anice nicht verübeln konnte, dass sie aus ihrer Ehe ausbrach – er kannte seinen Vetter Eoghann als elenden Kerl –, konnte er ihr doch nicht verzeihen, dass sie sich dazu einem Livingstone an den Hals warf. So war ihr Schicksal besiegelt; William schickte eine Gesandtschaft zur Burg seines Vetters, die laut das Todesurteil über die Ehebrecher verlas.
Während Eoghann nichts gegen Williams Dekret, dem zufolge Kenneth Livingstone hängen sollte, einzuwenden hatte, verwehrte er sich doch gegen das gleiche Urteil für seine Frau und beschloss, dass die Enthauptung eigentlich viel angemessener wäre für ihre Schandtat. Doch zuvor wollte er sie im alten Turm eine ganze Zeit gefangen setzen, damit sie den Bau des Blutgerüsts bezeugen konnte, auf dem sie und ihr Liebhaber in den Tod gehen sollten.
Wie Anices Zofe Inghean später ihren Enkelkindern erzählte, wurde Anice of Lockhart in jenen letzten vierzehn Tagen wahnsinnig. Sie stapfte mit wildem Blick in einer kalten Kammer ohne jegliche Annehmlichkeiten auf und ab und drückte die kleine, hässliche Skulptur eines Untiers, ein sogenanntes Beastie, an sich. Inghean erfuhr nie die Bedeutung dieser Skulptur; sie wusste lediglich, dass Anice und ihr Liebhaber irgendein spaßiges Geheimnis teilten und dass Livingstone das Ding zu ihrer Belustigung hatte anfertigen lassen. Das Schmuckstück war hässlich – in Gold gegossen, mit Augen und offenem Maul aus Rubinen, so dass es aussah, als würde es brüllen, und einem Schwanz, geflochten und mit Rubinen besetzt, der sich um die Klauenfüße legte.
Am Vorabend von Kenneth Hinrichtung durch den Strang rief Anice Inghean zu sich. Im Schoß hielt sie einen in ein Tuch eingeschlagenen Gegenstand. Langsam schlug sie das Tuch zurück und deckte einen Smaragd von der Größe eines Gänseeis auf. Es war ein Geschenk ihrer Mutter, sagte sie, der einzige Wertgegenstand, den sie Eoghann in all den Jahren ihrer Ehe hatte vorenthalten können. Anice wickelte den Smaragd wieder ein und flehte Inghean mit leiser, gehetzter Stimme an, ihr zu helfen. Sie drückte Inghean den eingewickelten Smaragd in die Hände, dann das hässliche Untier und bat sie, beides zu ihrem Bruder, dem Schmied, zu bringen und ihn zu bitten, den Smaragd in den Bauch des Beasties einzuschließen und so in Sicherheit zu bringen. Es war, so erklärte sie unter Tränen, ihr letztes, aber wichtigstes Geschenk an ihre Tochter Margaret.
Inghean konnte einer zum Tode Verurteilten den letzten Wunsch nicht abschlagen. Als es vollbracht war, kehrte sie, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie sich die Menschen zur Hinrichtung Kenneth Livingstones zusammenrotteten in den Turm zurück. Sie gesellte sich zu ihrer Herrin an die Brüstung ihres Turmgefängnisses und stand starr vor Entsetzen da, als Kenneth auf das Blutgerüst geführt wurde. Anice lachte meckernd wie eine Wahnsinnige, damit Eoghann ihre Angst nicht sah.
Dann hob Kenneth den Blick, sah Anice dort stehen, und Anice ergriff Ingheans Hand und grub die Fingernägel in ihr Fleisch, während sie zusahen, wie der Henker die Schlinge um Kenneths Hals legte. Und als der Henker zur Seite trat, lehnte Anice sich soweit über die Brüstung, dass Inghean fürchtete, sie würde stürzen, und schrie: »Fuirich do mi! – Warte auf mich!«
Der Henker zog den Strick, Kenneth’ Sturz erfolgte rasch wie auch das Brechen seines Genicks, und schlaff hing er da, und seine plötzlich leblosen Augen starrten leer auf die grölende Menge.
Anice ließ Ingheans Hand verzweifelt los und taumelte, so schlaff wie der Körper ihres Liebhabers, rücklings gegen die Brüstung.
Später bat sie, ihr die Skulptur und ihre Tochter Margaret zu bringen, die noch ein kleines Mädchen war. »Hör mir zu«, flüsterte sie, als Margaret in ihre Kammer gebracht worden war. »Sieh, was ich dir hier gebe«, sagte sie und nahm Inghean die Skulptur aus den Händen, »und versprich mir, es unter Einsatz deines Lebens zu hüten.«
Als Margaret nicht gleich antwortete, schüttelte Anice sie. »Hörst du mir zu, Maggie?«, fragte sie eindringlich. »Das, was ich dir hier gebe, ist wertvoller als alle Juwelen des Königs. Wenn die Zeit gekommen ist, dass du dich verliebst, und wenn dein Vater dir keine Hoffnung lässt, dann schaust du in den Bauch des Beasties, verstehst du?«
Margaret warf einen ängstlichen Blick auf das scheußliche kleine Ding und nickte.
Am nächsten Morgen kniete Anice unter den ungerührten Blicken ihres Gatten und ihrer zwei ältesten Söhne vor dem Block des Henkers.
Mit einem einzigen gewaltigen Hieb wurde Anice ihrem Liebhaber nachgeschickt.
Als die kleine Margaret heranwuchs, setzten turbulente Zeiten ein. Earl William starb von der Hand des Königs und plötzlich stürzte das Land in einen erbitterten Krieg der Clans. Douglas kämpfte gegen Douglas und Stuart; sämtliche Allianzen waren plötzlich verdächtig. Sogar die drei jüngsten Lockhart-Söhne stellten sich gegen ihren Vater und ihre zwei älteren Brüder und verbündeten sich mit den Stuarts. Inmitten dieser blutigen Clan-Kriege verliebte sich Margaret, inzwischen fünfzehn, in Raibert of Stirling der sich mit den jüngeren Lockharts verbündet hatte. Margaret ließ Inghean wissen, dass sie die Skulptur Raibert in Gewahrsam gegeben habe und mit ihren Brüdern nach Englandfliehen wolle. Sie küsste Inghean zum Abschied und schlüpfte hinaus in die Nacht.
Inghean sah das Mädchen nie wieder; und Jahre sollten vergehen, bevor sie erfuhr; dass Raibert in der Schlacht von Otterburn sein Leben verloren hatte und die beiden jüngeren Lockhart-Söhne das Beastie mit sich nach England genommen hatten. Das Beastie, nicht aber ihre Schwester Maggie, die mit gebrochenem Herzen zurückblieb und von ihrem Vater in ein Kloster gesteckt wurde, wo sie ein Jahr später von eigener Hand verstarb.
Inghean lebte noch viele Jahre danach um die Geschichte der Lady of Lockhart zu erzählen. Doch mit der Zeit wurde ihr Gedächtnis schwächer; und sie vergaß gewisse Einzelheiten. Am Ende ihres langen gesegneten Lebens war die Geschichte der Lady of Lockhart zur Geschichte des Fluchs der Lady of Lockhart geworden, denn nicht nur einer hatte die Wahnsinnige lachen gesehen, als ihr Geliebter hängen musste, und nicht wenige konnten sich vorstellen, dass sie ihre Tochter verflucht hatte.
Als Inghean schließlich aus dieser Welt schied, verschwand mit ihr auch die Wahrheit über die Lady of Lockhart. Der sogenannte Fluch löste sich von den historischen Tatsachen und dehnte sich auf alle weiblichen Nachkommen der Lockharts aus. Aus dem Beastie wurde nichts weiter als ein begehrter Besitz, der heimliche Grenzüberschreitungen der Lockharts, die es in ihren Besitz bringen wollten, zwischen England und Schottland zur Folge hatte, und diese Praxis hielt Hunderte von Jahren vor.
Als Schottland endlich mit seiner Schwester England vereinigt war, ging die Sage, dass eine von einem Lockhart gezeugte Tochter niemals heiraten würde, es sei denn, sie »blickte in den Bauch des Beasties«. Nach der Überlieferung der Familie bedeutete dies, dass eine Lockhart-Tochter dem Teufel ins Angesicht sehen musste, bevor sie heiraten konnte, und die Macht dieses Fluchs wurde noch gestützt von der Tatsache, dass keine Lockhart-Tochter jemals heiratete.
Kapitel 1
Loch Chon bei Aberfoyle,
im zentralen Hochland von Schottland, 1816
Dichter Nebel umhüllte seine Schuhe, die ghillie brogues aus Schaffell an seinen Füßen, so dass er nicht sehen konnte, wohin er trat. Doch es war oberstes Gebot, unbemerkt zu bleiben – er konnte das Franzosenlager zwischen den Bäumen hindurch direkt vor sich sehen und fragte sich, wie es ihnen gelungen war, ihn hier im fernen Schottland aufzuspüren. Offenbar suchten sie ihn immer noch, waren immer noch darauf bedacht, ihn zu töten, genauso wie vorher auf dem Kontinent.
Liam duckte sich hinter einen Baum und beobachtete sie. Sie hatten zur Nacht haltgemacht und lagerten um ein kleines Feuer. Einer von ihnen briet ein kleines Tier, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, die gleich hinter der Baumgrenze lauerte. Himmel, wie gern hätte er seine Männer gesehen! Seine schottischen Landsleute lagen jenseits des französischen Lagers und warteten auf ihn. Liam straffte sich, versuchte, weiter vorzudringen, doch der dichte Nebel ließ es nicht zu, und außerdem waren seine Beine schwer wie Blei, und ihm war, als watete er durch tiefes Wasser.
Plötzlich blitzte zu seiner Rechten etwas Buntes auf – ein französischer Soldat! Liam griff rasch nach dem Dolch an seiner Hüfte, doch er war fort, war aus dem Gürtel seines Kilts gerutscht. Der Soldat, auf dem Rückweg ins Lager, nachdem er einem natürlichen Bedürfnis gefolgt war, erschrak bei seinem Anblick und griff nach seiner Pistole. Sein Dolch, wo war sein Dolch? Zeit zum Überlegen blieb ihm nicht; Liam ließ sich in die Hocke sinken und zog mit einer geschmeidigen Bewegung seinen sgian dubh aus der Scheide in seinem Strumpf und stürzte sich auf den Franzosen, bevor dieser einen Ton von sich geben konnte.
Sie stürzten zu Boden, Liam landete obenauf, was dem Mann die Luft aus den Lungen trieb. Seine Pistole flog in hohem Bogen hinaus in den Nebel. Geräuschlos und flink, als wäre der Mann ein Tier, schnitt Liam ihm die Kehle durch, wie er es gelernt hatte, wälzte sich von ihm herab, kam auf die Füße und hockte sich, auf die Hände gestützt, vor ihn, in Erwartung des nächsten Franzosen.
Was war das? Ein leises Pfeifen – der elende Franzmann hatte irgendwie die anderen gewarnt! Gott im Himmel wo waren seine Männer? Sein Atem ging in heftigen Stößen, und Liam trat einen Schritt vor, fühlte, wie etwas sein Ohr streifte und schlug instinktiv danach. Noch ein Schritt, und eine Bewegung links von ihm zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Ruckartig fuhr er herum und schnappte beim Anblick des zweiköpfigen Trolls vor ihm unwillkürlich nach Luft, des gleichen Trolls, der – war das möglich? – ihn in seinen Träumen heimgesucht hatte, als er noch ein kleiner Junge war.
Ihm blieb keine Zeit zum Überlegen; der Troll kam, aufgrund seiner Körperfülle von einer Seite zur anderen schwankend, auf ihn zu. Etwas stieß Liam in den Rücken, nahm ihm das Gleichgewicht, doch er ignorierte es, völlig auf den Troll konzentriert, der mit ausgestreckten Händen auf ihn zukam, als wollte er ihn packen. Mit heftig klopfendem Herzen griff Liam nach seinem sgian dubh und hielt sich bereit. Im selben Moment, als er vorwärtsstürmen und den Troll angreifen wollte, spürte er einen heftigen Schmerz am Hinterteil, als hätte jemand mit seinem Stiefel …
Liam öffnete ruckartig die Augen; er sah seinen Bruder Griffin, der sich, eine Feder in der Hand, über ihn beugte, und erinnerte sich benommen, dass der Krieg mit Frankreich zu Ende war.
»Du hast mal wieder geträumt«, bemerkte Griffin nüchtern und fügte mit einem schiefen Lächeln hinzu: »Hoffentlich war es ein hübsches Ding.«
»Uuuh«, stöhnte Liam, wälzte sich herum und vergrub das Gesicht in den Kissen. »Warum musst du mich belästigen, Grif? Kannst du einen Mann nicht einmal schlafen lassen?«
»Die Sonne steht schon hoch, Liam. Deine Mutter fragt nach dir, und Payton Douglas ist gekommen. Hast du ihm nicht Unterricht im Schwertkampf versprochen?«
Verdammt, das hatte er. »Aye«, sagte er und gähnte, »habe ich.« Widerwillig nahm er das Kissen vom Gesicht und blinzelte in das Sonnenlicht, das ins Zimmer fiel. Wieder einmal war er schweißgebadet, die Folge einer neuerlichen nächtlichen Schlacht gegen die Franzosen. Er würde froh sein, wenn sein Regiment in Stellung ging und er seine Träume hinter sich lassen konnte.
»Heute erwarten wir Vater aus Aberfoyle zurück«, sagte Griffin und ging hinüber zu der Kommode an der Wand, um Liams Habseligkeiten, die darauf lagen, in Augenschein zu nehmen, »und Mutter verlangt deine Anwesenheit am Abendbrottisch.« Er gönnte Liam einen flüchtigen Blick. »Es gefällt ihr nicht, dass du dich bis in die frühen Morgenstunden herumtreibst.«
Liam ging einfach darüber hinweg. Seine Familie verstand nicht, dass er sich seine Soldatengeschicklichkeit erhalten musste, was nur möglich war, wenn er die verschiedensten Dinge sowohl bei Nacht als auch am Tag übte. Er stützte sich auf die Ellbogen und sah zu, wie Griffin die handgefertigte, reich verzierte lederne Felltasche in die Hand nahm, die er bei einem Schmied in der Nähe von Loch Ard erstanden hatte. »Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das wieder hinlegen würdest«, sagte er, als sein Bruder in die Tasche spähte.
Mit leisem Lachen gehorchte sein Bruder und warf die Tasche zurück auf den Schreibtisch. Er wandte sich einem Streifen karierten Stoffs zu, den Liam über eine Stuhllehne gehängt hatte, rieb einen Zipfel des Stoffs zwischen den Fingern, prüfte sein Gewicht. Griffin – der nie viel von Tradition gehalten hatte – trug enganliegende schwarze Hosen, eine dunkelbraune Jacke aus feinstem Stoff und eine blassgoldene Weste, blau gestreift in wunderschönen Tönen, die Liam an eine Schar Pfauhähne erinnerten – besonders an die fetten, überfütterten, die in den Gärten des Familienbesitzes Talla Dileas umherstreiften.
»Handgewebt von der alten Witwe MacDuff«, erklärte Liam.
»Aber natürlich, denn wer außer der alten Dame MacDuff webt so etwas noch?«, fragte Griffin, ließ den Stoffzipfel fallen und wandte sich Liam zu. Er verschränkte die Arme vor der Brust, kreuzte die Beine und streifte mit einem Blick den nackten Oberkörper seines Bruders. »Sag mal, hat man dir in der Armee beigebracht, nackt zu schlafen?«
»Nein«, antwortete Liam und schwang die Beine über die Bettkante. »Nackt zu schlafen, das habe ich in den Boudoirs der Damen gelernt.«
Griffin lachte, und sein Lachen war so strahlend und einladend wie das seiner Schwester Mared. Gähnend musterte Liam seinen jüngeren Bruder. Sein Körperbau glich Liams – groß, muskulös, dunkelbraunes Haar und Augen, so grün wie Heidekraut –, aber er war nicht ganz so kräftig wie Liam, war schlanker, aristokratischer gebaut als dieser, der stolz war auf sein kriegerisches Aussehen. Und Griffin war, zugegeben, ein sehr gutaussehender Mann, Liam dagegen … nun, eher unansehnlich.
Immer noch lachend ging Griffin zu der Tür aus alten Holzplanken.
»Ich lasse Douglas wissen, dass du gleichkommst«, sagte er. »Und ich sage deiner Frau Mutter, dass du versprochen hast, am Abendessen teilzunehmen.« Er zog den Kopf ein und duckte sich unter der Tür zu dem höhlenartigen Turmzimmer hindurch, in dem die Lairds of Lockhart jahrzehntelang geschlafen hatten, bis einer kam und ein Herrenhaus anbaute.
Liam stand auf, ließ das Laken von seinem nackten Körper gleiten, reckte die Arme hoch über den Kopf und trat an den schmalen Fensterschlitz mit Ausblick auf den alten Burghof.
Der Mann, den er dort unten entdeckte, war Payton Douglas, der gegen seinen eigenen Schatten focht. Liam verdrehte die Augen. In der Umgebung von Loch Chon lebte nicht ein einziger Schotte, der nicht von sich glaubte, er hätte das Zeug zum Soldaten. Doch der Wunsch allein reichte nicht. Dazu benötigte man Kraft und Witz und Mut. Er musste es wissen – schließlich hatte er sich in den letzten zehn Jahren durch alle Ränge des Highland-Regiments hochgearbeitet, hatte den ehrbaren Rang eines Captains erreicht und nicht nur einen, sondern vier Orden für Heldentaten in den Halbinselkriegen und bei Waterloo errungen. Ja, er kannte das Soldatentum, und seiner Meinung nach gab es nicht allzu viele Männer, die charakterlich dafür geeignet waren.
Und genau das wollte er Payton Douglas vor Augen führen.
Es war kein Geheimnis in der Gegend von Loch Chon, dass die Familien der Douglas’ und der Lockharts einander nicht grün waren; es war ein gegenseitiges Misstrauen, das schon seit Jahrhunderten bestand. Was genau zwischen den Familien vorgefallen war, wusste Liam nicht. Er wusste nur, dass Payton ein Douglas war. Trotzdem konnte er nicht anders, als ihn zu bewundern – er war ein tüchtiger Mann, es ging ihm gut trotz der schweren Zeiten, doch er war nun auch wieder nicht so bewunderungswürdig, dass Liam ihm gegenüber Milde walten lassen würde.
Aye, er würde sich mal ansehen, was Douglas unter der vornehmen Jacke, die er trug, zu bieten hatte. Mit einem leisen vergnügten Lachen löste Liam sich vom Fenster, ging zu dem Stuhl, über dessen Lehne sein Plaid hing, und begann, sich anzukleiden.
Während er auf Liam wartete (welcher erwachsene Mann konnte so weit in den Tag hinein schlafen?), vergnügte Payton sich damit, gegen seinen eigenen Schatten an der Mauer des alten Burghofs zu kämpfen. Er hatte nicht die geringste Ahnung von der Kampftechnik, da er nie den Luxus von Fechtstunden genossen hatte. Doch er hatte ein paar Duelle gesehen und war einigermaßen überzeugt davon, dass es nicht allzu schwierig sein konnte. Er stieß vor, zog sich zurück und stieß erneut vor, immer an der massiven Steinmauer entlang. Aber schon bald langweilte ihn das Spielchen, und er fand mehr Spaß daran, sich vorzustellen, dass er von allen Seiten von Lockharts angegriffen wurde. Er wirbelte herum, stieß sein Schwert in die Luft, wirbelte noch einmal herum, schickte sich an, vorzupreschen, taumelte jedoch mit einem leisen Schreckensschrei zurück gegen die Mauer und ließ sein stumpfes Schwert fallen.
»Herr im Himmel, Mared, du hast mir einen Heidenschrecken eingejagt!«, rief er hitzig aus und rang nach Luft.
Liams jüngere Schwester war wie aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht und zuckte gleichmütig die Achseln, warf sich ihren langen Zopf über die Schulter und rückte den schweren Korb zurecht, den sie auf die Hüfte gestützt hielt. »Sie sollten achtgeben, auf wen Sie das Ding richten.«
Oh, welch guter Rat. Payton stemmte die Hände in die Hüften und blickte böse auf Mared herab. Als ob das etwas nützte – sie schien es kaum zu bemerken. Diese Göre war wohl die Schlimmste von allen verdammten Lockharts, was für sich genommen schon bemerkenswert war, denn die Lockharts waren weiß Gott die schlimmste Ansammlung von menschlichen Wesen, die er kannte.
Mareds dunkelgrüne Augen richteten sich auf das Schwert, das am Boden lag. »Man zuckt schon unwillkürlich zusammen, wenn ein Mann von einer Mauer besiegt wird, nicht wahr?«, sagte sie gedehnt.
»Oh, aye«, sie war eine Schlimme, konnte einen Mann zur Weißglut bringen, und Payton wünschte inbrünstig, sie wäre nicht so verdammt schön. Doch in diesem smaragdgrünen Gewand, das zur Farbe ihrer Augen passte, konnte sie, schlicht gesagt, einen Mann verhexen. Die Betonung dabei lag natürlich auf dem Wort Hexe. Er bückte sich, hob sein Schwert auf und säuberte den Knauf von Schmutz. »Du hast eine verflixt spitze Zunge, Mared«, sagte er und hob den Blick vom Schwertknauf, »aber verdammt will ich sein, wenn du nicht schön bist wie ein klarer Sommertag.«
Mared schnaubte durch die Nase und verdrehte die Augen. »Ihre Schmeicheleien führen zu nichts, Douglas.«
»Soll Schönheit denn nicht bewundert werden?«
Mared kniff die Augen zusammen; sie griff in den großen Korb, den sie trug, nahm eine Brombeere heraus und warf sie sich in den Mund. »Sie halten mich offenbar für ein Spatzenhirn«, sagte sie und kaute gleichmütig auf der Beere. »Sie bewundern nicht die Schönheit, Sie haben nur Augen für Landbesitz, das ist alles.« Sie gönnte sich eine weitere Beere. »Und Sie fragen nach Lockhart-Land, als wäre es unfruchtbar.«
Aha! Also hatte sie davon gehört, dass er sich erkundigt hatte, wie viel Morgen Land der Lockharts für Vieh genutzt wurde. Diese Erkundigungen hatte er sehr diskret in Aberfoyle eingeholt. Er hatte keine Ahnung, woher sie davon wusste, doch er würde ein Monatseinkommen darauf verwetten, dass es irgendwie mit ihren bemerkenswerten grünen Augen zu tun hatte. »Ach, du naives Mädchen«, sagte er mit einer abschließenden Handbewegung. »Du verwechselst die Wertschätzung eines Mannes mit deinem närrischen Stolz.«
»Närrischen Stolz?« Sie knurrte, was sie davon hielt, und aß noch eine Beere. »Und Sie verwechseln Ehrgeiz mit einer jahrhundertealten Geschichte, Douglas.«
Jetzt war es an Payton, verächtlich zu schnauben, und er wies mit der Schwertspitze auf den Boden, dorthin, wo ihre abgestoßenen Lederschuhe unter ihrem Kleid hervorlugten. »Närrisch und starrsinnig bist du, Mared Lockhart. Willst du etwa abstreiten, dass das Land der Douglas und der Lockhart, wenn es vereint wäre, mehr einbringen würde?«
»Diah, Sie haben wohl den Verstand verloren! Warum sollte sich ein Lockhart je mit einem Douglas zusammentun?«
»Damit er … oder sie, sofern dieser unwahrscheinliche Fall überhaupt eintreten kann, die Erträge des Landes verdoppeln kann, indem er oder sie der Schafzucht mehr Platz einräumt. Deshalb.«
Mared stand reglos da. Blinzelte. »Ich glaube, Sie haben tatsächlich den Verstand verloren!«, rief sie und brach urplötzlich in Lachen aus. »Wirklich, Douglas, glauben Sie tatsächlich, wir würden unsere Rinder gegen Schafe eintauschen?«
Payton sah sie finster an. Ob sie nun schön war oder nicht, auf jeden Fall war sie genauso dickköpfig wie alle Lockharts, die er kannte. »Ach, ihr Lockharts seid ein dummer Haufen! Ihr wollt die Wahrheit nicht sehen, wollt nicht zugeben, dass ihr in Schulden ertrinkt und dass euer Vieh nicht das einbringt, was ihr zum Überleben benötigt! Schafe, Mared! Sie brauchen weniger Fläche und wandern übers Land, wogegen eure verdammten Kühe bis zum Mittsommer schon alles, was an Gras vorhanden ist, aufgefressen haben. Und in der Umgebung von Loch Chon weiß jeder, dass euch ohne das Geld eurer Pächter das Wasser bis zum Halse steht.«
Mareds Augen sprühten vor Wut. Sie rückte ihren Korb zurecht und drohte Liam mit einem schlanken Finger. »So reden Sie nicht mit mir, Douglas! Und niemals werden Sie Ihre schmutzigen Hände nach dem Land der Lockharts ausstrecken!«
»Mared, leannan, lass den armen Kerl in Ruhe!«
Mared und Payton drehten sich beide um, als Liam zielstrebig in den alten Burghof schritt. Sein Kilt schwang um seine Knie, ein schwerer Ledergürtel hielt das blütenweiße Hemd, dessen Saum er in den Bund gestopft hatte. Payton musste unwillkürlich lächeln – Liam Lockhart hielt unverbrüchlich an Tradition und Ehre fest und trug seinen schottischen Stolz wie einen Orden. Payton bewunderte seine Loyalität aufrichtig. Und er beneidete Liam um sein bisheriges Leben – mehr als einmal schon hatte Payton sich gewünscht, er wäre ausgezogen, um das Leben kennenzulernen, wie Liam es getan hatte, statt auf Befehl seines Vaters das College zu besuchen.
Liam blieb breitbeinig ein paar Schritte vor Payton und Mared stehen und zog sein Schwert aus der Scheide. Er hielt es, als hätte es kein Gewicht, mit gesenkter Spitze, und musterte Payton stumm. Nach einer Weile lächelte er Mared listig an. »Am besten ziehst du dich aus der Gefahrenzone zurück«, sagte er lässig. »Douglas wünscht sich eine kleine Lektion im Schwertkampf. Habe ich recht, Douglas?«
»Wenn du Lust hast«, antwortete Payton liebenswürdig.
»Ach«, brummte Mared, »welch ein Unsinn.« Doch sie tat, wie Liam ihr geraten hatte, und ging zu einer zerfallenden alten Bank an der Mauer. Zu Paytons Missbehagen stellte sie den Korb zur Seite und setzte sich, als hätte sie die Absicht, dem Unterricht zuzusehen.
»Du willst also eine Lektion«, sagte Liam noch einmal, hob langsam die Schwertspitze an und lenkte Payton von Mared ab.
»Aye.« Er nickte. »Ich habe mir sagen lassen, niemand führt die Waffe besser als Liam Lockhart.«
Liam schnaubte und hob das Schwert. »Stimmt, ich bin der Beste. Kein Mann hat sich je als besser erwiesen.« Er machte einen Schritt, dann noch einen, umkreiste Payton langsam, der still stehen blieb und dem Captain seinen Spaß ließ. Vor ihm blieb Liam stehen und berührte einen Knopf an Paytons Weste mit der Schwertspitze. »Hast du schon jemals mit dem Schwert gegen einen Mann gekämpft?«
»Nein.« Liam grinste. »Das dachte ich mir, denn sonst wüsstest du, dass du die Jacke ausziehen musst. Verschnürt wie eine Weihnachtsgans, kannst du nicht kämpfen.«
Payton lächelte dünn, legte seinen Mantel und sicherheitshalber auch noch die Weste ab und warf beides auf die Bank, auf der Mared saß. Sie lächelte frech, als ob sie hoffte zu sehen, wie er in Stücke gehauen wurde. Payton war nicht ganz sicher, ob dieser Wunsch ihr nicht vielleicht erfüllt wurde. Er wandte sich Liam zu. »Fangen wir an, ja?«
Ein breites Raubtierlächeln trat auf Liams Gesicht. »En garde«, sagte er leise und zog im selben Augenblick ein Bein zurück, verlagerte sein Gewicht auf dieses und beugte das andere.
Payton hob sein Schwert, imitierte Liams Haltung, doch Liam stöhnte, verdrehte die Augen und stieß mit seinem Schwert gegen Paytons. »Was soll das, Douglas? Stemm die Hand in die Hüfte und hebe dein Schwert… aye, so ist es richtig. Du wirst seitlich ausholen wollen oder mein Schwert herabzwingen wollen, verstehst du?«, fragte er und zeigte ihm, was er meinte. Payton nickte zustimmend und hörte genau zu, als Liam ihm erklärte, wie man im Angriff vorstößt, sich zurückzieht, wieder vorstößt und Kopf, Flanke und Brust bedroht. »Die Klinge geht dem Körper voran, sie sollte ihr Ziel treffen, bevor dein Fuß den Boden berührt. Verstehst du?«
»Aye«, knurrte Payton.
Sie übten das Vorstoßen mit gebeugten Knien und gingen zurück in die engarde-Position. Dann zeigte Liam ihm, wie man den Gegner abwehrt, wie man sich gegen einen Angriff verteidigt, den Wechselschritt, den Vorstoß zum Angriff, wieder den Wechselschritt. Seine Technik war nach Paytons Einschätzung erstaunlich anmutig für einen so großen Mann. Er selbst fühlte sich im Vergleich dazu dick und unbeholfen, nicht annähernd so graziös wie Liam.
»Aye, du hast das Gespür dafür«, sagte Liam und nickte nach einer Weile des Schattenfechtens längs der Mauer des alten Burghofs. »Dann lass mal sehen, wie du dich im Kampf bewährst«, sagte er und erschreckte Payton mit einem plötzlichen Vorstoß, nach dem seine Schwertspitze Paytons Gürtel berührte.
Er blickte zu Liam auf und lächelte schief. »Du willst mir doch nicht etwa die Unterhose ausziehen, oder?«
Liam lachte leise. »Hoch mit dem Schwert, Mann!«, warnte er Payton, stieß wieder vor und zerschnitt Paytons weiten Hemdärmel. Plötzlich gerieten sie in Bewegung, Payton wich unbeholfen zurück und versuchte verzweifelt, sich zu wehren, ohne zu stürzen. »Ach, hast du denn gar nichts gelernt? Ferse zu Zeh, Ferse zu Zeh!«, schrie Liam ihn an, doch unverhofft stieß Payton heftig gegen eine Wand und ließ sein Schwert fallen. Liam setzte die Schwertspitze an Paytons Hals. »Ts, ts«, machte er und schüttelte den Kopf. »Schade, das. Du bist mir ausgeliefert.«
Paytons Brustkorb hob und senkte sich. Er blinzelte, als sich das Sonnenlicht auf Liams Klinge brach, dachte an Mared, die zusah, wie er geschlagen wurde, glitt langsam an der Mauer herab in die Hocke und tastete nach seinem Schwert, während Liam ihn ruhig in Schach hielt. Payton nickte und atmete heftig. »Jetzt verstehe ich, warum man dich für den Besten hält, Lockhart.«
»Aye.« Liam grinste. »Du hast zu viel im Arm, nicht genug im Handgelenk«, sagte er. »Und du darfst nicht vergessen, den besten Winkel zum Zustoßen im Auge zu behalten.«
Das Schwert in der Hand, nickte Payton und stemmte sich langsam wieder hoch. »Nicht genug im Handgelenk«, wiederholte er. »So vielleicht?«, fragte er, und bevor Liam antworten konnte, stieß Payton vor und überrumpelte ihn wie durch ein Wunder. Er stieß noch einmal vor, Ferse zu Zehe, Ferse zu Zehe, hieb wild nach dem Kopf, der Brust und der Flanke und zwang Liam zum Zurückweichen.
Die beiden bewegten sich tänzelnd bis zur Mitte des alten Burghofs, so schnell, dass Payton nicht wusste, wie ihm geschah, aber er hatte immer noch die Oberhand, bestimmte das Spiel immer noch. In rascher Folge klang Stahl auf Stahl und zerriss die Morgenstille, so dass es an den Zähnen schmerzte. Liam war anscheinend in der Defensive, und Payton kämpfte verzweifelt, um ihn dort zu halten, stieß vor, immer und immer wieder, schlug sein Schwert zur Seite und drückte ihm den Arm gegen den Hals.
Statt wütend zu werden, lachte Liam. »Ah, du hast also doch das eine oder andere gelernt«, sagte er, stieß ihn unvermittelt mit einer geschmeidigen Bewegung und entwand sich seinem Griff, wirbelte herum und schlug Payton mit einem wuchtigen Schlag seines Schwerts vor die Brust zurück. Payton ging mit dumpfem Geräusch zu Boden, landete auf dem Rücken und bekam keine Luft mehr. Liam war im nächsten Moment über ihm, stellte einen Fuß auf seinen Unterleib und hielt ihm die Schwertspitze an die Kehle. Die freie Hand reckte er triumphierend in die Luft.
Einen kurzen Moment lang glaubte Payton, Liam würde ihn töten. Bis Liam den Kopf in den Nacken warf, lachte, ihm die Hand bot und ihm auf die Beine half.
Und irgendwo in einem Winkel seines Bewusstseins hörte Payton Mared enttäuscht ausrufen: »Ach, um Gottes willen!«
Carson Lockhart kam spät an diesem Nachmittag aus Aberfoyle nach Talla Dileas zurück, küsste seine Frau Aila auf den Mund und bedeutete seinem langjährigen Butler Dudley, ihm einen Schluck Whisky einzuschenken, damit er sich den Straßenstaub aus der Kehle spülen konnte.
Aila legte ihre Flickarbeit zur Seite, beobachtete ihren Mann und schätzte ihn still für sich ab. Sie war seit achtunddreißig Jahren mit dem Mann verheiratet und konnte ihn lesen wie ein Buch. Und seiner niedergeschlagenen Miene nach zu urteilen, hatte er in Aberfoyle nicht viel erreicht. Sie wartete, bis er es sich bequem gemacht, den ersten Whisky getrunken und den zweiten in der Hand hatte, bevor sie sprach. »Nun, Carson. Was für Nachrichten bringst du?«
Ihr Mann verzog das Gesicht bei der Frage und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch seinen dichten grauen Haarschopf. »Nicht viel Gutes«, gestand er. »Sie leihen uns mit Sicherheit keinen Farthing mehr, selbst wenn mein Leben davon abhinge.«
Diese Nachricht kam nicht unerwartet, doch sie hatten sich Besseres erhofft. Der alte Besitz der Lockharts war angesichts neuer landwirtschaftlicher Techniken und wachsender Industrie immer schwieriger zu erhalten, und die Familie war bei der Royal Bank of Scotland längst kein gerngesehener Kunde mehr. Als die Schulden wuchsen, waren sie zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht mehr so viele Pächter halten konnten. Die Familie war übereingekommen, die Kätner auszuzahlen, die seit Generationen das Land der Lockharts bewirtschafteten – sie würden einen fairen Preis zahlen und sie nicht, wie andere Lairds, aus ihren Häusern vertreiben. Es war eine edle Einstellung, doch genau diese Einstellung trieb die Familie heimlich, still und leise in den Bankrott.
Aila blickte versonnen aus dem dick verglasten Fenster in der Wand des Raumes, der früher der Rittersaal des alten Schlosses gewesen war. Sie fragte sich, ob ihre Familie sie wegen des Plans, an dem sie seit zwei Wochen schmiedete, auslachen würde. Es war ein ziemlich lächerlicher Plan, wie sie sich eingestehen musste, doch angesichts ihrer angespannten Finanzlage erschien er ihr zumindest einer Diskussion würdig. Sie mussten bald etwas unternehmen, damit sie Talla Dileas nicht verloren und sich den Tausenden von Highlandern anschließen mussten, die in Glasgow Arbeit suchten. Allein die Vorstellung ließ sie schaudern; sie glaubte, es würde Carson umbringen, wenn es dazu käme. Sie warf einen Blick auf ihren Mann, dessen Lider sich senkten, und ging zu dem großen Ohrensessel, in dem er sich niedergelassen hatte. Sie strich ihm mit der Hand über den Kopf, beugte sich zu ihm herab und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Schließ die Augen, Liebster«, flüsterte sie und nahm ihm das Whiskyglas aus der Hand. »Wir reden später darüber.«
Gemessen an ihrem früheren Lebensstandard konnte man die Mahlzeit kaum als Abendbrot bezeichnen.
Sie bestand aus Bannocks genannten Buchweizenfladen, einem ziemlich mageren Waldhuhn, einer Schüssel Brombeeren und Roggenmehlkuchen mit altem Obst. »Wir haben keine nennenswerten Lebensmittel, Mylady«, hatte Dudleys Frau, die Köchin, sich bei Aila beschwert. »Ich habe nichts außer Buchweizen.«
»Dann essen wir Bannocks«, hatte Aila scharf geantwortet. Sie war verzweifelt wegen der wachsenden Armut und hatte Liam in den Wald geschickt, um Wildbret zu besorgen. Die Brombeeren waren Mareds mühseligem Aufstieg auf den Din Footh zu verdanken, wo sie sie gepflückt hatte, der Roggenmehlkuchen angefaultem Obst. Das waren Speisen, mit denen sie bis zum Ersten des Monats, wenn die Pacht einging – so wenig auch geblieben war –, auskommen mussten.
Als die Familie sich an den Abendbrottisch setzte, unterließ man höflich Bemerkungen über das karge Mahl und nippte sparsam an den schwindenden Weinvorräten.
Aila blickte von einem zum anderen und bewunderte im Stillen ihre Kinder. Alle drei waren gebildet und weit gereist, etwas, was sie und Carson bewerkstelligt hatten, bevor die schlechten Zeiten kamen.
Da war Liam, groß und stark, der stolze Soldat. Er war Ailas unruhigstes Kind, derjenige, dem der Mangel an Aktivitäten in der Gegend von Loch Chon schon immer zu schaffen gemacht hatte. AJs Junge war er der Schwierigste gewesen, hatte sich so oft geprügelt, dass sein Gesicht auf immer davon gezeichnet war. Und jetzt diese zackige Narbe, die Erinnerung an eine Wunde, die er sich in der Schlacht bei Waterloo zugezogen hatte, so frisch noch, dass sie leuchtend rot war. Selbst jetzt noch, im Alter von fünfunddreißig Jahren, brachte Liams Rastlosigkeit, obwohl er erst seit einem Monat vom Kontinent zurück war, dass alte Haus durcheinander, er war in dieser kurzen Zeit schon in zwei Faustkämpfe geraten, hatte drei Männern das Fechten beigebracht und den widerstrebenden Griffin mindestens zwei Mal pro Woche tief in den Wald zur Jagd gezerrt, um seine Soldatentricks frisch zu erhalten, wie er sagte.
Dann folgte Griffin, ihr mittleres Kind, der, wie Ailas Vater, dem er so sehr ähnelte, in seinen feinen Anzügen so gut aussah und sich bedeutend mehr für gesellschaftliche Ereignisse interessierte als fürs Jagen und Kämpfen. Im Gegensatz zu Liam strebte Griffin die Reichtümer des Lebens an und war ehrgeizig, wünschte sich einen Stand in der Gesellschaft, den die Familie, wie Aila fürchtete, nie erreichen würde. Doch es war Griffin, der sie zum Nachdenken, zur Vorausschau anhielt; er drängte seinen Vater unablässig, neue riskante Unternehmungen in Betracht zu ziehen, die den Besitz ertragreicher machen konnten. Angesichts der derzeitigen Situation konnte Aila nichts gegen seinen Standpunkt vorbringen. Carson dagegen konnte es und tat es auch. Gott segne ihn, doch ihr Mann hatte sich mit dem Herkömmlichen bequem eingerichtet und war nicht bereit, sich der neuen Zeit anzupassen.
Und dann war da Mared, ihre geliebte, schöne Mared, gezeichnet von einem lächerlichen uralten Fluch, der besagte, dass sie niemals heiraten würde, wenn sie nicht dem Teufel persönlich ins Angesicht sah. Mared glaubte nicht recht an solchen Unsinn – der Rest der Familie ganz sicher auch nicht –, doch viele Einheimische in der Gegend von Loch Chon nahmen den Fluch für bare Münze. Sie betrachteten Mared als eine Art Kuriosum, flüsterten hinter vorgehaltener Hand über sie. Vor langer Zeit, als Mared noch ein kleines Mädchen war, hatte sie alle Hoffnung aufgegeben, den scheußlichen Fluch je überwinden zu können, und sie lebte so, wie sie es wollte, in der Überzeugung, dass sie nichts zu verlieren hatte, aber, traurig genug, genauso überzeugt, dass sie nichts zu gewinnen hatte.
Für die vier Menschen hier am Tisch hätte Aila ganz sicher alles getan. Wirklich alles. Sie würde sogar das Gesetz übertreten, denn sie war sicher, dass die Engländer ihren Plan als Gesetzesbruch betrachten würden, obwohl sie im Recht war.
Liam verschlang zufrieden seine Mahlzeit, ungeachtet der Einförmigkeit, und erfreute die anderen mit Geschichten von der Lektion im Schwertkampf, die er Payton Douglas gegeben hatte. »Er hat sich tapfer geschlagen, das muss ich ihm lassen«, sagte er. »Mit ein bisschen guter Anleitung würde noch ein brauchbarer Soldat aus ihm, wirklich.«
Mared schnaubte verächtlich. »Du redest, als wäre er unser Freund, Liam«, schalt sie den älteren Bruder. »Hast du alles vergessen? Er ist ein Douglas! Und er war überhaupt nicht so vielversprechend, wie du behauptest.«
»Ah, Mared, wie kalt du über unseren Nachbarn sprichst!«, rief Griffin lachend aus. »Ich hätte gedacht, du wärst ihm freundlicher gesinnt, zumal du so oft am Haus dieses Mannes vorüberschleichst«, fügte er hinzu und schob gedankenverloren ein Stückchen Waldhuhn auf seinem Teller hin und her. »Leugne es nicht länger – im Herzen hast du doch eine Schwäche für den Douglas.«
Mareds helle Wangen färbten sich rosenrot; sie sah ihren Bruder mit offenem Mund an. »Wie kannst du es wagen, so etwas Hässliches zu sagen, Griffin! Ich würde mir lieber die Pulsadern aufschneiden und verbluten, als einem Douglas einen Platz in meinem Herzen einzuräumen!«
»Ach, komm schon«, sagte Carson mürrisch, den Mund voller Bannock. »Der Mann ist im Grunde gar nicht so übel, oder?«
Empört sah Mared ihren Vater an, während Griffin und Liam leise lachten. »Vater, du weißt nicht, was du da redest!«, rief sie und warf ihren Brüdern einen hitzigen und überaus gereizten Blick zu. »Weißt du denn, was er gerade heute noch zu mir gesagt hat?«
»Aye – dass sein Herz Flügel bekommen und sich zu deinem Fenster aufgeschwungen habe, aber du hättest es nicht eingelassen«, sagte Griffin poetisch, woraufhin Liam brüllte vor Lachen.
Mared umklammerte die Tischkante und starrte ihren Vater an. »Er hat gesagt, wir würden, wenn wir es retten wollten, unser Land mit dem der Douglas’ vereinen und die Kühe zugunsten von Schafen aufgeben!«
Das ließ alle aufmerken. Liam und Griffin beugten sich gleichzeitig vor und sahen ihre kleine Schwester mit finsterer Miene an. »Dann hast du ihn wohl missverstanden, Mared. So etwas würde er niemals sagen«, forderte Griffin sie heraus.
»Aye, er hat es gesagt! Er hat gesagt: ›Mared, willst du abstreiten, dass das Land der Lockharts und der Douglas’ zusammengenommen mehr einbringen würde? ‹ Und ich habe gesagt: ›Sie haben wohl den Verstand verloren! ‹«
»Was hat er gesagt?«, bellte Carson.
»Dass wir alle profitieren würden, wenn unsere Ländereien vereint wären und nicht getrennt«, wiederholte sie und lächelte ihre Brüder selbstzufrieden an.
Eine Weile sagte niemand etwas, bis Griffin seine Meinung kundtat: »Wirklich, Vater, da ist etwas Wahres dran …«
»Zum Teufel, nein!«, brüllte Carson. »Verdammt will ich sein, wenn ein Douglas jemals auch nur einen Stein vom Land der Lockharts besitzen sollte!«
»Ich hätte ihm gleich den Leib aufschlitzen sollen, als ich Gelegenheit dazu hatte!«
»Liam!«, mischte Aila sich ein.
»Douglas hat es also auf unser Land abgesehen, wie?«, fragte Carson. Mared nickte wütend. »Und wir können nichts dagegen unternehmen, verdammt, so verschuldet, wie wir sind«, stöhnte Carson.
»Aber Vater, es stimmt, dass wir durch die Rinder Einbußen haben.«
»Ich werde nichts an der Art und Weise ändern, wie die Lockharts seit fünf Jahrhunderten ihren Wohlstand sichern, Griffin!«
»Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mo ghraid«, wagte sich Aila vor und zog aller Aufmerksamkeit auf sich.
»Und welchen?«, wollte Carson wissen.
Aila stellte ihr Weinglas ab und sah die vier nacheinander an.
»Dann hört zu«, sagte sie. »Ihr werdet denken, ich wäre nicht mehr bei Trost. Aber ich habe ein Buch gelesen, das der Vater deines Vaters geschrieben hat – eine Art Familienchronik. Es berichtet vom tragischen Tod der ersten Lady of Lockhart. Ihr erinnert euch doch gewiss an sie, von euren eigenen Studien her?«
Mared nickte eifrig, Griffin verdrehte die Augen, und Liam sah sie verständnislos an.
»Ach, Aila, du glaubst doch nicht etwa an den Fluch dieser Lady, oder?«, knurrte Carson.
»Nein, Carson.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Der Fluch interessiert mich nicht. Es geht um das Beastie.«
»Das Beastie?«, höhnte Liam. »Mutter, Beasties gibt es nicht…«
»Ich weiß«, sagte sie und schnitt ihm höflich, aber streng das Wort ab. »Doch einstmals gab es wirklich die goldene Skulptur eines Beasties mit Augen, Maul und Schwanz aus Rubinen. Der dem Untergang geweihte Geliebte schenkte es der ersten Lady of Lockhart als Beweis seiner Wertschätzung.« Damit hatte sie die ungeteilte Aufmerksamkeit aller gewonnen, und Aila berichtete, wie die Lady of Lockhart die Skulptur an ihre Tochter weitergegeben hatte, wie sie von den englischen Lockharts gestohlen wurde, dann von den schottischen Lockharts und so weiter und so fort, immer wieder, bis niemand sich mehr erinnerte. »Das Wichtigste ist«, schloss sie, »dass das Beastie sich seit der Jakobiter-Rebellion in England befindet. Aber es gehört uns. Und es ist ein kleines Vermögen wert.«
Griffins grüne Augen blitzten plötzlich verstehend auf. »Mutter, Gott segne dich!«, rief er aus. »Willst du vorschlagen, was ich jetzt vermute?«
Aila lächelte.
»Ich begreife überhaupt nichts«, sagte Mared und sah Griffin an.
»Wenn die Skulptur uns gehört, könnten wir sie verkaufen. Verstehst du, Vater? Das Gold und die Rubine würden ausreichen, um unsere Schulden zu bezahlen!«
»Aye, ich verstehe«, sagte Carson betont gedehnt und blickte Aila entnervt an. »Aber wie glaubt deine liebe Mutter denn, die Skulptur zurückzubekommen? Ihr wisst doch, was man über das verflixte Beastie sagt: Es ist englisch, denn es schlüpft den Schotten, die es besitzen, immer wieder durch die Finger.«
Eine gute Frage. Eine Frage, auf die Aila keine Antwort wusste. »Ich habe längst noch nicht alles bedacht, Carson«, sagte sie stirnrunzelnd. »Aber ich gebe nichts auf Flüche und Zauberei. Das Beastie befindet sich in England, weil die englischen Lockharts es den schottischen Lockharts gestohlen haben, und ich denke, wir müssen es von jemandem zurückstehlen lassen.«
»Stehlen?«, piepste Mared.
»Ich werde es holen«, sagte Liam, ohne zu zögern und völlig nüchtern.
»Oh, Liam, ich spreche nicht von meinen Kindern«, wehrte Aila hastig ab.
»Ehrlich, Mutter«, sagte Liam mit einem ungeduldigen Kopfschütteln. »Deine Idee ist großartig. Und du kannst nicht abstreiten, dass ich für diese Aufgabe am besten geeignet bin. Ich bin Captain in der Armee, oder? Captain im ehrenvollsten Regiment der Krone.«
Als anscheinend niemand verstand, was er damit sagen wollte, stöhnte Liam auf. »Ich bin für derartige Aufgaben ausgebildet, nicht wahr? Ausgebildet, Dinge auszukundschaften, und wenn dabei etwas schiefgehen sollte, bin ich darauf eingerichtet, es wieder geradezurücken.«
»Aye, aye, das bist du wirklich«, pflichtete Mared ihm bereitwillig bei. »Ich habe ihn heute beim Kämpfen beobachtet, Mutter. Es stimmt, er ist recht gut.«
»Ich hoffe doch sehr, dass er sich nicht wird duellieren müssen, Mared«, sagte Aila.«
»Und er war schon in London – ein Jahr lang zur Ausbildung auf der Militärschule«, fügte Griffin hinzu.
»Und während dieser Zeit habe ich Bekanntschaft mit unserem Vetter Nigel geschlossen, diesem erbärmlichen Stiefellecker«, erinnerte Liam mürrisch die Familie.
Aila blickte über den Tisch hinweg Carson an. Seine graugrünen Augen leuchteten jetzt, und er nickte. »Aye … Sie haben recht, meine Liebe. Unser Liam ist der Richtige für diese Aufgabe. Wir brauchen nur noch einen Plan zu entwerfen.«
Liam legte einen Arm über die Lehne seines Stuhls. »Ich habe eine Idee«, sagte er und legte über dem Roggenmehlkuchen voller Zuversicht seinen Plan dar. Er würde nach London reisen und Freundschaft mit seinem Vetter Nigel schließen. »Ein Kinderspiel«, spottete Liam. Er würde sich ihm als desillusionierter, enterbter schottischer Lockhart präsentieren – »Nicht sonderlich schwer zu spielen«, scherzte Griffin – und unter der sicheren Annahme, dass jedermann hier und da ein bisschen Klatsch genießt, schon gerade, wenn es sich um schmutzige Wäsche innerhalb der Familie handelt, würde Liam sich bei Nigel lieb Kind machen und eine Einladung ins Haus der Lockharts in London erschleichen, wo er die Skulptur finden würde.
Sobald er wusste, wo die Skulptur verborgen war, würde er im Schutz der Dunkelheit einfach in das Haus eindringen und sie sich unter der gebotenen Vorsicht wieder aneignen. »Meine Klugheit hat man allenthalben gepriesen«, erinnerte Liam seine Familie. Und schon würde er auf halbem Weg zurück nach Schottland sein, bevor die englischen Lockharts überhaupt merkten, dass das gesegnete Ding verschwunden war.
Als sie schließlich in den alten Rittersaal hinübergewechselt waren, hatten die fünf Lockharts den Plan von allen erdenklichen Seiten her beleuchtet, bis sie überzeugt waren, dass er nicht nur funktionieren würde, sondern in seiner Schlichtheit sogar genial war. Wären ihre Arme ein bisschen länger gewesen, hätten sie einander wohl bis zur endgültigen Erschöpfung gegenseitig auf die Schultern geklopft.
Kapitel 2
London, England
Seiner Fähigkeiten und der Bedeutung seiner Mission sicher – und begierig auf ein aufregenderes Leben als das bukolische am Loch Chon, während er auf den nächsten Stellungsbefehl seines Regiments wartete –, bestand Liam darauf, noch am Ende derselben Woche aufzubrechen. Seinen Kilt und seinen Dolch hatte er mit angemessener, von seinem Vater geliehener (und von Grif einfach konfiszierter) Kleidung in seinen Knappsack gepackt, und alles an Bargeld, was die Familie hatte zusammenkratzen können, steckte wohlverwahrt in seiner Felltasche, als er seine Mutter und seine Schwester küsste, Griffin auf den Rücken schlug und seinem Vater die Hand schüttelte, um sich auf die Suche nach dem Beastie zu begeben.
Per Postkutsche gelangte er spät an einem nassen, trüben Nachmittag, wie sie der frühe Herbst mit sich bringt, wenn er einen besonders scheußlichen Winter ankündigt, nach High Wycombe westlich von London. Er hüllte sich in seinen Soldatenmantel, rückte den schweren Knappsack auf seinem Rücken zurecht und marschierte etwa eine Meile von der Poststation bis zum Hotel Marlowe, wo seines Wissens Militärs der verschiedensten Dienstgrade anzutreffen waren. Er wurde nicht enttäuscht. Als der Abend sich neigte und nach einigen Bechern hatte Liam, was er wünschte: den Namen eines Londoners, der ihm zu einer Unterkunft verhelfen könnte. Es war ein Name, der selbst ihm bekannt war – Colonel Alasdair MacDonnell aus Glengarry. Die militärische Karriere des Mannes kannte Liam in- und auswendig, da ihm daran gelegen war, so viel wie möglich unter Schotten zu dienen. Was er allerdings nicht gewusst hatte, war, dass der Colonel zur Gründung der Highland Society of London beigetragen hatte, einer Art Herrenclub für die alten schottischen Clans. Colonel MacDonnell, so sagte man, war nachmittags meistens in diesem Club an der St. James Street anzutreffen.
Liam hätte nicht glücklicher sein können.
Am nächsten Morgen fühlte er sich ganz besonders tatendurstig und war der erste Passagier der öffentlichen Kutsche, die im Morgengrauen in Richtung Piccadilly Circus abfuhr. Doch als die Kutsche sich London näherte, gelang es dem Kutscher, insgesamt elf Personen ins Innere zu quetschen (und, wie es aussah, noch weitere zehn auf dem Stoßdämpfer und auf den Trittbrettern), wodurch Liam gegen die fleckige, abgeschabte Wand gedrängt wurde. Im Gedränge befanden sich auch ein kleiner Bursche mit großen braunen Augen, der während der gesamten Fahrt auf die Narbe auf Liams linker Wange starrte, ein Mann mit einer rohen Kiste voller gackernder Hühner, ein Baby, das, nachdem es, den Rückständen an seinen Fingerchen nach zu urteilen, auf etwas Ekligem herumgekaut hatte, die Unverschämtheit besaß, mit seiner pummeligen kleinen Hand auf Liams Knie zu patschen.
Unglücklicherweise brachte auch Piccadilly Circus keine Verbesserung seiner Lage. Nachdem es ihm gelungen war, sich aus der überfüllten Kutsche zu zwängen, fand Liam sich mitten auf einer Straße wieder, die angefüllt war mit Menschen und Kutschen, hochbeladenen Karren, verschiedenen brüllenden Tieren und haufenweise stinkendem Pferdemist. Aye, jetzt fiel ihm alles wieder ein, die zahlreichen Gründe, warum er London nicht mochte. Zum einen war die Stadt vollgestopft mit Engländern, einer Sorte Mensch, für die er sich nie hatte erwärmen können. Zum zweiten stank sie zum Himmel.
Doch das ließ sich nun mal nicht ändern. Liam zückte die grobe Karte, die einer der Soldaten am Vorabend für ihn gezeichnet hatte, suchte die St. James Street und tauchte mit gesenktem Kopf, den Mantelkragen hochgeschlagen, still in das Meer von Menschen und Tieren ein.
Er fand den Club in einer kleinen Straße gleich hinter St. James, wie der Soldat es ihm geschildert hatte, und stieß die Tür auf.
Etwa eine Stunde später saßen Liam und der anglophile Colonel MacDonnell nach einigen geschickten Komplimenten in einem dunkel getäfelten Raum mit dick gepolsterten Ledersesseln, ließen sich einen Whisky schmecken (für den der Mann einen halben Crown verlangte) und tauschten Kriegserinnerungen aus. Oder vielmehr, MacDonnell schwelgte in Erinnerungen, denn er redete gern über sich selbst. Mit englischem Akzent, was Liam maßlos ärgerte.
»Ah, Waterloo …«, seufzte er nach einiger Zeit und richtete den Blick auf etwas in der Ferne, was nur er selbst sah. »Eine verdammt schlimme Zeit, nicht wahr? Es war mir zuwider, so viele Männer in die Schlacht schicken zu müssen.« Er schüttelte den Kopf und musterte Liam. »Sieht aus, als hätten Sie auch einige Schlachterfahrung«, sagte er und wies auf Liams Narbe. »Sie hatten ein Kommando?«
Nein, Liam hatte kein Kommando, war aber oft genug ins Feld abkommandiert worden, um die Franzosen auszuspionieren und zu vernichten. »Aye«, sagte er schlicht. »Es fällt mir schwer, darüber zu reden«, sagte er und hoffte inbrünstig, das MacDonnell das Thema fallen ließ. Glücklicherweise stürmte just in diesem Augenblick ein wohlgenährter Mann in einer blaugoldenen Jacke von feinster Qualität hinein.
»Ah, wen haben wir denn da, MacDonnell? Einen Landsmann?« Der Mann quiekte beinahe und bediente sich des gleichen englischen Tonfalls wie MacDonnell.
»Lockhart. Hat bei Waterloo gedient«, erklärte MacDonnell stolz.
»Captain Lockhart«, erinnerte Liam ihn.
»Lockhart«, wiederholte der Mann und ließ sich wie ein Ball in einen der Ledersessel plumpsen. »Ich heiße Lovat. Nun, und? Sie haben doch einen Plaid mitgebracht? Ohne Ihren Beitrag haben wir jetzt vierzehn Stück.«
Er wirkte so schrecklich begierig, dass Liam widerwillig nach dem Knappsack zu seinen Füßen griff. Er hatte die verschiedenen Rechtecke aus Clan-Karomustern an der Wand längst bemerkt und gehofft, man würde ihn nicht fragen. Langsam öffnete er den Knappsack und zog seinen sorgfältig gefalteten Plaid heraus, den er tragen wollte, wenn der Zeitpunkt zur Erfüllung seiner Mission gekommen war.
»Uuuh«, geiferte Lovat. »Sogar den gesamten Plaid, wie?«, fragte er und griff danach. Doch Liam konnte die Vorstellung, dass diese beiden Männer seinen Plaid befingerten, kaum ertragen, und brachte ihn schnellstens außer Lovats Reichweite in Sicherheit. Lovat fuhr mit dem waidwunden Blick eines Rehs zurück. Liam hob einen Finger, gebot Lovat wortlos zu warten, beugte sich vor, zog seinen sgian dubh aus dem Stiefel und setzte die Dolchspitze ungeachtet der weit aufgerissenen Augen Lovats an einer Ecke des Stoffes an. Zähneknirschend, denn es tat ihm weh, schnitt er mit dem Dolch ein kleines Rechteck von einer Ecke ab und reichte es Lovat, während MacDonnell bewundernd zusah.
»Ah, wunderschön«, sagte Lovat. »Gute Qualität. Ihr Beitrag zu unseren Bestrebungen zur Erhaltung der Clan-Geschichte wird dankbar angenommen, Mr. Lockhart.«
»Captain«, korrigierte Liam.
Lovat lächelte, legte das Rechteck zusammen und schob es in seine Jackentasche. »Wie lange bleiben Sie denn in London?«, fragte er liebenswürdig.
»Auf unbestimmte Zeit.«
»Sie wollen sich hier niederlassen? Dann sind wir – wie? – ein Dutzend, wenn nicht mehr, nicht wahr, MacDonnell?«
»Ein Dutzend?«, fragte Liam.
»Ausgesiedelte Schotten.«
Warum ein Schotte, der etwas auf sich hielt, nach London aussiedeln würde, blieb Liam ein Rätsel. Er würde lieber nach Amerika segeln, statt bis in alle Ewigkeit in London stecken zu bleiben. »Aye, so ist es wohl«, sagte er mit einem traurigen Seufzer, bemüht, möglichst ausgesiedelt zu wirken. »Und es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie mir zu einer Unterkunft verhelfen könnten«, fuhr er fort. »Ich möchte keine große Wohnung – ein ganz schlichtes Zimmer würde mir reichen.«
»Unterkunft?«, wiederholte MacDonnell. »Sind denn nicht auch in London Lockharts ansässig? Der Name sagt mir etwas. Vielleicht könnten Sie bei denen Unterkommen?«
»Ah … nein«, sagte er vorsichtig. »Die Londoner Lockharts … nun ja, mein Vater, verstehen Sie, er hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meinem Onkel. Am besten wäre es, wenn ich in der Nähe eine Wohnung fände …, aber ich bin kein reicher Mann.«
Lovat und MacDonnell sahen ihn an, als hätte er gerade eingestanden, leprakrank zu sein.
»Verstehen Sie … Schafe«, lieferte er eine vage Erklärung nach.
»Aaaah«, machten beide gleichzeitig und nickten.
»Wissen Sie denn vielleicht, wo ich ein Zimmer mieten könnte?«
Lovat überlegte mit gefurchter Stirn, aber MacDonnell nickte nachdenklich. »Ich wüsste ein Zimmer …, aber mit gutem Gewissen kann ich es nicht empfehlen.«
Lovat sah ihn fragend an.
»Farnsworth«, sagte MacDonnell und zog eine Grimasse.
»Oh Gott!«, entfuhr es Lovat. »Ich glaube, ich habe nie einen geizigeren Engländer gesehen. Und er ist auch sonst ziemlich unangenehm, meinen Sie nicht? Oh, den kann ich nicht empfehlen, wirklich nicht, Captain. Sie täten besser daran, bei Ihrem Onkel vorstellig zu werden.«
»Ich fürchte, das ist nicht möglich. Jedenfalls nicht im Moment«, sagte Liam und seufzte, um den Ernst der Familienfehde zum Ausdruck zu bringen.
MacDonnell musterte ihn eine Weile und zuckte dann mit den Schultern. »Ich schätze, so schlimm ist es gar nicht, wenn Sie Farnsworth ertragen können. Immerhin hat er ein paar Zimmer zu vermieten. Und in bester Lage zur Stadt, möchte ich sagen, gleich drüben in Belgravia«, sagte er mit einer Handbewegung zur hinteren Wand. »Nicht auf der vornehmen Seite des Platzes, aber trotzdem … Wirklich, Sie könnten es bedeutend schlechter treffen, Captain. Trotzdem sollten Sie sich mit Ihrem Onkel aussprechen.«
»Ja, Mylord, das ist der hauptsächliche Grund für meine Reise nach London«, versicherte Liam ihm rasch.
»Trotzdem, Farnsworth ist ein griesgrämiger Mensch«, beklagte sich Lovat. »Er ist ein exzentrischer alter Kauz. Klar, er ist an den Spieltischen zu Hause, aber er würde um Gottes willen doch nicht einen einzigen Farthing aus seinem beträchtlichen Vermögen auf den Tisch legen. Er vermietet das Zimmer und nutzt diese Einkünfte, um seine schreckliche Sucht zu befriedigen.«
Ah … ein Pfennigfuchser mit einer schlechten Angewohnheit. Einer, der vielleicht zu manipulieren wäre, wenn die Lage es erforderte.
Liam verbiss sich ein Lächeln – es schien perfekt. »Würden Sie mir dann bitte die Adresse nennen?«, fragte er liebenswürdig und griff nach dem Rest seines Whiskys.
Kapitel 3
Liam fand den Belgrave Square problemlos, konnte jedoch nicht entscheiden, welche Seite die vornehme sein könnte, und da sich ein kalter Wind aufgetan hatte, hoffte er, dass sich ihm möglichst bald etwas Vornehmes in Form einer Unterkunft bot.
Als er den Platz überquerte, bemerkte er, dass eine Frau, die ihm entgegenkam, Probleme mit ihrem Schirm hatte – und als eine starke Böe hineinfuhr und ihn komplett umstülpte, erhaschte Liam einen Blick auf ihr Engelsgesicht. Sie sah ihn ebenfalls und lächelte. Liam senkte instinktiv den Kopf, wie er es sich wegen seines geschundenen Gesichts angewöhnt hatte, und beschleunigte den Schritt, um so schnell wie möglich an ihr vorüberzukommen. Unglücklicherweise folgte eine weitere Böe, ließ ihren Schirm flattern, und während die Frau mit ihm rang, trat sie direkt in seinen Weg.
»Oh weh, entschuldigen Sie vielmals, Sir!«, rief sie immer noch lächelnd aus, und in ihren blauen Augen blitzte das Lachen. »Und das Ding hier nützt mir überhaupt nichts bei diesem schrecklichen Wetter. Ich sollte es einfach ein für alle Mal wegwerfen.«
Überrascht und erfreut, weil sie nicht vor ihm zurückschrak und ihn auch nicht neugierig anstarrte, erwiderte Liam ihr Lächeln, zog den Hut und trat nach rechts, im selben Moment, als sie nach links auswich. Ihre Wangen röteten sich niedlich, und wieder lachte sie. »Ich bitte wirklich um Entschuldigung, Sir! Ich bin offenbar heute reichlich ungeschickt, wie?«
»Soll ich?«, fragte er und deutete auf den umgestülpten Schirm.
»Wenn es Ihnen nicht zu lästig ist?«, fragte sie und reichte ihm den Schirm. »Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
Er nahm ihr das Ding aus der Hand; seine Finger streiften die glatte Seide ihres Handschuhs, woraufhin ihm merkwürdig warm unter seinem Kragen wurde. Liam brachte den Schirm wieder in die richtige Form, freute sich, dass es ihm gelungen war, ohne ihn zu beschädigen, und wagte einen zweiten Blick auf diesen Engel.