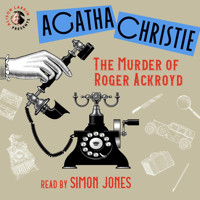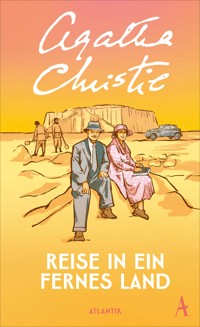
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unvergessliche Reise durch den Nahen Osten mit der Queen of Crime Mit Witz, Charme und einem unbestechlichen Blick für Ort und Menschen erzählt die Grande Dame des Kriminalromans von einem nahezu unbekannten Kapitel ihres Lebens: den abenteuerlichen Reisen zu Ausgrabungsstätten in Syrien und im Irak, die sie an der Seite ihres Ehemannes Max Mallowan, einem Archäologen, unternahm. Ihre lebendigen Eindrücke und stimmungsvollen Schilderungen nehmen die Leser mit auf eine Reise in den Orient der 1930er Jahre und zu den Schauplätzen ihrer großen Kriminalromane. "Unheimlich heiter und klug!" The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Agatha Christie
Reise in ein fernes Land
Claudia Mertz-Rychner
Meinem Mann, Max Mallowan,
dem Obristen, Buckel, Mac und Guilford
ist dieser Bericht voll Zuneigung gewidmet
Max Mallowan, Agatha Christie und Leonard Woolley in Al Mina
Er saß auf einem Tell
Ich sag euch alles, was ich kann,
weiß ich’s auch nicht im Übermaß.
Traf einen klugen jungen Mann,
auf einem Tell er saß.
»Wer sind Sie, Sir, Sie junger Mann,
und was ist Ihr Gesuch?«
Durch meinen Kopf die Antwort rann
wie Blut rinnt durch mein Buch.
Er sagt: »Ich such ’nen alten Topf,
Dinge aus früheren Tagen.
Und dann zerbrech’ ich mir den Kopf,
was diese uns wohl sagen.
Und dann (wie Sie) schreib ich es auf,
jed’s Wort zweimal so lang
wie Ihr’s und klüger obendrauf.
Den Kollegen wird ganz bang!«
Doch derweil strickte ich den Plan
’nen Millionär zu töten
Die Leich’ versteck ich in ’nem Van
oder ’nem Teich mit Kröten.
Nun ohne Antwort ihm zu geben
(so schüchtern bin ich nie)
weint’ ich: »Will wissen, wie Sie leben!
Und wann, und wo, und wie?«
Die Stimme reich an Zärtlichkeit
sagt er: »Ich muss Sie warnen.
Für mich gibt’s keine bess’re Zeit
als vor fünftausend Jahren.
Wenn Sie gern alte Schätze jagen
und die Steinzeit verehren,
dann kommen Sie mit mir und graben,
niemals zurückzukehren.
Ich war ganz abgelenkt und dachte
an Kaffee mit Arsen,
sodass ich es nicht fertigbrachte
so weit zurückzuseh’n.
Ich sah ihn an und seufzte zart,
schön war auch sein Gesicht…
»Komm sag mir, wie du lebst«, ich bat,
»mehr brauche ich auch nicht.«
Er sagt: »Ich jage hier Objekte,
gemacht von Menschenhänden.
Ich bild sie ab und pack sie ein,
um sie nach Haus zu senden.
Für Silber geb ich sie nicht her
und auch für keinen Goldbetrag.
Wir stell’n sie im Museum aus,
so wie die Tradition besagt.
Ich grabe Amulette aus,
unzüchtige Figuren,
Denn aus der Prähistorie
gibt’s viele solcher Spuren.
Und damit haben wir viel Spaß,
reich werden wir hier nicht.
Doch Archäologen werden alt,
uns geht es gut, gesundheitlich.«
Das hörte ich, denn hat ich nun
den klugen Plan geflochten,
die Leiche in ein Fass zu tun,
in dem schon Laugen kochten.
Ich dankte ihm für seine Worte,
für diese freie Diskussion,
und sagte, ich würd’ mit ihm gehen,
auf seine nächste Exkursion…
Und mach ich heut ne Sauerei,
steck Finger in die Säure,
oder zerbreche Töpferei,
was ich dann nicht bereue,
und höre ich den Fluss hier brummen,
oder ein Schrei ertönt, ganz grell,
dann seufz ich in Erinnerungen
an diesen Mann, den ich besungen –
Sein Blick war mild, sein Haar geschwungen,
ihm war Unglaubliches gelungen,
hat die Vergangenheit bezwungen,
er gab beste Erläuterungen,
er sammelte Erfahrungen,
und suchte nach Bestätigung,
auf Hügeln, in Vertiefungen,
fand Schätze bei den Ausgrabungen,
und saß auf einem Tell!
Aus dem Englischen von Hadley Heine
Vorwort
Dieses Buch gibt Antwort, Antwort auf eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird.
»Ach, Sie graben in Syrien? Erzählen Sie doch. Wie leben Sie dort, in einem Zelt?« etc. etc.
Die meisten Leute wollen es wohl gar nicht genau wissen, sie machen nur Konversation. Doch hie und da findet sich der eine oder andere, den es wirklich interessiert.
Und dieselbe Frage stellt die Archäologie an die Vergangenheit mit ihren Toten: »Wie habt ihr gelebt?«
Mit Hacken, Schaufeln und Körben finden wir die Antwort.
»Das waren unsere Kochtöpfe!« »In so einem Silo haben wir das Getreide gelagert.« »Mit diesen Knochennadeln nähten wir unsere Kleider.« »Hier befanden sich unsere Häuser, hier das Badezimmer und die sanitären Einrichtungen. Da, in diesem Topf, liegen die goldenen Ohrringe, sie gehören zur Aussteuer meiner Tochter.« »In jenem Gefäß ist mein Make-up.« »Diese Kochtöpfe sind ganz gewöhnlich. Ihr findet sie zu Hunderten. Wir holen sie beim Töpfer an der Ecke. Habt ihr Woolworth gesagt? Heißt das jetzt so?«
Manchmal stößt man auf einen Palast, nicht allzu oft auf einen Tempel, sehr viel seltener auf ein Königsgrab. Das sind natürlich Prunkstücke, sie machen Schlagzeilen in den Zeitungen, sie werden auf die Kinoleinwand projiziert, in Vorlesungen abgehandelt und überall herumposaunt. Doch meiner Ansicht nach interessiert sich der echte Ausgräber vorzugsweise für das tägliche Leben – für den Töpfer, den Bauern, den geschickten Siegel- und Amulettschneider, kurz und gut für Schuster, Schneider, Leinenweber – Doktor, Kaufmann, Totengräber.
Zum Schluss noch eine Warnung, um keine Enttäuschung aufkommen zu lassen. Dies hier ist kein tiefschürfendes Buch. Es vermittelt keine aufregenden Einsichten in die Archäologie, es fehlen auch wunderschöne Landschaftsbeschreibungen, die Lösung der ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme sowie ein historischer Abriss.
Genau besehen ist es ein Leichtgewicht, dieses Büchlein, es erzählt vom alltäglichen Leben und Treiben.
Kapitel 1Aufbruch nach Syrien
In wenigen Wochen fahren wir nach Syrien!
Wer sich im Herbst oder Winter für das heiße Klima ausrüsten will, stößt auf gewisse Schwierigkeiten. Die optimistische Hoffnung, dass die Sommerkleider vom letzten Jahr »es noch tun«, trügt. Sie »tun« es nicht mehr im entscheidenden Augenblick. Erstens wirken sie – an die bedrückenden Vermerke in den Aufstellungen von Transportfirmen erinnernd – »abgestoßen«, »zerkratzt«, »reparaturbedürftig« (zudem noch »eingelaufen, verblichen, absonderlich«). Und zweitens – leider, leider muss es gesagt sein – sind sie an allen Ecken und Enden zu eng.
Drum: auf in die Läden und Warenhäuser.
»Ja, gnä’ Frau, das ist jetzt nicht gefragt. Aber wir haben hier ein paar sehr hübsche Kostümchen – in gedeckten Farben – für große Größen.«
Ach, diese grässlichen großen Größen. Wie erniedrigend, eine große Größe zu sein. Wie viel schlimmer noch, sofort als große Größe erkannt zu werden. (Es gibt zwar auch glücklichere Tage, an denen ich, in einen gerade geschnittenen langen und schwarzen Mantel mit dem berühmten üppigen Pelzkragen gekleidet, die Verkäuferin aufmunternd flöten höre: »Gewiss ist gnä’ Frau nur mollig – Größe 44?«) Ich sehe mir die Kostümchen an mit ihren unerwarteten Pelzbesätzen und den Faltenröcken. Niedergeschlagen erkläre ich, dass mir ein Kleid aus Waschseide oder Baumwolle vorschwebt.
»Gnä’ Frau, suchen Sie doch unsere Segelabteilung auf.«
Sie sucht unsere Segelabteilung auf – ohne allzu große Zuversicht. Segeln umweht auch heute noch ein Hauch von Romantik, ein arkadisches Lüftlein. Junge Mädchen gehen segeln, sie sind schlank und frisch und tragen knitterfreie Leinenhosen, die enorm weit um die Fesseln schlabbern und hauteng um die Hüften sitzen. Junge Mädchen sind entzückend, wenn sie im Bikini baden. Und junge Mädchen sind die Kundinnen, die man für achtzehn verschiedene Modelle von Shorts im Auge hat.
Das elfenhafte Geschöpf von unserer Segelabteilung zeigt wenig Wohlwollen: »Aber nein, gnä’ Frau, wir führen keine großen Größen.« (Leises Entsetzen: große Größen – und Segeln? Wo bleibt da die Stimmung?) Es fügt noch hinzu: »Das passt wohl nicht zusammen, oder?« Betrübt gebe ich ihr recht.
Mir bleibt die eine Hoffnung: unsere Tropenabteilung.
Unsere Tropenabteilung bietet vor allem Tropenhelme an: braune Helme, weiße Helme, Patenthelme. Die zweispitzige Variante mit ihrem kecken Einschlag wird eine Spur schief getragen, sie leuchtet in den diversen Schattierungen von Rosa, Blau und Gelb wie fremde Dschungelblüten. Überdies finde ich ein riesiges Holzpferd im Angebot und eine Auswahl Reithosen.
Doch da gibt’s auch noch anderes, zum Beispiel die passende Garderobe für die Gattinnen der Gouverneure des britischen Weltreichs. Schantungseide! Schlicht geschnittene Röcke mit langem Jackett aus Schantung, ohne jedes jugendliche Kinkerlitzchen, kleiden die voluminöse Figur ebenso gut wie die hagere. Ich verschwinde mit verschiedenen Modellen und Größen in einer Umkleidekabine, und nur wenige Minuten später bin ich in eine Memsahib verwandelt. Ich unterdrücke meine Zweifel – schließlich sind diese Sachen luftig und praktisch, und ich passe noch hinein.
So wende ich mich mit gesammelter Aufmerksamkeit der Wahl der richtigen Kopfbedeckung zu. Der gewünschte Hut ist im Augenblick nicht aufzutreiben, ich muss ihn machen lassen. Das ist keineswegs so einfach, wie es klingt.
Was mir vorschwebt und was ich haben möchte und was ich mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erhalten werde, ist ein gut sitzender Filzhut in vernünftigen Proportionen. Solche Hüte trug man vor zwanzig Jahren beim Golfen oder beim Spazierengehen mit den Hunden. Jetzt gibt es nur diese Dingerchen, welche die Frauen auf den Kopf kleben, übers Auge, übers Ohr oder in den Nacken, wie es die Mode gerade diktiert – oder ebenjenen Safari-Hut mit mindestens einem Meter Durchmesser. Ich lege dar, dass ich einen Hut möchte wie den Safari-Hut, doch soll der Rand bloß ein Viertel so breit sein. »Aber nur der breite Rand schützt Sie vor der Sonne, gnä’ Frau!«
»Gewiss, aber ich fahre in eine schrecklich windige Gegend, da hält ein Hut mit einem solchen Rand keine Minute auf meinem Kopf.«
»Wir könnten ein Gummiband annähen …«
»Ich möchte einen Hut, dessen Rand Sie an diesem Hut hier abmessen können.«
»Natürlich, gnä’ Frau, mit einem flachen Kopf wird das ein entzückendes Modell.«
»Keinen flachen Kopf! Der Hut muss sitzen!!«
Sieg! Wir suchen die Farbe aus, eine dieser neuen Kreationen mit den hübschen Namen wie Staub, Rost, Schlamm, Asphalt, Asche etc.
Noch ein paar kleinere Einkäufe, von denen ich jetzt schon instinktiv weiß, wie nutzlos oder beschwerlich sie mir sein werden. Eine Reisetasche mit Reißverschluss, zum Beispiel. Das moderne Leben mit all seinen Komplikationen wird von dem grausamen Reißverschluss beherrscht. Er öffnet Blusen, er schließt Röcke, er hält Skianzüge zusammen. Und die »kleinen Kleidchen« haben, aus Jux, die überflüssigsten Reißverschlüsse.
Warum bloß? Nichts kann einen mehr entnerven als ein widerspenstiger Reißverschluss. Er bringt uns in eine misslichere Lage als jeder Knopf, Straps, Haken, jede Öse oder Spange.
In der Frühzeit des Reißverschlusses ließ sich meine Mutter aus lauter Begeisterung ein Korsett mit dieser wunderbaren Neuerung anfertigen – es hatte die unglücklichsten Konsequenzen. Das erste Schließen des Reißverschlusses war bereits ein Akt äußerster Pein, doch später verweigerte das Korsett eigensinnig das Hinabgleiten des Schiebers. Es bedurfte geradezu eines chirurgischen Eingriffs, um meine Mutter zu befreien. Und angesichts ihrer köstlichen viktorianischen Prüderie schien es zunächst durchaus möglich, dass die Gute den Rest ihres Lebens in dieser modernen Form des Keuschheitsgürtels ausharren müsste.
Deshalb habe ich Reißverschlüsse seit jeher mit Vorsicht betrachtet. Offenbar sind nur Reisetaschen mit Reißverschluss auf dem Markt.
»Die altmodischen Schlösser werden nicht mehr hergestellt, gnä’ Frau«, bemerkt der Verkäufer mit einem mitleidigen Blick. »Übrigens ist es ganz einfach, sehen Sie nur.« Er macht es mir vor. Ohne Zweifel, es ist wirklich ganz einfach – aber jetzt ist die Tasche auch leer.
»Nun gut.« Ich gebe seufzend nach. »Man muss mit der Zeit gehen.« Und voll böser Ahnungen kaufe ich die Reisetasche.
Damit bin ich die stolze Besitzerin einer Reisetasche mit Reißverschluss, des Jacketts und des Rocks einer Memsahib sowie eines möglicherweise befriedigenden Hutes.
Allerdings gibt es noch einiges andere zu erledigen.
Ich begebe mich in die Schreibwarenabteilung hinüber und erstehe mehrere Füllfederhalter und Kugelschreiber. Nach meiner Erfahrung kann sich nämlich ein Füllfederhalter in England vorbildlich aufführen, um in gottverlassenen Gegenden auf sein Streikrecht zu pochen und sich dementsprechend zu benehmen, indem er entweder wahllos über mich, meine Kleider, meinen Notizblock und alle erreichbaren Gegenstände Tinte spuckt oder mit spröder Zurückhaltung unsichtbare Krakel auf das Papier setzt. Ich nehme noch Bleistifte, bescheidene zwei Stück. Bleistifte haben zum Glück kein Temperament, sondern nur eine Neigung zu stillem Verschwinden, doch da werde ich eine sichere Quelle anzapfen. Wozu ist denn ein Architekt nütze, wenn er nicht Bleistifte ausleiht?
Der nächste Einkauf besteht aus vier Armbanduhren. Die Wüste ist nicht uhrenfreundlich. Schon nach wenigen Wochen hört dort das regelmäßige Ticken auf. Zeit, findet unsere Uhr, ist nur eine Dimension menschlicher Vorstellung, und je nach Laune bleibt sie acht-, neunmal am Tag für zwanzig Minuten stehen oder geht im Eilschritt vor. Gelegentlich wechselt sie zwischen beiden Spielarten ab. Schließlich bleibt sie stehen, und man holt Armbanduhr Nummer zwei hervor usw. Überdies versorge ich mich noch mit zwei, vier oder auch sechs Taschenuhren, um für den Augenblick gerüstet zu sein, in dem mein Mann an mich herantritt: »Ach, leih mir doch eine Uhr für den Aufseher, ja?«
Unsere arabischen Vorarbeiter haben allesamt, so tüchtig sie auch sein mögen, eine schwere Hand für einen Zeitmesser. Das Ablesen der Zeit erfordert von ihnen eine nicht geringe geistige Anstrengung. Häufig halten sie ein großes, mondgesichtiges Zifferblatt verkehrt herum und starren mit geradezu schmerzlicher Konzentration darauf, um zu einem völlig falschen Ergebnis zu kommen. Auch ziehen sie ihren kostbaren Schatz mit so viel Energie und Gründlichkeit auf, dass nur wenige Federn diesem Kraftakt gewachsen sind.
Zum Schluss haben alle Teilnehmer der Expedition ihre Uhren geopfert, eine nach der anderen – meine zwei, vier oder auch sechs Taschenuhren sollen ebendiesen scheußlichen Zeitpunkt hinausschieben.
Packen! Packen – da gibt es die verschiedensten Schulen und Glaubensrichtungen. Eine Kategorie von Reisenden fängt mindestens eine Woche oder vierzehn Tage vorher an, alles Notwendige bereitzulegen. Eine zweite Kategorie rafft eine halbe Stunde vor Abfahrt alles zusammen. Die sorgsamen Packer haben einen ungeheuren Verbrauch von Seidenpapier, die Verächter des Seidenpapiers werfen voller Optimismus ihre Sachen kreuz und quer in den Koffer. Wieder andere Packer vergessen sozusagen alles, was sie brauchen, und die letzte Kategorie schleppt ganze Berge von Zeug mit, das sie nie braucht.
Eins aber steht fest: Den Mittelpunkt archäologischen Packens bilden Bücher. Welche Bücher soll man mitnehmen, welche Bücher kann man mitnehmen, welche Bücher haben Platz und welche Bücher müssen – ein schmerzlicher Entschluss! – zu Hause bleiben? Ich bin felsenfest überzeugt, dass alle Archäologen nach folgendem System packen: Sie bestimmen die Höchstzahl der Koffer, die eine schwergeprüfte Schlafwagengesellschaft gerade noch zulässt. Dann füllen sie diese Koffer randvoll mit Büchern, um am Schluss widerstrebend ein paar Bände herauszuangeln und die freigekämpften Lücken mit Hemden, Schlafanzügen, Socken etc. aufzufüllen.
Als ich bei Max ins Zimmer schaue, gewinne ich den Eindruck, dass die Bücher bis zur Decke gestapelt sind. Durch eine Ritze zwischen den Büchertürmen erspähe ich Max’ umwölktes Gesicht. »Was meinst du«, fragt er, »bringe ich die wohl alle bei mir unter?«
Die Antwort ist so offenkundig ein klares Nein, dass es schiere Grausamkeit wäre, dies auch noch auszusprechen. Um halb fünf stürzt er mit der hoffnungsvollen Frage in mein Zimmer: »Hast du bei dir Platz?« Lange Erfahrung hätte mich lehren sollen, bestimmt abzulehnen, doch ich zögere, und schon ereilt mich mein Schicksal.
»Wenn du vielleicht ein oder zwei Kleinigkeiten …?«
»Etwa Bücher?«
Max sieht leicht überrascht drein. »Aber natürlich sind es Bücher, was sonst?«
Und mit einem Schritt nach vorn schmettert er zwei Riesenbände auf das Memsahibgewand, das proper gefaltet zuoberst auf dem Koffer liegt.
Ich erhebe lauthals Einspruch, doch zu spät.
»Unsinn«, erklärt Max, »Platz zum Verschwenden.« Und er drückt den Deckel zu, der sich mutig dagegenstemmt.
»Der Koffer ist ja immer noch nicht voll«, sagt Max mit unverwüstlicher Zuversicht. Zum Glück lenkt ihn jetzt ein buntes Leinenkleid ab, das in einem anderen Koffer liegt. »Was ist das?«
»Ein Kleid«, sage ich.
»Sehr interessant«, erwidert Max, »mit diesen Fruchtbarkeitssymbolen auf dem Vorderteil.«
Zu den schwerwiegenden Unannehmlichkeiten, welche die Ehefrau eines Archäologen zu ertragen hat, gehören die fachkundigen Kenntnisse ihres Mannes, woher sich dieses oder jenes völlig harmlose Muster ableitet. Um halb sechs teilt Max mir beiläufig mit, dass er sich noch Hemden, Socken und ein paar andere Kleinigkeiten in der Stadt besorgen will. Eine Dreiviertelstunde ist er verdrossen wieder da, weil alle Läden um sechs Uhr schließen. Auf meinen Hinweis, das sei schon immer so gewesen, erklärt er, dass ihm das bislang nicht aufgefallen sei.
Jetzt, meint er, bleibe ihm nur noch eines zu erledigen: seine Papiere zu ordnen.
Um elf Uhr gehe ich zu Bett, Max sitzt an seinem Schreibtisch (den schauerliche Strafen vor dem Aufräumen und Abstauben retten), begraben unter Briefen, Rechnungen, Broschüren, Zeichnungen von Töpfen, Scherben und vielen, vielen Streichholzschachteln, die kein einziges Streichholz enthalten, sondern seltsame, uralte Halbedelsteine.
Um vier Uhr früh tritt er hochgemut mit einer Tasse Tee ins Schlafzimmer und meldet, dass endlich jener hervorragende Artikel über die Ausgrabungen in Anatolien, den er letztes Jahr im Juli verloren habe, wieder zum Vorschein gekommen sei. »Hoffentlich habe ich dich nicht geweckt.«
Ich entgegne, natürlich habe er mich geweckt, und er könne mir ruhig ebenfalls eine Tasse Tee bringen.
Als Max mit dem Tee wieder da ist, erzählt er, dass er überdies einen ganzen Stoß Rechnungen entdeckt habe, die seiner Meinung nach von ihm bezahlt gewesen wären. Diese Erfahrung ist auch mir nicht neu. Einmütig stellen wir fest, dass sie uns bedrückt.
Um neun Uhr morgens werde ich gerufen, um mich als Schwergewicht auf Max’ überquellende Koffer zu setzen.
»Wenn du sie nicht zubringst«, sagt Max wenig ritterlich, »schafft es niemand.«
Die übermenschliche Aufgabe wird schließlich mit Hilfe der reinen Masse gelöst, und ich wende mich wieder meinem eigenen Problem zu, der Reisetasche mit Reißverschluss, wie ich visionär vorausgesehen hatte.
Als die Tasche noch leer bei Gooch stand, wirkte sie unkompliziert, hübsch und arbeitssparend. Wie fröhlich schnurrte dort der Reißverschluss auf und zu! Jetzt hingegen verlangt das Zumachen ein Wunder an Stimmigkeit. Da die Tasche randvoll ist, müssen die beiden Seiten mit mathematischer Genauigkeit zusammenpassen. Kaum rückt der Schieber langsam vor, erlebe ich neue Qualen wegen der Ecke eines Kulturbeutels. Zu guter Letzt ist es erreicht, und ich gelobe, die Tasche erst in Syrien wieder zu öffnen.
Bei genauer gedanklicher Prüfung ist das jedoch schlecht durchführbar – Grund: jener eben erwähnte Kulturbeutel. Soll ich mich auf der Reise etwa fünf Tage lang nicht waschen? Im Augenblick scheint mir das weit verlockender, als mich an das Öffnen der Tasche heranzuwagen.
Ja, jetzt ist es so weit, wir brechen wahrhaftig auf – und zahllose wichtige Punkte sind unerledigt geblieben: Die Wäscherei versagte, wie gewohnt, auch die Reinigung hat zu Max’ Kummer ihr Versprechen nicht eingehalten … Aber was macht das schon? Wir brechen auf.
Das heißt, für ein bis zwei kritische Minuten sieht es so aus, als ob wir keineswegs aufbrechen würden. Max’ Koffer, nur dem Schein nach harmlos, überfordern die Kräfte des Taxifahrers. Er und Max mühen sich zusammen ab, und erst mit Hilfe eines Passanten lässt sich das Gepäck in den Wagen hieven.
Wir fahren zur Victoria Station.
Du lieber Bahnhof, die Pforte zur Welt jenseits von England, wie sehr liebe ich deine Bahnsteige, wo die Züge zum Kontinent stehen. Wie sehr liebe ich überhaupt Züge! Begeistert schnuppere ich ihren schwefligen Mief – was für ein Unterschied zu dem diskreten, distanzierten, leicht öligen Geruch eines Schiffes, der mich stets melancholisch stimmt, da er mir Tage der Seekrankheit prophezeit. Nur ein Zug, ein mächtiger, schnaufender, hastender, geselliger Zug ist ein Freund, wenn seine schwer stampfende Maschine Rauchwolken ausstößt und ungeduldig die Melodie rattert: »Weiter geht’s, weiter geht’s, weiter geht’s, es geht weiter.« Er empfindet wie ich: »Weiter geht’s, weiter geht’s, es geht weiter.«
Bei der Tür unseres komfortablen Pullmanwagens wartet ein Häuflein Freunde auf uns. Wir führen die üblichen albernen Gespräche. Bedeutende letzte Worte fallen von meinen Lippen – Verfügungen über Hunde und Kinder, über das Nachsenden von Briefen und Bücherpaketen sowie von vergessenen Kleinigkeiten – »Ich glaube, das liegt auf dem Klavier, aber vielleicht findest du es auch im Badezimmer auf dem Schränkchen.« Alles ist schon längst gesagt worden, es gibt nichts Nutzloseres als diese Wiederholungen.
Max steht umringt von seinen Verwandten, ich von den meinen.
Meine Schwester schluchzt, überzeugt, mich nie wiederzusehen. Das beeindruckt mich wenig, weil meine Orientreisen sie immer davon überzeugt haben. Und wie, fragt sie, soll sie sich verhalten, wenn Rosalind eine Blinddarmentzündung bekommt? Mir scheint kein triftiger Grund dafür vorzuliegen, dass sich der Blinddarm meiner vierzehnjährigen Tochter entzündet, weshalb mir als Antwort bloß einfällt: »Operiere ja nicht selbst!« Meine Schwester ist nämlich weithin berühmt für ihre hitzigen Aktionen mit der Schere, die sie Furunkeln, langen Haaren und Kleidern gleichermaßen angedeihen lässt – mit großem Erfolg, wie ich zugeben muss. Max und ich tauschen die Verwandten, und meine gute Schwiegermutter empfiehlt mir nachdrücklich äußerste Vorsicht, da ich mich, wie sie durchblicken lässt, mit Heldenmut großer persönlicher Gefahr aussetze. Schrilles Pfeifen veranlasst mich, meiner Freundin und Sekretärin letzte Aufträge zu geben. Sie soll alles erledigen, was bei mir liegen geblieben ist: Sie soll Wäscherei und Reinigung in Trab setzen, der Köchin ein gutes Zeugnis schreiben, alle Bücher, die ich nicht mehr packen konnte, zur Post tragen, meinen Schirm bei Scotland Yard abholen und jenem Pfarrer höflich antworten, der in meinem letzten Buch dreiundvierzig Grammatikfehler entdeckt hat. Und sie soll den Samenkatalog für den Garten durchsehen und Kürbis und Pastinake anstreichen. Ja, sie wird alles erledigen, und falls die häusliche oder literarische Welt untergeht, will sie mir telegrafieren. Wozu denn, sage ich, sie hat doch jede Vollmacht und kann nach Belieben entscheiden. Sie schaut mich entgeistert an und verspricht, bedächtig vorzugehen. Wieder schrilles Pfeifen. Ich umarme meine Schwester und lasse mich zu der Bemerkung hinreißen, auch ich sei überzeugt, sie nie wiederzusehen, und mit einer Blinddarmentzündung bei Rosalind könne man durchaus rechnen. Unsinn, sagt meine Schwester, warum denn? Wir steigen in den Pullmanwagen, der Zug ächzt, fährt an – wir sind weg.
Ungefähr fünfundvierzig Sekunden lang ist mir scheußlich zumute, doch sobald der Bahnhof hinter uns liegt, erfüllt mich helles Jauchzen. Wir haben die so herrlich aufregende Reise nach Syrien begonnen.
Ein Pullmanwagen besitzt eine großartige und einschüchternde Aura, obwohl er nicht halb so bequem ist wie ein gewöhnliches Abteil erster Klasse. Doch wir fahren immer in einem Pullman, allein Max’ Gepäck zuliebe, das ein normales Eisenbahnabteil sprengen würde. Seit aufgegebene Koffer einmal verloren gegangen sind, lässt Max sich mit seinen kostbaren Büchern auf kein Risiko mehr ein.
In Dover finden wir ein verhältnismäßig ruhiges Meer vor. Dennoch verschwinde ich im Salon des Dames, um auf einer Liege zu meditieren mit all dem Pessimismus, den das Schaukeln der Wellen noch jedes Mal in mir züchtet. Schnell sind wir in Calais, und der französische Steward schleppt einen breitschultrigen Mann in blauer Bluse an, der sich um mein Gepäck kümmern soll. »Madame wird ihn am Zoll treffen«, sagt er dazu.
»Was hat er für eine Nummer?«, erkundige ich mich.
Der Steward strahlt sogleich Missbilligung aus: »Madame! Mais c’est le charpentier du bâteau!«
Ich werde entsprechend verlegen – um kurz darauf zu bedenken, dass diese Antwort nicht weiterhilft. Warum sollte die Tatsache, dass es sich um den Schiffszimmermann handelt, mir erleichtern, diesen Mann nachher unter mehreren hundert anderen in blauer Bluse zu erkennen, die alle »Quatre-vingt treize« und so weiterbrüllen? Sein Schweigen allein reicht zur Identifizierung kaum aus. Und umgekehrt: Verleiht ihm die Tatsache, dass es sich um den charpentier du bâteau handelt, die unumstößliche Sicherheit, eine ältere Engländerin aus einem ganzen Haufen älterer Engländerinnen herauszufinden?
An diesem Punkt meiner Überlegungen unterbricht mich Max mit der frohen Botschaft, er habe für mein Gepäck einen Gepäckträger aufgetrieben. Ich erkläre ihm, dass sich darum bereits der charpentier du bâteau bemühe, und Max möchte wissen, warum. Das ganze Gepäck sollte doch beisammenbleiben. Ich bin völlig seiner Meinung und kann zu meiner Verteidigung nur anführen, dass Seereisen mich jedes Mal geistig strapazieren. Max sagt: »Dann sammeln wir eben alles beim Zoll ein.« Und wir begeben uns zu jenem Inferno schreiender Gepäckträger sowie dem unvermeidlichen Zwischenspiel mit der einzigen Gattung durchdringend unangenehmer Französinnen, der Zollbeamtin, einem Geschöpf ohne Charme, Chic und Grazie. Sie schnüffelt, sie späht, sie fragt ungläubig: »Pas de cigarettes?«, und kritzelt schließlich mit widerstrebendem Knurren die mystischen Kreidehieroglyphen auf unsere Koffer – dann gehen wir durch die Absperrung zum Bahnsteig hinüber, hinüber zum Simplon-Orientexpress, der uns quer durch Europa fahren wird.
Wenn ich vor vielen, vielen Jahren die Riviera oder Paris besuchte, wurde mir in Calais beim Anblick des Orientexpresses jedes Mal warm ums Herz, und ich wünschte sehnlich, einsteigen zu dürfen. Jetzt verbindet uns eine alte Freundschaft, aber eine Spur Erregung ist geblieben. Diesen Zug nehme ich – ich stehe schon drin – ich sitze wahrhaftig in dem blauen Wagen, an dem außen das schlichte Schild hängt: Calais–Istanbul. Der Orientexpress ist mir ohne Zweifel der liebste von allen. Ich liebe sein Tempo Allegro con fuoco zu Anfang, das Schütteln und Rattern in der wilden Hast, Calais und den Okzident hinter sich zu lassen; es vermindert sich auf dem Weg nach Osten zu einem rallentando, bis es in einem unverkennbaren lento endet.
Am nächsten Morgen ziehe ich in aller Frühe das Rouleau hoch und schaue mir die schattenhaften Umrisse der Schweizer Alpen an. Wir fahren in die oberitalienische Ebene hinunter, am Gardasee und dem lieblichen Stresa vorbei. Später braust der Zug in den schmucken Bahnhof von Venedig – mehr bekommen wir von dieser Stadt nicht zu sehen – und wieder heraus und am Meer entlang nach Triest und durch Jugoslawien. Seine Geschwindigkeit nimmt stetig ab, die Aufenthalte dehnen sich mehr und mehr, die Bahnhofsuhren zeigen die widersprüchlichsten Zeiten. Auf westeuropäische folgt zentraleuropäische, dann osteuropäische Zeit. Die Namen der Stationen sind in unwahrscheinlichen und merkwürdigen Lettern angeschrieben. Die Lokomotiven, dick und gemütlich, stoßen einen besonders üblen schwarzen Rauch aus. Im Speisewagen werden die Rechnungen in erstaunlichen Währungen präsentiert, dazu die sonderbarsten Mineralwässer. Uns gegenüber sitzt ein kleiner Franzose am Tisch, schweigend in das Studium seiner Rechnung versunken. Nach mehreren Minuten hebt er den Kopf, sucht Max’ Blick und äußert mit erregt klagender Stimme: »Le change des Wagons Lits, c’est incroyable!« Auf der anderen Seite des Ganges bittet ein dunkelhäutiger Mann mit gebogener Nase um Auskunft, was seine Rechnung a) in Francs, b) in Lire, c) in Dinar, d) in türkischen Pfund und e) in Dollar betrage. Als der lang gestreckt leidende Speisewagenkellner das endlich ermittelt hat, holt unser Mitreisender nach kurzem Kopfrechnen – offensichtlich ein Finanzgenie – die für ihn günstigste Valuta aus der Tasche. Wie er uns erklärt, hat er damit fünf englische Pence gespart.
Am Morgen tauchen türkische Zollbeamte im Zug auf. Sie haben Zeit und großes Interesse an unserem Gepäck. Warum, fragen sie mich, nehme ich so viele Schuhe mit? Es sind viel zu viele. »Aber ich als Nichtraucherin habe keine Zigaretten bei mir, erlauben Sie mir stattdessen nicht ein paar zusätzliche Schuhe?« Der Zöllner lässt das Argument gelten, es leuchtet ihm ein. Und was ist das für ein Puder in dem Döschen hier, fragt er dann.
»Puder gegen Wanzen.« Das kapiert der Mann nicht. Stirnrunzelnd mustert er mich, voller Misstrauen, er hält mich für einen Drogenschmugglerin. »Dieser Puder ist weder für das Gesicht noch für die Zähne, für was ist er dann?«, will er vorwurfsgeladen wissen. Beschwingte Pantomime meinerseits. Ich kratze mich ganz realistisch, fange den Eindringling, bestäube das Holz. Ah, jetzt ist alles klar. Mit zurückgeworfenem Kopf lacht er schallend und wiederholt mehrmals ein türkisches Wort. Dagegen ist der Puder! Er erzählt diesen guten Witz einem Kollegen, und von Lachen geschüttelt gehen sie weiter. Der Schlafwagenschaffner erscheint, um uns zu drillen. Bei der Passkontrolle würden wir gefragt, welchen Geldbetrag wir mit uns führen – »Effectif, vous comprenez?« Ich liebe das Wort effectif – es beschreibt so genau das Gefühl von Bargeld in der Hand. »Sie werden«, fährt der Schaffner fort, »effectif genau so viel angeben.« Er nennt die Summe. Max widerspricht, weil wir mehr bei uns haben. »Was macht das schon! Die Wahrheit bringt Sie in Verlegenheit, sagen Sie, Sie hätten Kreditbriefe oder Reiseschecks und effectif genau so viel.« Als Erklärung fügt er noch an: »Was Sie haben, spielt keine Rolle, doch Ihre Angabe muss en règle sein, verstehen Sie, sagen Sie also genau so viel.«
Und schon kommt der Herr Finanzverwalter. Er notiert unsere Antwort, fast bevor wir den Mund öffnen. Alles ist en règle. Eben erreichen wir Istanbul, wir schlängeln uns zwischen merkwürdigen Holzhäusern mit Schieferdächern hindurch und heraus und erhaschen flüchtige Ausblicke auf die Theodosianische Mauer und das Meer zu unserer Rechten.
Istanbul macht mich verrückt – wenn man in dieser Stadt drin ist, sieht man sie nicht. Erst müssen wir Europa verlassen und über den Bosporus auf die asiatische Seite fahren, um Istanbul auch wirklich zu sehen. Wunderschön liegt es da an diesem Morgen, in einem klaren, bleichen Licht ohne Dunst, und die minarettenreichen Moscheen zeichnen sich vom Himmel ab.
»La Sainte Sophie ist herrlich«, schwärmt ein Franzose. Jedermann stimmt ein, bis auf eine unrühmliche Ausnahme, und die bin ich. Ich Unglücksrabe habe der Hagia Sophia nie etwas abgewinnen können. Ein bedauerlicher Mangel an Kunstverstand, aber so ist es. Schon immer war ich der Ansicht, dass diese Moschee einfach falsche Maße aufweist. Voller Scham über meinen perversen Geschmack halte ich den Mund.
In Haidar Pascha geht’s rein in den wartenden Zug und heißhungrig zum Frühstück – sobald der Zug endlich fährt. Dann folgt die liebliche Reise eines langen Tages am Marmarameer entlang, in dessen Buchten es von zartumrissenen bezaubernden Inseln wimmelt. Zum hundertsten Mal wünsche ich mir, eine dieser Inseln zu besitzen. Welch merkwürdige Sehnsucht, eine Insel ganz für sich zu haben. Fast alle packt es früher oder später, sie erhoffen sich dort Freiheit, Unbeschwertheit, Alleinsein. Doch die Wirklichkeit brächte, wie ich vermute, nicht Freiheit, sondern Gefangenschaft. Die Versorgung wäre doch völlig vom Festland abhängig. Pausenlos würde ich für den Kolonialwarenhändler lange Listen verfassen, mich um Fleisch- und Brotsendungen kümmern, und dazu hätte ich noch den Haushalt am Hals, da kaum ein Dienstmädchen auf einer Insel leben wollte, weit weg von ihren Freunden und dem Kino, ja sogar ohne Busverbindung zu ihresgleichen. Da ist eine Südseeinsel doch ganz was anderes, jedenfalls in meiner Vorstellung. Dort könnte man geruhsam die besten Früchte schmausen, ohne sich um Teller, Messer, Gabel, den Abwasch und das Fett im Ausguss zu scheren. Allerdings haben die einzigen Südseeinsulaner, die ich je essen sah, fetttriefenden Schmorbraten von ihren Tellern geschaufelt, die auf einem rabenschwarzen Tischtuch gedeckt waren.
Nein, eine Insel ist – und sollte es auch bleiben – ein Traum. Auf jener Trauminsel kennt man weder Kehren, Abstauben, Bettenmachen noch schmutzige Wäsche, Spülen, Fett, Vorratsplanung, Einkaufslisten, Lampenputzen, Kartoffelschälen, Mülltonnen – dort gibt es nur weißen Sand und blaues Meer, vielleicht noch ein zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gelegenes Märchenhaus, einen Apfelbaum, das Zwitschern und die goldenen …
Da schreckt Max mich auf mit der Frage, woran ich denke. Ich antworte schlicht: »Ans Paradies.«
Max sagt: »Warte nur, bis du vor dem Dschaghdschagh stehst.«
»Ist er schön?«
Max hat keine Ahnung, aber jene Gegend sei hochinteressant und im Grunde auch unerforscht.
Der Zug schlängelt sich eine Schlucht empor, und wir verlassen das Meer. Am nächsten Morgen schauen wir überwältigt von den Cilicischen Toren herab. Uns ist, als ob wir am Rande der Welt stünden und auf das Gelobte Land herabblickten – so muss es Moses zumute gewesen sein. Auch hier gibt es kein Herabsteigen. Der sanfte, dunkelblau verschwommene Zauber gehört zu einem Land, das man nie betreten wird. Die echten Städte und Dörfer verwandeln sich beim Betreten in die graue Alltagswelt – verflogen ist die verführerische Schönheit, die dich herabzieht.
Der Zug pfeift, wir klettern in unser Abteil und auf in Richtung Aleppo. Und von Aleppo nach Beirut. Dort sind wir mit unserem Architekten verabredet, und dort treffen wir unsere Vorbereitungen, um nach einem ersten Überblick über die Region von Khâboûr und Dschaghdschagh einen für die Ausgrabung geeigneten Hügel zu bestimmen.
Denn dies ist, laut Mrs. Beeton, das A des Anfangs. »Erst musst du den Hasen jagen«, bemerkte jene schätzenswerte Dame in Großmutters Kochbuch. Das heißt für uns: Erst musst du den Hügel finden. Und das haben wir vor.
Kapitel 2Das Gelände wird erkundet
Beirut! Blaues Meer, eine geschwungene Bucht, an der Küste entlang streckt sich eine dunstig blaue Gebirgskette. Das ist die Aussicht von der Hotelterrasse. Von meinem landeinwärts gelegenen Schlafzimmer schaue ich auf einen Garten mit dunkelroten Poinsettias. Das Zimmer ist hoch, schmutzig weiß und erinnert vage an ein Gefängnis. Ein modernes Waschbecken mit Wasserhähnen und einem Ablaufrohr blinkt als verwegene zivilisatorische Neuerung. Darüber hängt ein großer viereckiger Kasten mit abnehmbarem Deckel, randvoll mit schalem Wasser, das in den Kaltwasserhahn abfließt. (Später wurde dort ein modernes Hotel, das St. George, eröffnet.)
Im Osten hat die Klempnerei so ihre Tücken. Wie oft kommt ein warmes Getröpfel aus dem Kaltwasserhahn und umgekehrt. Und nie vergesse ich jenes nach westlichem Vorbild neu eingerichtete Badezimmer, wo ein einschüchterndes Röhrensystem ungeheure Massen kochenden Wassers produzierte, doch absolut kein kaltes Wasser liefern wollte. Auch klemmte der Hahn und der Türriegel dazu.
Als ich begeistert die Poinsettias betrachte und angewidert die Waschgelegenheit, klopft es an die Tür, und ein kleiner, untersetzter Armenier tritt herein. Er lächelt gewinnend, öffnet den Mund, zeigt mit dem Finger in seinen Schlund und stößt ein aufmunterndes »Manger!«hervor. Mit diesem schlichten Kunstgriff macht er auch dem Dümmsten klar, dass im Speisesaal serviert wird.
Unten erwartet mich Max mit unserem neuen Architekten, Mac, mir noch so gut wie unbekannt. In ein paar Tagen brechen wir zusammen auf, um drei Monate lang mit dem Zelt umherzuziehen auf der Suche nach möglicherweise ergiebigen Grabungsorten. Als Führer und philosophischer Freund soll uns in diesem Herbst Hamoudi begleiten, seit vielen Jahren Aufseher in Ur. Von dort stammt die alte Beziehung zu meinem Mann.
Mac erhebt sich, um mich formvollendet zu begrüßen, und wir verzehren ein gutes, allerdings eine Spur zu fettes Essen. Ich äußere einige liebenswürdige Sätze zu Mac, der sie erfolgreich abblockt mit einem »Ja?«, »So?«, »Gewiss!«.
Das dämpft erheblich. Das unbehagliche Gefühl überschwemmt mich, dass unser junger Architekt zu den Leuten gehört, bei denen mir immer wieder vor lauter Hemmungen der Geist ausgeht. Gott sei Dank sind jene Zeiten längst vorbei, da mich vor jedermann Hemmungen plagten. Im mittleren Alter habe ich das nötige gelassene Savoir-faire erlangt, und ab und an beglückwünsche ich mich, dass all diese Dummheiten endgültig hinter mir liegen. »Ich bin sie los!«, bestätige ich mir heiter. Und so sicher wie das Amen in der Kirche taucht unverhofft ein Individuum auf, das mich aufs Neue in einen nervösen Trottel verwandelt.
Mir hilft auch nicht die Vermutung, der junge Mac sei selbst übertrieben gehemmt und gebe sich eben darum dermaßen abwehrend. Es bleibt dabei: Vor seiner kühlen Herablassung, seinen nachsichtig hochgezogenen Brauen, vor seiner höflichen Aufmerksamkeit gegenüber all den Bemerkungen, von denen ich weiß, dass sie unmöglich solcher Mühe wert sind, verwelke ich zusehends und höre mich mit klarem Verstande schieren Unsinn daherschwatzen. Gegen Ende dieser Mahlzeit erteilt mir Mac einen Verweis. »Hören Sie«, meint er freundlich zu meinen verwegenen Tiraden über das Waldhorn, »das kann doch gar nicht sein.«
Natürlich hat er recht, es kann gar nicht sein.
Nach dem Essen will Max wissen, wie mir Mac gefällt. Ich antworte vorsichtig, er wirke nicht sehr gesprächig. Das findet Max einen unbezahlbaren Vorzug. »Ist dir klar«, sagt er, »was das heißt, in der Wüste an einen unermüdlichen Quassler gefesselt zu sein? Ich habe ihn genommen, weil er so gut schweigt.«
Das leuchtet mir ein, ich gebe es zu. Max sagt mir überdies zum Trost: »Wahrscheinlich ist er noch gehemmt, aber nicht mehr lange. Du jagst ihm eben Angst ein.«
Ich erwäge diese herzerquickende Deutung, ohne dass sie mich zu überzeugen vermag. So versuche ich, mich geistig etwas aufzurüsten. Erstens, hämmere ich mir ein, bist du alt genug, um Macs Mutter sein zu können. Zweitens bist du eine Schriftstellerin, eine berühmte sogar. Eine deiner Personen kam im Kreuzworträtsel der Times vor – wenn das keine Anerkennung ist! Und was am meisten ins Gewicht fällt: Du bist die Frau des Expeditionsleiters. Nimm dich also zusammen; wenn einer hier die Nase hoch trägt, dann bist du es und nicht dieser junge Mann. Lass dir nichts gefallen!
Später wollen wir unten Tee trinken, und ich mache mich auf, um Mac dazu zu bitten. Ich bin entschlossen, mich ungekünstelt und freundlich zu geben. Sein Zimmer ist unglaublich aufgeräumt, Mac sitzt auf einer zusammengefalteten karierten Wolldecke, sein Tagebuch auf den Knien. Er schaut mich höflich fragend an. »Haben Sie nicht Lust, mit uns Tee zu trinken?«
Mac erhebt sich. »Gerne.«
»Nachher möchten Sie bestimmt die Stadt kennenlernen«, rege ich an, »es macht doch Spaß, ein bisschen herumzuschnüffeln.«
Mac zieht milde die Augenbrauen hoch und erwidert kühl: »So?«
Das nimmt mir den Wind aus den Segeln. Ich führe den jungen Mann in die Halle zu Max, der in glücklichem Schweigen größere Mengen Kekse verzehrt. Max trinkt wohl Tee in der Gegenwart, doch sein Geist weilt in den Gefilden von circa 4000
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: