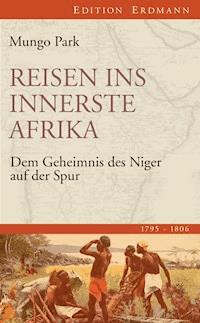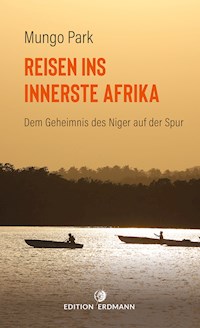
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Erdmann in der marixverlag GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1795 bricht der junge schottische Arzt Mungo Park in offizieller Mission auf, um das weitgehend unbekannte, unerschlossene, wilde Innere Afrikas weiter zu erforschen. Angezogen vom gewaltigen Strom Niger und dem legendären Timbuktu, der "Königin der Wüste", dringt er tief in den "dunklen Kontinent" vor. Vier vorherige Expeditionen waren bereits gescheitert, sein direkter Vorgänger war unterwegs ermordet worden. Parks Rückkehr am Weihnachtstag 1797 ist eine Sensation, seine Berichte machen ihn berühmt. Doch Park ruht sich auf seinem Ruhm nicht aus, er kommt in der Heimat nicht zur Ruhe, denn er ist dem Zauber Afrikas verfallen. Ermutigt durch den Erfolg seiner ersten Expedition unternimmt er 1805 entgegen vieler Warnungen eine zweite Reise. Diesmal gelangen nur seine Tagebücher zurück in die Heimat – er selbst bleibt in den Weiten Afrikas verschollen. Bei heutigen Reisen ins innerste Afrika ist aufgrund der politischen Lage oft noch Vorsicht geboten, trotzdem werden touristische Niger-Flussexpeditionen auf den Spuren Parks angeboten. In seinen lebendigen, eindrücklichen Schilderungen ist es möglich, sich lesend sicher dort zu verlieren, wo Mungo Park selbst verloren ging: auf der Lebensader Niger, im Herzen Afrikas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mungo Park
REISEN INS INNERSTE AFRIKA
Dem Geheimnis des Niger auf der Spur
Herausgegeben von Heinrich Pleticha
Mungo Park
INHALT
Einführung
Mungo Parks erste Reise im Inneren von Afrika
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebter Abschnitt
Achter Abschnitt
Neunter Abschnitt
Zehnter Abschnitt
Elfter Abschnitt
Zwölfter Abschnitt
Dreizehnter Abschnitt
Vierzehnter Abschnitt
Fünfzehnter Abschnitt
Sechzehnter Abschnitt
Siebzehnter Abschnitt
Achtzehnter Abschnitt
Neunzehnter Abschnitt
Zwanzigster Abschnitt
Einundzwanzigster Abschnitt
Zweiundzwanzigster Abschnitt
Dreiundzwanzigster Abschnitt
Mungo Parks zweite Reise im Inneren von Afrika
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Das Tagebuch Isaakos
Amadi Fatoumas Bericht
Fortsetzung von Isaakos Tagebuch
Anhang
Worterklärungen
Quellenverzeichnis
Köcher und Pfeil eines Bambarra-Häuptlings
EINFÜHRUNG
Im Jahre 1788 wurde in London die »British Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa« gegründet. Diese »British African Association«, auf Deutsch »Afrikanische Gesellschaft«, wie man sie allgemein kurz nannte, hatte nichts mit den zahlreichen Handelsgesellschaften dieser Zeit zu tun. Sie wollte, wie die Gründungsakte betont, die Zivilisation der Eingeborenen heben und den Sklavenhandel bekämpfen, vor allem aber die Erforschung Innerafrikas vorantreiben.
Bis zu diesem Zeitpunkt war von Afrika so wenig bekannt, dass es nicht nur wegen seiner Bewohner mit Recht der »dunkle Erdteil« genannt werden durfte. Die Fahrten der portugiesischen Entdecker hatten in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wenigstens die Küsten erschlossen und ein verhältnismäßig klares Bild der Umrisse des Erdteils erbracht. Gelegentlich waren Händler und Missionare ein Stück in das Innere vorgedrungen. So hatte beispielsweise schon 1613 der Jesuit Pedro Paez den Tanasee in Äthiopien als den Quellsee des Blauen Nils entdeckt. Aber solche Reisen bildeten Ausnahmen. Auch Nachrichten arabischer Händler über Innerafrika gelangten an die Küste, erbrachten aber nur ungenaue Vorstellungen, sodass schon Jonathan Swift (1667–1745), der geniale Autor von »Gullivers Reisen«, über die Karten Afrikas spötteln konnte:
»Geographers in Afric maps
With savage pictures fill their gaps
And over inhabitable downs
Place elephants, for want of towns.«
(Das heißt: »Die Geografen füllen auf den Karten Afrikas ihre Lücken mit wilden Zeichnungen und malen in unbewohnbare Flächen aus Mangel an Städten Elefanten ein.«) Erst 1749 fasste der französische Kartograf Bourguignon d’Anville (1697–1782) die Kenntnisse seiner Zeit in einer für die damaligen Verhältnisse gründlichen, wissenschaftlich fundierten Karte zusammen. Die riesigen weißen Flecken im Innern konnte er dabei allerdings auch nicht ausmerzen.
Glücklicherweise waren die Mitglieder der »African Association« keine Fantasten, sondern gingen bei ihren Planungen sehr methodisch vor und setzten von vornherein einige Schwerpunkte, zu denen vor allem die Erforschung des Nigers gehörte. Hier mochte nicht zuletzt das Interesse an der geheimnisumwobenen Handelsmetropole Timbuktu mitspielen. Nachrichten über Größe, Macht und Reichtum dieser Stadt, der alten Residenz der Songhai-Herrscher, waren längst nach Europa gedrungen, bisher hatte sie aber noch kein Weißer erreicht. Man wusste nur, dass sie an einem großen, nach Osten fließenden Strom lag, der entweder in einem See – dem nur vage bekannten Tschadsee – mündete oder einen Nebenfluss des Nils bildete. Zwar war schon seit dem 16. Jahrhundert das Mündungsdelta des Nigers bekannt, ob und wie aber dieser Fluss mit dem Stromsystem des Sudans zusammenhing, wusste niemand zu sagen.
Die ersten vier Expeditionen der »African Association« nach Innerafrika scheiterten. Der britische Major Houghton, der den Lauf des Nigers erforschen und nach Möglichkeit bis Timbuktu vordringen sollte, war unterwegs ermordet worden. Deshalb übertrugen die Herren in London diese Aufgabe nun dem erst zweiundzwanzigjährigen schottischen Arzt Mungo Park.
Park war am 10. September 1771 als siebtes Kind eines Packers in Powlshiels bei Selkirk in Schottland geboren worden. Nach dem Medizinstudium in Edinburgh war er 1792/93 als Schiffschirurg nach Sumatra gereist und nach seiner Rückkehr in die Dienste der »African Association« getreten. Nach sorgfältigsten Vorbereitungen und Studien in London reiste er schließlich am 22. Mai 1795 von Portsmouth aus mit dem Handelsschiff »Endeavour« an den Gambia und erreichte am 21. Juni den kleinen Hafen Dschillifrih. Hier setzt sein Reisebericht ein, in dem er ausführlich alle Erlebnisse bis zum Juni 1797 schildert.
Am Weihnachtstag des gleichen Jahres traf er wieder in London ein, wo seine Rückkehr eine Sensation bildete. Die Londoner Gesellschaft riss sich geradezu um ihn, doch zeigte er sich sehr zurückhaltend und wortkarg. »Er benimmt sich wie ein Negerkönig«, warf ihm eine seiner zahlreichen Gastgeberinnen vor.
Mungo Parks erste Reise 1795–1797
Schon im Sommer des folgenden Jahres überreichte er der »African Association« seinen ersten Rechenschaftsbericht, den er dann zusammen mit Brian Edwards, dem Sekretär der »African Association« ausarbeitete. Man ist verschiedentlich der Frage nachgegangen, welchem der beiden Männer die größeren schriftstellerischen Verdienste an den ungemein lebendigen und farbigen Schilderungen zukommen. Edwards selbst hob hervor, dass Park nach anfänglichen Schwierigkeiten ein beachtenswertes schriftstellerisches Talent entwickelt habe. Die weitgehend unbearbeiteten Aufzeichnungen der zweiten Reise lassen daran allerdings wieder Zweifel aufkommen; denn selbst in diesen einfachen Niederschriften hätte sich dieses Talent doch wenigstens einigermaßen äußern müssen. An den großartigen Leistungen Parks mindern solche Fragen nichts, ebenso wenig an dem Vergnügen, das die Lektüre seines Buches bereitet, das 1799 erschien und dessen erste Auflage in Höhe von 1500 Exemplaren innerhalb einer Woche verkauft war.
Deutlich zeigte sich, dass mit Park nicht nur eine neue Epoche in der Erforschung Afrikas begonnen hatte, sondern dass er auch der Reiseliteratur neue Impulse gab. Gewiss war er noch in starkem Maße dem Denken der Aufklärungszeit verhaftet, wenn er sich etwa mit Problemen der Zivilisierung der Negervölker auseinandersetzt. Seine Auffassung, dass die Farbigen Barbaren seien, solange sie dem Heidentum verfallen bleiben, spiegelt sogar das alte Denken der spanischen Konquistadoren des 16. Jahrhunderts, das im Grundsätzlichen von jenen anderen europäischen Nationen übernommen wurde, die eine Rechtfertigung ihres Kolonialismus suchten.
Aber er zeigt auch schon Verständnis für den Afrikaner, lehnt Pauschalurteile über ihre allgemeine Trägheit ab und sucht eine Erklärung dafür aus den klimatischen Verhältnissen zu geben. Die Habgier mancher Farbiger, unter der er so schwer zu leiden hatte, entschuldigt er aus der vergleichbaren Haltung ärmerer Bevölkerungsschichten in England. Mitfühlend beschreibt er die Trauer einer Mutter um den getöteten Sohn oder den Schmerz einer jungen Sklavin, die überraschend verkauft wird.
Sein besonderes Interesse gilt zwar naturwissenschaftlichen Problemen, doch liefert er auch gute ethnologische Beiträge. Wichtig – und im Allgemeinen viel zu wenig beachtet – sind seine Beobachtungen zum innerafrikanischen Sklavenhandel. Hier geht er sogar auf die historischen Ursprünge ein, analysiert die verschiedenen Arten der Sklaverei und ermöglicht Einblicke in die Bevölkerungsschichten. Sein Bericht über den Weg einer Sklavenkarawane aus dem Innern an die Küste gehört zusammen mit den späteren Schilderungen seines Landsmannes David Livingstone (1813–1873) zu den erschütterndsten und zugleich wichtigsten Aussagen eines europäischen Augenzeugen über die afrikanische Sklaverei. Wenig Beachtung dagegen schenkte er, wie seine Vorgänger und wie viele spätere Forscher, historischen Fragen. Immerhin bereiste er Gebiete, die im Mittelalter zu afrikanischen Großreichen gehörten. Noch konnten nicht alle Spuren der Vergangenheit ausgelöscht sein, doch scheinen sie ihn nicht interessiert zu haben. Am wichtigsten waren natürlich die geografischen Ergebnisse seiner Reise, so knapp sie sich auch in wenigen Worten zusammenfassen lassen. Er hatte nachweisen können, dass kein Zusammenhang zwischen den Stromgebieten der westwärts gerichteten Flüsse Senegal und Gambia und dem nach Osten fließenden Niger bestand. Die Breite des Stromes, den er von Sego aus noch etwa hundertzwanzig Kilometer abwärts verfolgte, ließ darüber hinaus den Schluss zu, dass kein Zusammenhang mit dem Nil bestand.
Mit der Veröffentlichung des Reiseberichts sah Park seine Aufgabe als erfüllt an. Kurz nach Erscheinen des Buches heiratete er im Sommer 1799 und ließ sich für die nächsten Jahre in Schottland nieder. Die Einnahmen aus seinem Buch und das Honorar der »African Association« ermöglichten ihm ein sorgenfreies Leben, und so ist es durchaus verständlich, dass er Vorschläge der britischen Regierung ablehnte, sich als Arzt in der Kolonie Neu-Südwales niederzulassen. 1801 übernahm er eine bescheidene Landpraxis in Peebles/Schottland.
Im gleichen Jahr schrieb ihm Sir Joseph Banks, der Präsident der »African Association«, dass diese zusammen mit der Regierung eine neue Forschungsreise an den Niger ausrichten wolle und man beabsichtige, ihm die Leitung zu übertragen. Die Verhandlungen zogen sich noch bis 1803 hin. Obgleich ihm einige Nachbarn, unter ihnen der große schottische Dichter Walter Scott (1771–1832), abrieten, entschloss er sich doch, das Angebot anzunehmen. Die Vorbereitungen waren diesmal dank der persönlichen Erfahrungen Parks ungemein gründlich. Sein Schwager Alexander Anderson und der Zeichner George Scott sollten ihn zusammen mit einigen Schiffszimmerleuten und Handwerkern von England aus begleiten. Am 30. Januar 1805 schifften sie sich in Portsmouth ein und erreichten sieben Wochen später die afrikanische Westküste. In den Briefen, die Park von unterwegs an seine Familie und an Mitglieder der »African Association« schrieb, zeigte er sich ungemein zuversichtlich. Er hatte nach wie vor alle gut gemeinten Warnungen zurückgewiesen, glaubte fest an den Erfolg seines Unternehmens. Wieder wollte er den Weg ostwärts vom Senegal bis nach Sego am Niger wählen, dort mit den ihn begleitenden Handwerkern ein größeres Boot zimmern und dem Strom flussabwärts bis zur Mündung folgen. Zum Schutz des ganzen Unternehmens sollte ihn ein Trupp Kolonialsoldaten begleiten.
Diese auf Weisung des Kolonialministeriums abkommandierte Schar bestand aus Leutnant Martyn und fünfunddreißig altgedienten Soldaten des Afrikanischen Korps, die in Kaye (bei Kisania) zu ihm stießen. Man scheint ihm von vornherein nicht die besten Leute gegeben zu haben, denn nur so sind die so rasch einsetzenden Verluste überhaupt zu erklären. Überhaupt stand das ganze Unternehmen unter einem denkbar unglücklichen Stern, doch lag ein erheblicher Teil der Schuld bei Park selbst. Er hätte aufgrund seiner Erfahrungen erst die bevorstehende Regenzeit abwarten und den Aufbruch in das Innere um sechs Monate verschieben müssen. In seinem übertriebenen Optimismus unterschätzte er aber die Schwierigkeiten und überschätzte wohl auch das Leistungsvermögen und den Gesundheitszustand seiner europäischen Begleiter.
Die Karawane, die am 27. April 1805 von Kaye aufbrach, bestand aus Park, Anderson, Scott und vier Schiffszimmerleuten, Leutnant Martyn mit seinen fünfunddreißig Soldaten und einem Mandingoführer namens Isaako. Das umfangreiche Gepäck war auf zweiundvierzig Esel verladen.
Mögen die Aufzeichnungen über die nun folgende Reise kaum mit den farbigen Schilderungen des ersten Reiseberichts konkurrieren können, so sind sie doch das erschütternde Dokument eines fehlgeplanten Unternehmens. Während der bald nach dem Abmarsch ausgebrochenen Regenzeit mit ihren schweren tropischen Gewittern erkrankten die meisten Leute und starben unterwegs. Die scheinbare Gefühllosigkeit Parks, mit der er diese Todesfälle registriert und über sie hinweggeht, lässt sich wohl nur aus den ungeheuren Anstrengungen erklären, die er aufwenden musste, um die Karawane wenigstens einigermaßen zusammenzuhalten und weiterzuführen. Immerhin war es die erste größere Forschungsexpedition dieser Art, und Park hatte keine Erfahrungen im Führen einer Gruppe. Noch siebzig Jahre später musste Henry Morton Stanley (1841–1904) bei seinen Expeditionen durch den Kongo-Urwald mit ähnlichen Schwierigkeiten kämpfen, weil auch er die Kräfte und die Energie seiner europäischen Begleiter überschätzte.
Als die Karawane nach knapp vier Monaten, sieben Wochen später als ursprünglich vorgesehen, am 19. August den Niger erreichte, lebten nur noch Park, Anderson, Scott, Martyn und sieben Soldaten, fast alle mehr oder weniger krank. Angesichts dieser Tatsache befremdet die Notiz Parks in seinem Tagebuch: »Es gewährte mir aber doch eine gewisse Genugtuung, feststellen zu können, dass ich einen Trupp Europäer samt vielem Gepäck über eine Strecke von mehr als fünfhundert Meilen geführt und dabei immer gute Beziehungen mit den Eingeborenen gehalten hatte.« Kein Wort der Klage über die hohen Ausfälle!
Während Park zusammen mit einem Soldaten aus mehreren Eingeborenenbooten ein flusstüchtiges Fahrzeug zusammenzimmerte, starben auch Anderson und Scott sowie weitere vier Soldaten. Bis zum 15. November waren alle Vorbereitungen abgeschlossen. Die Reise sollte am folgenden Tag beginnen, doch scheint sie sich noch etwas verzögert zu haben, denn der letzte Brief an seine Frau, den er den Tagebuchaufzeichnungen beifügte, trägt das Datum des Neunzehnten. Darin schrieb er: »Ich befürchte, dass Du aus weiblicher Furcht und der Ängstlichkeit einer Gattin Dir meine Lage viel schlimmer denkst, als sie wirklich ist. Es ist freilich wahr, meine geliebten Freunde, Anderson und Scott, haben beide von dieser Welt Abschied genommen; und der größte Teil der Soldaten ist während der Regenzeit auf der Reise gestorben; aber, glaube mir, ich selbst befinde mich recht wohl. Der Regen ist nunmehr völlig vorüber, und die gesunde Jahreszeit hat angefangen, sodass nichts von Krankheit zu fürchten ist; auch habe ich noch immer Macht genug, mich auf der Fahrt den Fluss hinab vor jedem Anfall zu schützen.
Wir haben alle unsere Sachen bereits eingeschifft und werden in dem Augenblick, wo ich diesen Brief geendigt habe, absegeln. Ich bin nicht willens, irgendwo anzuhalten oder zu landen, bis wir die Seeküste erreicht haben, was ungefähr gegen Ende Januar geschehen wird. Wir schiffen uns dann auf dem ersten nach England gehenden Fahrzeug ein. … Ich halte es nicht für unmöglich, dass ich noch eher in England sein werde, als Du dies erhältst. Sei überzeugt, dass ich mich glücklich fühle, wieder heimwärts zu fahren. Diesen Morgen wurde der Verkehr mit den Eingeborenen eingestellt, und jetzt zieht man die Segel auf zur Abreise nach der Küste.«
Das waren die letzten Zeilen aus der Hand des Forschers. Seine Briefe und das Tagebuch wurden von Isaako an die Küste gebracht und von da nach England geschickt. Dann hörte man nichts mehr.
Erst im Lauf des Jahres 1806 kamen Gerüchte aus dem Innern, wonach Park und seine Begleiter unterwegs ermordet worden seien. Der britische Gouverneur von Senegal beauftragte nun Isaako mit Nachforschungen am Niger. Dieser brach Anfang 1810 auf und kehrte nach zwanzig Monaten im Herbst 1811 an die Küste zurück. Die Ergebnisse seiner Nachforschungen übergab er in einem arabisch geschriebenen Tagebuch. Obgleich er mit der Aussage von Parks letztem Eingeborenenführer Amadi Fatouma einen Augenzeugenbericht vom Tod des Forschers und seiner letzten Begleiter liefert, bleiben doch Fragen und Zweifel offen. Merkwürdig erscheint vor allem die Behauptung, Park habe erklärt, nicht mehr in das Gebiet von Yaour zurückkehren zu können. Demnach hätte ja Amadi eigens einen Boten zu dem auf dem Schiff wartenden Park schicken müssen, um diese Auskunft einzuholen, die in ihrer Art nicht den sonstigen Äußerungen des Forschers entspricht. Ausgerechnet davon die Ermordung abhängig zu machen, erscheint widersprüchlich. Ebenso unwahrscheinlich ist die Behauptung, dass sich im Boot nur noch eine Art Gürtel befunden habe, den der Eingeborene eigens nach achtmonatiger Reise zurückgebracht habe. Hier trägt Isaako wieder zu stark auf, dramatisiert eine Kleinigkeit, um entweder von wichtigeren Dingen abzulenken oder um die Tatsache zu verschleiern, dass er in Wirklichkeit gar nichts erfahren hatte.
In England verzögerte sich die Veröffentlichung der Tagebuchaufzeichnungen unverhältnismäßig lange. Sie erschienen erst 1815 unter dem Titel »The Journal of a Mission to the Interior of Africa«. Das brennende Interesse weiter Kreise an den Reisen und Schicksalen des Forschers hatte allerdings einen deutschen Verleger nicht ruhen lassen. Schon 1807, zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine Einzelheiten über das Ende Parks bekannt waren, erschien in Hamburg ein Buch mit dem Titel »Mungo Parks neueste und letzte Reise ins Innere von Afrika nebst dem Tode dieses merkwürdigen Reisenden aus seinem Tagebuche und den Relazionen seiner übrig gebliebenen Gefährten niedergelegt bei der Afrikanischen Gesellschaft zu London. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Harry Wilkens. Vollständige Übersetzung«.
Mungo Parks erster (– – –) und zweiter (– – –) Reiseweg, 1795/97 bzw. 1805/06
Bis zum heutigen Tag immer wieder unter der Mungo-Park-Literatur zitiert, ist es in Wirklichkeit nur ein übler Trick eines geschäftstüchtigen Verlegers. Ob tatsächlich ein englisches Original dazu existiert, konnte nicht festgestellt werden. Da aber keines im Britischen Museum vorhanden ist, scheint vielmehr ein deutscher Autor die Nachrichten vom Tod des Forschers auf seine Weise ausgenutzt zu haben. In einer Zeit, in der selbst gebildete Kreise so gut wie nichts von Afrika wussten, konstruierte er eine Reise, die Park angeblich vom Sudan aus nach Äthiopien führte. Dafür schlachtete er ungeniert das kurz zuvor erschienene große Reisewerk von James Bruce (1730–1794) aus. Im letzten Viertel des Buches sprang er, wieder zeitgenössisches Material benutzend, an die afrikanische Westküste hinüber, um schließlich Park von der Goldküste aus irgendwo im Innern verschwinden zu lassen:
»Ich beschloss, weiter nordöstlich zu gehen. Nach einem Marsche von zehn Tagen hörte der fruchtbare Boden wieder auf, und eine schreckliche Wüste mit Flugsand dehnte sich vor unseren Augen. Meine Begleiter murrten und machten mir die bittersten Vorwürfe, die ich diesmal nicht ablehnen konnte. Man sprach von zu großen Aufopferungen und dass es unmöglich der Wille der afrikanischen Gesellschaft sei, Menschen hier in Wüsteneien zu schicken und verhungern zu lassen. Alles Zureden half nichts, und ich beschloss, mit einem Beispiel, das in solchen Fällen die beste Wirkung tut, voranzugehen.
Wohlan! sagte ich, ich kann euch nicht zwingen, mit mir zu gehen, aber ebenso wenig sollt ihr’s vermögen, mich zu zwingen, euch zu folgen. Ich habe meine erste Reise einsam und unter tausend Gefahren gemacht – auch jetzt komme ich zurück und bringe euch gute Nachricht. Wohlan, so könnt ihr folgen, wo nicht – so kehrt zurück.
Wir beredeten ihn vergebens, bei uns zu bleiben. Er eilte allein und im größten Zorne von uns. Bald verschwand er aus unseren Augen.
Zwei Tage hatten wir gewartet, als einige Neger uns begegneten, welche die uns wohlbekannten Kleider trugen. Sie konnten uns keine Auskunft geben, woher sie die Kleider bekommen hätten. Aber uns ward es mit einem Male deutlich genug: Mungo Park sei beraubt, wohl gar erschlagen. Weit konnte er nicht von uns sein. Wir brachen auf, und schon am Ende der ersten Tagereise fanden wir seine blutige Leiche in einem Felsentale. Er war von allen Kleidungsstücken beraubt und allen Anzeichen nach mit Keulen vor den Kopf geschlagen, denn seine Hirnschale war bei genauer Untersuchung zerschmettert. Wir begruben ihn sehr tief im Sand, und um seinen Körper keinen weiteren Misshandlungen auszusetzen, ebneten wir den Boden, sodass keine Spur vom Grabe sichtbar war. Spätere Nachrichten bestätigten unsere Vermutung. Ein König, dem er vorher vorgestellt worden war und der ihm alles in seinem Lande zeigen ließ, hatte ihn meuchelmörderisch umbringen lassen. Wir zogen nun wieder zurück nach unseren Faktoreien und kehrten mit dem nächsten Schiff nach England, da unsere Reise geendigt war.«
Die »African Association« setzte auch nach dem tragischen Ende der Expedition ihre Bemühungen um die Lösung des Nigerrätsels fort. Wenn die Angaben Isaakos und Amadis zutrafen, war das Boot etwa elfhundert Kilometer an Timbuktu vorbei flussabwärts gelangt. Wir wissen heute, dass damit nur noch achthundert Kilometer bis zur Flussmündung fehlten! Nach mehreren erfolglosen Unternehmen gelang es den Engländern Dixon Denham (1786–1828) und Hugh Clapperton (1788–1827), von Tripolis aus quer durch die Sahara bis in den Zentralsudan vorzustoßen und Sokoto, die Hauptstadt der Fulbe, zu erreichen. 1824 kehrten sie durch die Wüste wieder nach Norden zurück. Da zwischen den beiden Forschern ein Streit über den Lauf des Nigers entbrannte, ging Clapperton sogleich wieder nach Afrika und zog mit seinem Diener Richard Lander (1804–1834) von der Guineaküste aus nordwärts an den Niger und weiter nach Sokoto, wo er an der Ruhr starb. Damit war eine Verbindung der nördlichen und südlichen Reiseroute hergestellt. Das Werk vollendete dann der fünfundzwanzigjährige Lander, der 1830 erneut von der Guineaküste aus bis an den Niger vorstieß und ihn ungefähr an der Stelle erreichte, wo Mungo Park umgekommen sein muss. Von da aus fuhr er flussabwärts bis zur Mündung.
Unsere Ausgabe vereint die Berichte über beide Reisen sowie Ausschnitte aus den Aufzeichnungen des Mandingoführers Isaako. Sie geht auf die ersten deutschen Übersetzungen von 1799 und 1821 zurück. Bei der teilweise vom englischen Original abweichenden Namensschreibung wurde die deutsche Form gewählt. Die Texte sind nur leicht gestrafft und sprachlich geringfügig modernisiert.
Nicht aufgenommen wurden im 1. Teil ein Kapitel mit Nachrichten über die Küstenvölker (ursprünglich Abschnitt 2), einige überholte Aufzählungen afrikanischer Völkerschaften, ein Kapitel über die Sahara und ihre Tiere (ursprünglich Abschnitt 12) und einige Hinweise auf die Vorstellungen der Mandingos von der Erdgestalt. Im 2. Teil sind einige Aufzählungen von Geschenken, geografische Ortsbestimmungen, eine Beschreibung des Verfahrens der Indigo-Färberei und die Aufzählung der Stationen von Sego nach Miniana am Schluss des Tagebuches gestrichen.
HEINRICH PLETICHA
Faksimile des Titelblattes der deutschen Erstausgabe von Mungo Parks erstem Reisebericht
MUNGO PARKS ERSTE REISEIM INNEREN VON AFRIKA
ERSTER ABSCHNITT
VERANLASSUNG ZUR REISE.DER VERFASSER SCHIFFT SICH NACH AFRIKA EIN.SEINE ANKUNFT UND AUFENTHALT INPISANIA BEI DR. LAIDLEY.ABREISE VON DA IN DAS INNERE DES LANDES.
Als ich im Jahre 1793 aus Ost-Indien nach London zurückkam, suchte die Afrikanische Gesellschaft jemanden, der zur Erforschung Innerafrikas eine Reise den Gambia aufwärts versuchen sollte. Dies war mir eine erwünschte Nachricht; denn ich wollte gern ein so unbekanntes Land wie Afrika näher erforschen und den Charakter und die Lebensweise seiner Bewohner durch eigene Erfahrung kennenlernen. Ich bat also den Präsidenten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, Sir Banks, der zugleich einer der Kommissare der Afrikanischen Gesellschaft war, dass er mich für dieses Unternehmen vorschlagen wolle. Zwar war Captain Houghton als mein unmittelbarer Vorgänger auf eben dem Weg, den ich jetzt einschlagen sollte, wahrscheinlich verunglückt. Er war nämlich von Fort Goree aus, wo er das Kommando führte, auf Veranlassung und Kosten der Gesellschaft zu dem jetzt mir vorgeschriebenen Zweck den Gambia hinaufgesegelt, doch hatte man schon lange keine Nachricht mehr von ihm erhalten, also war er vermutlich von dem ungesunden Klima hinweggerafft oder vielleicht gar von Eingeborenen ermordet worden. Allein dadurch ließ ich mich nicht abschrecken. Ich wusste, dass ich Beschwerlichkeiten aller Art ertragen konnte, und hoffte, dass mich meine Jugend und feste Gesundheit vor den Einwirkungen des Klimas schützen würden. Die Gesellschaft gab eine ansehnliche Besoldung an, die mir genügte, ohne dass ich wegen einer künftigen Belohnung im Voraus etwas festsetzte. Sollte ich auf meiner Reise umkommen, dachte ich, so sterben eben meine Erwartungen und Hoffnungen mit mir. Gelänge es mir aber, meine Landsleute mit der Geografie Innerafrikas bekannter zu machen und ihrer Betriebsamkeit durch bisher unbekannte Handelswege eine neue Quelle des Reichtums zu erschließen, so wusste ich, dass ich in den Händen ehrliebender Männer war, die mir den wohlverdienten Lohn meiner gelungenen Bemühungen nicht vorenthalten würden. Da die Gesellschaft mich mit den nötigen Kenntnissen für eine solche Reise hinreichend ausgerüstet fand und auch die Erkundigungen, die sie über mich einzog, zu meinem Vorteil ausfielen, so nahm sie mich in Dienst und verfuhr gegen mich in allen Stücken so zuvorkommend und freigebig, wie ich es nur wünschen konnte.
Ursprünglich war die Rede davon, dass ich bis nach Senegambia mit Herrn Willis reisen sollte, der dort zum Konsul ernannt worden war und mir in dieser Eigenschaft hätte nützlich werden können. Allein diese Aussicht wurde dadurch vereitelt, dass die Regierung die Konsulstelle einzog. Indes ersetzte mir die Vorsorge der Gesellschaft den von dieser Seite erhofften Vorteil auf andere Weise.
Der Sekretär der Gesellschaft, der verstorbene Henry Beaufoy, war so gütig, mir ein Empfehlungsschreiben an Dr. Laidley zu geben, der schon mehrere Jahre bei einer englischen Faktorei an den Ufern des Gambias lebte. Auch versah er mich mit einem Kreditbrief von zweihundert Pfund Sterling. Nachdem auf diese Weise alles eingeleitet war, begab ich mich an Bord der Brigg »Endeavour«, auf der ich die Überfahrt machen wollte. Es war ein kleines Schiff, das vom Kapitän Richard Wyath kommandiert wurde und Wachs und Elfenbein am Gambia einzuhandeln pflegte.
Meine Instruktion war einfach und bestimmt. Ich sollte bei meiner Ankunft in Afrika entweder durch Bambuk oder auf einem anderen bequemeren Weg bis zum Niger vorstoßen, dann den Lauf und womöglich den Ursprung und das Ende dieses Flusses erforschen und mein Möglichstes tun, die dort liegenden Orte zu besichtigen, besonders die Städte Timbuktu und Hussa. Dann sollte ich entweder auf dem Gambia oder auf irgendeinem anderen Wege, der mir meiner Lage und meinem Plane nach dazu am bequemsten erscheinen würde, nach Europa zurückkehren.
Am 22. Mai 1795 segelten wir von Portsmouth ab. Am 4. Juni erblickten wir die Gebirge von Afrika und gingen am 21. des gleichen Monats nach einer angenehmen Reise von dreißig Tagen bei Dschillifrih vor Anker. Dies ist eine Stadt am nördlichen Ufer des Gambias gegenüber der Jamesinsel, wo die Engländer vormals eine kleine Festung hatten.
Europäische Station an der westafrikanischen Küste und Sklavenschiff
Das Königreich Bara, in dem Dschillifrih liegt, ist überaus fruchtbar. Die Einwohner handeln vor allem aber mit Salz. Sie schiffen diese Ware in Booten den Fluss hinauf bis nach Barraconda und bringen indianisches Korn, Baumwollzeug, Elefantenzähne, ein wenig Goldstaub und andere Dinge mehr wieder dafür zurück. Die große Zahl der Boote und die vielen Leute, die beständig zu diesem Handel benötigt werden, lassen den König von Bara für die Europäer wichtiger sein als irgendeinen anderen Regenten in der Nachbarschaft des Flusses. Dieser Umstand ist wohl schuld daran, dass es sich dieser anmaßt, von allen Nationen, die hier handeln, hohe Eingangszölle zu erheben. Für jedes Schiff, es sei groß oder klein, müssen beinahe zwanzig Pfund Sterling erlegt werden. Dieser Zoll wird gewöhnlich vom Gouverneur von Dschillifrih selbst eingefordert. Bei diesem Geschäft hat er stets ein ansehnliches Gefolge von Eingeborenen bei sich, unter denen sich auch stets einige finden, die infolge des häufigen Umgangs mit Engländern etwas Englisch gelernt haben. Sie sind bei dieser Gelegenheit äußerst beschwerlich und betteln mit solcher Zudringlichkeit um alles, was ihnen in die Augen fällt, dass die Kaufleute gezwungen sind, ihnen alles zu geben, was sie nur verlangen, um sie wieder loszuwerden.
Am 23. fuhren wir von Dschillifrih zwei englische Meilen weiter nach Wintain, einer am südlichen Ufer des Flusses an einer Bucht gelegenen kleinen Stadt, die wegen ihres starken Handels mit Wachs von den Europäern häufig besucht wird. Das Wachs wird von den Felupen in den Wäldern gesammelt und hier zum Verkauf gebracht. Sie sind ein wildes, ungeselliges Volk, das einen Landstrich bewohnt, in dem außerordentlich viel Reis gedeiht. Die Kaufleute, die auf dem Gambia und auf dem Casamance Handel treiben, pflegen sich daher in diesem Land mit Reis, mit Ziegen und Federvieh zu versorgen, weil hier alles billig zu haben ist. Den Honig, den die Felupen sammeln, verbrauchen sie größtenteils selbst. Sie machen nämlich ein stark berauschendes Getränk daraus, fast wie unseren englischen Met.
Bei dem Handel mit den Europäern bedienen sich die Felupen gewöhnlich eines Maklers vom Volk der Mandingo, der etwas Englisch spricht und mit dem Verkehr auf dem Fluss Bescheid weiß. Dieser Makler schließt den Handel, gibt aber mit Vorwissen des Europäers den Felupen nur einen Teil der Zahlung, den Rest, der daher mit Recht das Truggeld heißt, lässt er sich erst auszahlen, wenn der Felupe schon wieder abgereist ist, und behält ihn für seine Mühe.
Am 26. verließen wir Wintain und setzten unsere Reise auf dem Fluss fort. Während der Ebbe gingen wir jedes Mal vor Anker, oft ließen wir uns auch von einem vorausgeschickten Ruderboot ziehen. Der Fluss ist tief und trüb, die Ufer sind mit undurchdringlichem Dickicht bewachsen, und das ganze umliegende Land scheint flach und sumpfig zu sein. Der Gambia ist sehr fischreich. Einige seiner Fischarten schmecken überaus gut, aber so wie ich mich erinnere, ist keine davon in Europa bekannt. An der Mündung gibt es viele Haifische und höher hinauf Krokodile und Flusspferde.
Am sechsten Tag nach unserer Abreise von Wintain erreichten wir Dschonkakonda, einen ansehnlichen Handelsplatz, wo unser Schiff einen Teil seiner Ladung einnehmen sollte. Am folgenden Morgen kamen die europäischen Kaufleute von den verschiedenen Faktoreien, um ihre Briefe in Empfang zu nehmen und sich nach Art und Wert der Ladung zu erkundigen. Der Kapitän schickte sogleich einen Boten an Dr. Laidley, um ihm von meiner Ankunft Nachricht zu geben. Dieser traf am nächsten Morgen in Dschonkakonda ein. Ich übergab ihm den Brief des Herrn Beaufoy, und er lud mich sogleich gastfrei ein, so lange in seinem Hause zu wohnen, bis ich eine Gelegenheit fände, meine Reise fortzusetzen. Dieses Anerbieten nahm ich dankbar an. Der Doktor verschaffte mir ein Pferd und einen Führer, sodass wir schon am 5. Juli von Dschonkakonda aufbrechen konnten und noch am gleichen Vormittag um elf Uhr bei der Wohnung meines Wirts ankamen.
Pisania ist ein kleines Dorf, das im Gebiet des Königs Jany liegt. Es besteht bloß aus einer englischen Faktorei und wurde auch nur von Engländern und deren schwarzen Sklaven bewohnt. Es liegt am Ufer des Gambias, sechzehn englische Meilen von Dschonkakonda entfernt. Bei meiner Ankunft wohnten außer dem Doktor nur noch zwei Weiße da, die Brüder Ainsley, aber diese drei Personen hatten eine zahlreiche schwarze Dienerschaft. Die kleine Siedlung stand unter dem Schutz des Königs, und die Europäer wurden von den Eingeborenen so geachtet und geehrt, dass sie alles zur Genüge hatten, was ihnen das Land bot. Auch ging der größte Teil des Handels mit Sklaven, Waffen, Elfenbein und Gold durch ihre Hände.
Da ich für einige Zeit bequem hierbleiben konnte, bemühte ich mich, die Mandingo-Sprache zu lernen, weil diese fast in ganz Afrika gesprochen wird und ich nicht hoffen konnte, ohne sie eine richtige Kenntnis vom Land und seinen Bewohnern zu erwerben. Dr. Laidley, der durch einen langen Aufenthalt im Land und durch den beständigen Umgang mit den Eingeborenen die Sprache meisterhaft beherrschte, stand mir beim Erlernen bei. Gleichzeitig suchte ich auch Erkundigungen über die Gegend einzuziehen, die ich besuchen wollte. Man verwies mich deshalb an die Slatihs. Dies sind schwarze freie Kaufleute, die in diesem Teil von Afrika im großen Ansehen stehen und aus dem Innern des Landes Negersklaven zum Verkauf bringen. Ich merkte bald, dass ich mich auf ihre Nachrichten eben nicht sehr verlassen konnte; denn einer widersprach immer wieder dem andern gerade in den wichtigsten Dingen, und keiner schien es gern zu sehen, dass ich meinen Weg weiter fortsetzen wollte. Diese Umstände vergrößerten aber nur meine Begierde, durch eigene Beobachtungen zur Wahrheit zu gelangen.
So verstrich mir die Zeit auf eine angenehme Weise, und schon schmeichelte ich mir, der Hoffnung, dem Fieber, dem fast jeder Europäer bei seinem ersten Besuch unter einem heißen Himmelsstrich ausgesetzt ist, entgangen zu sein. Unvorsichtigerweise aber setzte ich mich am 31. Juli dem Nachttau aus, als ich eine Mondfinsternis beobachten wollte, um die Länge des Orts zu bestimmen. Am anderen Morgen befiel mich ein böses Fieber, und ich erkrankte so schwer, dass ich den größten Teil des Augusts im Haus verbleiben musste. Meine Genesung schritt nur langsam vorwärts, indes nutzte ich jede kleine Zwischenzeit, in der es mir besser ging, um auszugehen und mich mit den Produkten des Landes bekannt zu machen. Auf einem dieser Streifzüge, an einem heißen Tag, wagte ich mich weiter als gewöhnlich und bekam von Neuem das Fieber, sodass ich bis zum 10. September das Bett hüten musste. Bei diesem Rückfall war jedoch die Krankheit nicht so heftig wie zuvor, und nach drei Wochen war ich imstande, meine botanischen Spaziergänge von Neuem vorzunehmen, wenn es das Wetter erlaubte. Regnete es aber, so zeichnete ich Pflanzen in meinem Zimmer. Die Sorgfalt und Aufmerksamkeit Dr. Laidleys halfen mir, die Krankheit leichter zu ertragen. Seine Gesellschaft und seine Unterhaltung verkürzten die langweiligen Stunden der trüben Jahreszeit, in der es in Strömen regnet, erstickende Hitze am Tag zu Boden drückt und des Nachts das Gequake der Frösche, deren Anzahl hier alle Einbildungskraft übersteigt, und das durchdringende Geschrei der Goldwölfe oder das tiefe Heulen der Hyänen den Schlaf des Fremdlings verscheuchen oder das Getöse des fürchterlichsten Donners ihn immer wieder aufweckt, ein Getöse, von dem man keinen Begriff haben kann, wenn man es nicht selbst gehört hat.
Die ungeheuere Ebene des Landes ist mit Wäldern bedeckt, die einen ermüdenden und einförmigen Anblick bieten. Wenn auch die Natur den Einwohnern die Schönheiten einer romantischen Landschaft versagt, so hat sie ihnen doch mit freigebiger Hand den reicheren Segen des Überflusses und der Fruchtbarkeit gespendet; denn auch ohne sonderliche Bestellung trägt der Boden doch reichlich. Die Wiesen geben vortreffliche Weiden für die Herden, und der Gambia liefert wohlschmeckende Fische. Getreide und Reis werden in großen Mengen angebaut, auch haben die Eingeborenen in Städten und Dörfern bei ihren Wohnungen Gärten, in denen sie Zwiebeln, Jamswurzeln, verschiedene Kürbisarten, Wassermelonen, Erdnüsse und einige andere Küchengewächse anbauen. In der Nähe der Städte sah ich auch kleine Felder mit Baumwolle und Indigo angepflanzt. Aus Ersterem stellen sie ein Tuch her, und mit Letzterem geben sie ihm eine schöne blaue Farbe.
Wenn sie das Korn für die Speisen bereiten, stampfen sie es in einem großen hölzernen Mörser so lange, bis es aus den Hülsen fällt. Dann lassen sie es durch den Wind von der Spreu säubern und stampfen es dann im gleichen Mörser wieder zu Mehl. Am Gambia machen sie daraus eine Art von Pudding, der Kuskus heißt und folgendermaßen bereitet wird: Zuerst feuchten sie das Mehl an, rütteln es in einem großen Kürbis, bis es in kleinen Kügelchen zusammenklebt wie Sago, dann schütten sie es in einen irdenen Topf, dessen Boden voll kleiner Löcher ist. Dieser Topf wird nun entweder mit einem Teig aus Mehl und Wasser oder mit Kuhmist auf einen anderen festgeklebt und so aufs Feuer gesetzt. In dem unteren Gefäß ist gewöhnlich Fleisch und Wasser, dessen Dünste durch den durchlöcherten Boden des oberen Gefäßes dringen und so den Kuskus locker und gar machen. In allen Gegenden, die ich durchreist habe, war dies ein Lieblingsgericht. Man sagte mir, dass diese Art der Mehlzubereitung auch an der Küste der Barbarei allgemein üblich sei und das Gericht dort ebenfalls Kuskus heiße, wahrscheinlich haben also die Neger diese Zubereitung samt dem Namen von den Mauren gelernt.
Man macht hier aus Mehl noch eine andere Art von Pudding, den Miling. Auch bereiten sie den Reis auf zwei oder drei verschiedene Arten. Die niedere Volksklasse bekommt nur selten Fleisch, ist aber nicht völlig von seinem Genuss ausgeschlossen.
An Haustieren findet man hier, was wir in Europa haben. Schweine gibt es in den Wäldern. Man isst sie aber nicht gern. Vermutlich ist der entschiedene Abscheu, den die Mohammedaner gegen dieses Tier hegen, auch auf die Heiden übergegangen. Federvieh gibt es überall und in verschiedenen Arten. Das Perlhuhn und das rote Rebhuhn findet man sehr häufig auf den Feldern, und in den Wäldern hält sich eine Art von kleiner Antilope auf, deren Fleisch mit Recht für sehr schmackhaft gilt.
An wilden Tieren kommen im Mandingo-Land häufig Hyänen, der Panther und der Elefant vor. Es ist sonderbar, dass in keiner Gegend dieses großen Weltteils die Eingeborenen die Kunst der Inder besitzen, dieses starke und lenksame Tier zu zähmen und zum Dienst der Menschen zu nutzen. Wenn ich einigen Eingeborenen erzählte, dass man das in östlichen Ländern könne, so lachten sie mich geradezu aus und riefen einmal übers andere: »Topaupo Fonnio – Lüge eines Weisen!« Die Neger schießen den Elefanten besonders wegen der Zähne, die sie dann gegen andere Dinge bei den Elfenbeinhändlern verkaufen. Das Fleisch essen sie und finden es köstlich.
Das gewöhnliche Lasttier in allen Teilen von Afrika ist der Esel. Zum Ackerbau aber wird nirgends ein Tier verwendet. Deshalb ist auch der Pflug völlig unbekannt. Die Feldarbeit verrichten gewöhnlich Sklaven mit der Hacke.
Am 6. Oktober hatte das Wasser des Gambias seinen höchsten Stand erreicht, nämlich fünfzehn Fuß über dem Zeichen der gewöhnlichen Flut. Dann begann es allmählich zu fallen, erst langsam, bald aber sehr schnell, oft sank es in vierundzwanzig Stunden um mehr als zwölf Zoll. Anfang November hatte der Fluss wieder seine gewöhnliche Höhe und auch wiederum Ebbe und Flut. Zugleich war die Luft weniger feucht, sodass ich mich allmählich erholte und an meine Abreise denken konnte. Die beste Jahreszeit zum Reisen kam, die Ernte war vorüber, Lebensmittel gab es genügend und billig. Dr. Laidley machte um diese Zeit eine Geschäftsreise nach Dschonkakonda. Ich bat ihn, mir durch seinen Einfluss bei den Slathis oder Sklavenhändlern eine Gelegenheit zu verschaffen, in Gesellschaft und unter dem Schutz der nächsten Koffle (oder Karawane), die von Gambia nach dem Innern des Landes ginge, die Reise anzutreten. Zugleich trug ich ihm auf, mir ein Pferd und zwei Esel zu kaufen. Nach wenigen Tagen kam Laidley nach Pisania zurück und sagte mir, dass während der trockenen Jahreszeit gewiss eine Koffle nach dem Innern des Landes abgehen würde. Weil aber mehrere Kaufleute ihre Waren noch nicht beisammen hätten, lasse sich noch nicht der genaue Zeitpunkt sagen.
Weil mir nun die Slatihs und das andere Volk, aus dem die Karawane bestand, völlig unbekannt waren, sie auch meinem Plan feindlich gegenüberstanden und überhaupt nichts weniger als geneigt schienen, sich mit mir in irgendetwas einzulassen, auch die Zeit der Abreise noch sehr ungewiss war, entschloss ich mich, die gute Jahreszeit zu nutzen und mich ohne sie auf den Weg zu machen. Dr. Laidley pflichtete mir bei und versprach, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass ich bequem und sicher reisen könne. Der Entschluss war gefasst, und ich bereitete die Abreise vor.
ZWEITER ABSCHNITT
DER VERFASSER REIST VON PISANIA ABUND ERREICHT DSCHINDI.ER GEHT WEITER NACH MEDINA, DERHAUPTSTADT VON WULLI.UNTERREDUNG MIT DEM KÖNIG. AMULETTE.ER KOMMT NACH KOBRA.BESCHREIBUNG DES MUMBO JUMBO.ER KOMMT NACH KUDSCHAR UND ERREICHTTALLIKA IM KÖNIGREICH BONDU.
Am 2. Dezember 1795 verließ ich die freundliche Wohnung Dr. Laidleys. Glücklicherweise hatte ich einen Negerbedienten namens Johnson, der Englisch und Mandingo sprach. Er stammte aus diesem Teil Afrikas, war in seiner Jugend als Sklave nach Jamaika gekommen, hatte dort seine Freiheit erhalten, war mit seinem Herrn nach England gegangen, wo er sich mehrere Jahre aufhielt, und endlich nach seinem Vaterland zurückgekehrt. Dr. Laidley empfahl ihn mir, und ich mietete ihn als Dolmetscher für monatlich fünfzehn Barren, wovon er zehn und seine zurückbleibende Frau fünf erhielt.
Dr. Laidley gab mir auch einen seiner Negerjungen namens Demba mit, einen lebhaften Burschen, der die Mandingo-Sprache redete und bei unserer Rückkehr seine Freiheit erhalten sollte, wenn er mir treu dienen und sich gut aufführen würde. Ich besorgte mir ein Pferd, ein kleines, aber lebhaftes Tier, das mich sieben Pfund zehn Schilling kostete, und zwei Esel für meine beiden Begleiter. An Gepäck nahm ich so wenig wie möglich mit, nur Lebensmittel für zwei Tage, etwas Korallen, Bernstein und Tabak, um mir neuen Mundvorrat zu verschaffen. Etwas Wäsche, die unentbehrlichsten Kleidungsstücke, einen Sonnenschirm, einen Taschensextanten, einen Kompass und ein Thermometer, zwei Vogelflinten, zwei Paar Pistolen und einige andere Kleinigkeiten.
Ein freier Mann, ein Mohammedaner namens Madibu, der nach dem Königreich Bambarra reiste, zwei Slatihs, die nach Bondu gingen, und ein Neger namens Tami aus Kasson, ebenfalls ein Mohammedaner, der mehrere Jahre Dr. Laidley als Schmied gedient hatte und jetzt mit seinen Ersparnissen in seine Geburtsstadt zurückkehrte, boten mir ihre Dienste an, so weit unsere Reise uns miteinander führen werde. Sie gingen alle zu Fuß und trieben ihre Esel vor sich her.
So hatte ich nicht weniger als sechs Begleiter, in deren Augen ich ein bedeutender Mann war; denn man hatte ihnen angekündigt, dass ihre glückliche Rückkehr in die Gegenden am Gambia lediglich von meinem Wohlergehen abhinge. Dr. Laidley und die Herren Ainsley waren so gütig, mich die ersten zwei Tagereisen mit einem Teil ihrer Bedienten zu begleiten. Ich glaube gewiss, sie befürchteten, dass sie mich nie wiedersehen würden.
Nachdem wir über den Walli-krik, einen Arm des Gambias, gesetzt hatten, erreichten wir noch am gleichen Tag Dschindi und stiegen im Haus einer schwarzen Frau ab, die vormals die Geliebte eines weißen Handelsmannes gewesen war und deshalb vorzugsweise Seniora genannt wurde. Am Abend spazierten wir nach einem benachbarten Dorf, das einem der reichsten Slatihs namens Jemaffu Mamandu gehörte. Wir trafen ihn zu Hause, und er fühlte sich durch unseren Besuch so geehrt, dass er uns ein schönes Rind schenkte, das gleich geschlachtet und teilweise für unser Abendbrot zubereitet wurde. Die Neger essen gewöhnlich sehr spät. Um uns nun während der Zubereitung des Abendessens die Zeit zu vertreiben, forderte man einen Mandingo auf, einige lustige Geschichten zu erzählen, die wir auch drei Stunden lang mit anhörten. Diese Erzählungen sind den arabischen ähnlich, nur sind sie mehr scherzhafter Art. Ich teile hier im Auszug eine mit.
»Vor mehreren Jahren wurden die Einwohner von Dumasansa, einer Stadt am Gambia, sehr von einem Löwen geplagt, der jede Nacht ihre Herden anfiel. Wütend über die ewige Plage, beschloss das Volk, Jagd auf das Raubtier zu machen. Sie zogen aus, den Feind zu suchen, und fanden ihn im Dickicht verborgen. Sie feuerten sogleich auf ihn und waren glücklich genug, ihn so stark zu verwunden, dass ihn die Kraft verließ, als er auf sie losspringen wollte. Er sank zwar zurück, zeigte aber doch so viel Stärke, dass sich ihm niemand zu nähern wagte. Man beratschlagte, wie man sich seiner lebendig bemächtigen könne, weil es der sicherste Beweis der Tapferkeit sei und ihnen zugleich einen ansehnlichen Verdienst eintragen würde, wenn sie das Tier nach der Küste brächten und es den Europäern verkauften. Ein alter Mann schlug vor, das Sparrenwerk eines Hausdachs abzunehmen und es über den Löwen zu werfen. Sollte er auf sie losspringen, während sie sich ihm näherten, so dürften sie nur das Dach über sich herabfallen lassen und durch die Öffnungen feuern.
Dieser Vorschlag wurde angenommen. Die Löwenjäger hoben ein Hüttendach ab und zogen mutig damit zu Felde. Jeder hatte in der einen Hand ein Schießgewehr und trug auf der anderen Schulter das Dach. So näherten sie sich dem Feind, der aber wieder Kräfte gesammelt hatte und so grimmig aussah, dass es die Jäger für klüger hielten, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen, und sich mit dem Dach zudeckten. Unglücklicherweise war der Löwe aber zu schnell. Während sie das Dach niederließen, machte er einen Sprung und war mit seinen Verfolgern im gleichen Käfig gefangen. Zum Entsetzen und Jammer der Dumasanser verzehrte das Tier einen nach dem andern. Noch jetzt ist es in jener Gegend gefährlich, diese Geschichte zu erzählen; denn die Einwohner haben sich dadurch in der ganzen Nachbarschaft zum Gelächter gemacht, und mit nichts kann man sie so aufbringen, als wenn man sie auffordert, einen Löwen lebendig zu fangen.«
Am 3. Dezember nahm ich um ein Uhr nachmittags von Dr. Laidley und den Herren Ainsley Abschied und ritt langsamen Schrittes in den Wald hinein. Ein grenzenloser Wald lag vor mir, und zwar in einem Land, dessen Einwohner so roh sind, dass ein Weißer meistens zum Gegenstand der Neugier oder der Raubsucht wird. Die Freunde, denen du eben Lebewohl gesagt hast, sind wahrscheinlich die letzten Europäer, die du gesehen hast, dachte ich. Von nun an bist du vielleicht auf immer aus der Gesellschaft der Christen ausgeschlossen. Solche Gedanken trübten meine Seele, und ich mochte vielleicht drei Meilen im tiefen Nachdenken geritten sein, als ich in meinen Träumereien durch einen Haufen Volks gestört wurde, das auf uns zulief, die Esel anhielt und uns andeutete, dass wir nach Peckaba gehen und uns bei dem König von Wulli melden oder den gewöhnlichen Zoll hier auf der Stelle erlegen müssten. Vergebens suchte ich ihnen begreiflich zu machen, dass ich unmöglich Abgaben entrichten könne, da ich gar nicht in Handelsgeschäften reiste. Sie erwiderten, alle Reisenden müssten dem König ein Geschenk machen; wenn ich das nicht wolle, so dürfe ich nicht weiterreisen. Da sie zahlreicher als wir und überdies sehr laut waren, hielt ich es für das Klügste nachzugeben, und reichte ihnen vier Barren Tabak für den König, worauf sie mich meines Weges ziehen ließen. Bei Sonnenuntergang kam ich in ein Dorf nahe bei Kutacunda und blieb dort über Nacht.
Am Morgen des 4. Dezember kamen wir durch Kutacunda und wurden in der Nähe in einem kleinen Dorf angehalten, um dem König von Wulli Zoll zu entrichten. Die folgende Nacht ruhten wir in dem Dorf Tabajang, und am nächsten Mittag, dem 5. Dezember, erreichten wir Medina, die Hauptstadt des Gebietes von Wulli. Das ganze Land zeigt hier leicht ansteigende Hügel mit großen Waldungen. In den dazwischen liegenden Tälern befinden sich die Städte. Bei jeder Stadt ist hinreichend Land angebaut, um die Einwohner zu ernähren. Der Boden ist sehr fruchtbar. In den Tälern werden vornehmlich Baumwolle, Tabak und allerhand Küchengewächse erzeugt, die Hügel aber werden mit Korn besät. Bloß gegen die Gipfel hin deuten kurzes Gesträuch und roter Eisenstein die Grenze der Fruchtbarkeit an.
Die Einwohner sind Mandingos, die man in Mohammedaner (Buschrihns) und in Heiden (Kafiren – Ungläubige) aufteilt. Die Heiden bilden bei Weitem die größere Anzahl, und auch die Regierung liegt in ihren Händen. Obschon bei wichtigen Vorfällen die vornehmsten Mohammedaner zurate gezogen werden, sind sie doch von der ausübenden Gewalt ausgeschlossen, die allein in den Händen des Mansah oder Fürsten und seiner vornehmsten Staatsbedienten liegt. Den ersten Rang unter ihnen behauptet der Farbanna oder nächste Thronerbe. Auf ihn folgen, entsprechend der Autorität, die sie besitzen, die Alkaids oder Provinzgouverneure, die auch Kimohs genannt werden. Das übrige Volk teilt man in Freie und Sklaven. Unter den Ersteren sind die oben erwähnten Slatihs die Vornehmsten, in allen Klassen aber wird das Alter geehrt.
Der älteste Sohn ist Erbe des Throns. Ist er aber noch unmündig oder gibt es überhaupt keinen männlichen Nachfolger, so versammeln sich die Vornehmsten und übergeben dem nächsten Verwandten des verstorbenen Monarchen die Regierung, nicht etwa als Vormund oder Regent, sondern für sich, indem sie den Unmündigen ausschließen. Die Staatsausgaben werden durch Tribut vom Volk und durch Zollabgaben von den durchgehenden Waren bestritten. Kaufleute, die landeinwärts gehen, müssen ihre Abgaben in europäischen Waren entrichten; die aus dem Innern des Landes zur See wollen dagegen in Eisen und Baumbutter, und zwar in jeder einzelnen Stadt, welche sie unterwegs passieren.
Medina (d.h. arabisch »Stadt«, ein Name, den die Neger wahrscheinlich von den Mohammedanern entlehnt haben), die Hauptstadt des Königreichs, in dem ich mich jetzt befand, ist von ansehnlicher Größe. Sie zählt achthundert bis tausend Häuser und ist nach allgemeiner Landessitte mit einer hohen Lehmmauer, einer Umzäunung mit spitzigen Pfählen und dornigem Gesträuch umgeben. Die Mauer ist aber sehr verfallen, und die Umzäunung hat von der Hand rüstiger Hausfrauen, die die Pfähle als Brennholz wegschleppten, manches gelitten. Ich wohnte bei einem nahen Verwandten des Königs, der mir in Absicht der Etikette sagte, dass ich dem König nicht die Hand reichen dürfe, wenn ich ihm vorgestellt werde. Diese Freiheit gestatte er keinem Fremden. Ich wollte ihm nämlich am Nachmittag meine Aufwartung machen und mir die Erlaubnis erbitten, durch sein Gebiet nach Bondu reisen zu dürfen.
Der König hieß Dschatta und war ein ehrwürdiger Greis. Ich fand ihn auf einer Matte vor seiner Tür sitzend, zu beiden Seiten viele Männer und Frauen, die sangen und in die Hände klatschten. Ich grüßte ihn ehrerbietig und trug mein Anliegen vor. Der König antwortete gnädig, dass er mir nicht nur die Erlaubnis gebe, durch seine Staaten zu reisen, sondern auch für meine Sicherheit beten wolle, worauf einer von meinen Begleitern wahrscheinlich zum Dank für die Gnade des Königs ein arabisches Lied zu singen oder vielmehr zu brüllen begann. Zwischen jeder Pause schlugen der König und alle Anwesenden die Hände gegen die Stirn und riefen mit andächtiger Feierlichkeit »Amen, Amen«. Der König versprach mir auch, mich am anderen Tag sicher bis an die Grenze seines Reichs geleiten zu lassen. Ich beurlaubte mich und schickte am Abend dem König eine Anweisung für zwölf Maß Rum auf Dr. Laidley. Dafür bekam ich von ihm einen großen Vorrat Lebensmittel als Gegengeschenk.
Am 6. Dezember ging ich morgens wieder zum König, um mich zu erkundigen, ob er mir einen Führer und Begleiter besorgt habe. Ich fand seine Majestät auf einem Fell an einem großen Feuer sitzend, denn die Afrikaner sind gegen die geringste Veränderung in der Lufttemperatur äußerst empfindlich und beklagen sich oft über Kälte, wenn ein Europäer es vor Hitze kaum aushält. Er empfing mich sehr freundlich und bat mich dringend, doch von dem Vorhaben abzusehen, in das Innere des Landes zu reisen. Ich solle die Einwohner der östlichen Gegend nicht mit den Wullis vergleichen; denn diese wären mit den Weißen bekannt und ehrten sie, jene aber hätten nie einen Weißen gesehen und würden mich unfehlbar umbringen. Ich dankte ihm für seine gütige Fürsorge, sagte aber, dass ich alles genau erwogen habe und fest entschlossen sei, trotz aller Gefahren weiterzugehen. Er schüttelte den Kopf, drang aber nicht weiter in mich, sondern sagte nur, dass der Führer sich am Nachmittag einstellen werde.
Wirklich kam er um zwei Uhr. Ich nahm also Abschied von dem guten alten König, machte mich auf den Weg, und in drei Stunden erreichten wir Kondschur, ein kleines Dorf, wo wir über Nacht bleiben wollten. Hier kaufte ich für einige Korallen ein schönes Schaf, das meine Begleiter sogleich unter vielen religiösen Zeremonien schlachteten.
Mein Dolmetscher und ein Serawullih stritten sich um die Hörner. Ich legte den Streit dadurch bei, dass ich jedem eines gab. Die Neger verwenden solche Hörner als Kapseln, um die Amulette, die sie beständig bei sich tragen, vor Nässe zu schützen und sicher aufzubewahren. Diese Amulette sind Gebete oder Sprüche aus dem Koran, welche die Priester auf kleine Stückchen Papier schreiben und den unwissenden Eingeborenen verkaufen, die ihnen außerordentliche Wunderkräfte zuschreiben. Einige Neger tragen sie in Schlangenhaut eingewickelt um den Fuß und glauben, dadurch vor dem Biss dieser giftigen Tiere geschützt zu sein. Andere nehmen sie mit in den Krieg und bilden sich ein, dass ihnen dann der Feind nichts anhaben könne. Gewöhnlich aber verwendet man sie als Hilfsmittel gegen Krankheiten, gegen Hunger und Durst. Man sollte kaum glauben, wie ansteckend diese Art von Aberglauben ist; denn obwohl die meisten Neger Heiden sind und die mohammedanische Lehre verwerfen, so habe ich doch keinen gefunden, der nicht an die mächtige Wirksamkeit dieser Amulette fest glaubte. Wahrscheinlich rührt dies daher, dass die Eingeborenen das Schreiben als eine Art von Magie ansehen und mehr Vertrauen auf die Kunst des Magiers als auf die Sprüche des Propheten setzen.
Am 7. verließ ich Kondschur und kam am 8. nach Kolor, einer ansehnlichen Stadt, wo mir am Eingang eine Art von Maskenkleid aus Baumrinde auffiel, das an einem Baum hing und nach der Aussage meiner Begleiter dem Mumbo Jumbo gehöre. Dies ist ein Knecht Ruprecht, den man in allen Mandingo-Städten findet, und mit dessen Hilfe die heidnischen Einwohner ihre Frauen zum Gehorsam bringen. Da sie nämlich so viele Frauen nehmen, wie sie ernähren können, kommt es oft vor, dass diese miteinander in Streit geraten und das Ansehen des Hausherrn nicht hinreicht, sie wieder zur Ruhe zu bringen. So wird der Mumbo Jumbo als Mittler gerufen, und diesem gelingt es immer, die Ruhe wiederherzustellen.
Dieser sonderbare Vertreter der Gerechtigkeit, in dem man entweder den Mann selbst vermutet oder doch jemanden, den er über alles unterrichtet hat, verkündet in dieser auffallenden Verkleidung, mit einer Rute bewaffnet, seine Ankunft durch ein lautes und schreckliches Geschrei in den Wäldern außerhalb der Stadt. Sobald es dunkel wird, beginnt seine pantomimische Rolle. Er kommt in die Stadt und begibt sich nach dem Bentang, wo sich alle Einwohner sogleich versammeln. Für die Frauen ist dieser Vorfall wohl eben nicht erfreulich; denn da der Verkleidete ihnen völlig unbekannt ist, so fürchtet jede verheiratete Frau, dass der Besuch ihr zugedacht sei. Erscheinen aber müssen sie alle, wenn sie aufgefordert werden. Mit Gesang und Tanz, der bis Mitternacht dauert, beginnt die Zeremonie, dann heftet der Mumbo seine Blicke auf die Verbrecherin. Diese Unglückliche wird darauf sogleich ergriffen, nackt ausgezogen, an einen Pfahl gebunden und unter Gelächter und Spott der ganzen Versammlung entsetzlich mit der Mumbo-Rute gepeitscht. Es ist empörend, dass gerade die Frauen sich bei solchen Gelegenheiten am lautesten gegen ihre arme Mitschwester zeigen. Diese unsittliche Szene pflegt bis zur Morgendämmerung zu dauern.
Mumbo Jumbo
Am 9. Dezember fanden wir unterwegs nirgends Wasser und eilten deshalb bis nach Tabakunda. Am Abend des 10. kamen wir nach Kuniakary, einer Stadt, fast so groß wie Kolor. Am 11. erreichten wir Kudschar, die Grenzstadt von Wulli gegen Bondu, von dem es durch eine Wüste von zwei Tagereisen getrennt ist. Mein Führer, dem ich etwas Bernstein für seine Mühe gegeben hatte, kehrte nun zurück. Da man mir hier voraussagte, dass ich in der Wüste nicht immer Wasser finden werde, sah ich mich nach Leuten um, die ich als Führer und zugleich als Wasserträger verwenden konnte. Zwei einheimische Elefantenjäger erboten sich dazu. Ich nahm sie an und zahlte jedem drei Barren im Voraus. Der Tag war indes zum größten Teil verstrichen, wir blieben also diese Nacht noch in Kudschar. Obschon der Anblick eines Weißen den Bewohnern dieser Stadt nicht völlig fremd ist, da mehrere von ihnen die Gegenden am Gambia zu besuchen pflegen, so betrachteten sie mich dennoch mit einem Gemisch von Neugier und Ehrfurcht.
Am Abend gab man mir ein Getränk zur Erfrischung, das wie sehr gutes englisches Bier schmeckte. Mich interessierte die Zubereitung, und ich erfuhr zu meiner Verwunderung, dass es wirklich aus Korn gemacht wird und man dieses, wie in England den Weizen, vorher malzt. Eine Wurzel von angenehmer Bitterkeit ersetzt den Hopfen.
Am Morgen des 12. erfuhr ich, dass einer der Elefantenjäger davongegangen sei. Damit die beiden anderen nicht seinem Beispiel folgen möchten, ließ ich sogleich ihre Kalebassen mit Wasser füllen und trat mit Sonnenaufgang meine Reise durch die Wüste an. Wir hatten kaum eine Meile zurückgelegt, als meine Begleiter anhielten, um ein Safi zu bereiten, damit uns unterwegs nichts Übles geschehe. Am Ende sagten sie dreimal hintereinander ein paar Sprüche her, spien auf einen Stein, warfen ihn dann mitten auf den Weg und zogen nun getrost weiter in der festen Überzeugung, dass der Stein alles Böse auf sich genommen habe, was die höheren Mächte bewegen könnte, uns zu schaden.
Um Mittag gelangten wir an einen großen Baum, den die Eingeborenen Nimba Taba nennen. Er war mit unzähligen Lumpen und kleinen Zeugfetzen behängt, die von den Reisenden wohl ursprünglich an die Zweige geknöpft worden waren, um dem Wanderer anzuzeigen, dass Wasser in der Nähe zu finden sei. Im Laufe der Zeit wurde das eine heilige Gewohnheit, sodass jetzt niemand wagte, an dem Baum vorüberzugehen, ohne etwas daranzuhängen. Auch ich hängte ein schönes Stück Zeug daran auf. Da meine Führer sagten, dass in der Nähe ein Quell oder See sein müsse, so ließ ich die Esel abladen und ihnen Futter geben, während wir uns ausruhten und an unseren Vorräten labten. Inzwischen schickte ich einen Elefantenjäger aus, um den Brunnen zu suchen, da wir die Nacht dort verbringen wollten, wenn er Wasser führte. Der Neger entdeckte eine Tränke, aber das Wasser war dick und schlammig. Am Ufer zeigten sich Spuren eines erst kürzlich erloschenen Feuers und Überreste von Speisen, ein Zeichen, dass Reisende oder Straßenräuber den Ort kurz zuvor verlassen hatten. Meine Begleiter fürchteten das Letztere und rieten mir deshalb, lieber bis zu einem anderen Wasserplatz zu gehen, den wir ihrer Versicherung nach gewiss gegen Abend erreichen würden. Wir brachen also sogleich wieder auf, doch wurde es bald acht Uhr, als wir dort eintrafen. Da wir von der langen Tagereise ermüdet waren, zündeten wir ein großes Feuer an und lagerten uns, umgeben von den Lasttieren, einen Büchsenschuss weit von dem Wald auf dem nackten Boden. Die Neger beschlossen, nacheinander Wache zu halten.
Ich fürchtete keine Gefahr, doch hegten die Neger die ganze Reise über eine unbeschreibliche Furcht vor Straßenräubern. Sobald der Tag anbrach, füllten wir unsere Sufros oder Schläuche und die Kürbisse aus dem See und machten uns auf den Weg nach Tallika, der ersten Stadt in Bondu, die wir am Vormittag des 13. erreichten. Ich kann mich nicht von den Wullis trennen, ohne zu rühmen, dass sie mich überall freundlich empfingen und ich über ihre herzliche Aufnahme an den Abenden die Mühseligkeiten des Tages gewöhnlich vergaß. Obgleich mir die afrikanische Lebensweise anfänglich nicht gefiel, so fand ich doch bald, dass die Gewohnheit alle kleinen Unbequemlichkeiten erträglich macht.
DRITTER ABSCHNITT
EINIGE NACHRICHTEN VON DEN EINWOHNERN TALLIKAS.ANKUNFT IN KURKERANY. FISCHEREI AM FLUSS FALEMEH.ANKUNFT IN FATTEKONDA.UNTERREDUNG MIT ALMANI, KÖNIG VON WONDU.ZWEITER BESUCH BEI DEM KÖNIG UND SEINEN FRAUEN.ANKUNFT IN DSCHOHG.
Tallika, die Grenzstadt von Wondu gegen Wulli, wird von mohammedanischen Fullah bewohnt. Die durchziehenden Karawanen pflegen sich hier mit Lebensmitteln zu versehen und Elfenbein einzukaufen; denn die Einwohner sind geübte Elefantenjäger. Ein Verwalter des Königs residiert hier, der dem Herrscher von der Ankunft jeder Karawane rechtzeitig Nachricht geben muss. Der Zoll, den die Karawanen hier entrichten, wird nach Esels-Ladungen berechnet, d.h. für jeden beladenen Esel ist eine Taxe zu entrichten. Ich nahm meine Wohnung in dem Haus des Zolleinnehmers und vereinbarte mit ihm, dass er mich für fünf Barren nach Fattekonda, der Residenz des Königs, begleiten solle. Vor meiner Abreise schrieb ich einige Zeilen an Dr. Laidley und gab meinen Brief dem Führer einer Karawane, die eben nach dem Gambia abging. Sie bestand aus fünf mit Elfenbein beladenen Eseln. Von den großen Zähnen trägt der Esel zwei auf jeder Seite, die kleineren sind in Häute eingewickelt und mit Stricken befestigt.
Am 14. Dezember verließen wir Tallika und ritten ungefähr zwei Meilen weit ruhig fort, als auf einmal ein heftiger Wortwechsel zwischen dem Schmied und einem meiner anderen Begleiter entstand. Es ist merkwürdig, dass der Afrikaner eher Schläge vergibt als ein Schimpfwort auf seine Voreltern. »Schlage mich, aber schimpfe meine Mutter nicht« ist ein gewöhnlicher Ausdruck bei den Sklaven. Diese Art von Beleidigung hatte den einen so aufgebracht, dass er seinen Säbel gegen den Schmied zog, und der Streit wäre gewiss schlimm ausgegangen, wenn nicht die anderen ihm den Säbel aus der Hand gewunden hätten. Auch ich mischte mich ein, gebot dem Schmied Stillschweigen und drohte dem andern, der unrecht hatte, ihn wie einen Räuber auf der Stelle zu erschießen, wenn er in Zukunft wieder seinen Säbel ziehen oder mit einem meiner Leute Händel anfangen würde. Diese Drohung wirkte, und wir ritten verdrießlich den ganzen Nachmittag, bis wir in eine angebaute Ebene gelangten, in der mehrere kleine Dörfer lagen. In einem übernachteten wir. Eine gute Abendmahlzeit und kleine Geschenke beendeten alle Feindseligkeiten unter meinen Begleitern. Es war schon ziemlich spät, ehe wir an den Schlaf dachten. Wir unterhielten uns mit einem umherziehenden Sänger, der kleine Geschichten erzählte und Lieder spielte, indem er über eine gespannte Saite blies und sie zugleich mit einem Stäbchen strich. Diese umherziehenden Barden singen aus dem Stegreif das Lob derer, die sie bezahlen.
Am Morgen des 15. Dezember verabschiedeten sich meine beiden Slatihs mit vielen Gebeten für meine Sicherheit von mir. Eine Meile von Ganado entfernt setzten wir über einen Seitenarm des Gambias. Die Ufer sind steil und mit Mimosen bedeckt. Im Schlamm des Flusses gibt es eine Menge großer Muscheln, die aber von den Eingeborenen nicht gegessen werden. Gegen Mittag, als die Sonne fürchterlich brannte, ruhten wir zwei Stunden in dem Schatten eines Baumes, hielten unsere Mahlzeit mit Milch und gestoßenem Korn, das wir von einem Hirten kauften. Bei Sonnenuntergang erreichten wir Kurkerany, wo der Schmied einige Verwandte hatte. Hier machten wir ein paar Tage Rast.
Kurkerany ist eine mohammedanische Stadt mit einer hohen Mauer und einer Moschee. Ich bekam hier sogar eine Anzahl arabischer Handschriften zu sehen. Am Abend des 17. Dezember brachen wir wieder auf. Ein junger Mann, der Salz von Fattekonda holen wollte, begleitete uns. Gegen Abend erreichten wir ein kleines Dorf ungefähr drei Meilen von Kurkerany entfernt. Hier versahen wir uns mit Lebensmitteln, die so wohlfeil waren, dass ich ein schönes Rind für sechs kleine Stücke Bernstein kaufte; denn ich merkte, dass meine Reisegefährten sich vermehrten oder verminderten, je nachdem ihnen die Kost behagte.
Am folgenden Morgen setzten wir unsere Reise weiter fort. Da sich noch einige Fullahs zu uns gesellten, gewann unser Zug ein recht wehrhaftes Ansehen, und wir mussten nicht befürchten, in den Wäldern geplündert zu werden.
Die Neger haben eine eigene Art, die widerspenstigen Esel zum Gehorsam zu bringen. Sie spalten einen Baumzweig, geben dem Esel das gespaltene Ende wie das Gebiss eines Zaums ins Maul und binden die Enden davon über dem Kopf wieder zusammen. Das andere Ende des Zweiges hängt vom Maul zur Erde herab. Es muss so lang sein, dass es den Boden berührt, wenn das Tier den Kopf sinken lässt. Schlägt der Zweig an Steine oder Wurzeln an, verursacht das ihm einen heftigen Stoß gegen die Zähne. Der Esel merkt dies bald, trägt den Kopf aufrecht und geht sehr ruhig und gravitätisch. Das Ganze sieht lächerlich aus, hat sich aber bewährt und ist bei den Händlern allgemein üblich.