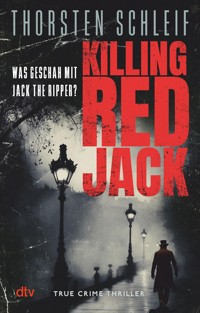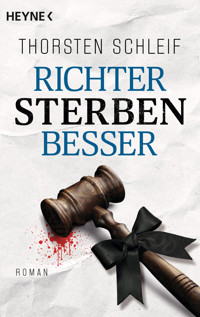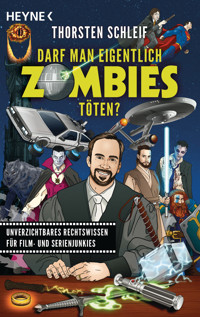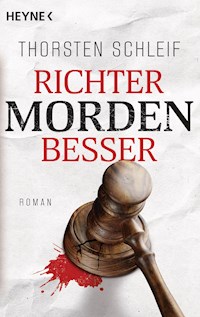9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Siggi Buckmann-Reihe
- Sprache: Deutsch
Gerächt ist gerecht
Amtsrichter Siggi Buckmann hat sich geschworen, für Gerechtigkeit einzustehen – notfalls auch nach Feierabend. Als sein einstiger Mentor tot in einem Waldstück aufgefunden wird, macht er sich auf die Suche nach den Schuldigen. Schneller als gedacht handelt er sich dabei Ärger mit einer dubiosen Immobilienfirma, der russischen Mafia und dem Sohn des Ministerpräsidenten ein. Die einzige Verbündete gegen seine neuen Feinde ist die kluge Journalistin Robin Bukowsky. Aber kann er ihr wirklich trauen? Vieles scheint dagegen zu sprechen. Zum Beispiel Buckmanns nicht ganz so gesetzeskonforme Vergangenheit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH
Ein Mord kommt selten allein … Während Richter Siggi Buckmann noch mit dem schlechten Gewissen wegen seines vielleicht perfekten Mordes an dem Bandenchef Ercan Ayaz kämpft, wird er bereits in einen neuen Justizskandal hineingezogen. Der Selbstmord seines alten Mentors veranlasst Siggi, Nachforschungen gegen die WIP anzustellen, eine Grundstücksgesellschaft, die Anleger um Millionen betrogen hat. Hinter der Gesellschaft steckt niemand anderes als Dimitris Stogarev, ein Mitglied der russischen Mafia, das jedoch gute Kontakte zu höchsten Kreisen der Politik unterhält.
Zur selben Zeit erhält Buckmann die Aufgabe, sich um die Reporterin Robin Bukowsky zu kümmern, die unter dem Vorwand, ein Buch über das Justizsystem zu verfassen, ein Praktikum bei Gericht absolviert. Tatsächlich wittert sie eine spannende Story hinter Buckmann und dem Mord an Ercan Ayaz …
DERAUTOR
Thorsten Schleif, Jahrgang 1980, studierte Rechtswissenschaften in Bonn. Seit 2007 ist er Richter im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Er war am Landgericht Düsseldorf und in der Verwaltung des Oberlandesgerichts Düsseldorf tätig. In den Jahren 2014 bis 2019 war er alleiniger Ermittlungsrichter für die Amtsgerichtsbezirke Wesel und Dinslaken. Gegenwärtig arbeitet Schleif als Vorsitzender des Schöffengerichts und Jugendrichter am Amtsgericht Dinslaken. 2019 und 2020 veröffentlichte er zwei Sachbücher, es folgten zwei Hörbücher im Jahr 2021, »Richter morden besser« war sein erster Roman. Seit 2016 ist Schleif außerdem als Keynote Speaker tätig. Er lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Duisburg.
THORSTEN SCHLEIF
RICHTER JAGEN BESSER
ROMAN
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 05/2023
Copyright © 2023 by Thorsten Schleif
Copyright © 2023 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Joscha Faralisch
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/Photo Lab,
Hernan E. Schmidt, Le Nhut, chainarong06
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-30518-5V002
www.heyne.de
Für meine Mutter
Prolog
Jochen sog die kühle, feuchte Luft durch die Nase. Er roch das Harz der Kiefern, er roch vermoderndes Laub. Er roch das alte Holz des Hochsitzes, auf den er noch in der Dunkelheit geklettert war. Nun begann der Sonnenaufgang, was an diesem wolkenverhangenen, nebligen Tag aber kaum eine Rolle spielte. Nur die Farbe des Himmels wechselte von schwarz zu dunkelgrau. Jochen vertrug die Kälte im Herbst immer schlechter. Sein rechtes Knie schmerzte und auch seine Schulter, die er sich bei einem Sturz vom Rennrad ausgekugelt hatte. Aber das lag schon Jahre zurück. Oder waren es Jahrzehnte? Jochen nahm eine Bewegung wahr, etwa zweihundert Schritte von seinem Hochsitz entfernt auf der Lichtung des Waldes. Er griff zu seinem Gewehr und blickte durch das Zielfernrohr. Ein junges Rehkitz hatte sich aus dem Wald gewagt und es auf das feuchte, frische Gras der breiten Lichtung abgesehen. Jochen stellte das Zielfernrohr scharf. Er sah das junge Tier, wie es unbekümmert fraß und noch unbeholfen ein paar tapsige Schritte vorwärts machte. »Na, mein Kleines«, flüsterte Jochen. »Du bist aber unvorsichtig.« Jochen fokussierte die Stelle unterhalb der Schulter des jungen Tieres. Der perfekte Blattschuss. Dann hielt er den Atem an und zählte. Einundzwanzig. Das junge Kitz fraß weiter. Zweiundzwanzig. Es blickte nicht einmal auf, als sich ein Rabe krächzend ein paar Schritte weiter aus dem Gras erhob. Dreiundzwanzig. Jochen setzte das Gewehr wieder ab. ›Nein, du bist heute nicht mein Ziel‹, lächelte Jochen in sich hinein. Dann blickte er sich um. Er hatte ein Bellen gehört, noch weit entfernt. Jochen suchte das andere Ende der Lichtung ab. Kaum mehr als einen halben Kilometer Sicht erlaubte der Nebel. Er sah eine schlanke Silhouette am Waldrand, dort, wo der kleine Trampelpfad entlanglief, den auch er am frühen Morgen genommen hatte. Ein Fußgänger trat aus dem Wald, neben ihm ein kleiner Schatten, vermutlich der Ursprung des Bellens. Mann oder Frau? Auf diese Entfernung schwer zu erkennen. Jochen griff erneut zu seiner Büchse und legte an, sodass er durch das Zielfernrohr sehen konnte. Der Fußgänger lief genau in seine Richtung. Jetzt konnte man die langen blonden Haare erkennen, die unter der Kapuze der dunkelblauen Jacke herausblickten. Und die schlanke, fast zierliche Gestalt. Eine Frau also. Und den leichten Schritten zufolge eine junge Frau, vielleicht Anfang zwanzig. In ihrer linken Hand konnte Jochen eine Hundeleine erkennen. Jochen stellte das Zielfernrohr scharf. Die junge Spaziergängerin lief unbekümmert weiter. Sie konnte ihn in dem gut getarnten Hochsitz nicht erkennen, selbst dann nicht, wenn sie auf zwanzig Schritt herangekommen wäre. Jochen hielt den Atem an. Einundzwanzig. Wieder krächzte ein Rabe ein paar Schritte entfernt. Zweiundzwanzig. Ein Bellen des Hundes, der den Raben entdeckt hatte. Dreiundzwanzig. Jochen drückte ab. Der Schuss zerriss die friedliche Stille, die eben noch über dem Wald gelegen hatte. Die Kugel durchdrang mit Leichtigkeit die Schädelplatte, und Blut spritzte aus der frischen Wunde an der Schläfe. Das ungeladene Gewehr mit dem Zielfernrohr fiel auf den Boden. Und Jochen sackte tot in sich zusammen, den Revolver mit dem qualmenden Lauf immer noch in seiner rechten Hand.
1
Kaffee. Der Schriftsteller Oscar Wilde soll gesagt haben: »Ich kann im Leben auf alles verzichten, aber nicht auf Luxus.« Bei mir ist es ähnlich. Ich kann auf alles verzichten, aber nicht auf Kaffee. Will ich auch nicht. An jenem Morgen machte ich daher so etwas wie einen kalten Entzug. Unfreiwillig natürlich. Die Stadtwerke hatten unerwartet den Strom für einige Stunden abgestellt. Nun, um ganz ehrlich zu sein, hatten sie es vorher angekündigt. Schriftlich. Zweimal. Aber ich hatte es vergessen, und so war es für mich unerwartet, als ich – wie an jedem Morgen – in die Küche ging und mir der Kaffeevollautomat den Dienst versagte. Auch das kleine Café gegenüber dem Altbau, in dem meine Wohnung lag, war von der Stromsperre betroffen. Und so kam es, dass ich gegen halb zehn schlecht gelaunt und mit einem auf null gesenkten Koffeinspiegel das kleine Amtsgericht am Rand der Altstadt betrat. Glücklicherweise war Sabine, der gute Geist meiner Geschäftsstelle, in jeder Beziehung zuverlässig – auch darin, einen starken Kaffee zu kochen. Und daher spürte ich mit jeder Stufe, die ich dem ersten Stock des Amtsgerichts, in dem sich auch die Strafabteilung befand, näher kam, wie sich meine Laune besserte, angesichts der Vorfreude auf die erste Tasse Kaffee. Und die zweite. Und die dritte. Ich hatte einige aufzuholen.
Zwischen dem Treppenhaus und dem großen Geschäftsstellenzimmer lag mein Büro, das ich aber erst mit einem ausgeglichenen Koffeinspiegel aufsuchen wollte. Auf der Fensterbank gegenüber meiner Bürotür saß eine Frau und spielte an ihrem Handy. Anfang dreißig, die dunkelblonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, Jeans und Lederjacke. Ihre nackten Füße steckten in leichten Turnschuhen. Wäre ich nicht so auf meinen Kaffee fixiert gewesen, wäre mir vermutlich aufgefallen, dass sie durchaus hübsch war. So aber eilte ich an ihr vorbei. Wenigstens ließ mich meine gute Erziehung noch ein mehr oder weniger unfreundliches »Morgen« in ihre Richtung grummeln.
»Herr Buckmann?«
Mist. Abrupt blieb ich stehen und drehte mich zu ihr um.
»Ja? Haben Sie etwa auf mich gewartet?«
»Da Sie unpünktlich sind, blieb mir nicht viel anderes übrig«, grinste mich die Blonde frech an.
»Unpünktlich?«
»Wie würden Sie es nennen, wenn man eine halbe Stunde zu spät zu einer Verabredung erscheint?«
»Ja, da wäre unpünktlich durchaus ein zutreffender Begriff.«
Jetzt erst musterte ich die Frau näher. Hohe Wangenknochen, ein leichtes Kinngrübchen, zierliche Nase. Das Highlight des Gesichts waren jedoch die Augen, die mich ebenso selbstbewusst wie freundlich anblickten. Ein grünes und ein blaues Auge.
»Und Sie und ich hatten eine Verabredung?«
Die Blonde nickte weiterhin lächelnd.
»Für neun Uhr. Mein Name ist Bukowsky.«
Bukowsky? Zugegeben, der Name sagte mir etwas. Ich dachte angestrengt nach, was mir an diesem Morgen sehr schwerfiel. Niedriger Koffeinspiegel. Konzentrationsschwäche ist eine typische Entzugserscheinung. Ich hatte darüber etwas in der Zeitung … Natürlich! Zeitung. Vor einigen Wochen hatte mich ein Journalist angeschrieben. Oder besser nicht mich, sondern den Direktor des Amtsgerichts, der sich wie immer auf irgendeiner Fortbildungsveranstaltung befand. Die Pflege der Richterrobe im fortgeschrittenen Alter oder so was. Jedenfalls hatte er die E-Mail kommentarlos an mich weitergeleitet. Ein Journalist, der ein Buch über den Zustand der Justiz schreiben wollte und deshalb um ein kurzes Praktikum beim Amtsgericht gebeten hatte. Mit Empfehlung des Justizministers. Ich vereinbarte mit ihm per E-Mail einen Termin. Anscheinend für den heutigen Tag. Und offenbar war er eine Sie.
»Sie sind Robin Bukowsky?«
Sie nickte.
»Ich dachte, Robin Bukowsky sei ein Mann«, brummelte ich.
»Ach. Und hätten Sie gewusst, dass ich eine Frau bin, wären Sie pünktlich gewesen?«
»Nein. Ich bin für Gleichberechtigung. Ich behandele Männer, Frauen und Diverse grundsätzlich gleich respektlos.«
Frau Bukowsky lachte herzhaft.
Ich kratzte mich verlegen am Hinterkopf.
»Fangen wir noch mal an«, fuhr ich fort und reichte ihr die Hand. »Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Buckmann.«
Die Journalistin ergriff meine Hand, drückte sie erstaunlich fest und antwortete: »Danke, dass Sie Zeit für mich haben.«
Ich schloss die Tür zu meinem Büro auf, verabschiedete mich gedanklich von meinem ersten Kaffee und bat Frau Bukowsky einzutreten. Die Journalistin blieb in der Mitte des Raumes stehen und blickte sich interessiert um. Ich kannte diesen Blick. Der typische Blick eines Menschen, der zum ersten Mal ein typisches Richterbüro betrat. Eine Mischung aus Mitleid und Belustigung. Mitleid wegen der Möbel aus den Siebzigerjahren, der seit fünfzehn Jahren nicht gestrichenen Wände, des alten Schreibtischstuhls mit den kaputten Rollen, des zerschlissenen Linoleums, des veralteten Computers. Belustigt wegen meiner eingerahmten Bilder. Die Hollywoodstars vergangener Zeiten: John Wayne, Clint Eastwood, Sean Connery, Marylin Monroe.
»Ich würde Ihnen gern einen Kaffee anbieten«, sagte ich und deutete auf einen Aktenbock in einer Wandnische, auf dem sich bis vor zwei Tagen noch mein altgedienter Kaffeevollautomat befunden hatte. »Aber mein Kaffeeautomat hat die nationale Sicherheit gefährdet.«
Tatsächlich hatte er die jährliche Prüfung nicht bestanden. Irgendetwas mit dem Widerstand stimmte wohl nicht. Da konnte ich dem Prüfer noch so oft erklären, dass er tadellosen Kaffee hervorbringt. Und versuchen, ihn mit einer Tasse des köstlichen Getränks zu bestechen. »Der muss weg!«, hatte der Blaumann gnadenlos gesagt. Und so hatte ich ihn am gleichen Tag mit in meine Wohnung genommen und einen neuen bestellt, der aber erst zu Beginn der nächsten Woche geliefert werden sollte.
»Ist nicht schlimm«, lächelte die Journalistin.
Ja, für Sie vielleicht nicht.
»Ich trinke nur wenig Kaffee.«
Bis gerade waren Sie mir noch sympathisch.
»Bitte nehmen Sie Platz«, forderte ich Frau Bukowsky auf und deutete auf einen der alten Holzstühle an meinem kleinen Besprechungstisch.
»Was kann ich für Sie tun?«
Frau Bukowsky setzte sich und erzählte, dass sie ein Buch über die Arbeit an deutschen Gerichten schreibe. Überlastung. Ressourcenverschwendung. Ausbildungsmängel. Sie wollte sich einen Einblick vor Ort verschaffen.
»Und dafür haben Sie tatsächlich eine Empfehlung des Ministers erhalten?«, fragte ich ungläubig. »Was haben Sie ihm dafür versprochen? Nur Nettes zu schreiben?«
Frau Bukowsky blickte mich an und lächelte selbstbewusst.
»Nein. Ich habe versprochen, etwas nicht zu schreiben. Einen Artikel über den Sohn des Ministerpräsidenten, einen Bekleidungsfabrikanten, der einen Großauftrag für Gefängnisbekleidung erhalten hat und eine große Provisionszahlung.«
»Eine Erpressung?«, fragte ich amüsiert.
Die Journalistin machte ein übertrieben erschrockenes Gesicht.
»Aber nein! Ich habe ihm nur erklärt, dass ich eigentlich viel lieber an meinem Buch weiterschreiben würde, hierfür aber selbst Erfahrungen an einem Gericht sammeln müsse. Er hat ein paar Telefonanrufe getätigt, und da bin ich!«
Irgendwie mochte ich sie.
»Nun, wenn Sie wirklich wissen wollen, wie ein Richter arbeitet, dann kommen Sie doch morgen früh um neun Uhr mit in meine Gerichtsverhandlung.«
Die Reporterin tippte den Termin in ihr Smartphone ein und stand auf.
»Sehr schön, ich freue mich!« Sie reichte mir die Hand. »Und was steht für morgen auf dem Plan?«
Ich überlegte kurz. »Ein Ladendiebstahl, zwei Schwarzfahrer, Besitz von Marihuana und Fahren ohne Fahrerlaubnis.«
Frau Bukowsky machte ein etwas enttäuschtes Gesicht.
»Das klingt nicht gerade spannend.«
Sie öffnete die Bürotür und trat hinaus.
»Mörder werden Sie beim Amtsgericht nicht finden«, sagte ich lachend.
Bevor sie die Tür schloss, drehte sich die Journalistin noch einmal um und erwiderte augenzwinkernd: »Vielleicht muss man nur richtig suchen.«
2
Das Ärgerliche an einem Mord sind die Folgen. Und damit meine ich nicht die Folgen für das Opfer. Die sind zwar auch nicht schön, aber wenigstens überschaubar. Ich spreche von den Folgen für den Täter, jedenfalls für den Täter mit einem durchschnittlichen Gewissen. Da eine Wiedergutmachung der Tat im eigentlichen Sinn denklogisch ausscheidet, bleibt das schlechte Gewissen. Ein Leben lang. Der Dieb kann zurückgeben, der Brandstifter reparieren oder wieder aufbauen und der Schläger wenigstens die Arztkosten und ein Schmerzensgeld zahlen. Was kann der Mörder tun? Gut, er könnte die Beerdigungskosten tragen. Aber mal ganz ehrlich: Das freut das Opfer auch nur bedingt. Nämlich unter der Bedingung, dass es an ein Leben nach dem Tod glaubt. Und natürlich, dass es damit auch recht hat.
Vermutlich sehen die Strafgesetze der meisten Länder auch deshalb eine lebenslange Freiheitsstrafe als Folge für einen Mord vor. Wenn eine Wiedergutmachung ausscheidet, dann braucht es der Täter gar nicht erst zu versuchen. Darum soll er Zeit finden, um über seine Tat nachzudenken. Ein Leben lang. Das ist übrigens die zweite recht unangenehme Folge für den Mörder. Der lebenslange Aufenthalt in recht beengten Räumlichkeiten. Zwar auf Staatskosten, aber trotzdem nicht attraktiv.
Die meisten Menschen machen sich hierüber keine Gedanken. Allerdings hatte ich die Gruppe der meisten Menschen vor einigen Wochen verlassen, als ich Ercan Ayaz, den brutalen Chef eines städtischen Drogenrings, ermordet hatte. Jedenfalls mittelbar. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Den eigentlichen Mord hatte Ayaz’ Vorgänger, der ehemalige Chef des Drogenrings, begangen, ein gewisser Özman Yilmaz. Aber der hatte sich getäuscht. Oder vielmehr hatte ich ihn getäuscht. Ich hatte ein Missverständnis, an dessen Entstehen der Rechtsanwalt des Drogenringes nicht ganz unschuldig war, gehegt und gepflegt, sodass Yilmaz davon ausging, Ayaz hätte ihn verraten und ihm einen langjährigen Aufenthalt auf Staatskosten in vergitterten Räumlichkeiten beschert. Und ich hatte dafür gesorgt, dass Ayaz in genau dieselbe staatliche Einrichtung eingeliefert wurde wie Yilmaz, wo der ihn dann zuverlässig am Tag nach der Einlieferung davon überzeugen konnte, das Atmen dauerhaft einzustellen. Mithilfe eines Messers und eines guten Dutzends Stichkanälen in der Lebergegend. Da die Polizei, die Staatsanwaltschaft und auch die Gerichte Özman Yildiz die Tat unproblematisch nachweisen konnten, suchten sie gar nicht erst nach mir, dem Täter hinter dem Täter. Es war der perfekte Mord. In mittelbarer Täterschaft – juristisch gesprochen. Das klingt jetzt vielleicht so, als wäre ich auf den Mord stolz. Das bin ich nicht. Kaum. Allenfalls ein kleines bisschen vielleicht. Immerhin hatte Ayaz nicht nur einige Menschenleben auf dem Gewissen, sondern auch das Leben meiner Tochter bedroht. Und das meines Referendars. Mein eigenes übrigens auch.
Jedenfalls hatte ich seit diesem Tag ein schlechtes Gewissen. Vermutlich, weil ich mit einem Mord gegen all das verstoßen hatte, wofür ich in den letzten fünfundzwanzig Jahren als Richter eingestanden bin. Und ich habe auch ein wenig Angst, doch noch erwischt zu werden. Deshalb zucke ich seit diesem Tag innerlich zusammen, wenn ich das Wort »Mord« höre. Es ist mir vorher nie bewusst gewesen, wie viele Wörter mit »Mord« beginnen. Mordsappetit, Mordsarbeit, Mordsspaß, Mordshunger, Mordsspektakel, Mordsstimmung – die deutsche Sprache ist im wahrsten Sinne des Wortes geradezu mordlustig.
Immer wenn ein Mensch in meiner Gegenwart ein solches Wort benutzt, beziehe ich es auf mich und meinen Mord. Das ist natürlich völliger Unfug. Trotzdem lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, als ausgerechnet eine Journalistin auf meinen Hinweis, dass sie am Amtsgericht keine Mörder finde, sagte: »Vielleicht muss man nur richtig suchen.« Ich weiß, dass das nur ein Scherz sein sollte. Und natürlich bezog sich das nicht auf meinen Mord. Nahm ich an. Hoffentlich.
Ich schüttelte den Gedanken ab und konzentrierte mich wieder auf das eigentliche Problem an diesem Morgen: Kaffee!
3
Die Geschäftsstelle ist das Zentrum der Strafabteilung des Amtsgerichts. Hier lagern die Akten zu aktuellen Verfahren. Hier sitzen die vielen fleißigen Bienen – und in den letzten Jahren auch zunehmend die ein oder andere Drohne – und schreiben Urteile, Protokolle und Beschlüsse, verschicken Briefe, telefonieren mit Anwälten, Zeugen und Sachverständigen. Und nur hier gibt es einen ganz bestimmten Geruch, eine Mischung von altem Papier, beißendem Druckertoner und frischem Kaffee. Auf Letzteren hatte ich es nach dem Gespräch mit der Journalistin abgesehen. Doch noch während ich die Tür öffnete, merkte ich, dass irgendetwas nicht stimmte. Es fehlte der typische Kaffeeduft.
»Guten Morgen! Was ist los? Gibt es heute keinen …«
Der Rest der Frage blieb mir im Hals stecken.
Für gewöhnlich saß Sabine morgens energiegeladen hinter ihrem Bildschirm. Wir hatten uns von Anfang an gut verstanden, als ich vor fünfzehn Jahren vom Landgericht zum Amtsgericht versetzt worden war. Sabine war so etwas wie meine große Schwester. Tatsächlich war sie einige Jahre älter als ich, hatte sich jedoch besser gehalten. Ein sportlicher, quirliger Typ mit Läuferfigur, kurzen, blonden und stets verstrubbelten Haaren und nie um einen frechen Spruch verlegen. Heute allerdings saß sie zusammengesunken auf ihrem Bürostuhl und putzte sich die Nase. Ihre Augen waren gerötet.
»Was ist los?«
Sabine antwortete mit leiser und brüchiger Stimme: »Jochen ist tot.« Nach einem Moment fügte sie hinzu: »Selbstmord.«
Der Satz zog mir den Boden unter den Füßen weg. Jochen Mershofen war mein alter Mentor. Ein Richter, wie man sich einen Richter vorstellt. Selbstbewusst, erfahren, weise. Und immer ein offenes Ohr für seine Kollegen. Jochen war vor wenigen Jahren pensioniert worden. Ich hatte ihn einige Monate nicht gesehen und wollte ihn längst angerufen haben, mich endlich mal wieder melden. Aber irgendwie hatte ich das aus den Augen verloren.
Ich stand noch immer in der geöffneten Tür, die Klinke in der Hand, und starrte Sabine an. Unfähig, etwas zu sagen. Sabine stand auf, kam zu mir und drückte mich.
»Setz dich, Siggi. Ich mache uns einen Kaffee.«
Da war sie wieder, die große Schwester. Ich ließ mich auf den Bürostuhl von Hanna fallen, Sabines Zimmerkollegin, die sich im Urlaub befand, und sah zu, wie Sabine die Enden eines Kaffeefilters faltete und ihn in die alte Maschine steckte, die auf dem kleinen Kühlschrank stand.
»Ich verstehe nicht … ich meine … Jochen … warum hat er …?«
Einen vollständigen Satz brachte ich nicht hervor.
Wortlos zuckte Sabine die Schultern und löffelte den Kaffee in den Filter. Dann schaltete sie die Maschine an und setzte sich wieder hinter ihren Schreibtisch. Schweigend hörten wir zu, wie die Kaffeemaschine zu gurgeln begann.
»Mein Ex hat vorhin angerufen«, brach Sabine endlich die unangenehme Stille. »Eine junge Frau hat Jochen heute Morgen gefunden. Auf dem Hochsitz an der Spall-Heide. Er hatte seinen Revolver noch in der Hand.«
Sabines Ex ist Polizeibeamter, und ihre guten Kontakte zur Polizei hatten uns bei der Arbeit schon oft geholfen.
Ich sah zu, wie das Wasser in den Filter lief und schon bald die ersten Tropfen der schwarzen Flüssigkeit die Glaskaraffe füllten. Nach einer Weile stand ich auf und nahm zwei Tassen aus dem kleinen Schränkchen neben dem Kühlschrank, die ich bis zum Rand füllte. Irgendjemand hatte mal gesagt: »Kaffee hilft immer!« Er hatte sich geirrt.
4
Robins Appartement lag in der obersten Etage eines dreistöckigen Neubaus am Stadtrand. Die Journalistin öffnete die schicke graue Tür, trat ein und kickte sie mit dem Fuß wieder ins Schloss. Dann warf sie ihre Schlüssel in die kleine Steinschale, die auf dem Schränkchen der winzigen Diele stand, streifte die Turnschuhe ab und ging barfuß auf dem Parkett in das ebenso geschmackvoll wie spartanisch eingerichtete Wohnzimmer mit der offenen Küche. Lederjacke und Bluse landeten unsanft auf einem Sessel am Fenster. Robin griff nach zwei Boxhandschuhen, die auf dem Boden lagen, lockerte Schultern und Nacken, während sie sie überstreifte, und zog die Riemen mit den Zähnen fest. Dann widmete sie sich nur mit Jeans und schwarzem Tanktop bekleidet dem großen, schweren Lederboxsack, der in der Mitte des Raums an einer glänzenden Eisenkette hing. Schon die ersten paar Hiebe zeigten, dass Robin genau wusste, was sie tat. Das waren keine wilden Schläge, um Frust abzubauen, sondern die routinierten Haken und Geraden einer trainierten Boxerin.
Heute allerdings diente der Sandsack ausnahmsweise auch dazu, ein wenig Dampf abzulassen. Die Journalistin hatte die letzte Stunde im Stau stehend verbracht, weil irgendein Hochzeitskorso die Autobahn blockiert hatte, damit Herren in viel zu kleinen und schlecht sitzenden Anzügen romantische Selfies von sich und ihren überschminkten und in nuttige Kostüme gewickelten Herzensdamen machen konnten. Die ehrenamtlichen Stauführer erwischten Robin auf dem Rückweg vom Gerichtsgebäude, nachdem sie sich mit Richter Buckmann getroffen hatte.
Nach einer Viertelstunde Sandsackarbeit war der Ärger verflogen. Schweißperlen standen auf Robins Stirn und den nackten Schultern. Sie zog die Handschuhe aus und öffnete ein Fenster. Dann holte sie ein frisches Handtuch aus dem kleinen Bad neben ihrem Schlafzimmer, trocknete das Gesicht und legte es um ihre Schultern. In der aufgeräumten Wohnküche nahm sie einen Proteinshaker aus dem Schrank, füllte ihn zur Hälfte mit Wasser, gab zwei Esslöffel Eiweißpulver hinzu und setzte sich auf einen der Barhocker an die Kücheninsel. Dort hatte sie am Morgen ihr wichtigstes Arbeitsmittel zurückgelassen, ein silbergraues Notebook mit Sechzehn-Zoll-Monitor. Sie schüttelte den hohen Becher, bis sich das Pulver aufgelöst hatte, und nahm einen großen Schluck. Dann klappte sie den Bildschirm des Notebooks auf. Drei Artikel regionaler Tageszeitungen waren auf dem Bildschirm nebeneinander angeordnet. Die Schlagzeilen behandelten dasselbe Thema: »Chef eines Drogenrings ermordet«, »Bandenchef Ercan Ayaz im Gefängnis hingerichtet«, »Mord in Vollzugsanstalt – Was sagt der Minister?«
Robin klickte auf eine Bilddatei, und ein Foto vergrößerte sich, das die Journalistin von der Homepage des Amtsgerichts kopiert hatte. Es zeigte die örtlichen Richter, die in Robe vor dem Eingang des Gerichts posierten. Die Journalistin zog mit der Maus einen roten Kreis um den Kopf eines Robenträgers. Es war der Mann, den sie heute persönlich kennengelernt hatte, Richter Buckmann. Robin verglich das Foto mit dem Eindruck, den sie von ihm gewonnen hatte. Das Foto wurde ihm nicht gerecht. Er wirkte selbstbewusster als auf dem Bild. Und er sah – ganz objektiv betrachtet – besser aus, vor allem athletischer. Das würde ihr Vorhaben sehr viel angenehmer machen. Robin hatte schon oft geflirtet, um an eine Story zu kommen, und kannte ihre Wirkung auf Männer. Vor allem auf Männer im »interessanten« Alter. Trotzdem fiel die Arbeit leichter, wenn sie nicht unattraktiv waren.
Das Summen des Smartphones, das neben dem Notebook auf der hölzernen Fläche der Kücheninsel lag, riss die Journalistin aus ihren Gedanken. Robin betätigte die Lautsprecherfunktion.
»Hallo, Maria.«
Maria war nicht nur eine Kollegin, sondern eine ihrer engsten Freundinnen. Sie kannten sich seit dem gemeinsamen Studium. Zurzeit arbeiteten sie an einer Reportage über vegane Ernährung, die in einigen Wochen in einer renommierten Frauenzeitschrift erscheinen sollte. Wissenschaftliche Studien, Kochrezepte, Restaurants, Auswirkungen in der Schwangerschaft – das volle Programm. Maria hatte den Auftrag an Land gezogen und ihre Freundin um Hilfe gebeten. Das Thema lag Robin zwar weniger, aber das Honorar war großzügig, sodass sie zugesagt hatte.
»Hallo, Robin! Ich wollte mal hören, wie der erste Tag bei Gericht gelaufen ist. Wie ist er denn so?«
»Anders als erwartet.«
»Oje. Noch dröger und klappriger? Alter, weißer Mann in Reinkultur?«
Robin lachte.
»Nein, ganz im Gegenteil!« Nach einem Augenblick fügte sie amüsiert hinzu: »Es könnte interessant werden …«
5
Jochen hatte nie geheiratet. Seine Jugendliebe hatte sich noch während des gemeinsamen Jurastudiums von ihm getrennt und war nach Australien ausgewandert. Erst viele Jahre später erfuhr er, dass sie schwanger gewesen und er Vater eines Sohnes geworden war. Auch wenn sie sich einige Male gegenseitig besucht hatten, war ein echtes Vater-Sohn-Verhältnis nie entstanden. Über die Jahre war aus meinem alten Mentor ein eingefleischter Single geworden. Seine nächste Verwandte war seine zehn Jahre jüngere Schwester Kathrin, die ich auf Jochens Ausstand kennengelernt und seitdem häufiger gesehen hatte. Zu ihr fuhr ich am Nachmittag desselben Tages, um mein Beileid auszudrücken und Hilfe anzubieten.
Schon als ich vor dem hübschen Einfamilienhaus hielt und die Wagentür öffnete, vernahm ich lautes Kindergeschrei aus dem Inneren des Hauses.
»Siggi!«, sagte Kathrin überrascht, als sie die Haustür öffnete. »Komm doch bitte herein!«
»Ich möchte nicht stören …«
»Du störst nicht. Es ist lieb von dir, dass du vorbeikommst.«
Kathrin führte mich ins Wohnzimmer und wies auf einen Sessel. »Nimm bitte Platz! Einen Kaffee?«
Ich schüttelte den Kopf. »Danke, nein.«
Auf einem Kissen vor dem Fenster lag Judex, Jochens kleiner Border Collie, den Kopf auf die Pfoten gelegt, und blickte traurig in den Garten. Er schien zu spüren, dass sein Freund nicht zurückkehren würde.
Im oberen Stockwerk waren Kinder zu hören. Mindestens zwei.
»Meine Enkel«, erklärte Kathrin. »Meine Tochter und mein Mann sind in die Stadt gefahren, um alles zu regeln.« Kathrin atmete einmal tief durch.
Wieder rumste es oben.
»Die beiden sind noch zu klein, um zu verstehen, was passiert ist«, lächelte sie.
»Es tut mir so leid, Kathrin. Gibt es irgendetwas, was ich für euch tun kann?«
Jochens Schwester schüttelte den Kopf und lächelte.
»Danke, Siggi. Weißt du, das ist alles so unwirklich. Ich habe es noch immer nicht begriffen. Ich fürchte, das kommt noch.«
»Weißt du, warum Jochen …?«, setzte ich an und schluckte. Es fiel mir schwer, den Satz zu beenden. Erst jetzt setzte sich Kathrin auf das kleine Sofa, das gegenüber meinem Sessel stand, und sah mich an.
»Jochen hatte eine starke Depression.«
»Jochen?« Der angelnde, jagende Tennisspieler, der an jedem Stammtisch gern gesehen war. Der Jochen? Kathrin schien meine Gedanken zu erraten.