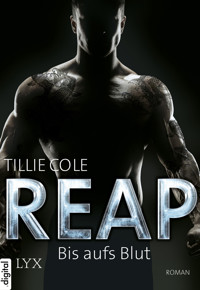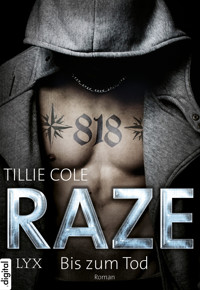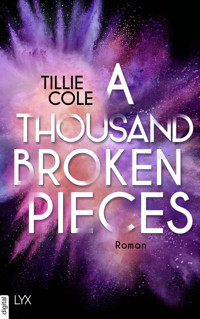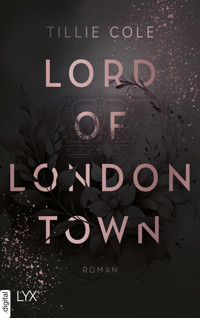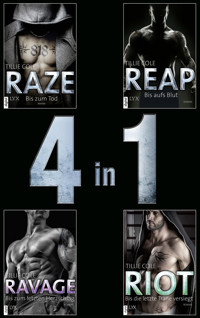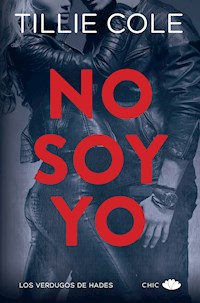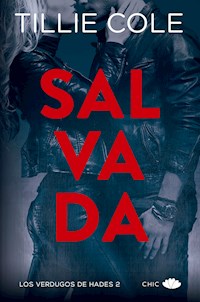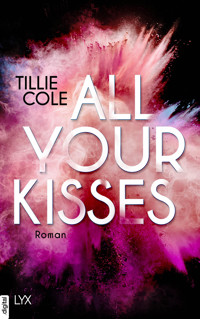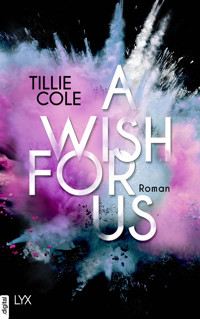6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Scarred Souls
- Sprache: Deutsch
Rau, düster und herzergreifend
901 hat keinen Namen, keine Familie, keine Identität. Er ist die perfekte Tötungsmaschine, er kennt nichts anderes. Wenn sein Meister sagt: "Kämpf", dann kämpft er ... bis er alle bezwungen hat. Er hat nur ein Ziel: so viele Siege einzufahren, dass er frei ist. Er braucht keine Freunde, keine Frau. Sie machen ihn schwach, doch er ist stark. Bis er sie sieht. Ebenfalls versklavt rührt ihr Lächeln etwas in seinem Herzen, das ihm den Atem raubt. Nun muss er eine schwere Entscheidung treffen: Freiheit oder Liebe ...
Band 4 der Scarred-Souls-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Tillie Cole
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungProlog12345678910111213141516EpilogDanksagungDie AutorinWeitere Romane von Tillie Cole bei LYX.digitalImpressumTILLIE COLE
RIOT
Bis die letzte Träne versiegt
Roman
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
Zu diesem Buch
901 hat keinen Namen, keine Familie, keine Identität. Er ist die perfekte Tötungsmaschine, er kennt nichts anderes. Wenn sein Meister sagt: »Kämpf«, dann kämpft er – bis er alle, die mit ihm in der Grube stehen, bezwungen hat. Denn nur dann fühlt er sich lebendig, fühlt er sich frei. Er braucht keine Freunde, keine Frau. Sie machen ihn schwach, doch er ist stark. Bis er sie sieht. Ebenfalls versklavt rührt ihr Lächeln etwas in seinem Herzen, das ihm den Atem raubt. Aber sie gehört Meister, und Gefühle für sie bedeuten den Tod. Nun muss 901 eine schwere Entscheidung treffen: Freiheit oder Liebe …
Für die Fans der Scarred-Souls-Reihe, die diese epische Reise mit mir gemacht haben.Auf dass wir die Revolution der Dark Romance miterleben!
Prolog
901
Die Blutgrube
Georgien
Unbekannter Standort
Der grobe Sand knirschte unter meinen Füßen, als ich durch den Tunnel stapfte. Das laute Stampfen Tausender Zuschauer – blutdürstiger, reicher Zuschauer –, deren Füße auf den Boden über mir knallten, erfüllte jeden Zoll Luft um mich herum. Meine Muskeln zuckten, und ich hielt meine Kinschals, meine kostbaren russischen Kosakendolche, in den Händen. Ich drehte sie, das Adrenalin rauschte durch meine Adern und entfachte meinen Blutdurst.
Das donnernde, rhythmische Stampfen der ungeduldigen Menge wurde schneller, und meine Beine verfielen in einen gleichmäßigen Trott. Ich zog die Lippen zurück und fletschte die Zähne. Ein tiefes Grollen drang aus meinem Mund. Das Echo meiner schweren, erwartungsvollen Atemzüge hallte im Gleichklang mit meinen Füßen.
Die pechschwarze Finsternis im Tunnel wich dem Licht, als ich mich der Rampe zur Grube näherte. Die Grube, in der Herzen durchbohrt und Monster erschlagen wurden. Die Grube, wo das Blut so ungehindert wie Wasser floss, wo Muskel vom Knochen fiel, so mühelos wie zartestes Fleisch.
Wo Champions uneingeschränkt herrschten.
Die Grube, in der ich Hof hielt. Der König, der dämonische Schatten, der berühmte »Pit Bull«. Ich war ungeschlagen. Keiner, den Meister von über der Erde hier herunterschleppte, konnte mich besiegen. Die brachten mir kaum einen Kratzer bei, wenn sie angriffen. Seit Jahren herrschte ich hier als Champion.
Diese Sandarena gehörte mir.
Jede Seele, die in diesem Ring freigesetzt wurde, gehörte mir.
In der Blutgrube war ich ein Gott.
Als die Mündung zur Grube in Sicht kam, wurde ich schneller, und die Menge über mir brüllte. Und dann war ich frei, stürmte in die Arena und jagte vorwärts, um jeden abzuschlachten, der mir im Weg stand.
Ich holte aus, und meine Kinschals schlitzten nicht einen, sondern zwei Männer auf, die ohne jedes Geschick oder einen Hauch von Kampfgeist auf mich zurannten. Ihre leblosen Körper sackten hinter mir zu Boden, aber ich blickte nicht zurück. Meine Augen verfolgten die noch übrigen drei Kämpfer, die mich umkreisten und nach meinem Blut gierten.
Ich lächelte, hielt den Kopf gesenkt und mied ihren Blick. Sie hatten keine Chance. Für mich waren diese Kerle schon tot. Noch mehr Frischfleisch, das entsorgt werden musste.
Der Erste rannte auf mich zu, dicht gefolgt vom Nächsten. Ich schlitzte sie auf, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen. Dann wagte sich der letzte Gegner vor. Er schwang eine Klingenkette um seinen Kopf. Ich duckte mich erst nach links, dann nach rechts, bis wir einander passierten. Ich rammte ihn in die Seite und jagte ihm meine treuen Klingen in den Leib. Konzentriert hörte ich den sterbenden Mann zu Boden fallen, hörte den dumpfen Aufschlag, als sein Körper den Sand aufwirbelte … und dann den tosenden Beifall der Zuschauer.
Ich stand da, aufrecht und reglos, als die Menge aufsprang und immer wieder meine Nummer brüllte.
»901! 901! 901!«
Ich blickte prüfend in die Menge, Hass ging in Wellen von mir aus, bis meine Augen Meister fanden. Er saß auf seinem Platz, dem vergoldeten, im Mittelpunkt zur Arena. Sein Blick war stechend. Es war ein finsterer Blick, erfüllt von einer Mischung aus Stolz und Tadel.
Ich wartete darauf, dass er mir die Erlaubnis gab, zu gehen. Als er es mit einer wegwerfenden Handbewegung tat, drehte ich mich auf dem Absatz um und stürmte zurück in den Tunnel. Ich trottete durch den finsteren Gang zurück zu meiner Zelle, als plötzlich Meister vor mir auftauchte.
Ich blieb stehen und erstarrte zur Salzsäule.
Sofort senkte ich als Geste der Unterwerfung den Kopf.
Mein Blick richtete sich auf Meisters perfekt polierte schwarze Schuhe und die in feinstes Tuch gehüllten Beine. Und ich wartete. Ich wartete darauf, dass er etwas sagte.
»Ich sagte dir, du sollst es diesmal langsamer angehen. Ich befahl dir, eine Show zu liefern. Du tötest zu schnell. Du kostest mich Geld. Niemand lässt seine besten Kämpfer gegen dich antreten, wenn du nicht einen Hauch von Schwäche zur Schau stellst. Du erweckst nie den Anschein, dass man dich schlagen könnte.«
Meine Kinnmuskeln verkrampften sich bei seiner Maßregelung. Meine Hände packten die Kinschals fester. »Ich verliere nicht«, antwortete ich grollend.
Meisters Füße kamen näher, bis er zu mir aufsah. Er war finster, hochgewachsen und massig gebaut. Ich war größer, ich war breiter, ich war sein preisgekrönter Killer. Ich bestand aus einem Berg kräftiger Muskeln – dafür hatte er gesorgt. Ich war brutale, wahr gewordene Kraft – er hatte mich dazu gemacht. Und ich kannte keine Furcht – Meister hatte mir so viele Bestrafungen auferlegt, dass Furcht in meinem schwarzen Herzen keinen Platz hatte. Er war so gründlich gewesen, dass ich nicht einmal den Mann fürchtete, dessen Eigentum ich war.
»901«, mahnte er und zeigte mir, dass unter einer Fassade der Ruhe Furcht brodelte, »du bist mein bester Kämpfer. Mein Champion. Mein Pit Bull.« Er trat noch näher. »Zwing mich nicht, dir Schmerz zuzufügen.« Er hob die Hand, und mit einer Bewegung, die mich jedes Mal über alle Maßen anekelte, strich er langsam mit einem Finger über meine Wange. Ich erstarrte, als seine Fingerspitze über meine Lippen und abwärts über meinen Oberkörper fuhr. Sein Finger zeichnete das Tattoo auf meiner Brust nach. Meine Nummer: 901.
Ich riskierte einen Blick in seine Augen, als er wie gebannt auf das Tattoo starrte. Meine Adern füllten sich mit flammendem Feuer. Flammen anstelle von Blut. Denn Meister war irre. Meister lebte dafür, uns zu beherrschen. Seine Sklaven. In der Blutgrube war er ein König. Und das Schlimmste war, dass er selbst daran glaubte.
Meister trat mit einem Räuspern zurück und nahm die Hand weg. Mein Blick fiel wieder auf den Sand unter meinen Füßen. »901, du hast keine Wahl.« Von einem Augenblick zum anderen veränderte sich seine Persönlichkeit. Sein Zorn schwand, und er seufzte. »Zwing mich nicht, dich zu bestrafen. Es würde mich sehr schmerzen, dich, meinen Champion der Champions, zu bestrafen.«
Seine Worte ließen meine Haut prickeln. Denn er meinte es ernst. Meister würde mich bestrafen, daran hatte ich keinen Zweifel. Er war ein Raubtier, ein geborener Killer, von allen gefürchtet. Er stand darauf, seinen Sklaven Schmerzen zuzufügen. Aber noch mehr stand er darauf, einen zu manipulieren, bis man nicht mehr wusste, was er gerade dachte oder ob heute der Tag war, an dem er beschloss, einen töten zu lassen.
Sein gesamtes Imperium stand auf einem Fundament aus Angst.
Doch ich hatte keine Angst. Ich war zu wichtig für ihn. Das wusste ich. Er wusste es auch. Jeder wusste es. Ich hatte keine Schwäche, die er ausnutzen konnte.
Das ärgerte ihn mehr als alles andere.
Er wartete auf eine Antwort von mir. Ich holte tief Luft und sagte: »Ich werde nicht langsamer machen. Niemand wird mich schlagen.«
Er schüttelte den Kopf und lächelte. Doch in seinem Lächeln lag kein Humor. Nur Herausforderung. »Da irrst du dich, 901. Jeder hat eine Schwachstelle.« Seine Augen flammten auf, und er fuhr fort: »Es geht nur darum, sie zu finden.«
Ohne seine Erlaubnis zum Sprechen erhalten zu haben, antwortete ich: »Ich habe keine Schwachstelle. Ich gestatte mir keine Schwäche. Niemals.«
Meister antwortete nicht. Er blieb still stehen, direkt vor mir, mehrere Minuten lang. Schweigend. Nachdenklich. Bis er beiseitetrat, was ich als Zeichen nahm, mich umzudrehen und zu gehen.
Als ich weiter durch den Flur zu meiner Zelle eilte, rief Meister mir nach: »Du wirst nachgeben, 901. Dieses Mal lasse ich deinen Ungehorsam durchgehen. Aber denk nicht, du wärst immun gegen Bestrafung. Jeder ist ersetzbar in der Grube. Sogar du. Irgendwann kommt immer jemand, der stärker und schneller ist. Schwächen lassen sich finden. Und ich versichere dir, sie werden genutzt werden.«
Ich erstarrte. Seine kalte, leblose Stimme floss zäh über meine Haut. Meisters Schritte kamen näher, und das leichte Tappen seiner Schuhe auf dem Sand schnitt durch die süßliche Stille und drang bis zu mir. Einen Augenblick lang blieb er stehen, um seine Macht über mich zu demonstrieren. Dann, endlich, ging er.
Als seine Schritte in der Ferne verstummten, marschierte ich zurück in meine Zelle. Bei jedem Schritt hörte ich seine Worte im Kopf und verzog die Lippen in reinem Hass.
Vor langer Zeit hatte ich beschlossen, mich nicht von ihm brechen zu lassen, was er auch sagte oder tat. Ich würde meine Gegner nicht langsamer töten, und ich würde ganz bestimmt keine »Show daraus machen« – Versagen vortäuschen und meine Körperkraft verbergen. Noch wichtiger war, ich würde keine Schwäche zeigen. Denn das hier war die gottverfluchte Blutgrube. Schwache Männer krepierten. Champions fielen. Nur die brutalsten Killer überlebten.
Auch ich würde auf diesem Sand sterben – aber nicht, bevor Meister mir jemanden brachte, der würdig und gnadenlos genug war, um mein Herz zum Stillstand zu bringen. Erst dann würde ich meinen letzten Atemzug tun.
Meine Stärke, meine Weigerung, mich seinem Willen zu beugen, war die einzige Wahl, die ich in diesem Leben noch hatte. Alles andere hatte er mir geraubt – meine Freiheit, mein Lebensglück, meinen freien Willen. Doch mein Kriegerstolz gehörte nur mir. Ich würde nicht zulassen, dass er mir den auch noch nahm.
Ich holte tief Luft und lief schneller. Ich fühlte mich sicher in dem Wissen, dass es niemanden dort draußen gab, der mich in absehbarer Zeit besiegen konnte.
Ich war der Russische Pit Bull.
Der Sammler der Seelen.
Das hier war meine Domäne.
Die Blutgrube war meine Arena.
Und ich würde kämpfen bis zum Ende.
1
152
Die Blutgrube
Georgien
Unbekannter Standort
Ein warmer Windhauch strich über meine Haut und holte mich aus dem Schlaf. Ich wollte die bleischweren Lider öffnen. Aber als ich sie schließlich aufbekam, sah ich nur verschwommen. Ich wollte den Kopf heben, doch der tat weh, und Schmerzwellen rollten über meinen Rücken.
Ein Stöhnen kam über meine Lippen, als ich Arme und Beine heben wollte. Sie fühlten sich an wie von Tausenden Nadeln durchbohrt. Mein Mund war trocken. Endlich wurde meine Sicht klar genug, um an die Steindecke über mir zu starren. Der Stein war matt grau. Doch ich lag auf etwas, das im Kontrast zu meiner Umgebung weich und bequem war, und mein Kopf sank in etwas, das sich anfühlte wie in Seide gehüllte Daunen.
Ich runzelte die Stirn. Es gelang mir, die steifen Finger zu bewegen, und ich strich über den weichen Stoff unter mir. Ich holte tief Luft, hielt den Atem an, zwang mich dann, mich auf die Seite zu drehen und unterdrückte dabei den Schmerzenslaut, der mir über die Lippen kommen wollte. Ich keuchte vor Anstrengung.
Ich kniff die Augenlider zusammen. Als der Schmerz verging, öffnete ich die Augen wieder und starrte auf das, was vor mir war. Ich lag in einem … Bett? Ein echtes Bett. Ein großes, weiches Bett. Mein Kopf war ganz benommen vor Verwirrung. Mein Herz raste vor Panik darüber, dass ich hier war. Ich hatte mir nie das Recht auf ein Bett verdient.
Dieses Mal ignorierte ich den Schmerz und schob den Kopf höher auf das luxuriöse Kissen, bis der Raum ins Blickfeld kam. Er war groß und wunderschön eingerichtet. Weiße Vorhänge an der Decke verwandelten den Raum in ein Zelt. Es gab mehrere Teppiche in satten Rottönen und Antiquitäten, die perfekt in jeden Vorort gepasst hätten.
Ich versuchte dahinterzukommen, wo ich sein mochte, aber in meinem Kopf war nur dichter Nebel. Ich schloss die Augen, und das grelle Licht ließ mich zurückschrecken. Dann dämmerte es mir. Ich war kein Licht gewohnt, sondern nur Dunkelheit. Aber warum? Ich wusste es nicht! Ich zerbrach mir den Kopf, um mich zu erinnern. Doch es kamen nur Fragmente: Käfige, Spritzen, Schmerz, rot glühendes Feuer in meinen Adern und das unerträgliche Verlangen, dass es gelöscht werden solle. Dann kamen dunklere Visionen: Bilder von Männern in schwerer schwarzer Kluft, ein Haus voller Kinder, und diese Kinder wurden aus ihren Betten gerissen und verschleppt.
Meine Hände fingen zu zittern an und meine Finger krümmten sich zu schwachen Fäusten. Phantome. Nachtphantome, flüsterte es in meinem Kopf, aber die Worte glitten davon.
Dann tauchte ein schemenhaftes Gesicht auf. Ohne Gesichtszüge, aber mit brutalen Narben. Das Gesicht eines Monsters, doch – so erschreckend dieses riesige muskelbepackte, vernarbte Monster auch war, empfand ich keine Furcht. Genau genommen fühlte ich das Gegenteil: Geborgenheit. Beim Anblick seines Gesichts umgab mich Wärme. Meine Hände zitterten nicht mehr. Doch das Gesicht blieb. Es wich einer tiefen rauen Stimme, die mir versicherte, dass es mich beschützen würde. Um jeden Preis. Dass es kommen würde, um mich zu holen, wo auch immer ich war. Dass wir eines Tages wieder frei wären.
Ich fühlte die sanfte, feuchte Berührung einer Träne auf meiner Hand. Da wurde mir klar, dass ich weinte. Ich legte die Stirn in Falten und fragte mich, wieso ich weinte. Wieder zerbrach ich mir den Kopf und versuchte mich zu erinnern, wieso der Mann so wichtig für mich war. Ich war schon fast so weit, dass es mir wieder einfiel, als die Tür rechts von mir aufging. Ich erstarrte, als eine junge Frau hereinkam. Mit weit aufgerissenen Augen und schwer atmend musterte ich sie. Sie war klein und trug ein langes, schlecht sitzendes graues Kleid. Sie hinkte leicht. Als sie mir den Kopf zuwandte, schnappte ich nach Luft. Ihre rechte Gesichtshälfte war entstellt. Auf dieser Seite wuchs kein Haar auf ihrem Kopf. Die dunklen Züge der jungen Frau waren von breiten, hässlichen Narben verunstaltet.
Auf ihrem Rücken erkannte ich das einzigartige Tattoo, das ihren Status verriet. Sie war eine ch’iri. Eine der »Plagen.« Die unterste Stufe der Sklaven in der Blutgrube. Sie hatten die Nummer 000 eintätowiert, zum Zeichen dafür, dass sie keine Namen hatten. Sie waren die Totengeister unserer Welt, die Komparsen, die so tief standen, dass sie nicht einmal eine persönliche ID wert waren. Ich runzelte die Stirn und fragte mich, woher ich das alles wusste.
Die Blutgrube … Meine Gedanken rasten, als mir klar wurde, wo ich mich befand. An dem Ort, den ich am meisten fürchtete. Ich war in der Blutgrube. Aber wie? Wo? Wieso?
Als würde sie meinen starren Blick fühlen, richteten sich die dunklen Augen der ch’iri auf mich. Sie erstarrte, dann senkte sie schnell den Kopf. In meiner Kehle bildete sich ein Kloß. Sie sah nicht älter als ein Teenager aus. Vielleicht fünfzehn, sechzehn Jahre?
Die ch’iri drehte sich um und wollte auf die andere Seite des Raumes huschen, doch ich konnte rufen: »Nein, bitte nicht.« Ich schluckte schwer, und es fühlte sich an, als steckten Millionen Glassplitter in meiner Kehle.
Ich hustete, um das unangenehme Gefühl loszuwerden. Währenddessen wiegte sich die ch’iri unsicher auf den Füßen. Schließlich ließ sie die Schultern hängen, ließ die Wäsche, die sie in den Händen hielt, fallen und eilte an mein Bett. Ich sah ihr zu, wie sie aus dem Krug neben mir Wasser in ein Glas goss. Ohne den Blick zu heben, gab sie mir zu trinken. Ich wollte die Hand heben, um es zu nehmen, aber meine Schmerzen waren zu groß, um auch nur einen Muskel zu bewegen. Tränen stiegen mir in die Augen. Der Frust meiner misslichen Lage war zu viel.
Als eine Träne auf das Kissen fiel, spürte ich den Rand des Glases an meinen Lippen. Als ich die Tränen wegblinzelte, die mir die Sicht trübten, bedeutete die ch’iri mir mit einer Geste zu trinken. Ich schloss die Augen, als die kühle Flüssigkeit meine Zunge benetzte, und trank und trank, bis das Glas leer war. Die ch’iri füllte es erneut, und ich trank es wieder leer.
Als sie es ein drittes Mal füllen wollte, flüsterte ich: »Nein, das reicht. Danke.«
Die junge Frau hielt den Kopf gesenkt und wollte gehen. Doch ich bat: »Nein, bitte bleib. Ich …« Ich schüttelte den Kopf und zuckte zusammen. Doch ich ignorierte den Schmerz und fragte: »Wo bin ich? Warum bin ich in einem solchen Zimmer?«
Die ch’iri antwortete, ohne mir in die Augen zu sehen: »Sie sind in der Suite der Hohen Mona, Miss. Auf Befehl von Meister.«
Und in einem Sekundenbruchteil der Klarheit wusste ich wieder, was ich war. Ich war eine mona. Eine Sklavin, deren Körper dazu diente, Männern Vergnügen zu bereiten, wann immer sie es wünschten.
Das warme Blut, das durch meine Adern rann, wurde zu Eis. Kalte Schauer liefen mir über die Haut und über den Rücken.
Hohe Mona?
Meister?
Suite?
Meister Arziani. Der Name ließ mein Herz rasen. Ich war nicht sicher, warum dieser Meister mich so ängstigte, aber erneut vertraute ich meinen Instinkten, die mir sagten, dass ich ihn sehr fürchten musste.
Ich füllte meine Lungen mit dringend nötiger Luft und fragte: »Ich bin in der Blutgrube?« Die Frage kam über meine Lippen, und in den Worten schwang die Verwirrung mit, die mir immer noch den Verstand vernebelte.
»Ja, Miss. Sie wurden vor sechs Wochen zurückgebracht. Sie waren eine Weile weg.«
Schockwellen liefen durch meinen Leib. »Sechs Wochen? Zurückgebracht?«, fragte ich. Die ch’iri nickte einmal. Ich zermarterte mir das Hirn, um mich zu erinnern, wo ich gewesen war; an irgendetwas aus den letzten sechs Wochen – doch da war nichts. Ich geriet in Panik.
»Ich erinnere mich nicht«, sagte ich heiser. »Ich erinnere mich an gar nichts.« Doch dann flackerte wieder das Narbengesicht des Mannes in meinem Kopf auf. Ich wollte das Bild seines Gesichtes festhalten. Ich erinnerte mich daran, dass er blaue Augen hatte. Irgendwie vertraute blaue Augen. Aber bevor ich begreifen konnte, wieso, war er verschwunden, wieder eingesaugt in irgendein schwarzes Loch, das mir alle bewussten Gedanken stahl.
Mir wurde das Herz schwer, und ich bekam keine Luft mehr. Meine trockenen Lippen öffneten sich, als ich nach Luft schnappte. Trotz des Schmerzes bei der Bewegung drückte ich die Hand ans Herz. Panik durchfuhr mich, und meine Füße begannen zu strampeln. Doch mein treuloser Körper wollte sich nicht rühren. Die Schmerzen hielten ihn nieder. Ein Wimmern kam über meine Lippen. Im nächsten Moment packten zwei Hände meine Arme und hielten mich fest.
Verzweifelt sah ich auf. Die ch’iri beugte sich über das Bett und versuchte, mich zu beruhigen. »Ich … kann nicht … atmen …«, presste ich durch zusammengebissene Zähne. Endlich begegnete die ch’iri meinem Blick. Ihre Augen waren groß und dunkel. Sie wäre hübsch gewesen, dachte ich, wäre ihr Gesicht auf der einen Seite nicht so verunstaltet.
»Sie haben Angst«, sagte sie leise. »Das sind die Drogen. Sie wurden von der einen entwöhnt und an die andere gewöhnt, in einer niedrigeren, weniger starken Dosis. Daher die Schmerzen. Deshalb bereitet es Ihnen solche Mühe, sich zu erinnern. Ihr Gehirn braucht Zeit, um sich anzupassen.«
Ich streckte die Hände aus, griff nach den Armen der ch’iri und nahm den Rhythmus ihres Atems an. Sie atmete langsam ein, während ich ihre ruhigen, gleichmäßigen Atemzüge nachzuahmen versuchte. Mein Herz hatte so hektisch gepocht, dass ich glaubte, es würde mir aus dem Brustkorb springen. Doch nach einigen Minuten schlug es wieder normal. Ich konnte wieder atmen. Und mein Puls wurde langsamer und gleichmäßig.
Trotzdem ließ ich die Arme der ch’iri nicht los. Als sie sah, dass ich mich beruhigt hatte, senkte sie den Kopf, und ich musterte sie eindringlich. Mir wurde das Herz schwer. Die Entstellung, die wie ein Brandmal aussah, war schlimm. Haar wuchs dort nur vereinzelt, und ihre Haut war über die ganze rechte Wange, vom Hals bis zum Ohr gerötet. Eine Welle des Bedauerns überkam mich.
Was hatte sie über sich ergehen lassen müssen? Wie war das passiert? Und wieso galt so etwas als normal? Wieso schockierte es mich nicht, jemanden mit so brutalen Narben zu sehen?
Dann dachte ich an ihre Worte, und die Angst packte mich wieder. Ich öffnete den Mund und flüsterte: »Drogen? Du sagtest … Drogen?«
Nach kurzem Zögern antwortete die ch’iri: »Ja, Miss.«
»Bitte«, bat ich. »Erklär es mir. Ich … ich bin verwirrt. Mein Gedächtnis ist ein einziges Durcheinander. Ich kriege nichts auf die Reihe.«
Die ch’iri wurde blass und schüttelte den Kopf. »Ich habe kein Recht, über solche Dinge zu sprechen. Ich wurde nur geschickt, um mich um Sie zu kümmern, nicht mehr.«
»Bitte«, flehte ich. »Wieso bin ich hier? Wie bin ich hierhergekommen? Ich brauche etwas, das Sinn ergibt.« Mein Kopf dröhnte, als ich verstummte.
Mehrere Sekunden vergingen, bevor die ch’iri antwortete. »Sie waren lange Zeit bei Herrin Arziani. Sie waren nicht in der Blutgrube. Aber Meister hat Sie zurückbefohlen. Also sind Sie zurückgekehrt. Mehr weiß ich nicht.«
Ich schloss die Augen und versuchte mich zu erinnern. »Ich erinnere mich nicht«, flüsterte ich.
»Die Drogen«, wiederholte die ch’iri. Ich öffnete die Augen und wartete darauf, dass sie es mir erklärte. Sie biss sich nervös die Lippen und sagte schließlich: »Sie standen unter der Droge für monebi – für Sklavinnen. Sie wurde Ihnen jahrelang verabreicht. Als Meister Sie zurück nach Hause befahl, gab er Befehl, dass Sie entwöhnt werden und stattdessen die Rezeptur für die Hohe Mona bekommen sollen.«
»Warum?«
»Ich weiß es nicht, Miss. Ich wurde als Ihre ch’iri hierhergebracht. Ich habe die Aufgabe, mich um Sie zu kümmern, so lange Sie eine Hohe Mona sind. Jede Hohe Mona hat eine Helferin. Das ist eines Ihrer Privilegien.«
Unzählige Fragen drängten sich in meinem benommenen Verstand, aber ich entschied mich für: »Hohe Mona?« Ich schüttelte den Kopf. »Kannst du das erklären? Ich verstehe nicht? Was ist eine Hohe Mona?«
Die ch’iri sahauf und erklärte: »Miss, Sie sind Meisters neue persönliche Gespielin. Sie wurden auserkoren, ihm zu gehören. Und zwar nur ihm. Sie sind nicht länger Eigentum anderer Männer.«
Mir wich das Blut aus dem Gesicht. Ich ließ ihre Arme los, starrte auf meine Hände und sah sie zittern. Ich forschte in meinem Gedächtnis nach dem Grund, warum die Neuigkeit, dass ich nun Meisters Hohe Mona war, etwas Schlechtes bedeutete, doch ich konnte mich nicht erinnern. Es war als würde eine hohe Mauer meine Vergangenheit vor meinem inneren Auge abschirmen und die Antworten auf meine Fragen verbergen.
»Warum zittere ich?«, fragte ich nervös. »Warum macht mir das Angst?« Ich ballte die Hände zu Fäusten und biss vor Schmerz die Zähne zusammen. Dann sah ich mich prüfend im Zimmer um, betrachtete den Luxus und Reichtum. Nichts sah vertraut aus. Instinktiv wusste ich, dass ich einfach nicht hierher gehörte.
Als mir der Gedanke durch den Kopf ging, trat ein anderer an seine Stelle. Ich fühlte das weiche Bett unter mir, atmete die reine, duftende Luft ein und fragte: »Wenn ich die neue Hohe Mona bin, was ist dann aus der letzten geworden?«
Die Anspannung in der Luft war greifbar. Ich sah zu der ch’iri auf und drängte: »Sag es mir.«
»Sie wurde getötet, Miss.«
Mir sank das Herz. »Wie?«
»Ich weiß es nicht, Miss. Sie war ungehorsam. Ich weiß nicht, wie oder warum, aber Meister hat sie hingerichtet. Öffentlich. In der Grube.«
»Der Grube?«
»Die Grube ist der Ort, wo Meisters Kämpfer ihre Kämpfe ausfechten, Miss.«
Ich hob die Hand an den Kopf und fasste mir ins Haar. »Ich erinnere mich an gar nichts. Und doch wirkt alles so vertraut, falls das irgendeinen Sinn ergibt. Es ist, als würde ich die Antworten auf alle meine Fragen kennen, aber sie stecken irgendwo fest, und ich kann nicht auf sie zugreifen.«
»Eines Tages erinnern Sie sich wieder«, sagte die ch’iri. »Die neue Droge für eine Hohe Mona, die man Ihnen gegeben hat, bringt eine Klarheit mit sich, die Ihnen bei der B-Droge gefehlt hat. Es dauert eine Weile, aber hoffentlich früher als später werden Sie sich erinnern. Der Einfluss der schwächeren Droge ist besser, Miss. Glauben Sie mir. Sie schützt Sie vor Schwangerschaften, weckt aber trotzdem das Verlangen, von Meister genommen zu werden. Aber sie wird Ihnen keine Schmerzen zufügen oder Sie verrückt machen wie zuvor. Meister mag es, wenn seine Hohe Mona sich seiner Berührungen bewusst ist. Er möchte gern, dass Sie sich jederzeit seiner bewusst sind. Er will, dass Sie jede einzelne Sekunde in seiner Gegenwart wahrnehmen. Er will, dass Sie sich daran erinnern, wem Sie dienen.«
»Woher weißt du das alles?«, fragte ich.
Die ch’iri zögerte, dann sagte sie: »Es ist unter den Sklaven allgemein bekannt, Miss. Meister hält nicht viel geheim.«
Ich nahm die Hände aus meinem Haar und ließ sie sinken, während mir die Angst wieder über den Rücken kroch. Angst davor, die einzige Gespielin des Meisters zu sein. Für einen Mann, an den ich keine Erinnerung hatte. Doch mein Verstand sagte mir, dass er ein Mann war, den ich bereits gut kannte.
Stille im Zimmer, dann fragte ich: »Warum ich? Warum wurde ich erwählt? Hat Meister … mich früher schon einmal genommen? Ich habe das Gefühl, dass es so sein könnte. Ich habe das Gefühl, dass er mich schon früher berührt hat.«
Die Schultern der ch’iri versteiften sich, doch schließlich flüsterte sie: »Ja, Miss. Er war der einzige Mann, der Sie hier in den ersten Wochen bedient hat, so lange die Droge für monebi Sie noch im Griff hatte. Seit Ihr Bedürfnis nach seinem Samen sich gelegt hat, wartet er begierig darauf, dass Sie vollends, mit klarem Kopf erwachen.« Kurz sah sie mir in die Augen und wandte dann rasch den Blick ab.
»Was?«, fragte ich voll Grauen. Die ch’iri sagte nichts weiter, also schüttelte ich ihren Arm und drängte: »Was ist? Sag es mir.«
»Sie haben seine Aufmerksamkeit erregt, Miss. Mehr als ich es je zuvor erlebt habe. Er besucht Sie jeden Tag und wartet darauf, dass Sie die Augen öffnen. Das ist … das ist nicht normal für ihn. Er ist Meister, er kann jede haben, die er wünscht, aber er ist ausschließlich auf Sie fixiert.«
»Tatsächlich?«, fragte ich und schluckte meine Angst hinunter.
»Ja, Miss. Er wird sehr froh sein, dass Sie wach sind. Er wurde langsam unruhig. Er hat sich nicht einmal eine andere mona genommen. Er will nur Sie.«
Ich spürte die Schmerzen in meinem Körper und sank in die Kissen zurück. Die ch’iri blieb neben mir und sammelte ihren Mut, um fortzufahren: »Miss, ich arbeite schon mein ganzes Leben für die monebi. Sie erinnern sich noch nicht, was Sie durchgemacht haben, doch es wird Ihnen wieder einfallen. Wenn es so weit ist, werden Sie dankbar sein, dass Sie in diesen neuen Stand erhoben wurden.« Sie senkte den Blick und seufzte dann. »Das Leben der monebi besteht aus Gewalt und Sklaverei. Wir alle sind Besitz des Meisters und werden von ihm beherrscht, aber obwohl ich eine der Niedrigsten unter den Niederen bin, würde sogar ich bereitwillig meinen Status als ch’iri gegen den einer mona eintauschen.« Sie schluckte, ihre Wangen röteten sich, und sie fuhr rasch fort: »Wenn Sie sich jedem Befehl von Meister unterwerfen und allem gehorchen, was er von Ihnen verlangt, werden Sie sehen, dass Sie es viel besser haben.«
Daraufhin ergriff die ch’iri die Gelegenheit, sich von meinem Bett zu entfernen und sich wieder ihren Aufgaben zu widmen. Ich sah zu, wie sie mit geübten Handgriffen frische Bettwäsche aufnahm und in eine Kommode legte. Dann ging sie zu der großen Badewanne und ließ Wasser einlaufen. Sie gab irgendeine Flüssigkeit in das Wasser, worauf wundervoller Wohlgeruch das Zimmer durchzog.
Ich schloss die Augen, als der Duft mich umhüllte. Als ich sie wieder öffnete, ging die ch’iri mit einem roten Kleid in den Händen zur anderen Seite des Zimmers. Sie legte es auf einen Tisch, kam dann zur Wanne zurück und drehte das Wasser ab.
Neben meinem Bett blieb sie stehen. »Miss, ich habe die Anweisung, Sie zu baden. Meister befahl mir, dass ich Sie, sobald Sie aufwachen, säubern, einkleiden und vorbereiten und ihn anschließend informieren soll.«
Wieder stieg Panik in mir auf, aber ich unterdrückte sie. Ich wusste, dass es keinen Ausweg gab. Etwas, eine unbekannte Stimme in meinem Kopf, sagte mir, dass ich gegen dieses Schicksal nicht ankämpfen konnte, was auch immer mir bevorstand. Mühsam setzte ich mich auf und nahm das Angebot der ch’iri an, mich zu stützen. Die ch’iri entkleidete mich und half mir, ins heiße Wasser zu gleiten.
Als die Wärme meinen Körper umhüllte, seufzte ich, meine Muskeln entspannten sich, und mein Schmerz löste sich mit dem aufsteigenden Dampf. Vor Müdigkeit fielen mir die Augen zu. Als ich sie schloss, tauchte das Bild einer dunkelhaarigen Frau vor meinem inneren Auge auf, die über mir schwebte. Es war verschwommen, aber ich konnte sehen, wie sie einem Mann befahl, mich zu nehmen, während ich mich vor Schmerzen auf dem Boden wand. In der Vision sah ich auch den narbigen Mann aus meiner früheren Erinnerung. Er kauerte gefesselt in der Ecke eines kleinen Raumes, und ein Metallkragen wurde um seinen kräftigen Hals geschnallt. Und er kämpfte, um sich zu befreien, während ich auf dem harten Boden lag und ein tiefer, unerträglicher Schmerz mich von innen zerriss. Er wurde gezwungen zuzusehen, wie ich geschändet wurde. Sein riesiger, muskelbepackter Körper strahlte Wut aus.
Der Narbenmann brüllte auf, als der Kerl, der mich nahm, sich in mich ergoss. Aber in dem Erguss des Mannes lag eine Linderung meiner Schmerzen. Er brachte mir einen kurzen Moment des Friedens. Ich erinnerte mich daran, dass ich die Augen schloss, und als ich es tat, befahl die Frau dem Narbenmann, jemanden zu töten. Sie versprach ihm, wenn er tötete, würde ich frei sein. Sogar in meinem drogenbenebelten Zustand war mir klar, dass in ihren Worten keine Wahrheit lag; und das Gesicht des Narbenmannes verriet mir, dass auch er es wusste. Trotzdem tat er wie befohlen. In seinen Zügen konnte ich sehen, dass er immer tun würde, was sie sagte … denn jedes nächste Mal konnte mir die Freiheit bringen.
Der Raum, in dem ich festgehalten worden war, war kalt und finster, aber der Mann tat alles, was von ihm verlangt wurde, ohne Fragen zu stellen. Dann löste sich die Vision langsam auf, und eine Flut von Schuldgefühl, Beschämung und Trauer überfiel mein Herz.
Ich schlug die Augen auf, als ich einen Stich in die Haut an meinem linken Arm fühlte, der mich aus meinen Erinnerungen riss. Die ch’iri war an meiner Seite und injizierte eine klare Flüssigkeit in meinen Arm. Aber ich wehrte mich nicht. Irgendwie wusste ich, dass ich mich nicht wehren durfte. Ich wusste, dass dies jeden Tag mit mir passierte.
Das war mein Leben.
2
152
Ich fühlte, wie die Flüssigkeit aus der Spritze langsam durch meine Adern lief, und mit ihr wurden meine Glieder leicht. Der Schmerz in den Muskeln verschwand, bis nur noch ein Gefühl berauschender Wärme übrig war. Meine Lider flatterten, als die Wärme weiter südwärts wanderte, zwischen meine Beine. Ein Wimmern drang aus meiner Kehle, als die Anspannung dort immer stärker wurde.
»Miss?«, fragte die ch’iri sanft. Ich öffnete langsam die Augen und fühlte, wie meine Wangen sich röteten. Sie stand neben mir und hielt mir ein weiches Handtuch hin. Ich stand in der Wanne auf, ließ mich von ihr in das Handtuch wickeln und fragte nicht nach dem Warum. Ich wusste, ich fragte nie nach dem Warum. Es gab keine Erklärung für irgendwas in meinem Leben.
Die ch’iri führte mich zu einem Stuhl. Vor mir stand ein großer mannshoher Spiegel, und ich starrte die Frau an, die mir aus dem Spiegel entgegenblickte. Blaue Augen, dunkles Haar, gerötete Wangen. Sie war schlank und ziemlich hochgewachsen. Ihre Haut hatte einen leichten Olivton.
Ich starrte weiter, ganz benommen vonder Wirkung der Droge, während die ch’iri mein bis zur Taille reichendes Haar ordnete und mein Gesicht mit Puder und Cremes zurechtmachte. Auf ihr Zeichen hin stand ich auf und ließ mich von ihr in ein langes rotes Seidenkleid hüllen. Es fiel bis auf den Boden und wurde von zwei Bändern zusammengehalten, die mit Silberspangen an den Schultern befestigt waren. Links und rechts hatte es einen hohen Beinschlitz, der die mit Duftöl eingeriebene schimmernde Haut darunter zeigte. Ich wiegte mich vor und zurück, während das Drängen zwischen meinen Beinen immer stärker wurde. Ich presste die Oberschenkel zusammen und suchte nach Erlösung, doch vergeblich.
Gerade, als ich überzeugt war, dass ich den sengenden Schmerz nicht länger aushalten konnte, ließ sich an der Tür hinter mir ein Geräusch vernehmen, und die ch’iri führte mich in die Mitte des Zimmers und bedeutete mir, dort stehen zu bleiben. Dann wich sie zurück und glitt in die Schatten, um sich unsichtbar zu machen. Selbst mit meinem benebelten Verstand registrierte ich, dass ihr Verhalten mich verwirrte. Sie wirkte verängstigt. Voller Angst vor der Person, die jeden Moment eintreten würde.
Dann kam ein Mann herein. Ein dominanter, geheimnisvoller Mann. Seine dunklen Augen fanden meinen Blick, und er blieb wie angewurzelt stehen. Er trug einen dunklen Anzug und eine grüne Krawatte. Sein dunkles Haar war nach hinten gekämmt, und dunkle Bartstoppeln bedeckten sein kräftiges kantiges Kinn. Ich registrierte, dass er einigermaßen gut aussah. Um einiges älter als ich, aber trotzdem gut aussehend.
Dann lächelte er.
Und ich erstarrte.
Bevor ich irgendetwas tun konnte, packte mich eine verheerende Woge von Verlangen, und ein kleiner Aufschrei drang über meine Lippen. Die dunklen Augen des Mannes flammten erregt auf, und er kam langsam und beherrscht näher.
Wie ein Raubtier.
Der starke, moschusartige Duft seiner Haut hüllte mich ein, als er vor mir stand. Ich wiegte mich vor und zurück, während mich eine weitere Woge aus Hitze überkam und meine Muskeln entflammte. Der Mann reagierte auf mein Wimmern, indem er die Hand an mein Gesicht hob. Er war größer und breiter als ich. Aber seine großen Hände waren glatt und sanft.
»Du bist noch schöner als eine griechische Göttin«, flüsterte er und fuhr mit der Hand über meine Wange. Druck baute sich zwischen meinen Beinen auf, und mein Körper sehnte sich danach, dass er seine Hand tiefer wandern ließ, um den Druck zu lindern. Ich keuchte, unfähig, die Augen offen zu halten, als mich ein weiterer Ansturm von Hitze überwältigte. Zwischen meinen Schenkeln sammelte sich Feuchtigkeit. Da ließ der Mann die Hand sinken und fasste mir zwischen die Beine. Ich riss die Augen auf, und mein Puls raste vor Verlangen.
Seine Nüstern weiteten sich, als er meine Reaktion wahrnahm; er beugte sich vor und rieb seine Nase an meiner. Seine Finger bewegten sich langsam, und ich seufzte begierig, dass er die Finger in mich hineinschob. »Wunderschön«, flüsterte er, als sein Mund mein Ohr streifte, während seine Finger über meine erhitzte Haut wanderten. »Du brauchst mich, nicht wahr, 152? Du brauchst deinen Meister, der dir den Druck nimmt? Der dafür sorgt, dass du dich besser fühlst? Dass deine Möse sich wieder beruhigt?«
Ich antwortete mit einem Stöhnen, aber ich hörte ihn. Ich vernahm jedes Wort. Der Mann war Meister Arziani. Das war der Mann, dem ich dienen sollte. Ich stöhnte wieder, als seine freie Hand etwas an der Schulter meines Kleides berührte und der Stoff zu Boden fiel und sich um meine Füße bauschte. Kühle Luft küsste meine nackte Haut.
Ein tiefes, hungriges Stöhnen drang aus seiner Kehle; in Sekundenschnelle lag sein begieriger Mund an meiner Brust. Als seine Zunge über eine Brustwarze glitt, schrie ich auf. Seine Hände zwischen meinen Beinen bewegten sich schneller und brachten mich an den Rand des Orgasmus. Doch als der Drang kurz davor war, gelindert zu werden, wich Meister zurück und befahl: »Leg dich auf das Bett. Auf den Rücken.« Seine Stimme war jetzt rau und streng. Ich tat wie befohlen, während Meister sich zügig seiner Kleidung entledigte. Seine Bauchmuskeln spielten, als er näher kam, seine kräftigen Beine waren von dunklen Haaren bedeckt.
Ich legte mich auf den Rücken und spreizte einladend die Beine. Ich brauchte ihn. Doch als Meister ans Bett trat, bedeckte er mich nicht mit seinem Körper, sondern ging auf die Knie und nahm mich mit dem Mund. Ein ekstatischer Schrei entfuhr meiner Kehle, als ich spürte, wie seine Zungenspitze über meine Knospe strich. Ich krallte die Hände in das Bettlaken, als eine Woge aus Lust über mir zusammenschlug. Doch der Druck in meinem Unterleib ließ nicht nach, sondern wurde noch stärker. Er steigerte sich immer weiter, bis mein Körper vor Verlangen brannte, hart genommen und mit dem Samen des Meisters gefüllt zu werden.
Ein Schweißfilm bedeckte meine Haut, und Meister löste seinen Mund von mir und schob sich langsam hoch, bis er über mir war. Ich bog den Rücken durch und wollte mehr: seine Berührung, seine Wärme, seine Hände. Unsere Blicke trafen sich, und er leckte sich über die Lippen und umfasste mit einer Hand meine Brust.
Ich bewegte die Hüften, als Meister sich zwischen meine Beine schob und ich seinen harten Schaft spürte. Ich wollte mich ihm entgegendrängen, doch Meister hob meine Handgelenke über meinen Kopf. Sein Griff war zu fest, um dagegen anzukämpfen; ich warf mich in dem verzweifelten Verlangen nach Erleichterung hin und her.
Meisters Gesicht näherte sich meinem, und er übersäte meine Wange mit Küssen. Dann wich er ein wenig zurück und sagte: »Ich wusste, dass es so mit dir sein würde. Du wurdest dafür geboren, eine Hohe Mona zu sein. Dein unübertroffenes Aussehen, dieser Körper … dieses unersättliche Verlangen, dass ich dich nehme. Dein Meister.« Seine Pupillen weiteten sich, und ich biss mir auf die Lippe, als ich spürte, wie seine Eichel sich in mich schob.
Als er in mich eindrang, wurde sein Griff um meine Handgelenke immer stärker, bis ein Anflug von Schmerz durch meinen Körper jagte, der die Lust auslöschte. Doch als ich aufschrie, drang er mit einem abrupten Stoß tiefer in mich vor, dass ich erneut aufschrie. Zu viele widerstreitende Reize durchfluteten mich, als er mich nahm und mich mit jedem Stoß näher an den Abgrund trieb.
Meister stöhnte, und ich war sein Echo, während sein Brustkorb über meine Brüste streifte. Sein warmer Atem strich über mein Gesicht. Sein Mund näherte sich meinem Ohr, und er grollte: »Ich besitze dich, mona. Jeder Teil von dir ist mein Eigentum. Du gehörst mir.«
Ich schrie auf, als sein Griff um meine Handgelenke wieder fester wurde und brutaler Schmerz die Lust verjagte. »Hörst du mich?«, fragte er und hielt unvermittelt inne. Sein gut aussehendes Gesicht war streng und unnachgiebig, als er auf mich herabstarrte.
Ich stöhnte protestierend und wollte die Hüften bewegen, um wieder zu fühlen, wie er sich in mir bewegte. Doch er rührte sich nicht, und seine Augen blickten hart und rasend vor Verlangen, meine Antwort zu hören.
»Ja«, antwortete ich atemlos. Ich schrie, als er meine Handgelenke so fest packte, dass ich fürchtete, er würde mir die Knochen brechen. »Meister«, zischte er, »zeig verdammt noch mal Respekt, mona.«
»Ja, Meister«, verbesserte ich mich hastig und hielt gleich darauf den Atem an. Meisters Züge entspannten sich, seine Wut verschwand, und sein Griff um meine Handgelenke lockerte sich. »Schon besser«, lobte er und ließ ein Handgelenk los, um seine Hand an meine Wange zu legen.
Mit einem Griff an mein Kinn sorgte er dafür, dass ich ihm in die Augen sah, dann ermahnte er mich: »Ich werde keinerlei Ungehorsam dulden, mona. Du gehörst mir, und als mein Eigentum werde ich dich behandeln wie eine Königin.« Sein Mund glitt an mein Ohr, und er flüsterte: »Aber widersetze dich mir in irgendeiner Weise, und ich sorge dafür, dass du den Tag bereust, an dem du geboren wurdest.«
Er hob die Hände und küsste mich sanft und behutsam auf die Lippen – ein krasser Kontrast zu den drohenden Worten aus seinem Mund. Dann packte er mich an den Haaren, riss meinen Kopf nach hinten und forderte: »Hast du mich verstanden, mona? Sag mir, dass du jedes Wort verstanden hast.«
Weiß glühender Schmerz jagte durch meine Kopfhaut, und das unerträgliche Gefühl lag im Widerstreit mit dem Verlangen zwischen meinen Beinen. »Ja, Meister«, würgte ich hervor, und Tränen liefen mir aus den Augenwinkeln.
Meister ließ mein Haar los und ein vernichtend schönes Lächeln zeigte sich auf seinen vollen Lippen. »Gut«, verkündete er stolz und massierte mir nun mit den Fingern die Kopfhaut, die er eben noch so malträtiert hatte. Dann erstarb sein Lächeln, als sein harter Schaft in mir zuckte und pulsierte. Ich wartete darauf, was als Nächstes kam, unsicher, ob es Lust oder Schmerz sein würde. Dann drehte er mich, noch immer in mir, unvermittelt herum, sodass ich rittlings auf seinen Hüften saß.
Seine Hände strichen über meine Oberschenkel und packten schließlich meine Hüften, während meine Handflächen flach auf seiner breiten, muskulösen Brust lagen. »Fick mich«, befahl er, und seine dunklen Augen loderten vor Erregung. Seine Hände gruben sich so fest in meine Hüften, dass ich davon bestimmt einen Bluterguss bekommen würde. »Nimm mich, bis ich komme.«
Und ich tat es. Ich brauchte seine Erlösung, und so ließ ich mich von seinen groben Händen leiten, bis ich die Augen schloss, den Kopf in den Nacken warf und die Verzückung umarmte. Als mein Körper sich streckte, stieß ich ein langes, lautes Stöhnen aus, grub die Nägel in Meisters Haut, während er sich unter mir versteifte und seine Lust hinausbrüllte. Sein Samen füllte mich und linderte die Hitze in meinem Unterleib. Meine Haut prickelte, und ich bewegte mich auf seinen Hüften langsam weiter vor und zurück, während sein Schwanz in mir zuckte.
Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, doch als mein Atem wieder ruhig ging, senkte ich den Kopf und schlug flatternd die Augenlider auf. Mein Blick traf auf dunkle, zufriedene Augen, die jede Bewegung von mir verfolgten; ein Raubtier, ein wahrer Meister der Grube.
Ein Gefühl von Kälte kroch mir über den Rücken und breitete sich in meinem Körper aus, als ich wie gelähmt unter seinem Blick verharrte. Als das unstillbare Verlangen abklang, traf mich die Realität des Augenblicks wie ein Schlag. Das war Meister. Der Mann, der über alle Schicksale in der Grube herrschte. Der darüber entschied, ob wir lebten oder starben.
Und ich war auserwählt worden, ihm Lust zu bereiten.
Echte, wahre Angst erfüllte mein Herz.
»Mein zartes, hübsches Blütenblatt«, säuselte Meister mit tiefer Stimme. Seine Fingerspitzen strichen von meinen Hüften über meinen Bauch, bis sie zwischen meinen Beinen lagen. Er fuhr mit dem Finger durch meine feuchte Spalte. Als er dabei die Hüften hob, kam ein weiteres Stöhnen über meine Lippen.
»Gefällt dir das, Blütenblatt?«, fragte er. Ich holte tief Luft, doch bevor ich antworten konnte, stieß er hervor: »Antworte mir!«
Ich zuckte zusammen, als ich die Aggression in seiner Stimme hörte. »Ja, Meister«, antwortete ich schnell. »Es gefällt mir, Meister.«
Meine Worte waren Balsam für ihn, und er lehnte sich entspannt zurück aufs Bett. Ich blickte nach unten auf meine Hände an seiner Brust und ich wurde blass, als ich die Male meiner Nägel auf seiner Haut sah, unter denen sich Blut sammelte. Ich zog hastig die Hände weg und sah voller Angst zu, wie Meister auf das Blut herabblickte. Mein Herz hämmerte vor Entsetzen, was er als Nächstes tun würde. Doch zu meiner Überraschung erschien ein zufriedenes Lächeln auf seinen Lippen, und seine Augen wurden dunkel vor Begierde.
Ich schluckte meine Beklommenheit hinunter, als Meister mit der Hand über die kleinen Blutflecken rieb. Dann hob er, zu meiner Überraschung, den Finger an seine Lippen und leckte das Blut von der Fingerspitze. Er senkte den Finger wieder und sagte: »Ich wusste, du wurdest geboren, um mir zu gehören.« Seine Hände griffen nach meinen Hüften und fuhren über meine Haut, bis sie meine Brüste umfassten. Meine Nasenflügel weiteten sich, als seine Berührung mein Begehren erneut aufflammen ließ und meine Hüften sich wieder vor und zurück bewegten. »Als ich dich beobachtete, während du bei meinem Miststück von Schwester warst, wusste ich, dass du die bist, auf die ich gewartet habe. Dass die anderen Hohen Monas dir nicht das Wasser reichen können.«
Meisters Schwanz in mir wurde wieder hart, und er stieß sachte die Hüften vorwärts und steigerte meine Lust. Ich stöhnte, und Meisters Stöhnen antwortete mir.
Auf der Suche nach Erlösung ließ ich die Hüften schneller kreisen. Meisters Hände packten meine Brüste fester, und ich schrie auf, als sein Griff schmerzhaft wurde. »So ist es gut, Blütenblatt«, flüsterte er, »nimm mich hart, während du diesen Schmerz spürst.« Lust überwand den Schmerz, den er mir zufügte, das Ziehen in meinem Unterleib wurde stärker, und ein Prickeln lief mir über die Haut, als ich der am Horizont auftauchenden Lust nachjagte.
Meister stöhnte und begann kraftvoll in mich zu stoßen. Und es dauerte nicht lange, bis ich über den Abgrund stürzte und im Licht zerbarst. Ich sank vornüber auf Meisters Brust, und er stieß noch dreimal zu, verströmte seinen Samen in mich und löschte damit das brennende Verlangen, das die neue Droge entfacht hatte. Meister schlang die Arme um mich, doch ich konnte erkennen, dass er es nicht aus Zuneigung, sondern aus Besitzgier tat. Sein Griff war unnachgiebig, seine Arme ein Käfig aus Fleisch und Blut. Er hielt mich an sich gedrückt, und ich kniff fest die Augen zu, während die Angst immer noch unter meiner Haut prickelte. Nun, da die Wirkung der Droge abgeflaut, ihr falsches Begehren gestillt war, hatte ich keine Ahnung, was ich als Nächstes tun sollte.
Meine Erinnerungen schwiegen, doch ich war mir sicher, dass ich noch nie mit einem Mann zusammen gewesen war, ohne unter Drogen zu stehen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte.
Meisters Fingerspitzen malten träge Kreise auf meinen Rücken. Ich atmete langsam und versuchte einen Aufschrei zu unterdrücken. »Weißt du, warum ich dich Blütenblatt nenne, 152?«, fragte er leise, und eine sanftere, zärtlichere Seite seiner Persönlichkeit kam zum Vorschein.
»Nein, Meister«, antwortete ich zaghaft.
Meisters Hand wanderte in mein Haar, seine Finger kämmten durch die dunklen Strähnen. Seine Hand verharrte. Er wandte sich meinem Gesicht zu, um zu antworten: »Weil du, wie ein Blütenblatt, ganz leicht zerstört werden kannst. Aber solange du unversehrt bleibst, bist du wunderschön anzusehen.«
Obwohl zärtlich ausgesprochen, hing das Gewicht seiner Worte wie ein Dolch über meinem Kopf. Meister streichelte weiter mein Haar, als hätte er nicht gerade eine Drohung ausgesprochen, und mir wurde klar: seine Worte waren Drohung und Versprechen zugleich.
»Ja, Meister«, antwortete ich schwach. Meister seufzte zufrieden zur Antwort.
Er drehte das Gesicht zu mir und begann meine Wange mit Küssen zu bedecken. »Du riechst und schmeckst so gut, Blütenblatt«, murmelte er.
Ich schloss die Augen und ließ ihn gewähren. Doch während ich in seinen Armen lag, wurde mir klar, dass ich seine Berührung nicht mochte. Der Mann sah gut aus, doch unter der Oberfläche lauerte ein grausames Monster. Wenn ich das Blatt einer Blüte war, dann war er der Dorn.
»Komm«, sagte Meister schließlich, nachdem seine Hände minutenlang über meinen Körper gewandert waren. Als sein nun schlaffes Glied aus mir hinausglitt, rollte ich mich zur Seite, damit er sich erheben konnte. Als er vom Bett aufstand, zeigte er auf etwas in der dunklen Seite des Zimmers. Darauf öffnete sich eine Tür, und die ch’iri von zuvor kam herein. Ein Wärter hatte sie hereingeführt. Ich begriff sofort, dass dieser Wärter dabei zugesehen hatte, wie Meister mich vögelte.
Die Nachtphantome, meldete ein schwaches Echo in meinem Kopf. Der Gedanke entfloh wieder, als jemand mich am Ellbogen packte und zu einem abgeteilten Raum geleitete. Als ich den Blick senkte, sah ich den Nacken der Person. Das Tattoo sagte 000: die ch’iri.
»Kommen Sie, Miss«, drängte sie und zog mich in einen Raum, der offenbar ein üppig vergoldetes Badezimmer war. Eine Toilette, ein Waschbecken und eine frei stehende Badewanne an einer Seite des riesigen Raumes, und auf der anderen Seite ein vornehmer Sitzbereich.
Die ch’iri führte mich zur Badewanne, befeuchtete ein Tuch und begann mich zwischen den Beinen und an den Oberschenkeln von Meisters Samen zu reinigen. Ich starrte benommen auf die Steinwand vor mir und kämpfte gegen den Nebel an, der immer noch in meinem Kopf herrschte.
Nachdem die ch’iri meine Oberschenkel mit einem weichen Handtuch getrocknet hatte, führte sie mich zur Sitzecke und bedeutete mir, Platz zu nehmen. Dann öffnete sie zügig eine große Doppeltür. Ich blickte auf und sah reihenweise wunderschöne Kleider in lebhaften Farben.
Die ch’iri nahm ein neues heraus, und ich stand auf und ließ mich ankleiden. Ich blickte auf dieses Kleid und sah, dass es von einem tiefen Grün war. Müßig dachte ich mir, dass die Farbe wunderschön war. Dann runzelte ich die Stirn und fragte mich, ob ich je zuvor die Farbe von etwas bemerkt hatte. Im Moment zeigten sich die Bilder in meinem Kopf nur in Graustufen. Als ich mich im Zimmer umsah, wurde mir klar, dass das Leben hier in Farbe stattfand, dennoch besaß es weder die Form noch die Schönheit lebhafter Farben.
Die ch’iri trat zwei Schritte zurück und nickte. »Sie sehen wunderschön aus, Miss. Meister wird erfreut sein.«
Ich starrte sie an. Sie hielt den Kopf gesenkt. Ich sah Röte in ihrem Nacken, die ihr langsam ins Gesicht stieg. Ich trat einen Schritt auf sie zu und legte ihr die Hand auf die Schulter. Sie versteifte sich. »Du musst den Kopf nicht vor mir senken, ch’iri.«
Doch sie hob ihn nicht. Stattdessen antwortete sie: »Ich bin eine ch’iri, Miss. Wir stehen unter allen anderen. Meister befiehlt es so.« Sie hielt kurz inne und fuhr dann fort: »Und Sie sind die Hohe Mona, Miss. Sie sind von gehobenem Stand. Was auch immer vorher war. Sobald Meister es befiehlt, gibt es kein Zurück mehr.«
Meine Hand sank von ihrer Schulter, und sofort huschte die ch’iri hinaus und wartete, dass ich ihr folgte. Ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte, also ging ich ihr nach. Wir betraten das Zimmer, in dem Meister wartete. Sobald er mich sah, flammten seine Augen auf, und seine Lippen wurden schmal, als ringe er um Atem.
Einmal mehr war er tadellos gekleidet und makellos gepflegt. Meister streckte die Hand aus. Ich zwang meine Füße zu laufen, ging zu ihm und legte meine Hand in seine. Er hob sie an den Mund, hauchte einen Kuss auf den Handrücken, zog mich neben sich und hakte seinen Arm in meinen.
Dann drehte er sich mit mir zu der einzigen anderen Tür im Zimmer um, hielt inne, sah mich an und erklärte: »Du siehst wunderschön aus, 152. Wie eine Erscheinung.«
Ich neigte den Kopf und antwortete: »Danke, Meister.«
Er beugte sich nah zu mir, strich eine Haarsträhne aus meinem Nacken, drückte einen Kuss auf meinen Puls dort und fuhr fort: »Und du lernst schnell. Hoffen wir, dass du weiter so gehorsam bleibst. Meine Hohen Monebi haben die Angewohnheit, mein Vertrauen zu missbrauchen und daraufhin ihr Leben zu verlieren.« Er fuhr mit seiner rauen Wange über meine und sagte: »Es würde mir gar nicht gefallen, wenn du mich in Zugzwang bringst. Ich würde solche Schönheit nur äußerst ungern fallen sehen.«
»Ja, Meister«, flüsterte ich, meine Hände zitterten.
Meister richtete sich auf und lächelte breit. »Das höre ich gern.« Er hielt meinen untergehakten Arm fest und ging mit mir durch die Tür, vorbei an einem Wärter in pechschwarzer Uniform. Ich warf einen Blick zurück auf den Wärter und sah, wie seine harten Augen uns nachstarrten.
Eiskalte Schauer rannen mir über den Rücken, als mir ein Bild von zwei Kindern durch den Kopf schoss – ein älterer Junge und ein kleines Mädchen, die sich unter einem Bett versteckten. Dem folgte ein tiefes Gefühl von Kummer. Ich strengte meinen Kopf an und mühte mich krampfhaft, die Erinnerung festzuhalten, während Meister mit mir durch einen feuchtkalten dunklen Flur und eine Treppe hinunterging.
Wärter standen in Abständen an den Wänden. Als wir vorbeikamen, nahmen sie Haltung an und salutierten. Er beachtete ihre Demonstration von Loyalität und Respekt nicht. Er hielt nur den Kopf hoch erhoben und konzentrierte sich auf den Weg vor ihm.
Als das schwache Geräusch von klirrendem Metall und Geschrei immer lauter wurde, je weiter wir kamen, fragte ich mich, wohin wir eigentlich unterwegs waren. Ich musste nicht lange rätseln, denn als wir um eine Ecke bogen, enthüllte die Mündung des Flurs die Antwort auf meine Frage.
Ich starrte mit offenem Mund auf die riesige Fläche vor mir. So weit, dass es mir schwerfiel zu deuten, was ich sah.
Meister trat vor und streckte seine freie Hand aus. »Die Blutgrube«, verkündete er mit Stolz und Arroganz im Tonfall.
Die Blutgrube … Meine Augen mühten sich, die vielen über Hunderte kleiner Sandgruben verteilten Männer zu erfassen. Und sie kämpften. Waffen unterschiedlicher Art waren im Einsatz. Männer in allen Gestalten und Größen. Muskeln über Muskeln, als sie einander umkreisten, kämpften und Blut vergossen. Alle waren gleich gekleidet: nackter Oberkörper, nackte Füße, eine schwarze Hose.
An den Wänden der Gruben standen Wärter. Die meisten hatten Metallstäbe in den Händen, aus deren Spitzen Funken sprühten, die wie blaues Feuer aussahen. Wenn ein Mann aus dem Ring trat oder zu kämpfen aufhörte, bekam er einen Schlag mit dem Stab. Die meisten fielen mit offensichtlichen Schmerzen zu Boden, als würde kochend heißes Blei sie innerlich verbrennen.
Plötzlich kam mir wieder das Bild des Narbenmannes in den Sinn, der meine Gedanken heimsuchte, seit ich aufgewacht war. Ich konnte ihn sehen, klar und deutlich, wie er als Junge vor mir stand, ein großes Tattoo auf der Brust, und gezwungen wurde, zu kämpfen, während ich gezwungen war, zuzusehen. So wie jetzt.
Und er tat es. Er kämpfte gegen jeden, wie befohlen, und griff nach mir, als all seine Gegner besiegt waren. Doch wie es seitdem jeden Tag geschehen war, wurde ich weggebracht. Und dann …
Ich wusste es nicht.
Als meine Sicht wieder klar wurde, flüsterte ich: »Ich habe das schon einmal gesehen. Ich war schon einmal hier.«
Meister versteifte sich neben mir. »Was?«
Mein Herz raste vor Furcht. Ich hätte nicht ungefragt sprechen dürfen. Ich schluckte meine Nervosität hinunter und wiederholte: »Ich sagte, ich glaube, ich war schon einmal hier.« Ich runzelte die Stirn und versuchte mich an Meisters schmale dunkle Augen zu erinnern. Dann straffte ich die Schultern und fuhr fort: »Aber ich erinnere mich nicht daran, wie, warum oder wann. Sicher irre ich mich?«
Meister rührte sich einige Sekunden lang nicht, noch änderte sich sein Gesichtsausdruck. Schließlich stellte er sich vor mich und blockierte den Blick auf die kämpfenden Männer. Er hob die Hände an meine Wangen und lächelte. »Du bist hier aufgewachsen, 152. Als Kind und als Teenager hast du viele Tage hier verbracht, du warst eine unserer Spitzen-monebi.« Plötzlich wurde seine Miene eisig, als er seinem Zorn freien Lauf ließ. »Hätte ich dich vorher gekannt, wärst du schon in jungem Alter bei mir gewesen. Doch meine Schwester fand dich zuerst. Und nun bist du zu Hause …«