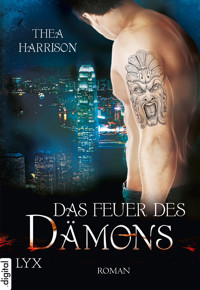9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Rising-Darkness-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ihr ganzes Leben lang leidet die Ärztin Mary schon unter merkwürdigen Träumen, bis sie eines Tages die Wahrheit erfährt: Sie ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern gehört zu einer Gruppe unsterblicher Wesen, die im Laufe der Jahrhunderte ständig wiedergeboren werden. Da begegnet ihr Michael, der schon seit einer Ewigkeit nach ihr sucht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Thea Harrison bei LYX
Impressum
THEA HARRISON
Rising Darkness
Schattenrätsel
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Richard Betzenbichler
und Katrin Mrugalla
Zu diesem Buch
Ihr ganzes Leben lang leidet die Ärztin Mary schon unter merkwürdigen Träumen, die sie zunehmend verstören. Als sie eines Tages Stimmen im Wind zu hören glaubt und eine Vision hat, ist sie überzeugt, endgültig den Verstand zu verlieren. Doch es kommt noch schlimmer. Unbekannte versuchen sie zu entführen, und nur mit Hilfe seltsamer Naturkräfte kann sie ihren Häschern entkommen. Die mysteriösen Ereignisse wecken zunehmend Erinnerungen in ihr, die aus dem Leben einer anderen zu stammen scheinen. Kurz darauf trifft sie den Krieger Michael, der etwas tief in ihr erschüttert. Er offenbart ihr, dass sie einst seine Seelengefährtin war und dass sie beide zu einer Gruppe von Unsterblichen gehören, die seit Äonen immer wiedergeboren werden. Vor vielen tausend Jahren folgten sie einem grausamen Feind in diese Welt, indem sie ihre sterblichen Hüllen zurückließen. Doch nun ist ihr Gegner stärker als je zuvor, und außer Mary und Michael ist nur noch eine weitere der ursprünglichen Sieben am Leben. Es liegt nun an ihnen, die Erde vor der finsteren Macht zu bewahren, die ihre Saat des Bösen bereits über Tausende von Jahren auf der Welt verbreiten konnte.
1
Das Entsetzen war scharlachrot. Es hatte den kupferartigen Geschmack arteriellen Bluts.
Der Täter ist entkommen und hat unsere Welt verlassen.
Sie stand neben ihrem Partner in einem Kreis aus sieben Wesen. Ihre geballten Energien blitzten wie eine Supernova. Angst verdunkelte die Farben der Gruppe. Der Kummer und die Wut ihrer Anführerin bildeten einen Fleck aus Grau und Schwarz.
Die Verwandlung, die in ihrem Partner vor sich ging, glich der eines Kämpfers, der aus dem Schlaf erwacht. Sie spürte, wie ihre Energie auf seine reagierte und in Schwingung geriet wie Kristall unter Druck.
Wir müssen eine Möglichkeit finden ihn aufzuhalten, oder er wird unvorstellbares Unheil anrichten.
Alle sieben verschrieben sie sich ihrer Aufgabe und verabschiedeten sich von ihrem Zuhause. Sie würden nie mehr zurückkehren können. Aus Energie und magischem Feuer bereitete ihre Anführerin einen Trank, von dem sie trinken mussten, um sich zu verwandeln und in eine fremde Welt zu reisen.
Ihr Partner stellte sich seinen letzten Momenten voller Kraft und Mut. Als er seine schönen Augen schloss, versprach er: Wir sehen uns bald wieder.
Sie hatten so perfekt zusammengepasst. Sie waren im selben Moment geboren worden und waren gemeinsam durch das Leben gereist, Gegensatz und Ergänzung, zwei ineinandergreifende Teile, die sich gegenseitig Halt gaben und ausglichen.
Doch egal wie verbunden sie im Leben waren, diese mitternächtliche Brücke mussten sie jeder für sich überqueren. Ihre Energie strahlte in blutroten Wellen von ihr ab, während sie dem Ende des einzigen Lebens, das sie kannte, ins Auge sah.
Sie versuchte ihm zu antworten, aber das Gift hatte sie bereits von ihrem physischen Körper getrennt. Sie schickte ihm einen letzten funkelnden Strahl aus Liebe und Zuversicht, dann brach die Dunkelheit über sie herein.
Sie war vor so langer Zeit gestorben.
Vor Tausenden von Jahren.
Moment mal. Was war das?
Nein.
Mary streckte den Arm aus und krachte mit den Fingerknöcheln gegen etwas Hartes. Schmerz schoss ihren Arm hinauf.
Sie setzte sich ruckartig auf und wiegte sich vor und zurück. Farbige Fetzen flatterten um sie herum wie Scherben eines Buntglasfensters. Nach einem Moment der Verwirrung begriff sie, wo sie sich befand. Sie hatte quer über ihrem Bett gelegen, in einem chaotischen Nest aus Bettdecke, Kissen, einem Stapel Kleider und irgendwelchen sonstigen Sachen.
Ihr Herz brach in einen Trommelwirbel aus, verlangsamte sich dann aber wieder zu einem normaleren Tempo. Ihr Kopf dagegen wollte sich nicht beruhigen. Er dröhnte in einem schmerzhaften Takt.
Der Wecker neben ihrem Bett zeigte 6 Uhr 30. Himmel noch mal! Sie war erst vor fünf Stunden nach Hause gekommen. Ihre Schicht in der Notaufnahme hatte sechsundzwanzig Stunden gedauert. Unter den eingelieferten Patienten waren die Opfer eines Verkehrsunfalls gewesen, in den fünf Wagen verwickelt waren, sowie zwei Opfer mit Schusswunden. Eins davon, eine siebzehnjährige alleinerziehende Mutter, war gestorben.
Sie dachte an ihren Traum und an den Täter, den die Wesen verfolgt hatten. Schweiß brach ihr aus, und Entsetzen, gepaart mit dem Gefühl unendlichen Verlusts, überrollte ihren Körper mit der Heftigkeit einer klimakterischen Hitzewelle.
Manche Leute spielten in ihrer Freizeit Golf, andere wanderten oder gingen zu Aerobic-Kursen. Sie dagegen träumte von glitzernden, in den Farben des Regenbogens pulsierenden Wesen, die in einer Art bizarrem Selbstmordakt vergiftetes Kool-Aid tranken. War das besser oder schlimmer, als von Opfern mit Schusswunden zu träumen?
Mühsam sog sie Luft in ihre verengten Lungen. Vielleicht war es im Moment besser, wenn diese Frage unbeantwortet blieb.
Irgendetwas klebte an ihrem Gesicht fest. Sie strich sich mit den Fingern über die Wange, pulte ein Stück Stoff von der Haut und starrte es an. Der Stoff hatte ein blaugrünes Paisley-Muster.
Verschwommen tauchte eine Erinnerung in ihrem Kopf auf, wie ein Farbfleck auf einer ölverschmierten Pfütze am Straßenrand.
Sie hatte den Stoff vor ein paar Tagen in der Restetruhe des Stoffladens gefunden und ihn mitgenommen, um ihn in ihren nächsten Quilt einzuarbeiten. Als sie völlig überdreht von ihrer überlangen Schicht nach Hause gekommen war, hatte sie ihre überschüssige Energie im Haushalt ausgetobt und war mitten im Zusammenlegen der Wäsche eingeschlafen.
Der Adrenalinschub hatte alle ihre Hoffnungen zunichtegemacht, noch einmal einschlafen zu können. Mühsam erhob sie sich aus dem zerwühlten Bett und griff nach ihrem T-Shirt und den Shorts. Sie versuchte, sich mit den Fingern das Haar zu kämmen, das so elektrisch aufgeladen war, dass es knisterte. In den verfilzten Locken gerieten die Finger in lauter Sackgassen und Einbahnstraßen. Ihre schulterlangen rotbraunen Strähnen zeugten von ihrer gemischtrassigen Herkunft. Sie waren so dick und kraus, dass sie sich nur dank eines Stufenschnitts halbwegs frisieren ließen.
Im Moment schien ihr Haar mehr Energie zu haben als sie selbst. Sie gab den Versuch auf, das Durcheinander zu entwirren. Ungebändigt fiel es ihr wie eine Löwenmähne auf die Schultern herab.
Sie nahm Haustürschlüssel und Sonnenbrille vom Tisch im Flur, zog ihre Tennisschuhe an und schnappte sich ihr Kapuzenshirt. Keine Minute später war sie draußen, im warmen Frühlingsmorgen. Die Sonne blendete sie, und rasch setzte sie die Sonnenbrille auf.
Sie wohnte in einem Elfenbeinturm in einer Gegend, die sie für sich die Hexenstraße nannte. Der Elfenbeinturm war ein gedrungenes, windschiefes Gebäude inmitten eines Viertels aus Holzhäusern, die überwiegend von Arbeitern bewohnt wurden, unten am St. Joseph River im Südosten Michigans. Es war ein etwas schäbiges Wohnhaus am Flussufer, das vor fast einem Jahrhundert gebaut und noch nie modernisiert worden war. Das Wohnzimmer und die Schlafräume befanden sich im ersten Stock über der Garage, um vor den regelmäßigen Wasserhochständen des Flusses geschützt zu sein. Angemietet hatte sie es nach ihrer Scheidung vor fünf Jahren.
Der Elfenbeinturm war im Laufe der Zeit immer mehr heruntergekommen, an einer Seite des Gebäudes hatte sich sogar die Aluminiumverkleidung gelöst. Die Betontreppe, die zur Haustür führte, war schmal und uneben und verwandelte sich im Winter in eine gefährliche Rutschbahn. Einmal war sie von der Arbeit nach Hause gekommen, nachdem ein heftiger Regen in Eisregen übergegangen war. Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als die Stufen auf allen vieren hochzuklettern.
Die Wohnung selbst dagegen war warm und kuschelig: Wandverkleidung aus altem Kiefernholz, ein zerkratzter, aber dennoch wunderschöner Parkettboden und ein gemauerter Kachelofen. Als sie die Wohnung zum ersten Mal betreten hatte, schien etwas über sie hinwegzugleiten wie eine unsichtbare Umarmung. Sie stellte sich gern vor, dass es der Geist dieser Wohnung war, der sie willkommen geheißen hatte. Trotz des Zustands und trotz manchem, was dagegen sprach, hatte sie sofort gewusst, dass sie hier leben würde.
Bei all seiner Armseligkeit wohnte dem Elfenbeinturm eine bodenständige und doch starke Magie inne. Beim Blick aus dem Panoramafenster im Obergeschoss sah man weder unten die Straße, eine Sackgasse, noch die Nachbarhäuser. Stattdessen konnte sie sich in der Illusion wiegen, in einer Hütte im Wald zu sein, weit weg von allen anderen. Stundenlang konnte sie aus dem Fenster auf die Nadelbäume, Eichen und Platanen schauen, bei Schneestürmen durcheinanderwirbelnde weiße Flocken bestaunen oder die mit der Tageszeit mitwandernden Schatten der Bäume verfolgen.
Die eigentliche Hexenstraße lag ganz in der Nähe, im selben Viertel, und war Teil einer Strecke, die sie für ihren täglichen Zwei-Meilen-Lauf auserkoren hatte. Die Strecke führte am nahe gelegenen Fluss vorbei und faszinierte sie im Wechsel der Jahreszeiten immer wieder aufs Neue.
Kleine Häuser verschwanden beinahe unter hohen, dichten Laubbäumen, deren Gerippe der jährliche Tod freigelegt hatte: Bäume mit klaren schlanken Konturen bis hin zu solchen von eher arthritischer Schönheit, mit knotigen Gelenken und verrenkten Gliedern, die in unglaubliche Richtungen abstanden und in Tausenden von spinnenartigen, nach Luft greifenden Fingern endeten.
Das Unterholz war ein undurchdringliches Dickicht. Kräftige Ranken und herabgefallene Äste wirkten entmutigend auf mögliche Eindringlinge. Die Bäume trafen sich in den Kronen, um an den mal mehr, mal weniger windigen Tagen miteinander zu rascheln und zu flüstern. Im Sommer überdachten sie die schmale Asphaltstraße wie ein Baldachin aus Laub.
Heute war sie zu müde für ihren üblichen Lauf. Stattdessen ging sie die Strecke.
Mit dem warmen Wetter kehrte auch der Baldachin aus Laub rasch zurück. Jenseits des am Rand bereits grünen Spaliers der Äste reisten flauschige Kumuluswolken mit solcher Windeseile dahin, als würden sie vor einer unsichtbaren Bedrohung fliehen. Die Bäume knarrten und raschelten. Blätter und Zweige, die Überbleibsel vom Tod des Waldes im vergangenen Herbst und Winter, tanzten um sie herum und folgten ihr die Straße hinunter.
Die wirbelnden Blätter flüsterten leise miteinander.
Sie ist nicht die Richtige, Dummerchen.
Doch, das ist sie! Sie riecht nach Blut. Hierfür wird er uns reichlich belohnen.
Mary blieb stehen und drehte sich um. Was ihr Gehirn sich alles ausdachte!
Sie bildete sich das doch nur ein, oder etwa nicht?
Abgesehen vom Murmeln der Bäume und von einer Autotür, die irgendwo in der Ferne zugeschlagen wurde, war es ein stiller Tag, und nur der Wind wirbelte Zweige und Blätter wild durcheinander. Ein Schatten legte sich über die tanzende tote Pracht und hüllte sie in Dunkelheit.
Wie konnte ein Baum solch einen Schatten werfen, wenn die Sonne noch nicht sonderlich hoch am Himmel stand? Sie sah nach oben. Vielleicht war es eine Wolke, die den Schatten warf.
Am Rand ihres Bewusstseins nahm sie etwas Böses wahr, und die kleinen Härchen in ihrem Nacken stellten sich auf. Vielleicht war die Dunkelheit etwas anderes, etwas, das nichts Gutes im Schilde führte.
Sie schüttelte den Kopf über ihre überbordende Fantasie, drehte sich um und setzte ihren Weg fort.
Du hast es gesehen! Sie hat uns angeschaut! Bedeutet das etwa, dass sie uns gehört hat?
Normale Leute hören uns nicht. Wir müssen es weitersagen!
Abrupt blieb sie stehen. Schweiß brach ihr aus.
Das habe ich mir nicht eingebildet.
Ich höre Stimmen.
Wirklich und wahrhaftig – Stimmen!
Ein Schauder durchlief sie von Kopf bis Fuß. Wieder drehte sie sich um und betrachtete ihre Umgebung. Es war niemand in der Nähe. Ein Stück die Straße hinunter stürzten zwei Kinder aus einer Haustür, die Ranzen um die schmalen Schultern geschlungen.
Ein paar Meter entfernt wirbelten Zweige und Kiefernnadeln in einem dunklen, heidnischen Tanz.
Alles andere war zur Ruhe gekommen. Kein Wind blies, keine Brise strich ihr über das Gesicht. Sogar die Bäume über ihr verharrten in wartendem Schweigen.
Da war nichts in der Nähe, was diese falsche, unmögliche Luftturbulenz hätte auslösen können.
Sie merkte, dass sie die Zähne zusammenbiss. Sie trat mit dem Fuß nach den tanzenden Zweigen und Blättern und zischte: »Hört auf!«
Die leisen Stimmen fingen an, alle durcheinanderzureden.
Ja, sie hat uns gehört. Tatsächlich. Wir müssen los!
So abrupt, wie sie aufgetaucht waren, verstummten die Stimmen. Die Zweige und Blätter fielen zu Boden.
Nichts sonst störte die Stille außer gelegentlich ein Wagen, der aus einer Einfahrt fuhr, mit Menschen darin, die unter dem aufmerksamen Blick der Bäume zur Arbeit fuhren – denn bei manchen Bäumen waren die Menschen, die sich in ihrem Territorium angesiedelt hatten, nur geduldet.
Woher kam bloß dieser Gedanke? Wieso sollte sie so etwas denken?
Panik ergriff sie. Sie war es gewohnt, seltsame Träume zu haben. Die hatte sie schon ihr ganzes Leben lang. Aber Stimmen zu hören und Dinge zu sehen, wie gerade eben – wie sie glaubte, gerade eben gesehen zu haben –, das deutete auf eine Psychose hin.
Sie versuchte, die aufsteigende Panik in den Griff zu bekommen. Nein. Sie war einfach übermüdet und noch nicht ganz wach, noch immer halb in einem Traum gefangen, in dem Eschers Uhren ineinanderflossen und sich endlos windende Treppen ins Nichts führten.
Eine Tasse Kaffee, und schon wäre dieser Irrsinn vorbei. Sie machte kehrt und ging zurück in Richtung ihres Hauses. Raschen Schritts bog sie um die Ecke.
Ihr Exehemann Justin stand auf ihrer Veranda am Fuß der Betontreppe. Sein dunkles Haar hatte in der Morgensonne einen rötlichen Glanz, und sein schmales, kluges Gesicht wurde von einer Ray-Ban-Sonnenbrille in zwei Hälften geteilt. Er trug einen seiner Büro-Anzüge, zweckmäßig und doch elegant, die Jacke in der ungewöhnlichen Wärme des Frühlingsmorgens aufgeknöpft.
Als sie ihn sah, blieb sie mit einem leisen Stöhnen stehen. Justin hatte sie bemerkt, bevor sie sich umdrehen und davonjoggen konnte.
Klasse. Genau was sie brauchte, zusätzlich zu allem anderen.
Nun – je schneller sie es hinter sich brachte, desto schneller war sie ihn wieder los. Schicksalsergeben ging sie auf ihn zu.
2
Solange Michael zurückdenken konnte, war er voller Wut gewesen, schon bevor er die Gründe für diese Wut begriffen hatte.
Als kleiner Junge, vor über dreißig Jahren, hatte er zu Schreikrämpfen geneigt und zu untröstlichem Weinen, das stundenlang anhalten konnte. Einmal hatte es sogar mehrere Tage angedauert. In seiner Erinnerung waren seine Eltern blasse, nicht durchsetzungsfähige Schatten, die ihm Sorge und Betroffenheit vorspielten. Ärzte und eine Subkutannadel waren ebenfalls zum Einsatz gekommen.
Er hatte Spritzen nicht ausstehen können. Fünf Erwachsene waren vonnöten gewesen, um ihn zu bändigen. Danach hatte man ihn eine Zeit lang mit Medikamenten ruhiggestellt und ihn zu einer Therapeutin geschickt. Die Medikamente lehrten ihn eine wichtige Lektion. Sie machten ihn benommen und schwindelig, und ihm wurde klar, dass man ihn nur dann damit verschonen würde, wenn er sein Verhalten den Vorstellungen der Erwachsenen anpasste.
Er malte eine Menge bunter Bilder und beobachtete die Therapeutin genauso intensiv wie sie ihn. Sobald er sie durchschaut hatte, erzählte er ihr nur noch, was sie hören wollte. Schließlich wurden die Therapiestunden beendet und die Medikamente abgesetzt.
Trotzdem war er noch immer ein wildes, eigensinniges, hochbegabtes Kind. Seine Eltern versuchten, ihm Lesen und Schreiben beizubringen, konnten sein Interesse aber erst wecken, als er eines Abend in den Nachrichten einen Bericht über den Iran-Irak-Krieg sah. Selbstvergessen und ohne auch nur ein einziges Mal zu blinzeln verfolgte er die Nachrichtensendung bis zum Ende, und dann verlangte er von seinem Vater, ihm aus der Zeitung jeden einzelnen Artikel zu dem Thema vorzulesen. Innerhalb weniger Jahre erreichte seine Lesekompetenz Collegeniveau.
Die Schule war farblos. Sie hinterließ bei ihm keinen sonderlichen Eindruck. Die anderen Kinder waren ebenfalls farblos. Er hatte keine Freunde. Er hatte Anhänger. Dank seiner Beobachtungsgabe und seines Instinkts wusste er, was seine Lehrer von ihm hielten, dass sie einerseits fasziniert von ihm waren, sich andererseits aber Sorgen um seine Zukunft machten.
Ihm war das egal. Sie waren farblos. Nichts in der äußeren Welt war jemals annähernd so real wie das, was in ihm tobte.
Er war auf dem besten Weg, sich zu einem ausgewachsenen Psychopathen zu entwickeln. Seine Träume, nicht mehr den Gesetzen der farblosen Welt unterworfen zu sein, waren noch verschwommen, nahmen aber immer gefährlichere Gestalt an. Er war bereits in mehrere Prügeleien mit anderen Kindern verstrickt gewesen, und er hatte bemerkt, dass Gewalt ihm gefiel.
Und Gewalttätigkeit lag ihm.
Eines Tages, er war acht, erschien eine alte Frau am Zaun des Schulhofs.
Michael war sich ihrer Gegenwart genauso bewusst, wie er alles andere um sich herum sehr bewusst wahrnahm. Allerdings beachtete er sie nicht weiter, sondern organisierte seine Anhänger, um auf dem Spielplatz mal wieder für Ärger zu sorgen.
Dann geschah etwas außerordentlich Ungewöhnliches.
Junge, sagte die alte Frau.
Das war alles. Aber sie sagte es INSEINEMKOPF.
Er drehte sich um und starrte sie an. Die alte Schachtel sah extrem farblos aus. Genau wie all die anderen unscheinbaren Frauen mit den fröhlichen, runzeligen Gesichtern, die hier stehen blieben, um Kindern in der Schulpause beim Rennen und Spielen zuzusehen.
Er kniff die Augen zusammen und ging auf sie zu, Schule, Warnung vor Fremden, Anhänger und Ärger machen, alles vergessen. Einige der Kinder riefen seinen Namen, und irgendein Geschoss traf ihn an der Schulter. Er ignorierte alles und blieb erst etwa zehn Meter von dem fast zwei Meter hohen Maschendrahtzaun entfernt stehen. Die ganze Zeit beobachtete die Frau ihn aus ihren funkelnden schwarzen Knopfaugen.
»Wie hast du das gemacht?«, fragte er.
Kinder, die kreischend Fangen spielten, rannten zwischen ihnen hindurch, aber sie hörte ihn trotz des Lärms. Sie lächelte, und ihr Gesicht wurde noch faltiger. Das ist ein Geheimnis, sagte sie. Ich kenne eine Menge Geheimnisse.
Ihm stockte der Atem. Verblüfft starrte er sie an. Sie war zwar alt und faltig, aber definitiv nicht farblos. Instinktiv machte er einen weiteren Schritt auf sie zu. »Bring es mir bei.«
Ihre Lachfältchen vertieften sich. Sie wandte den Blick nicht eine Sekunde von ihm ab. Ihre funkelnden Augen zeigten Belustigung, aber auch etwas Härteres. Vielleicht, sagte sie, und ihre mentale Stimme klang gleichgültig. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf an.
Noch nie in seinem kurzen, behüteten Leben hatte man ihn derart angestarrt, wie gewogen und zu leicht befunden, aber genau diese Botschaft lag im Blick der alten Frau. Mürrisch verzog er das Gesicht. »Kommt worauf an?«
Auf dein Benehmen, junger Mann. Und darauf, ob du noch zu retten bist.
Noch nie hatte er solch alte Augen gesehen. Er war zu jung und zu unwissend, um zu verstehen, wie tödlich sie waren. Er wusste nur, dass dieses seltsame Gespräch realer war als alles, woran er sich erinnern konnte.
Er lief zum Zaun, packte die Metallstreben mit beiden Händen und sah zu ihr hoch. »Es tut mir leid«, sagte er. Die ungewohnten Worte blieben ihm beinahe im Hals stecken, aber er zwang sie hinaus. »Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Bitte, würden Sie mir beibringen, wie Sie das gemacht haben?«
Ihr Gesicht nahm einen milderen Ausdruck an, und mit ihren knotigen Fingern berührte sie seine geballten Fäuste, während sie zum ersten Mal laut sprach. »Gut gesagt. Vielleicht bringe ich es dir wirklich bei, aber das hängt noch von einer weiteren Sache ab.«
Verwirrt schüttelte er den Kopf. Das war alles äußerst seltsam. Aus der Ferne hatte sie so klein gewirkt, kaum größer als er. Jetzt, wo er direkt vor ihr stand, schien sie ihn deutlich zu überragen.
»Alles, was Sie wollen«, versprach er. Er war ja noch so jung.
Sie beugte sich vor und sah ihn durchdringend an. Er stellte fest, dass er sich auch in Bezug auf ihre Augen getäuscht hatte. Sie waren nicht wie freundliche kleine Knöpfe. Sie waren heiß und voller glühender Energie, wie schwarze Sonnen.
»Du darfst es niemandem sagen«, flüsterte sie. »Sonst müsste ich dich umbringen.«
Die Angst elektrisierte ihn. Noch nie, weder in Wirklichkeit noch in seinen wildesten Träumen, hatte ein Erwachsener so mit ihm gesprochen. Und vielleicht meinte sie es sogar ernst.
Der Mann dagegen, zu dem er heranwachsen sollte, wusste später, dass es so war.
Er rüttelte am Zaun. »Ich verspreche es. Ich werde es niemandem sagen.«
»Niemals«, sagte die alte Frau.
Er nickte. »Niemals.«
Sie zog die Stirn kraus. »Großes Pfadfinderehrenwort?«
Diese Worte! Ihr war es wirklich ernst. Wow, war das cool! Er erwiderte ihren Blick, grinste und legte die Hand auf sein Herz.
Die alte Frau lächelte wohlwollend. »Braver Junge.«
Sie sagte ihm, er solle sich ruhig verhalten und abwarten, was er auch tat, obwohl es ihm schwerer fiel als alles zuvor.
Zwei Wochen später wurde er für seine Geduld belohnt. Als er aus der Schule nach Hause kam, sah er vor dem übernächsten Haus einen Umzugswagen stehen.
Neugierig lief er hin und beobachtete, wie ein halbes Dutzend Männer Möbel, Haushaltsgeräte und Kisten ausluden. Kein Spielzeug, keine Fahrräder, nichts Seltsames oder Auffälliges, nur ganz normale Möbel. Farblos. Er wollte sich gerade umdrehen, als er eine dünne, ältliche weibliche Stimme den Männern vom Haus her etwas zurufen hörte.
Ein plötzlicher köstlicher Schauder glitt über seine Haut wie die Klinge eines kühlen Messers.
Diese Stimme hatte er schon lange nicht mehr gehört, aber er hätte sie jederzeit erkannt.
Er klopfte an die Tür. Sie schenkte ihm einen Keks. Für die Umzugshelfer musste es aussehen, als würde sich eine gewöhnliche alte Dame mit einem wohlerzogenen, neugierigen Jungen aus der Nachbarschaft anfreunden.
Eine Woche später lernte die alte Dame seine Eltern kennen. Kurz darauf ging er dienstags und donnerstags zum Klavierunterricht zu ihr. Seine Familie besaß kein Klavier, also ging er auch montags, mittwochs und freitags zu ihr, um zu üben.
Seine Eltern waren erstaunt und entzückt darüber, mit welcher Ausdauer er sich seinen künstlerischen Ambitionen widmete. Im Klavierspiel schien er seine Unruhe überwinden zu können. Als seine Mentorin ihn für die Dauer der Sommerferien einlud, stimmten seine Eltern mit kaum verhüllter Erleichterung zu.
Währenddessen verwandelte sich Michael von einem schwierigen kleinen Jungen mit unerfreulichen, unkontrollierbaren Gefühlen in ein ruhiges, beherrschtes und unvergleichlich tödliches Wesen.
Er erfuhr, wer er war.
Wichtiger noch, er erfuhr, warum er so war, wie er war.
»Du hast deine andere Hälfte verloren«, erklärte ihm seine Mentorin. »Das ist vor sehr langer Zeit passiert. Vor so langer Zeit, dass es mich überrascht, überhaupt noch gesunde Anteile in dir zu entdecken. Du musst dich daran erinnern, wer du bist. Du musst dich an alles erinnern, das du aus deinem Gedächtnis noch ausgraben kannst, und deine Fähigkeiten und den Zweck deines Daseins wiederentdecken. Ich kann dir dabei helfen.«
Während er Meditation und Disziplin lernte, begriff er nach und nach, was seine Mentorin meinte. Den wütenden Anteil in sich empfand er wie ein wildes, nur unzureichend gebändigtes Tier. Als er älter wurde, lernte er diese Energie zu nutzen, indem er seine gesamte Konzentration darauf richtete, und dann begannen blutrote Erinnerungsfetzen, ihm den Weg in die Vergangenheit zu weisen.
Eine Vergangenheit, bevor er in dieses Leben geboren wurde.
Eine Vergangenheit, so weit zurückliegend, so lange vorbei.
Und ihm fiel nach und nach wieder ein, was er verloren hatte. Wen er verloren hatte.
Die andere Hälfte seines Ichs.
Der Entschluss, den er fasste, war unerschütterlich. Falls sie noch in irgendeiner Form existierte, würde er sie finden.
Er würde sie finden.
3
Unübersehbar widerwillig ging Mary an diesem frühen Frühlingsmorgen weiter auf ihren Exehemann zu, der vor ihrer Haustür stand.
»Richtig schmeichelhaft, wie du dich freust«, sagte Justin grinsend. »Nur gut, dass ich so ein gesundes Ego habe. Guten Morgen, und du kannst mich auch mal.«
»Wenn du hier uneingeladen auftauchst, brauchst du dich nicht zu wundern.« Ihre Stimme klang rau. Sie räusperte sich. »Himmel, Justin, es ist noch nicht mal sieben. Um die Uhrzeit habe ich nicht einmal mit dir geredet, als wir noch zusammengelebt haben.«
»Und wieso gehst du nicht ans Telefon?«, fragte er genervt. »Wenn du mal rangehen würdest, müsste ich hier nicht unangekündigt vor deiner Tür stehen.«
Sie blinzelte ihn an, dann ging sie die Treppe hinauf, um die Tür aufzuschließen. Er folgte ihr langsam. »Weil es nicht geklingelt hat.«
»Hast du überhaupt eins?« Inzwischen stand er hinter ihr und betrachtete das Chaos, das in ihrer Wohnung herrschte. »Und wie willst du das eigentlich wissen? Die Haube deines Wagens ist kalt, aber als ich geklopft habe, hast du nicht reagiert. Ich wollte schon reingehen und nachschauen, ob alles in Ordnung ist.«
Sie seufzte. »Du schaffst es noch, dass ich bereue, dir einen Schlüssel gegeben zu haben.«
»Wenn du ihn zurückhaben willst, musst du mich im Armdrücken besiegen. Und du weißt, ich halte mich nicht an die Regeln.« Sobald sie drinnen standen, musterte er sie noch einmal genauer. Sein Lächeln erlosch. »Ist alles in Ordnung mit dir? Du siehst reichlich blass aus.«
»Mir geht’s gut.« Sie nahm ihre Sonnenbrille ab und rieb sich das Gesicht. Noch immer spürte sie, wo sich die Sachen, auf denen sie geschlafen hatte, in ihre Haut eingedrückt hatten. Das Hämmern in ihrem Kopf war schlimmer geworden. Sie ging in Richtung ihrer Küche und sagte über die Schulter: »Ich brauche Kaffee. Willst du auch eine Tasse?«
»Ja.« Justin folgte ihr. »Sei so nett und tu mir einen Gefallen. Mach einen Termin bei deinem Arzt aus, hörst du?«
»Wie bitte? Nein. Ich habe doch gesagt, mir geht es gut.« Mary blieb mitten in ihrer Küche stehen und sah sich verwirrt um. Sie wusste genau, wo sie war, aber dennoch kam ihr alles so fremdartig und unverständlich vor.
Sie gehörte nicht hierher. Wieder packte sie die Panik wie ein Ertrinkender, der einen unter Wasser zu ziehen droht. Sie schob die Panik beiseite, schüttelte sich wie ein nasser Hund und ging auf die Kaffeekanne zu.
»Ich glaube nicht, dass es dir so gut geht, wie du behauptest.« Justin sah sie stirnrunzelnd an.
Sie machte eine abwehrende Geste. »Ich hatte gestern einen höllischen Tag. Meine Schicht hat sechsundzwanzig Stunden gedauert. Wir haben einen Unfall reinbekommen, in den mehrere Wagen verwickelt waren, außerdem zwei Opfer mit Schusswunden.«
Er schüttelte den Kopf. »Das ist heftig. Was ist passiert?«
»Bei dem Unfall sind mehrere Wagen aufeinander aufgefahren. Gott sei Dank gab es keine Toten. Die Schießerei war da schon ein anderes Kaliber. Eine junge Frau hatte herausgefunden, dass der Vater ihres Babys mit einer anderen Frau ebenfalls ein Kind hat. Sie hat sich die Neun-Millimeter von ihrem Bruder ausgeliehen und das Paar erschossen, als es auf der Terrasse des örtlichen Dairy Queens saß.« Sie sah Justin mit grimmigem Gesichtsausdruck an. »Die Mutter des zweiten Babys ist tot, und der Vater liegt auf der Intensivstation. Vielleicht kommt er durch, vielleicht auch nicht. Die Babys sind vom Jugendamt in Obhut genommen worden, was, wenn man es sich recht überlegt, vermutlich das Beste ist, was ihnen in ihrem kurzen Leben passiert ist.«
»Das habe ich in den Nachrichten gehört«, erwiderte Justin leise.
Sie öffnete eine Schranktür und nahm Kaffee und Filter heraus. Über die Schulter sagte sie: »Um das Maß vollzumachen, habe ich gerade mal vielleicht vier Stunden Schlaf bekommen. Kein Wunder, dass ich wie ausgespuckt aussehe. Es ist also nichts Ernstes.«
Er seufzte. »Hör mal, ich habe keine Zeit, mich mit dir zu streiten. In zwanzig Minuten muss ich bei der Arbeit sein … also versprich mir, dass du dich untersuchen lässt, und halt die Klappe.«
Sie füllte Wasser in die Kaffeekanne, goss es in den Wasserbehälter, schaltete die Maschine ein und schob die Kanne auf die Warmhalteplatte. »Also wirklich, Justin«, erwiderte sie gereizt. »Stehe ich uneingeladen bei euch vor der Tür und sage dir und Tony, was ihr zu tun habt?«
»Schatz, es tut mir leid«, machte er reuig einen Rückzieher. Als er sanft die Hand auf ihre Schulter legte, fuhr sie zusammen. »Es ist nur … also selbst ich weiß, dass man mit einer Frau niemals über ihr Gewicht reden darf, aber du hast abgenommen, und dabei wiegst du sowieso schon zu wenig. Du warst immer nur wie ein Vögelchen, ganz das typische ›five-foot-two-and-eyes-of-blue-girl‹.«
Der Kaffeeduft begann, sich in der Küche auszubreiten. Mary sah ihren Ex grimmig lächelnd an. »Komm mir ja nicht schon so früh am Morgen mit Dean-Martin-Songs, sonst übernehme ich keine Verantwortung mehr für das, was ich tue.« Sie deutete mit dem Finger auf ihn. »Genau das werde ich der Polizei sagen, wenn sie mit dem Leichensack kommt.«
Er erwiderte ihr Lächeln nicht, stattdessen nahm sein Gesicht einen störrischen Ausdruck an. »Ich meine das völlig ernst. Du siehst nicht gut aus, Mary. Du bist nur noch Haut und Knochen. Wenn du nicht vernünftig darüber reden willst, mache ich eben selbst einen Termin bei Tony für dich aus.«
»Den Teufel wirst du tun!« Sie starrte ihn böse an.
Er holte sein Handy heraus, drehte ihr den Rücken zu und ging den kurzen Flur entlang zum Wohnzimmer. Kurz darauf fing er an, mit jemandem zu reden.
Mary hätte am liebsten laut geschrien. Stattdessen atmete sie tief ein und blies die Luft dann aus wie ein Dampfdrucktopf. Sie goss sich eine Tasse Kaffee ein und trug sie zum Tisch. Als sie einen Stapel aus Zeitschriften und Post von einem der Stühle nahm, kam darunter das schnurlose Telefon zum Vorschein.
Sie schaltete es ein und lauschte. Kein Freizeichen. Der Akku musste leer sein. Ihr Handy benutzte sie nur für die Arbeit, und die Nummer hatte Justin nicht. Sie stellte das Telefon auf die Ladestation, setzte sich, stützte die Unterarme auf den Tisch und ließ den Kopf auf die Handballen sinken.
Ihre Gedanken kehrten zurück zu ihrem Traum. In letzter Zeit träumte sie ihn häufiger, und die Szenen wurden immer lebendiger. Diesmal waren die Körper der sieben Wesen durchscheinend gewesen. Bänder aus farbigem Licht waren aus ihnen herausgeflossen und hatten in der Luft getanzt, als wären die Wesen so etwas wie exotische Anemonen. Das Gift hatte bittersüß geschmeckt und nach Gewürznelken gerochen.
In Farbe hatte sie schon mehrmals geträumt, aber noch nie hatte sie einen Geruch oder Geschmack wahrnehmen können. Ob es wohl irgendwie mit dieser Entwicklung zusammenhing, dass sie auf einmal Stimmen hörte und unglaubliche Dinge sah?
Wieder spürte sie, wie die Panik nach ihr griff. Sie drängte sie zurück. Das war das Letzte, was sie jetzt gerade brauchen konnte. Sie hob den Kopf, streckte die Arme nach vorne und betrachtete ihre Hände. Sie waren schlank und geschickt, was im OP ein großer Vorteil war, doch im Moment kamen sie ihr fremd vor, als gehörten sie zu jemand anderem.
Justin kam mit energischen Schritten zurück in die Küche. Er goss sich Kaffee ein, trank einen Schluck, trat dann an ihren Stuhl und klopfte ihr auf den Rücken. »Tony hat ein paar Termine verschoben. Er hat heute Nachmittag um drei Zeit für dich. Und da ich dir nicht traue, dass du wirklich hingehst, mache ich im Büro heute früher Schluss und fahre dich hin.«
»Ich war so ein hilfloses Häschen, als ich dich geheiratet habe«, erwiderte sie. »Aber Medizinstudentin und Jurastudent sind doch das typische amerikanische Traumpaar, nicht wahr? Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei.« Gott sei Dank hatte sie es aufgegeben, sich ein Leben zu schaffen, das wenigstens nach außen hin normal aussah.
»Wovon reden Sie, Frau Doktor? Welches hilflose Häschen? Du bist doch ganz der Typ Marlboro-Mann. Abgesehen natürlich von den Zigaretten, dem Cowboyhut und dem Penis.«
Sie zog eine Augenbraue hoch.
»Na gut, eigentlich bist du überhaupt nicht wie der Marlboro-Mann.« Er grinste. »Aber du hast diese Aura der stillen, vor sich hin brütenden Helden, mit einem Anklang von etwas Tragischem in der Vergangenheit. Nur dass ich deine Vergangenheit kenne und weiß, dass sie so normal wie sonst was ist. Aber jedenfalls sehr sexy. Ich hatte immer eine Ärztin heiraten wollen … und wenn du diesen Penis gehabt hättest …«
»Die Therapie hat echt einen Gockel aus dir gemacht«, sagte sie.
»Was Tony zu schätzen weiß«, erwiderte er.
Sie verdrehte die Augen. »Verschwinde. Fahr endlich zur Arbeit.«
Er wurde wieder ernst. »Um halb drei bin ich wieder hier und hole dich ab. Sei ja fertig, sonst werde ich zum Macho und werfe dich mir über die Schulter.«
»Hör auf, mich zu bevormunden. Ich komme nicht mit.« Ihre Tasse war leer. Sie stand auf, um sich nachzuschenken.
»Wie auch immer.« Justin musterte sie von oben bis unten. »Ich glaube, Tony ist es egal, ob du dir die Beine rasiert hast.«
»Himmel noch mal!« Sie konnte sich nicht länger beherrschen. Er sah sie gekränkt an und wirkte dabei so entzückend rebellisch wie ein Zweijähriger. Sie versuchte, ihre Ungeduld zu zügeln. »Schau, ich weiß es zu schätzen, dass du dir Sorgen machst. Das ist nett von dir.«
»Nett!« Er schnaubte.
Ihr Blick wurde kritischer. »Ich warne dich. Allmählich habe ich genug von deiner Sturheit und davon, dass du dich andauernd in mein Leben einmischst. Außerdem ist Tony der Letzte, zu dem ich gehen würde.«
»Aber wieso denn?«
»Weil er dein Partner ist und ich ihm auch privat über den Weg laufe, du Blödmann.«
»Eigentlich tust du das gar nicht«, widersprach Justin. »Du hast uns schon seit ewigen Zeiten nicht mehr besucht. Wenn ich versuche, dich mit jemandem zu verkuppeln, kommst du einfach nicht. Soweit ich das beurteilen kann, triffst du dich mit überhaupt niemandem. Das ist das Problem mit diesen stillen, gedankenversunkenen Marlboro-Mann-Typen. Sie reden nicht gern.«
Mary schloss die Augen. Ihn einfach zu ignorieren, würde zu nichts führen. Fröhlich übersah er jeden Wink mit dem Zaunpfahl, wenn er ihm nicht in den Kram passte.
»Heute ist mein erster freier Tag seit Wochen«, fuhr sie ihn an. »Ich habe keine Lust, ihn im Wartezimmer eines Arztes zu verbringen.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Außerdem fehlt mir nichts.«
Die Lüge hallte in ihrem dröhnenden Kopf wider. Sie war völlig am Ende. Was auch immer ihr mysteriöses Leiden war, es wurde schlimmer. Wenn sie nicht herausfand, was mit ihr los war, würde sie zerbrechen, ganz tief im Inneren, wo es niemand sehen konnte, wo der lebendigste Teil von ihr seinen Platz hatte.
Justin fuhr sich mit der Hand durch das Haar, warf einen Blick auf seine Uhr und sah bestürzt hoch. »Ich habe keine Zeit mit dir zu streiten.«
»Gut«, erwiderte sie. Dann überkam sie verspätet die Neugier. »Wieso bist du eigentlich überhaupt heute Morgen hier aufgekreuzt?«
»Ach ja. Ich wollte dich fragen, ob du noch mal auf Baxter aufpassen kannst. Ich musste es unbedingt wissen, und du bist nicht ans Telefon gegangen.« Er zögerte, und sie spürte, wie sich etwas in seinem Auftreten veränderte. »Tony und ich sind zu einem Wochenende auf dem Land eingeladen, aber wir müssen nicht unbedingt beide hin.«
»Ich habe das Telefon nicht gehört, weil der Akku leer ist.« Sie wiederholte es so geduldig, wie sie nur konnte. Dann fiel ihr wieder ein, was sie eigentlich hatte tun wollen, und sie goss sich ihre zweite Tasse Kaffee ein. Sie hielt sich die Tasse unter die Nase, schloss die Augen und ließ den Dampf ihre kühle Haut wärmen.
Er hatte recht. Irgendwo zwischen Arbeit und dauernden Sorgen war ihr ihr Sozialleben abhandengekommen. Es bestand nur noch aus Justin, Tony und deren Hund, und selbst die hatte sie seit Monaten nicht mehr besucht.
Sie würde ihrer To-do-Liste noch eine Arbeit hinzufügen müssen: Toilette reparieren. Lampe reparieren. Mich selbst reparieren.
Laut sagte sie: »Natürlich passe ich auf Baxter auf. Ich liebe den Hund.«
»Danke. Das weiß ich echt zu schätzen.« Erneut warf er einen Blick auf seine Uhr. »Ich habe heute einen Gerichtstermin. Ich muss los. Aber ich komme später wieder. Bis halb drei.«
Am liebsten hätte sie ihm irgendetwas über den Schädel gezogen. Stattdessen biss sie die Zähne zusammen. Je eher sie aufhörte, ihm zu widersprechen, desto schneller wurde sie ihn los. »Beeil dich, sonst kommst du zu spät zur Arbeit.«
»Ach, verdammt!« Er beugte sich vor, küsste die Luft neben ihrer Wange und hastete aus dem Haus.
Mary trat an das große Wohnzimmerfenster und sah mit zusammengekniffenen Augen zu, wie er davonfuhr. Sie tippte mit dem Fingernagel gegen die Scheibe. »Du kannst gerne kommen«, flüsterte sie dem sich entfernenden Wagen hinterher. »Aber glaub ja nicht, dass ich dann da bin.«
Sie legte die Wäsche zusammen, räumte sie weg und machte das Bett. In der Waschküche wartete ein weiterer Haufen bunter Stofffetzen. Nachdem sie sie in die Waschmaschine gestopft hatte, putzte sie das Wohnzimmer.
Da sie allein lebte, und das in einem Haus mit mehr Zimmern, als sie eigentlich benötigte, hatte sie das Wohnzimmer zu einem ihrer Arbeitsräume umfunktioniert. Dort lagen vier Quilts in unterschiedlichen Fertigungsstufen. Der bei Weitem Bunteste von ihnen war der Patchwork-Quilt im Mustermix. Sie betastete den Stoff, aber der Quilt sprach sie nicht an. Er wirkte leblos, wie etwas, das nichts mit ihr zu tun hatte – als hätte ein Besucher ihn im Haus vergessen.
Sie ging den Flur entlang zu dem Zimmer, das sie zum Atelier umgestaltet hatte. Zwei Stunden lang versuchte sie etwas von der schwer fassbaren Bildsprache ihres Traums auf die Leinwand zu bringen.
Diese Wesen hatten von innen heraus geleuchtet. Die Farben, die sich innerhalb ihrer Körper bewegten und in Lichtspiralen nach außen flossen, ließen sich in ihrer seltsamen Fremdartigkeit nicht auf Papier bannen. Sie schienen Gefühle wiederzugeben oder die Persönlichkeit darzustellen, als ob die Wesen völlig andere Sinne hätten, mit denen sie die Pheromone sehen konnten, die ihre Körper ausstießen.
Solange Mary zurückdenken konnte, war sie von seltsamen Träumen geplagt worden. Der, dem sie den Namen »Traum vom heiligen Trank« gegeben hatte, war nur einer von vielen, die sie in schöner Regelmäßigkeit heimsuchten. Manchmal blieben die Details des Traums vom heiligen Trank vage, oder sie änderten sich von Mal zu Mal. Einige Einzelheiten jedoch blieben stets gleich. Es waren sieben Menschen, oder besser gesagt Wesen. Jeweils zwei bildeten ein Paar, dazu kam ein entflohener Sträfling. Immer tranken sie das Gebräu, und immer waren Marys Empfindungen nach dem Aufwachen Angst und ein unbeschreiblich intensives Gefühl des Verlusts.
Sie schüttelte den Kopf und zog die Stirn in Falten. Manche Leute glaubten, jeder Mensch habe einen Seelenverwandten – aber sie hatte keinen. Dieser Glaube war zu gewöhnlich, zu romantisch, war bar jeglicher Grundlage. Da sie nicht an Seelenverwandtschaft glaubte, verstand sie nicht, wieso dieses Thema in ihren Träumen wieder und wieder auftauchte.
Menschen lernten ähnlich denkende Menschen kennen, weil sie sich für ähnliche Dinge interessierten und daher ähnliche Aktivitäten entwickelten. Gleich und gleich gesellte sich nun mal gern. Entweder das, oder man lief sich durch Zufall über den Weg.
Glücklicherweise hielt das Verlustgefühl im Anschluss an den Traum vom heiligen Trank nie lange an, egal wie mächtig und überwältigend es zunächst war. Solch einen Schmerz hätte niemand lange ausgehalten, zumindest soweit Mary das bisher beobachtet hatte. Menschen schienen unerträgliche Schmerzen immer nur in Wellen zu erleben.
Als sie noch ein Kind gewesen war, waren die Träume nicht so intensiv und auch nicht so lebendig gewesen, aber aufgewühlt hatten sie sie immer. Je älter sie wurde, desto farbiger, detailreicher und emotional aufwühlender wurden auch ihre Träume.
Als Medizinstudentin an der Notre Dame University hatte sie einmal versucht, die Dämonen in ihrem Kopf zur Ruhe zu bringen und die von der Universität angebotene Psychotherapie in Anspruch genommen. Mehr als ein Jahr hatten ihr Therapeut und sie ihre Kindheit und die mögliche Symbolik ihrer Traumbilder erforscht.
Justin hatte recht. Sie hatte eine völlig normale Kindheit gehabt. Sie war auf Bäume geklettert, war hingefallen, hatte sich bei Schulaufführungen versprochen. Sie hatte Cupcakes für Wohltätigkeitsveranstaltungen gebacken und bei Freundinnen übernachtet. Sie konnte sich in allen Einzelheiten an ihre Kindheit erinnern. Abgesehen vom Tod ihrer Eltern, als sie vierzehn war, gab es einfach nichts, was sie sonderlich belastet hätte. Und selbst damals hatte sie noch das Glück gehabt, zu einer liebevollen Tante zu kommen, die einem untröstlichen Kind die nötige Aufmerksamkeit schenkte.
Sex interessierte sie nicht, obwohl sie sich das eine Zeit lang gewünscht hatte. So faszinierend die Vorstellung war, so wenig begeisterte sie die Umsetzung. Anstatt die Intimität als emotionale Bestätigung zu empfinden, erlebte sie sie mehr wie etwas Klinisches, von ihr Losgelöstes, das sie eher anwiderte. Verabredungen mit Männern ging sie möglichst aus dem Weg.
Am Anfang hatte es sie erleichtert, dass auch Justin kein sonderliches Interesse an körperlicher Nähe zeigte. Während ihrer Ehe hatte es nur ansatzweise eine körperliche Beziehung zwischen ihnen gegeben. Als er sich endlich eingestanden hatte, dass er schwul war, war sie beinahe nahtlos in die Rolle der unterstützenden Freundin geschlüpft. Ihre Trennung war für sie beide eine Erlösung gewesen.
Für kurze Zeit hatte sie ihren Hang zur Eigenbrötlerin auf den frühen Verlust ihrer Eltern geschoben, aber das hatte sie sich nicht lange vormachen können. Es gab einen Grund, warum sie kein geselliges Leben führte, und es lag nicht nur daran, dass sie einen hektischen Job mit unregelmäßigen Arbeitszeiten hatte.
Sie wusste nur, dass sie diese verzweifelte Sehnsucht nach … irgendetwas hatte, aber sie konnte einfach nicht herausfinden, wonach. Klar war ihr bloß, dass sie es bei anderen Menschen nicht bekommen konnte. Sie musste einen Weg finden, sich selbst zu heilen, selbst ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Vielleicht würde sie dann zu jemandem eine Beziehung entwickeln können, der ihr wirklich etwas bedeutete.
Nachdem sie sich eingestanden hatte, dass die Therapie zu nichts führte, hatte sie die Sitzungen beendet. Dann hatte sie einen Platz an der medizinischen Fakultät bekommen, und Justin und sie hatten sich scheiden lassen. Jetzt lebte sie in ihrem Elfenbeinturm. Ihrer Ansicht nach war die Therapie ein kompletter Reinfall gewesen.
Auch das Bild, das sie gerade malen wollte, war ein kompletter Reinfall. Egal wie sehr sie es versuchte, die Eindrücke aus ihrem Traum ließen sich nicht auf die Leinwand übertragen.
Sie hob die Leinwand von der Staffelei und lehnte sie zum Trocknen an die Wand. Dann griff sie nach Skizzenblock und Stiften, in der Hoffnung, mithilfe eines anderen Mediums wenigstens einen Teil der schwer greifbaren Details darstellen zu können, die sie so deutlich vor ihrem geistigen Auge sah.
Während sie arbeitete, tauchte aus der Tiefe ihrer Erinnerung eine alte Begebenheit auf. Mary hielt inne, damit sich die Erinnerung besser herauskristallisieren konnte. Schon als Kind hatte sie immer gemalt. Sobald ihre Finger groß genug waren, um Buntstifte zu halten, hatte sie – wieder und wieder – Menschen hinter Gittern gemalt.
Im Laufe der Jahre war das Ganze zu einem ausgeklügelten Geheimprojekt geworden. Die Gefangenen erhielten Namen und Persönlichkeiten. Sie hatten Zimmer in ihren Gefängnissen. Mary zeichnete einfache Betten, Stühle, Regale, Küchen, alles hinter Gitterstäben. Das waren ihre Leute, und sie würde immer nach ihnen sehen.
Irgendwann war diese Besessenheit verschwunden. Sie hatte nie jemandem davon erzählt, und sie hatte die Bilder immer voller Schamgefühl zerrissen. Was für ein Monster war sie bloß, dass sie Tagträume von eingesperrten Menschen hatte?
Sieben. Ihr stockte der Atem. Sie hatte immer sieben Menschen gemalt.
Wie hatte sie das bloß vergessen können?
Sie malte, mit langsamen Bewegungen, versuchte, in das erlernte Können der Erwachsenen etwas von dem ungeschickten Drauflosmalen des Kinds einfließen zu lassen, um die Details aus der damaligen Zeit wiederaufleben zu lassen. Ein knöchellanges Kleid, gemalt wie ein einfaches Dreieck, die langen Ärmel, das lockige Haar … beim Saum des Kleids zögerte sie, und ihre Stirn legte sich in Falten. Wenn sie sich richtig erinnerte, hatte sie nie Hände oder Füße gemalt.
Dieses Bild wäre ein gefundenes Fressen für ihren Psychotherapeuten von der Uni. Mit einem lauten Knall schlug sie den Skizzenblock zu.
4
Der Tag war voller Klingen.
Die blassen Strahlen der Frühlingssonne schnitten wie Messer durch die sprießenden Blätter der Bäume. Durchdringendes Licht und grüne Schatten umgaben die alte Frau, während sie zarte Unkrauttriebe aus dem Gartenbeet bei der Eingangstür zog. Sie betrachtete Schatten und Licht, die Flecken auf ihre knotigen Hände warfen, und genoss das flüchtige Versprechen der Sonnenstrahlen auf Wärme, auch wenn ein kalter Wind vom See heraufwehte und sich mit unsichtbaren Krallen durch ihre abgetragene Jacke bohrte.
Sie atmete tief ein, hob das Gesicht und ließ sich in die Hocke sinken. Der sägemesserscharfe Wind brachte ein wenig Feuchtigkeit vom nahe gelegenen, rastlosen Wasser mit, einen leichten Duft nach früh blühenden Wildblumen, den Geruch nach Kiefern, Lehm und Neuigkeiten.
Lauschend legte sie den Kopf auf die Seite. Mit Sinnen und Fähigkeiten, die der ältlichen Frau, die sie zu sein schien, nicht gegeben gewesen wären, stellte sie sich auf die Energiemuster um sie herum ein. Dann machte sie sich auf den Weg durch den Wald, der zu einer kleinen Kiesbucht am Lake Michigan führte.
Während sie wartend am Pier stand, tuckerte ein klobiges Motorboot heran und trieb schließlich im Leerlauf an den Steg. Die beiden dunkelhaarigen Insassen mit den kräftigen, breiten Wangenknochen der Eingeborenen sahen einander ähnlich wie Verwandte.
Am Steuer saß ein gut aussehender, schlanker Halbwüchsiger. Auf dem Boden des Boots hockte ein deutlich älterer Mann, das angegraute dunkle, kaum zu bändigende Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Er hatte sich gegen den schneidenden Wind in Decken eingewickelt und lehnte sich an die Beine des jungen Manns.
Die alte Frau betrachtete das Paar mit unbewegtem Gesicht. Über den beiden schien eine tiefe Traurigkeit zu schweben. Den Jungen hatte sie noch nie gesehen. Normalerweise lenkte der ältere Mann das Boot, die Augen zusammengekniffen gegen den Rauch der Zigarette, die ihm ständig aus einem seiner Mundwinkel hing.
Jetzt hatte er die Decke bis zum Hals hochgezogen, seine sonst so schöne kupferfarbene Haut war grau, seine Lippen hatten eine ungesunde bläuliche Farbe.
»Jerry«, begrüßte sie ihn.
»Großmutter«, flüsterte der Mann. Die Anrede stand für Respekt, nicht für Verwandtschaft.
Abgesehen von Michael, Jerry und Jerrys Sohn Nicholas wusste niemand, wo sie zu finden war. Jerry hätte eigentlich im Krankenhaus sein sollen, stattdessen hatte er sein Leben aufs Spiel gesetzt, um hierherzukommen, also musste es wichtige und eilige Neuigkeiten geben, die ein derartiges Opfer verlangten.
Sie deutete mit dem Kinn auf seinen Gefährten. »Einer von deinen Jungs?«
»Enkel. Er heißt Aaron. Ich fand, es ist höchste Zeit, dass er erfährt, wie er hierherfindet.«
Sie sah sich Aaron genauer an. Die langen Haare trug er in einem Pferdeschwanz, und seine Handgelenke schmückten Leder- und Silberarmbänder. Sein schwarzes Haar glänzte wie die Flügel eines Raben, und er hatte die gleiche kupferfarbene Haut wie sein Großvater und auch die gleichen Gesichtszüge, nur dass seine eine Sinnlichkeit ausstrahlten, die Jerry fehlte. Die großen dunklen Augen und die vollen Lippen musste er von seiner Mutter geerbt haben. Er war älter, als er auf den ersten Blick wirkte, vielleicht zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig. Er war hoch aufgeschossen, doch trotz der breiten Schultern musste sein Körper seine Kräfte erst noch voll entwickeln.
Jerry musste einen guten Grund haben, Aaron den Weg zu ihrem Zuhause zu zeigen. Offensichtlich vertraute er seinem Enkel. Das konnte nur bedeuten, dass er den Jungen auch in andere heilige Lehren eingeführt hatte, altes geheimes Wissen, das nur an einige wenige Auserwählte weitergegeben wurde. Jerry bereitete Aaron darauf vor, nach seinem Tod seinen Platz einzunehmen. Doch dass er seinem Enkel vertraute, hieß noch lange nicht, dass sie ihn ungefragt akzeptierte. Erst würde Aaron ihrer eigenen Überprüfung standhalten müssen, bevor sie ihm gestattete, mit dem Wissen, wie man hierherkam, diesen Ort wieder zu verlassen.
Während sie ihn noch prüfend musterte, hielt er ihr mit weit aufgerissenen Augen, in denen das Weiße hell glänzte, ein Bündel entgegen. Die Haut seines Großvaters Jerry war von einer ungesunden Blässe, doch auch das Gesicht des Jungen war unter dem Kupferton weiß und wies Spuren von Tränen auf. Das Paket war in schützenden roten Baumwollstoff gehüllt und mit ungefärbtem Zwirn umwickelt.
Die alte Frau betrachtete es ausgiebig. Sie wusste, was sich darin befand. Das Paket stellte eine traditionelle Bitte an eine Ureinwohnerin im Rang einer Ältesten dar, eine Bitte um Hilfe. Darin würde sie Tabak finden, weißen Salbei und so viel Geld, wie sie irgendwie hatten zusammenkratzen können. Wenn sie es annahm, ging sie damit eine heilige Verpflichtung ein.
Sie nahm es nicht. Stattdessen fragte sie den Jungen: »Kannst du deinen Großvater zur Hütte hinauftragen?«
Aaron nickte. Seine ausgestreckte Hand und seine Lippen zitterten sichtbar.
Sie stählte sich gegen das Herzerweichende in seinem stumm flehenden Blick. »Dann bring ihn rauf.« Sie sah ihren alten Freund Jerry an, der selbst ein Ältester war, in einer nicht weit entfernt liegenden Ojibwa-Gemeinde. »Du weißt, ich kann dir nichts versprechen, aber selbstverständlich tue ich, was ich kann.«
Er nickte. »Danke.«
Sie machte sich an den steilen Anstieg, und der Junge hob seinen Großvater hoch und folgte ihr. Hinter ihr hörte sie, wie Jerry Aaron mit kratziger Stimme Anweisungen gab. »Wenn du mich zum Haus raufgebracht hast, machst du unten beim Boot das Dankesritual für unsere sichere Fahrt. Mach es ordentlich. Opfere Tabak.«
Die Stimme des Jungen war tiefer, als sie vermutet hatte, und zitterte, so aufgewühlt war er. »Ja, Sir.«
Sie hatte die Frage so lange zurückgehalten, wie sie konnte. Als es ihr nicht länger möglich war, fragte sie, ohne sich umzudrehen: »Wer ist gestorben?«
Schweigen. Schließlich war es der Junge, der sich zu einer Antwort durchrang. Mit tränenerstickter Stimme sagte er: »Mein Onkel Nicholas.«
Oh nein. Nein.
Sie krümmte sich zusammen. Sie hatte es schon gewusst, bevor der Junge es ausgesprochen hatte. Aber sie hatte es nicht wahrhaben wollen. Bis zum letzten Moment hatte sie gehofft, es handle sich um jemand anderen.
Jerry flüsterte heiser: »Setz mich ab. Geh zu ihr.«
Sie hob die von Altersflecken übersäte, verknöcherte Hand. »Nein. Lasst mich.«
Wieder herrschte Schweigen. Ein paar Sekunden später war sie wieder in der Lage, sich aufzurichten. Mühsam stieg sie weiter den Pfad hinauf. Die beiden folgten ihr.
Sobald sie in der Hütte angekommen waren, legte der Junge seinen Großvater auf das Sofa vor dem leeren Kamin und half ihm aus der warmen, flanellgefütterten Jeansjacke. Auf ihren Befehl hin machte der Junge Feuer im Kamin. Stöhnend setzte sie sich Jerry gegenüber an den massiven Zedernholztisch. Ihre Blicke trafen sich, grimmig und voller Trauer beim Gedanken daran, was dieser Verlust für sie bedeutete.
»Du schweigst«, befahl sie ihm und hielt ihm den verkrümmten Zeigefinger unter die Nase. Als die Flammen zu tanzen begannen, sagte sie über die Schulter zu dem Jungen: »Erzähl mir, was passiert ist.«
Der Junge kniete sich neben dem Sofa, auf dem sein Großvater lag, auf den Boden. Mit gesenktem Kopf strich er ihm immer wieder über das Haar und berichtete ihr, was sie bisher herausgefunden hatten.
Zu diesem frühen Zeitpunkt war es noch nicht viel, aber es war genug.
Nicholas Crow, ehemaliger Green Beret und Chef der Abteilung der Secret Security, die für den Schutz des Präsidenten zuständig war, war am vergangenen späten Abend während seiner dienstfreien Zeit vor einem Restaurant ermordet worden. Ausgesehen hatte die Tat wie ein Raubüberfall. Er war mit mehreren Messerstichen getötet worden, außerdem hatte man ihm die Kehle aufgeschlitzt. Aufgrund seiner Fähigkeiten und seiner Stellung war sofort eine groß angelegte Fahndung eingeleitet worden, durchgeführt von höchster Ebene. Im Weißen Haus herrschte Alarmstufe Rot. Der Präsident hatte beschlossen, die Woche in Camp David zu verbringen. Nichts davon war in den Nachrichten aufgetaucht.
»Er war der Einzige von unseren Leuten, der wenigstens ansatzweise an der richtigen Stelle saß«, flüsterte Jerry. »Mein guter, tapferer Junge. Es gibt keinen anderen wie ihn.«
»Ich habe dir doch gesagt, du sollst still sein«, erwiderte sie. Ihre Stimme klang erstickt von Tränen, die zu weinen sie keine Zeit hatte.
Sie verbündete sich nicht mehr oft mit menschlichen Wesen, und Nicholas war einer der wichtigsten menschlichen Verbündeten gewesen, die sie je gehabt hatte. Jerry und sie hatten sich seit seiner Kindheit eigenhändig um seine Ausbildung gekümmert. Ihn jetzt zu verlieren war ein schrecklicher Schlag, nicht nur wegen des Verlusts eines starken, klugen Mannes, sondern auch weil dadurch deutlich wurde, wie viel ihr Feind wusste und was er vorhatte.
Sie schob die Gedanken einen Moment beiseite, legte die Hand auf Jerrys Brust und konzentrierte sich. Trauer und Stress, dazu zu viele Jahre mit zu vielen Zigaretten machten seinem Herzen schwer zu schaffen.
Der kalte, ruhige Teil ihres Gehirns prüfte den Schaden. Sie verfügte über begrenzte Heilfähigkeiten. Im Laufe der Jahre hatte sie für Jerrys Herz getan, was sie konnte, aber die Zeit und das Alter forderten unvermeidlich ihren Tribut.
Sie konnte es noch einmal tun. Sie konnte ihn heilen. Das lag gerade noch innerhalb ihrer Möglichkeiten. Aber es würde sie eine ungeheure Menge Energie kosten, die sie nicht an ihn zu verschwenden wagte. Jedenfalls nicht jetzt. Das konnte sie sich nicht leisten.
Mit Jerry verband sie eine jahrzehntelange Freundschaft. Er kannte Geheimnisse, die nur wenigen anderen Menschen jemals anvertraut worden waren, und dennoch musste ihre Antwort Nein lauten.
Sie zog die Hand zurück. »Ich habe eine Tinktur, die helfen wird«, sagte sie zu Jerry und dem Jungen.
Sie verschwieg ihnen die Wahrheit nicht. Die Tinktur würde seine Symptome lindern und ihm die Krankheit etwas erträglicher machen, aber sie würde ihn nicht heilen. Wenn sie die beiden fortschickte, würde Jerry wahrscheinlich sterben, bevor der Junge ihn in ein Krankenhaus bringen konnte. Ihn mit dem Hubschrauber transportieren zu lassen kam nicht infrage. Sie konnte nicht zulassen, dass die Behörden von diesem Ort erfuhren.
Die Erleichterung, die sich auf den Gesichtern der beiden abzeichnete, machte ihr Schuldgefühle.