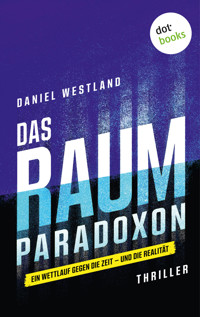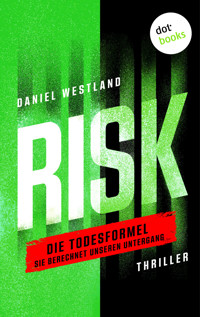
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Unaufhaltsame Gier – eine Gleichung ins Verderben … Risikoforscherin Jennifer Meyer hat nur noch sechs Monate zu leben – sie kann nur weitermachen wie zuvor und warten bis die Erbkrankheit sie dahinrafft, die bereits ihren Vater getötet hat. Als ihre Forschung sie auf die Spur des Konzerns GlobalENJ führt, der in den Schatten agiert und vor nichts Halt macht, um seinen Profit zu steigern, stellt Jennifer eine fatale Gleichung auf: Die katastrophalen Auswirkungen der Machenschaften des Unternehmens summieren sich zum Aussterben der Menschheit! Mit diesem Wissen bewaffnet, muss sie nun vor den Schergen von GlobalENJ fliehen, um den letzten Dominostein aufzuhalten, der den Untergang unwiderruflich lostreten wird … Ein packender Wissenschaftsthriller über Kapitalismus und Korruption für Fans von Mark Dawson und Wolfgang Hohlbein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Risikoforscherin Jennifer Meyer hat nur noch sechs Monate zu leben – sie kann nur weitermachen wie zuvor und warten bis die Erbkrankheit sie dahinrafft, die bereits ihren Vater getötet hat. Als ihre Forschung sie auf die Spur des Konzerns GlobalENJ führt, der in den Schatten agiert und vor nichts Halt macht, um seinen Profit zu steigern, stellt Jennifer eine fatale Gleichung auf: Die katastrophalen Auswirkungen der Machenschaften des Unternehmens summieren sich zum Aussterben der Menschheit! Mit diesem Wissen bewaffnet, muss sie nun vor den Schergen von GlobalENJ fliehen, um den letzten Dominostein aufzuhalten, der den Untergang unwiderruflich lostreten wird …
Über den Autor:
Daniel Westland schreibt Sachbücher und Thriller. Er war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und ist überzeugt, dass zwei Dinge die Welt besser machen: Wissen und Träumen! Er lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat drei Kinder.
Die Website des Autors: danielwestland.de
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor »RISK – Die Todesformel«, »REVERSE« und »Das Raum-Paradoxon«.
***
eBook-Neuausgabe April 2025
Dieses Buch erschien bereits 2012 unter dem Titel »Schwarze Schwäne« bei script5
Copyright © der Originalausgabe 2012 script5 ein Imprint der Loewe Verlag GmbH, Bindlach
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/sergio 34
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-659-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Daniel Westland
Risk – Die Todesformel
Thriller
dotbooks.
Motto
Dein Blick
wie die Sonne
erhellt den Raum
und lässt mich sein wollen
wie ich wäre
Kapitel 1
Jennifer trug ein rosa Top mit Spaghettiträgern, eng anliegende Jeans und regenbogenbunte Sneakers mit Glitzersteinen. Genau das richtige Outfit für russisches Roulette mit sechs Schuss im Revolver. Sie hatte beschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen, und ihr Outfit für den heutigen Tag ganz bewusst gewählt.
»Happy birthday to you!«, sagte Jonas leise, während sie beide zum Fenster der Schwebebahn hinausschauten.
Gerade war ihr Haus in Sichtweite gekommen, in dessen Garten sie zahllose Kindergeburtstage gefeiert hatten. Sie hatten sich immer abgewechselt: Einmal durfte Jennifer zuerst feiern, dann war ihr Bruder Jonas am folgenden Wochenende dran. Im nächsten Jahr umgekehrt. Jennifer verspürte einen Stich, als sie an diese unbeschwerten Kindheitstage zurückdachte.
»Ich wünsche dir die besten sechs Monate deines Lebens, Schwesterherz!«
Jennifer wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und stieß ihrem Zwillingsbruder den rechten Zeigefinger in die Rippen. »Ich dir auch. Und außerdem viel Spaß beim Rest deines Lebens.«
»Ach, komm schon«, meinte Jonas, »du bist doch sonst nicht so missgünstig.«
Jennifer spürte, dass ihr Bruder sich um einen entspannten Ton bemühte, der ihm aber nicht richtig gelingen wollte. »Sonst hat mir ja auch nicht der zweite Arzt innerhalb einer Woche versichert, dass ich bald draufgehen werde.«
»Okay, okay, da hast du natürlich recht«, wehrte Jonas ab. »Aber trotzdem. Was bleibt uns denn anderes übrig, als das Beste daraus zu machen? Glaubst du etwa, ich finde das witzig?«
Ein herausforderndes Funkeln trat in Jennifers Augen. »Ich hätte gedacht, du freust dich – so mies, wie du mich mein Leben lang behandelt hast!«
»Mies?! Ich?!«, empörte sich Jonas, grinste dabei aber erleichtert. »Also wirklich! Seit zweiundzwanzig Jahren bin ich dein Bollwerk, dein älterer Bruder, dein Schutzengel!«
Unwillkürlich hob Jennifer bei diesem Wort die Hand zu dem kleinen Schutzengel, der an einer dünnen silbernen Kette um ihren Hals hing. Sie hielt einen Moment inne, während ihre Augen über die Häuser und Täler Wuppertals glitten, ohne wirklich etwas wahrzunehmen. Doch dann fand sie wieder in die Realität zurück.
»Quatsch!«, widersprach sie Jonas. »Nun mach dich mal nicht wichtiger, als du bist, nur weil du zuerst geboren wurdest. Jedes Jahr muss ich mir diesen Blödsinn anhören, dabei beweist das einfach nur, dass du unsäglich schlechte Manieren hattest – und im Übrigen immer noch hast!«
Sie bemühte sich um ein Grinsen, aber es fiel gequält aus. Dann wandte sie sich von ihm ab und schaute wieder zum Fenster hinaus. Die Schwebebahn war weit über hundert Jahre alt und stand unter Denkmalschutz. Irgendwie war es traurig, das ganze Leben in einer Stadt verbracht zu haben, die für nichts anderes bekannt war als für ihr berühmtes Transportmittel des öffentlichen Personennahverkehrs. Genau genommen war Wuppertal ein elendes Kaff. Als Teenager hatten sie sich beide geschworen abzuhauen, sobald es ging, aber dann war es doch ausgesprochen bequem gewesen, das Studium einfach in der Heimatstadt zu beginnen. Die Wohnung, die sie sich als WG mit Jonas teilte, gehörte einer Freundin ihrer Mutter und letztlich war es auch gut gewesen, vor Ort zu sein, als Clemens so krank wurde.
Sechs Monate, hörte sie die Stimme des Arztes in ihrem Kopf. Sie würde gerade noch die erste Hälfte des nächsten Semesters mitbekommen. Die letzten Tage hatte sie es bewusst vermieden, darüber nachzudenken, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen sollte. Aber jetzt blieb ihr nichts anderes mehr übrig. Jeder Tag zählte, jede Stunde. 4.320 Stunden, knapp 260.000 Minuten. Wobei – zum Ende hin würden ihre Hormone verrücktspielen und ihr Körper »Ausfallerscheinungen« zeigen. Welche das konkret waren, hatte der Arzt auch nicht sagen können. Nur die spärliche Info, dass sich die Krankheit durch einen höchst individuellen Verlauf auszeichne, hatte er ihr noch mit auf den Weg gegeben.
Na toll, konnte sie nicht wenigstens an einer berechenbar verlaufenden Krankheit sterben? Ohne weitere Überraschungseffekte?
Wie ihr Vater litt Jennifer an einer seltenen, höchst aggressiven Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Ihr Blut fabrizierte Antikörper gegen ihre eigene Schilddrüse und fraß diese sozusagen auf. Von den sechs Monaten blieben ihr also in Wahrheit vielleicht noch drei oder vier, die sie tatsächlich aktiv nutzen konnte. 2.160 bis 2.880 Stunden, abzüglich Schlaf.
Was sollte sie mit dieser Zeit anfangen? Was wollte sie damit anfangen? Wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätte … Nein, der Gedanke war Quatsch. Wenn einem nur noch vierundzwanzig Stunden blieben, würde man sich mit Freunden und der Familie treffen, gut essen, auf irgendeinen Berg klettern und in die Ferne schauen. Aber das konnte man nicht neunzig Tage hintereinander machen!
Ein halbes Jahr erschien Jennifer nicht lang genug, um wirklich etwas zu erleben. Andererseits war es zu lang, um die Gelegenheit zu verschwenden, vielleicht wenigstens den einen oder anderen ihrer Träume wahr werden zu lassen. Aber wovon genau träumte sie eigentlich? Wie stellte sie sich das Leben vor? Was wünschte sie sich, wonach sehnte sie sich, was fehlte ihr?
Clemens.
Ja, am meisten fehlte ihr der Vater.
Der Schmerz, die Trauer und die Einsamkeit trafen sie wie ein Faustschlag in den Magen. Jennifer war in einer religionslosen Familie aufgewachsen und glaubte nicht an ein Leben nach dem Tod. Die Feststellung, dass sie ihrem Vater bald folgen würde, hatte für sie nichts Tröstliches. Das Wissen darum, dass Clemens für immer aus ihrem Leben verschwunden war, schmerzte so sehr, dass sie sich mit aller Macht zwang, ihre Gedanken in eine andere Richtung zu lenken.
Drachenfliegen. Einen Roman schreiben. Die Welt umsegeln. Sich mit Haut und Haaren, Hals über Kopf verlieben – obwohl, das wäre dann auch blöd. Etwas erfinden. Eine Sprache lernen. Die acht Weltwunder sehen, oder wenigstens eins. Sich mit ihrer Mutter besser verstehen …
»Was denkst du?«, fragte Jonas.
»Nichts«, sagte Jennifer und starrte weiter zum Fenster hinaus. Heute Abend würde sie sich hinsetzen und eine Liste machen: 100 Dinge, die ich tun will, bevor ich sterbe. Oder vielleicht sollte sie lieber nur fünfzig nehmen? Oder dreißig? Kam ja auch darauf an, wie lange es jeweils dauerte, bis sie einen Punkt abhaken konnte.
Schweigend fuhren sie weiter bis zur Ohligsmühle. Kurz bevor sie den Bahnhof erreichten, bemerkte Jennifer Jonas Blick: Es lag ein freudiges Funkeln, aber auch eine stumme Frage darin. Unwillkürlich begann Jennifer zu grinsen und wollte sich den Bruchteil einer Sekunde später erheben, doch Jonas war schneller. Er sprang abrupt auf und drückte Jennifer zugleich mit einer Hand auf die Schulter, um sie in ihren Sitz zu pressen. Es war ihr altes Spiel aus Kindertagen, dessen sie nie müde wurden: Wer von ihnen schaffte es zuerst zur Tür hinaus auf den Bahnsteig? Wie oft war einer von ihnen dabei gestolpert, hingefallen oder gegen die Wand neben der Tür gerannt … Trotzdem war es immer ein Riesenspaß und der missbilligende Blick der Leute war es sowieso wert.
Da Jonas impulsiver als Jennifer war, gelang es ihm meist, sie einfach zur Seite zu drängen, doch heute stemmte sie sich kraftvoll gegen seinen Druck und schnellte ebenfalls hoch, sodass sie sich nebeneinanderher zwischen den Sitzen hindurch zur Tür drängelten, während der Zug zum Stehen kam. Jennifer hob den Arm und versuchte, Jonas zwischen zwei leere Sitzbänke zu schubsen, aber ihr Bruder konnte den Kurs halten. So erreichten sie zeitgleich den Bereich vor der Tür, die sich bereits öffnete, weil jemand einsteigen wollte.
Das verschaffte Jennifer einen winzigen Vorteil, weil sie sich auf der Seite des Bahnsteigs befand. Schwungvoll warf sie sich nach links und hechtete mit ein klein wenig Vorsprung zur Tür hinaus, streifte dabei jedoch einen Mann, der gerade die Bahn betrat. Sie wirbelte herum und strich sich die blonden Haare aus dem Gesicht. »Entschuldigung, das wollte ich nicht«, sagte sie mit einer Stimme, in der sowohl Freundlichkeit als auch eine entschlossene Strenge lagen und mit der sie meist bekam, was sie wollte. So auch diesmal.
»Schon gut, kein Problem«, sagte der Mann lächelnd. Seine Arme waren von den Schultern bis zu den Handgelenken mit brutalen Tätowierungen übersät.
Jonas trat nun ebenfalls aus dem Zug und schaute dem Muskelpaket mit halb offenem Mund hinterher.
»Genau dein Typ, was? Aber ich schwöre dir, wenn, dann nimmt er mich, nicht dich«, flüsterte Jennifer grinsend und knuffte ihren Bruder in die Seite. »Und dann auch noch langsamer als ich, obwohl du vor mir losgelaufen bist.«
Für einen Moment verdrängte eine kindliche Freude den dunklen Schatten, der seit einer Woche über Jennifer hing. Der unerwartete Zusammenbruch, Notaufnahme und Krankenhaus, dann die Diagnose. Jonas war immer an ihrer Seite gewesen. Doch genau in diesem Augenblick waren sie für einen Moment, was sie immer gewesen waren: Zwillingsgeschwister, die in einem ständigen, allumfassenden Wettbewerb miteinander standen.
»Ich wollte dich eben auch mal gewinnen lassen. Wo du doch nicht mehr viele Gelegenheiten dazu hast!«, konterte Jonas.
Jennifer presste die Lippen aufeinander. Sie wusste, dass ihr Bruder mit seinen dummen Scherzen nur versuchte, seine eigene Angst um sie zu überspielen. Langsam atmete sie ein und wieder aus. »Ihr könnt euch bewusst machen, dass jedes Ausatmen ein Ende darstellt, jedes Einatmen einen neuen Anfang«, hatte der Therapeut ihnen nach dem Tod ihres Vaters im letzten Herbst gesagt. Jonas hatte damit nichts anfangen können, Jennifer aber griff seitdem in Krisenmomenten immer auf diese hilfreiche Technik zurück.
Sie atmete noch einmal tief durch und sagte dann leise: »Du hast ja recht. Aber ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, bis wir Witze darüber machen können, okay?«
Jonas nickte und berührte kurz liebevoll ihre Wange. »Klar. Tut mir leid.«
Jennifer schlang ihre Arme um ihren Körper und rieb mit den Händen die Oberarme, als wäre ihr urplötzlich eiskalt geworden. Dann wandte sie sich wortlos ab und ging los. Vorhin beim Arzt hatte Jonas gar nicht lockergelassen. »Chemotherapie, Transplantation, Blutwäsche – es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, Jennifer zu helfen!«, hatte er geradezu ultimativ gefordert. Doch der Arzt hatte nur traurig den Kopf geschüttelt. Der hatte bestimmt auch keine Lust darauf, solche Diagnosen zu stellen. Im Moment bekam sie noch nicht mal Medikamente. Erst wenn Symptome auftraten, würde man sie behandeln können.
Jennifer hegte keinen Zweifel daran, dass Jonas sein Leben für ihres gegeben hätte, und normalerweise kam sie auch ganz gut mit seinen zynischen Witzen klar. Es war eben seine Art, mit Dingen umzugehen, die nicht so liefen, wie sie sollten. Während seines Coming-outs war es besonders schlimm gewesen, doch gerade hatte sein Spruch sie sehr getroffen. In ein paar Tagen gerne wieder, dachte Jennifer, aber heute war alles noch zu frisch. Sie fühlte sich wund und unsicher.
Jonas hatte schon fast zu ihr aufgeschlossen, als ein Mann über den Bahnsteig gerannt kam. Er hatte sehr kurz geschnittenes Haar und mochte etwa vierzig Jahre alt sein. Seine Schuhe waren staubig, seine Hose fleckig, das Hemd war zerknittert. Er hielt sich mit der rechten Hand den Bauch, als hätte er Schmerzen.
Die Bahn hinter ihnen begann zu piepsen, um das bevorstehende Schließen der Türen anzuzeigen. Der Mann wollte sich im letzten Moment zwischen Jennifer und Jonas hindurch in den Wagen werfen, geriet aber aus dem Gleichgewicht und prallte wie eine Kugel im Flipperautomat erst gegen Jonas, dann gegen Jennifer. Das Gesicht des Mannes war dem ihren für einen kurzen Moment ganz nah und sie nahm einen merkwürdigen, leicht fauligen Geruch wahr, ehe er schließlich direkt neben der noch offen stehenden Tür gegen die Seitenwand der Schwebebahn taumelte.
Ungläubig schaute Jennifer zu, wie sein ganzer Körper in sich zusammenzusacken schien und er nach hinten kippte wie eine halbschlaffe Gummipuppe. Seine Schulter traf zuerst auf den Beton, dann die Hüfte und schließlich, mit einem erschreckenden Geräusch, sein Kopf. Die Augen des Mannes waren geschlossen. Er rollte noch ein wenig nach vorn, dann blieb er – halb auf der Seite, halb auf dem Bauch – reglos liegen.
Die Türen der Schwebebahn schlossen sich nun vollständig und im nächsten Moment fuhr sie auch schon davon. Jennifer und Jonas sahen einander entgeistert an. Dann kamen die Erinnerungen an den Erste-Hilfe-Kurs zurück, den sie vor zwei Jahren wiederholen mussten, als sie sich einen Sommerjob als Rettungsschwimmer geteilt hatten. Jennifer riss ihre kleine Handtasche von der Schulter und warf sie beiseite, dann beugte sie sich hinunter und brachte den Mann in die stabile Seitenlage.
»Soll ich dir helfen?«, fragte Jonas, aber Jennifer schüttelte den Kopf, während sie versuchte, den Puls des Mannes zu fühlen. »Schnell und deutlich«, stellte sie nach wenigen Sekunden erleichtert fest.
Ein gutes Zeichen. Dann zog sie das Kinn des Mannes herunter und schaute ihm in Mund und Rachen, um festzustellen, ob die Luftröhre mit Erbrochenem verstopft war. Seine Zunge sackte aus dem Mund, dazu ergoss sich ein Blutschwall auf den Boden. Sie kniff die Augen zusammen und spähte in den Mund hinein. »Die Atemwege scheinen frei zu sein«, sagte sie ungerührt und warf ihrem Bruder einen Blick zu, der die Nase rümpfte.
»Und was jetzt?«, fragte er unsicher.
Jennifer schaute sich suchend um, dann entdeckte sie den Notrufknopf am Treppenaufgang. »Ruf einen Krankenwagen«, wies Jennifer ihren Bruder an und nickte in Richtung der Notrufsäule. Sie hatte die Hoffnung, dass auf diesem Weg schneller Hilfe käme als per Handy.
Als Jennifer sich wieder dem Mann zuwandte, schlug er die Augen auf und begann gleichzeitig, wie elektrisiert zu zucken. Seine Arme und seine Wange schabten über den rauen Beton, er schien Worte formen zu wollen, aber es gelang ihm nicht. Unter großer Mühe beugte er den rechten Arm und tastete nach einer kleinen schwarzen Tasche an seinem Gürtel, während er weiter von Krämpfen geschüttelt wurde. Er versuchte vergebens, den Druckknopf zu öffnen. Jennifer beugte sich vor, zog die Lasche des Täschchens hoch und holte eine beängstigend große Spritze daraus hervor.
»Hhrr«, stieß der Mann heiser hervor und schlug sich mit der Hand erst auf die Brust, dann auf den Bauch. »Hhrr!«
Jennifer starrte erst ihn, dann die Spritze an. Der Mann riss seine Augen noch weiter auf, während er von zunehmend intensiveren Krämpfen geschüttelt wurde. »Hhrr!«, machte er erneut in dem erkennbaren Bemühen, sich verständlich zu machen, und deutete wieder auf den Bauch.
Jennifer zögerte nur noch einen Moment, aber die Lippen des Mannes verfärbten sich bereits blau. Obwohl seine Atemwege frei waren, nahm er offensichtlich zu wenig Sauerstoff auf. Nachdem sie die Schutzkappe von der Nadel entfernt hatte, zog sie dem Mann das Hemd aus der Hose, packte mit der freien Hand die Haut seines Bauches, bildete eine Falte, stieß die Spritze hinein und drückte den Kolben nach unten.
Augenblicklich ebbten die Krämpfe ab, dann schloss der Mann seine Augen und sein Kopf fiel zurück auf den Boden. Plötzlich sog er deutlich hörbar durch den Mund Luft ein, zweimal, dreimal, und seine Lippen nahmen wieder Farbe an. Wenige Sekunden später jedoch schloss sich sein Mund und sein Körper erschlaffte vollständig.
Jennifer versuchte, Ruhe zu bewahren, und atmete tief durch. Entweder hatte sie dem Mann gerade das Leben gerettet – oder ihn umgebracht. Sie legte die leere Spritze beiseite und ließ sich zittrig auf ihre Fersen sinken. »Könntest du jetzt besser doch noch einen Krankenwagen rufen?«, bat sie Jonas.
»Klar.« Er nickte und lief los. Aber noch bevor er das Notrufgerät erreicht hatte, kamen zwei Sanitäter in voller Montur und samt Trage die Treppe hochgelaufen, wenige Schritte hinter ihnen folgte ein Notarzt.
Erleichtert richtete Jennifer sich auf und sah den Männern entgegen. Auf ihren Uniformen trugen sie ein Symbol, das sie noch nie gesehen hatte, ein weißes Kreuz auf rotem Grund in einem blauen Kreis. Bestimmt einer dieser privatisierten Krankentransporte. Der Arzt war, ungewöhnlich für ein Kaff wie Wuppertal, Asiate.
Jonas deutete sofort in Richtung des Ohnmächtigen auf dem Bahnsteig und die drei Männer liefen, ohne innezuhalten, an ihm vorbei. Sie stellten die Trage ab und der Arzt schob Jennifer beiseite, während er eine Spritze aus seiner Arzttasche zog.
Jennifer schoss die Frage durch den Kopf, wer den Krankenwagen gerufen hatte – vielleicht ein anderer Fahrgast oder der Schwebebahnfahrer, der den Vorfall während des Abfahrens auf dem Monitor beobachtet hatte.
»Er ist einfach umgefallen. Hatte Puls und Atmung, aber scheinbar Sauerstoffmangel«, berichtete Jennifer dem Arzt. »Er trug eine Spritze in dieser Tasche und ich hatte den Eindruck, er wollte mich darauf aufmerksam machen. Ich habe sie ihm in den Bauch verabreicht, wie eine Diabetesspritze. War das okay?«
»Oh«, machte der Arzt und packte seine eigene Spritze wieder ein. Er schaute Jennifer mit gerunzelter Stirn streng an, als hätte sie etwas falsch gemacht, sagte dann aber: »Das ist gut. Das war ganz richtig von Ihnen.«
Mit einer kurzen Handbewegung wies er seine Kollegen an, den Patienten auf die Trage zu befördern.
»Außerdem hat er aus dem Mund geblutet«, ergänzte Jennifer noch und deutete auf die Blutlache am Boden.
Der Arzt zuckte mit den Schultern und schien unbeeindruckt. »Das kommt vor«, entgegnete er kühl und erhob sich.
»Müssen Sie nicht noch …?«, begann Jennifer zu fragen, aber der Asiate starrte sie nun aggressiv an.
»Was? Muss ich was? Fragen von Laien auf Bahnsteigen beantworten und wertvolle Zeit verlieren?« Er schüttelte den Kopf. »Nein. Nein, das muss ich ganz sicher nicht.« Dann setzte er in einem Ton, als hätte er die Worte auswendig gelernt und würde sie nur widerwillig aufsagen, hinzu: »Aber vielen Dank für Ihre Hilfe. Unser Patient wird es Ihnen zu danken wissen.«
Die Sanitäter schnallten den ohnmächtigen Mann gerade mit zwei breiten Lederriemen auf der Trage fest, da öffnete er erneut die Augen. Sein Blick huschte von Jonas über Jennifer zu dem Notarzt und wieder zurück zu Jennifer. Sie hatte den Eindruck, als läge etwas Flehendes in seinem Blick.
»Warten Sie«, bat sie und legte einem der Sanitäter eine Hand auf den Unterarm. Sie griff nach ihrer Handtasche und zog eine Visitenkarte daraus hervor. »Hier«, sagte sie zu dem Mann auf der Trage und schob sie in die Brusttasche seines Hemdes. »Falls Sie eine Zeugin brauchen! Ich glaube, Sie sind ausgerutscht und haben sich dabei verletzt. Also, wenn Sie möchten, rufen Sie mich gern jederzeit an!« Sie drückte dem Mann die Hand.
»Wir müssen jetzt los. Es handelt sich um einen medizinischen Notfall, ist Ihnen das nicht klar?«, herrschte der Arzt Jennifer an.
»Ist ja schon gut«, entgegnete Jonas und zog seine Schwester ein Stück beiseite, wobei er ihr beruhigend die Hand drückte.
»Los!«, befahl der Asiate seinen Männern und die drei verließen den Bahnsteig ebenso zügig, wie sie erschienen waren.
Jennifer sah ihnen verwundert hinterher. Sie spürte, wie ein leichtes Zittern sie erfasste, doch dann fuhr die nächste Bahn ein und sie mussten zur Seite ausweichen, um den aussteigenden Passagieren Platz zu machen. Jennifer griff nach ihrer Tasche und nickte kurz ihrem Bruder zu. »Komm! Wir waren heute schon lange genug unterwegs und ich habe Mama versprochen, dass ich mich bei ihr melde, wenn ich weiß, was der Arzt gesagt hat.«
Auf dem Nachhauseweg liefen die Szenen in der Arztpraxis und auf dem Bahnsteig als Endlosschleife in Jennifers Kopf. Und obwohl Jonas neben ihr herging und sogar einen Arm um ihre Schultern gelegt hatte, ließen die letzten Stunden nur einen Gedanken zu: Was für ein blöder Geburtstag!
Einsatzleiter Young-Sun Bak setzte sich ans Steuer des »Rettungswagens«. Einsätze wie dieser, in denen er binnen Sekunden entscheiden und improvisieren musste, waren der Grund, weshalb er seinen Job liebte. Und das Mädchen war süß gewesen. Schlank, aber nicht zu schlank, hellblaue Augen, ein aufmerksamer, beinahe widerspenstiger Blick und lange blonde Haare. Schade, dass er sie nie Wiedersehen würde.
Er ließ den Motor aufheulen, schaltete das Blaulicht ein und jagte vom Parkplatz, wobei er beinahe einen Volvo streifte, der gerade gemächlich einbog. So schnell wie möglich fuhr er vom Stadtzentrum weg und nach zehn Minuten entdeckte er, wonach er suchte: den riesigen Parkplatz eines Vorort-Einkaufszentrums. Er parkte in der hintersten Ecke – hier würde sie garantiert niemand stören – und wandte sich um.
Dr. Wagner, ein richtiger Mediziner, hatte jetzt die Betreuung des Patienten übernommen. Über einen Tropf verabreichte er Gregor Gehrmann eine entkrampfende Lösung. Gegen die Schmerzen hatte er dem Mann schnell lösliche Tabletten unter die Zunge geschoben, jetzt reinigte und bandagierte Wagner die Schürfwunden an Kopf und Arm.
Young-Sun griff zielgerichtet zur Seitennaht von Gehrmanns Oberhemd und zog ein schmales, etwa zehn Zentimeter langes Stäbchen aus einer speziellen Tasche, die dort angebracht war. Das Ding sah aus wie eines dieser Leuchtstäbchen, die Kinder so liebten. In Wahrheit handelte es sich jedoch um einen äußerst präzisen GPS-Sender samt Lagesensor, der augenblicklich Alarm gab und die aktuelle Position bis auf eineinhalb Meter genau sendete, sobald er zwischen sechs Uhr morgens und zehn Uhr abends länger als vier Sekunden mehr als sechzig Grad aus der Senkrechten gebracht wurde. Nachts im Schlaf traten die Anfälle praktisch nie auf. Im Grunde funktionierte das Gerät genau wie die automatischen Notrufsender für Rentner, nur viel schneller und präziser.
Young-Sun warf den Sender in einen bereitstehenden Mülleimer, weil nicht abzusehen war, ob das Gerät bei dem Sturz Schaden genommen hatte. Und die Dinger waren nicht teuer – knapp unter dreihundert pro Stück.
»So«, sagte er. »Vernehmung.«
Dr. Wagner nickte und hob eine Hand, in der er eine Spritze mit einer klaren Flüssigkeit hielt. Er tastete nach Gehrmanns Rippen, stieß die Nadel dann vorsichtig zwischen ihnen hindurch in die nächste Umgebung des Herzens und injizierte dem Patienten drei Milliliter reines Adrenalin. Nach wenigen Sekunden begann Gehrmann zu schwitzen, schließlich schlug er die Augen auf. Seine Lider flatterten und er stemmte sich gegen die Riemen, mit denen er auf der Liege festgeschnallt war.
»Fünf Minuten, höchstens«, warnte Wagner.
»Schon klar, Doc«, sagte Young-Sun. Sie arbeiteten nicht zum ersten Mal zusammen. »Was ist passiert?«, fragte er dann den Patienten.
Gehrmann begann zu reden wie ein Wasserfall. Bei dieser Studie hatten sie wirklich Glück. Alle Probanden wollten gern mitmachen, auch wenn das ganze Prozedere rundum illegal war. In Internetforen hatten sie gezielt Gerüchte über ein neues Medikament gegen multiple Sklerose gestreut. Die Interessenten, die sich daraufhin meldeten, waren zu einem Test eingeladen worden – der offiziell in einer Messbarkeitsstudie eines bereits erhältlichen Mittels bestand, in Wahrheit aber bekam die Hälfte der Teilnehmer statt des erprobten Heilmittels ein wirkungsloses Placebo und die als »Placebo« ausgelosten Teilnehmer erhielten die Neuentwicklung. So konnte man ohne die teuren offiziellen Prüfverfahren herausfinden, wie vielversprechend die Entwicklung war.
Gehrmann sprudelte hervor, dass er sich bereits seit gestern schlecht fühle, Krämpfe, Lähmungserscheinungen, sensorische Aussetzer, das volle Programm, und dass er daher unangemeldet ins Labor hatte kommen wollen, doch dann sei ihm schwarz vor Augen geworden. Eine junge Passantin habe ihm die lebensrettende Cortisonspritze verabreicht.
Young-Sun schaltete das digitale Aufnahmegerät ab, schloss es an den Laptop an und fertigte einen Print der Aussage, den er Gehrmann zum Unterschreiben hinhielt. Der schaffte es vor lauter Erregung kaum, seinen Namen leserlich auf das Blatt zu kritzeln.
Noch während Young-Sun das Dokument zum Abspeichern durch den tragbaren Scanner zog, verpasste Wagner dem Patienten eine K.O.-Spritze und beobachtete dann auf dem Monitor das steile Abfallen der Herzfrequenz – nur um bei einem Puls von vierzig den Tropf aus der Braunüle auf dem Handrücken zu ziehen und intravenös eine bewährte Mischung aus Beruhigungs- und Aufputschmittel zu verabreichen, die zu einem Drittel mit einem noch nicht für die offizielle Nutzung zugelassenen vollsynthetischen Polymer angereichert war, das eine vollständige und augenblickliche Löschung aller chemischen Verbindungen im Kurzzeitgedächtnis verursachte. Schnell genug nach einem bestimmten Ereignis angewandt, war dies eine narrensichere Vergessensdroge.
Nachdem Gehrmann wenig später wieder aufgewacht war, befragte Young-Sun ihn erneut, um völlig sicherzugehen. Da der Proband sich an nichts erinnern konnte, legte der Einsatzleiter ihm ein mögliches Geschehen in den Mund, das keinerlei negative Rückschlüsse auf das getestete Medikament zuließ. Erst als all das erledigt war, setzte Young-Sun sich wieder ans Steuer und verließ den Vorstadtparkplatz.
Das Navigationsgerät wies ihm den Weg zur firmeneigenen Klinik im Ebbegebirge, die weder in einem Telefonverzeichnis noch im Internet zu finden war. Nur eine Handvoll Eingeweihter wusste, was sich hinter den Mauern des sonst so unscheinbaren Gebäudes tatsächlich verbarg.
Prof. Dr. Dr. Ekhardt Hirschberger liebte seine Spielzeuge. Von der Abfindung hatte er sich einen roten Jaguar E-Type geleistet, selbstverständlich makellos instand gesetzt. Cabrio. Weißes Leder. Er ließ den Wagen um die Kurven sausen. Derart abgeschieden zu wohnen wie er, wurde nur durch die kleinen Freuden des Alltags erträglich.
Er zischte durch das kleine Dörfchen, in dem er seine Lebensmittel erwarb, wechselte dann am Ende der Hauptstraße die Straßenseite und hielt schließlich vor dem Briefkasten auf der linken Seite. Man konnte meilenweit sehen. Das Fenster surrte leise herunter, der elektrische Fensterheber war tatsächlich die beste Nachrüstung überhaupt gewesen. Wie hatten die Menschen früher nur gelebt?
Er beugte sich nach rechts und öffnete das Handschuhfach. Darin lagen zwanzig Briefe, deren Adressdaten ihn deutlich mehr gekostet hatten als der Wagen. Aber wenn auch nur ein Viertel seiner Anfragen Erfolg hatte, würde sich diese Investition zweifellos innerhalb weniger Jahre auszahlen – von dem unvermeidlichen Weltruhm, den er im Kreise seiner Kollegen erzielen würde, einmal ganz abgesehen.
Hirschberger warf die Briefe in den Kasten, dann klappte er sein Handschuhfach wieder zu, sah sich um, warf sicherheitshalber noch einen Blick in den Rückspiegel und fuhr schließlich los. Immer geradeaus, bis zu einem kleinen Aussichtspunkt am Straßenrand, wo er eine Zigarette rauchen und den Sonnenuntergang genießen würde. Sein etwas zu langes weißes Haar wurde vom Wind zerzaust. Das Leben war großartig – seines jedenfalls.
Jennifer und ihre Mutter mailten einander regelmäßig alle zwei, drei Tage, seit Stephanie vor vier Monaten nach Hongkong gegangen war. Acht Jahre lang hatte sie als Geschäftsführerin den deutschen Standort eines international erfolgreichen Softwareunternehmens geleitet. Nun war sie seit Anfang des Jahres dafür verantwortlich, die Expansion im asiatischen Raum voranzutreiben. Das war ihre Art, nach Clemens Tod der Leere im Haus zu entgehen. Nach der ersten Diagnose hatte ihre Mutter angeboten, sofort nach Hause zu kommen, aber Jennifer hatte abgelehnt – sie wollte erst die zweite Meinung abwarten.
Jetzt öffnete sie das Fenster des Videochats und wählte ihre Mutter aus der Kontaktliste. Es klingelte, dann erschien nach kurzer Verzögerung Stephanies Gesicht. »Hi!«, sagte Jennifer. Sie gab sich Mühe zu lächeln.
»Hallo! Wie geht es dir? Was hat der Arzt gesagt?«, fragte ihre Mutter. Sie hatte das Gespräch auf dem Handy angenommen. Es war später Abend in Hongkong und im Hintergrund konnte Jennifer durch ein Panoramafenster die Lichter Kowloons glitzern sehen.
»Schlechte Nachrichten«, sagte Jennifer leise. »Er sagt, man kann nichts machen. Mir bleibt noch ein halbes Jahr.«
Ihre Mutter schloss die Augen. Es tat Jennifer fast noch mehr weh, ihren Schmerz zu sehen, als den eigenen auszuhalten.
»Soll ich kommen?«
Jennifer schüttelte den Kopf. »Danke. Aber – nein. Ich muss erst mal meine Gedanken sortieren. In einem halben Jahr kann man eine Menge anstellen und es gibt so vieles, was ich unbedingt noch erleben will. Ich war zum Beispiel noch nie in Hongkong; vielleicht sollte also lieber ich dich besuchen kommen als umgekehrt.«
Ihre Mutter zuckte mit den Schultern und zog die Augenbrauen hoch. »Das stimmt natürlich. Okay. Ich bin innerhalb von vierundzwanzig Stunden bei dir, wenn du mich brauchst. Sag mir einfach Bescheid.«
Jetzt lächelte Jennifer wirklich. »Danke, Mama, das mach ich. Bis bald.«
Sie legten auf. Jennifer spürte einen dicken Kloß in ihrer Kehle und wischte sich mit dem Handrücken über die Augen.
Es war einfach nur beschissen, so früh im Leben sterben zu müssen.
Kapitel 2
Professor Koch kam mit hochrotem Kopf zur Tür herein. Er knallte Jennifer und Thorge die Rechercheunterlagen auf den Tisch. »Was soll ich denn damit anfangen? Halten Sie mich für einen Vollidioten? In dem ganzen Stapel steht nichts, was ich nicht noch aus meinem Grundstudium wüsste – und wie Sie sich denken können, ist das bei mir schon eine geraume Zeit her! Ihre Aufgabe bestand darin, den aktuellen Forschungsstand zu dokumentieren! Das hier ist ein Geschichtsbuch der Biomathematik.«
»Aber –«, begann Thorge.
Schwerer Fehler. Kochs Wut konzentrierte sich nun ganz auf seinen Laborleiter. »Wollen Sie etwa behaupten, Sie und … äh … « Er warf einen Blick in Jennifers Richtung.
»Jennifer«, half ihm Thorge auf die Sprünge.
»Ja. Selbstverständlich. Wollen Sie etwa behaupten, Sie und Jennifer hätten mehr als eine Viertelstunde aufgewandt, um das hier zusammenzustellen?«
An seiner Schläfe pulsierte eine Ader. Koch war ein fantastischer Chef, engagiert und einfallsreich, aber er hatte durchaus seine menschlichen Schwächen. Er war ein echter Choleriker, wenn ihm etwas nicht passte.
»Doch, wir –«, begann Jennifer jetzt.
Koch wandte sich in ihre Richtung und zog wortlos die Augenbrauen hoch. Jennifer war fünf Jahre jünger als Thorge und jobbte hier nur in den Semesterferien als wissenschaftliche Hilfskraft. Thorge hingegen war schon fast mit seiner Promotion fertig und hatte eine feste Stelle bei RISK, einem Spin-off der biomathematischen Fakultät der Universität Wuppertal. Mit Geldern der UNO und der Weltgesundheitsorganisation betrieb RISK internationale Risikoforschung und bestand aus einem Netzwerk aus sieben rechtlich selbstständigen Firmen, einer auf jedem Kontinent.
Koch atmete tief durch und bemühte sich erkennbar um einen gemäßigten, wenn auch strengen Tonfall. »Ich benötige die Unterlagen rechtzeitig vor der Konferenzschaltung mit den Kollegen in New York um siebzehn Uhr unserer Zeit. Wenn Sie«, er warf Thorge einen Blick zu, »ein brauchbares Abstract voranstellen, reicht also um vier.« Dann brach sich sein Zorn doch noch Bahn. »Ansonsten sitzen Sie auf der Straße, alle beide.«
Koch wandte sich ab und verließ das Büro. Wenn er nicht mehr wütete, sondern schmallippig wurde, wirkte er noch viel bedrohlicher, fand Jennifer. Erstaunlich, dass ein an sich richtig cooler Typ so eine strenge, unangenehme Seite hatte.
Koch hatte Jennifer schon im ersten Semester imponiert. Der Professor war mit zweiundfünfzig Jahren zum Leiter der Fakultät ernannt worden und damit einer der jüngsten Kollegen unter den Fakultätsleitern gewesen. Mittlerweile war Timotheus Koch einundsechzig, zweifacher Großvater und gehörte zu den ältesten Mitarbeitern der Universität. Dennoch zählte er nicht etwa die Monate bis zu seiner Pensionierung, denn er forschte mit großer Leidenschaft und genoss die Arbeit mit den Studenten. Sie hielten ihn jung, betonte er immer wieder. Koch kam meist in Stoffhosen, einem Polohemd mit wildem Aufdruck und lässigen Segeltuchschuhen ins Büro. Heute allerdings trug er Anzug und Krawatte.
Doch nicht nur Koch und seine überaus engagierte Lehrtätigkeit hatten Jennifer imponiert, auch die Ausgründung RISK, die er zusätzlich leitete, war in ihren Augen ein hoch spannendes Feld. RISK widmete sich der kommerziellen Auswertung einer von Kochs wissenschaftlichen Thesen, nämlich dass es möglich sein müsste, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der zu jedem gegebenen Zeitpunkt an jedem beliebigen Ort eine Katastrophe eintreten wird, egal ob natürlichen oder anderen Ursprungs. Er wollte sozusagen die »Tödlichkeit« in einem dreidimensionalen Zeit-Ort-Gefahr-Graph abbilden. Beispielhaft wollte Koch dies an den experimentellen Ergebnissen einer ihm bekannten Forschergruppe zeigen. Die Kollegen arbeiteten daran, aus menschlicher DNA künstliche Haut zu »züchten«, um sie Brandopfern innerhalb weniger Stunden für Transplantationen zur Verfügung zu stellen, doch die Ergebnisse waren überraschend schwankend. Koch versuchte, die Erfolge und Misserfolge in Zeit-Raum-Koordinaten zu fassen und – unter Einbeziehung zahlreicher weiterer Faktoren – sogar Voraussagen zu treffen.
Kochs Forschung wurde mit Geldern von Regierungsorganisationen unterstützt – in ihrem Fall WHO und UNO. Die Weltgesundheitsorganisation saß in Genf und war der weit angenehmere Partner. Bei den Vereinten Nationen in New York wollte man möglichst schnell möglichst viele Erfolge feiern. Deshalb konnte Jennifer gut nachvollziehen, dass Koch auf die heutige Telefonkonferenz perfekt vorbereitet sein wollte.
Thorge kaute an seinen Fingernägeln herum. Er war ganz blass geworden. »Ich kann es mir nicht leisten, diesen Job zu verlieren! Meine Freundin ist schwanger!«, murmelte er.
»Was?«, fragte Jennifer verdutzt. »Das sind ja mal interessante Neuigkeiten! Gratuliere!« Als sie seinen Gesichtsausdruck bemerkte, schickte sie noch ein fragendes »Oder?« hinterher.
Thorge zuckte mit den Schultern. Er war knapp einen Meter siebzig groß und wog deutlich über hundert Kilo, trug ausschließlich schwarze Klamotten – und sein Körper war mit Piercings und Tattoos förmlich übersät. Manchmal konnte Jennifer kaum glauben, dass sich hinter dieser Fassade ein unsicheres Sensibelchen verbarg.
»Doch … ja … schon«, sagte er. »Wir freuen uns. Aber es war nicht geplant und ich weiß auch nicht … also, ich weiß einfach nicht, ob wir gute Eltern sein werden. Verstehst du?«
Jennifer nickte. »Klar«, sagte sie. »Aber ich vermute, nur Leute, die am Ende schlechte Eltern werden, fragen sich nicht, ob sie gute Eltern sein werden.«
»Hm?«
»Dass du überhaupt darüber nachdenkst, zeigt meiner Meinung nach, dass du ein guter Vater werden wirst.«
»Danke. Das freut mich.« Er lächelte, dann wurde er schlagartig wieder ernst. »Aber deswegen ist es erst recht wichtig, dass ich diesen Job behalte!«
»Warum solltest du ihn denn verlieren?«
»Du hast Koch doch gehört.«
»Ach, das meint er bestimmt nicht so. Vielleicht hat er schlecht geschlafen, keine Ahnung. Ich habe doch geholfen, das Material zusammenzustellen – so schlecht ist es wirklich nicht. Aber meine Mutter ist auch manchmal so wie er. Vor lauter Stress und Aufregung voll streng. Deswegen nehme ich das nicht wirklich ernst. Das geht vorbei. Komm, wir suchen einfach die neuesten Infos raus, du schreibst eine Zusammenfassung und alles wird gut.«
Es kam ihr komisch vor, dass sie Thorge gegenüber so auftrat, schließlich arbeitete sie erst seit zwei Wochen hier und war mit Abstand die Jüngste. Aber andererseits war sie sich tatsächlich ganz sicher, dass Koch seine Drohung nicht ernst meinte. Und je schneller sie das neue Material zusammenhatten, desto schneller würde er sich auch wieder beruhigen. Außerdem war Jennifer ganz froh, dass sie etwas zu tun hatte, denn dann musste sie nicht dauernd daran denken, dass ihr nur noch wenige Monate blieben.
Entschlossen stürzte sie sich in die Arbeit.
Ganz ließ sie dieser Gedanke dann aber doch nicht los, wie Jennifer sich wenig später eingestehen musste. Das Thema Zellwachstum war ihr jetzt schlicht zu nah, als dass sie sich ausschließlich rein professionell damit hätte beschäftigen können.
Thorge hatte ihr die englischsprachigen Datenbanken überlassen. Sein Fachwissen war zwar ausgezeichnet, aber Englisch war nicht seine Stärke. Nachdem Jennifer und Jonas zwei Jahre lang in Miami zur Schule gegangen waren – ihre Mutter hatte damals in den USA gearbeitet –, war ihr Englisch fließend und auf Spanisch konnte sie sich zumindest grundlegend verständigen.
Gerade loggte Jennifer sich bei Science Weekly, Natural Science, dem International Biochemical Newsletter sowie in der Datenbank des Fachbereichs Biomathematik der Universität Seattle ein und begann, aktuelle Artikel zu sichten.
Sie hatte sich für das Studienfach Biomathematik entschieden, weil es eine Möglichkeit bot, der Natur in die Karten zu gucken und zugleich die größeren Zusammenhänge des Lebens zu verstehen, bei denen jede chemische Reaktion, jedes Lebewesen nur eine statistische Größe war. Wie immer überflog sie erst einmal die Themen und Überschriften der einzelnen Artikel: »Polyglycerolsulfate zeigen starkes anti-inflammatorisches Potenzial +++ Ozonschwund über der Arktis führt zu erhöhter ultravioletter Strahlung in Skandinavien +++ Mögliche Ursache für Alzheimerkrankheit entdeckt: Ein körpereigenes Lipidmolekül hat fatale Auswirkungen, wenn es sich in Nervenzellen anhäuft +++ Konjugierte Linolsäuren, viel gepriesene Schlankheitsmittel stimulieren in der Bauchspeicheldrüse die Ausschüttung von Insulin – eine denkbare Folge: Diabetes +++ Hirntumore verändern den Zellstoffwechsel auch in gesunden Hirnregionen«
Sie druckte aus, was ihr für Koch und seine Videokonferenz relevant erschien, und blieb schließlich an einem populärwissenschaftlichen Artikel aus den USA hängen, in dem ein Experte der Universität Atlanta sich zu möglichen Risiken durch die künstliche Beschleunigung des Zellwachstums äußerte. Er gab zu bedenken, dass sich auf diese Weise auch Störungen und Fehlinformationen potenzieren könnten. Jennifer scrollte durch den Artikel und las konzentriert die Ausführungen des Autors.
»Die Bildung der DNA – die Zusammenstellung des Zellerbgutes – erfolgt ohnehin nicht fehlerfrei. Dies ist von der Natur auch so ›gewollt‹, sofern man natürlichen Prozessen einen ›Willen‹ unterstellen möchte, jedenfalls dient es evolutionär der Stärkung der Art beziehungsweise der möglichen Entwicklung neuer Arten und Lebewesen. Krebs und Autoimmunstörungen werden häufig als Zivilisationskrankheiten bezeichnet, doch in Wahrheit handelt es sich um simple Fehler bei der Zellreproduktion, die in unserer hochzivilisierten Welt vermehrt auftreten, weil die Menschen aufgrund der verbesserten Gesundheitsvorsorge weitaus älter werden als bisher. Dennoch ist der Verdacht zumindest nicht zu entkräften, dass weitere Elemente – Schadstoffe, Abgase, Lebensweise und Ernährung, möglicherweise sogar psychologische Faktoren – diese Entwicklung verstärken oder beeinflussen.«
Jennifer runzelte die Stirn. Sie hatte sich immer gegen diese »Selbst-schuld«-Weltsicht gesträubt, die unterstellte, Krebspatienten und andere Kranke hätten einfach die falschen Entscheidungen im Leben getroffen. Sicher war es möglich, sich zu Tode zu saufen oder aufgrund jahrelanger Arbeit mit Asbestfasern zu erkranken. Doch im Normalfall war die Sache weit einfacher – wenngleich auch brutaler: Jennifers Ansicht nach hatte man entweder Glück oder eben Pech. Einer starb, ein anderer nicht. Der Natur ging es nicht um den Erhalt der Art. Das ganze Leben war einfach nur ein Haufen zielloser biochemischer Reaktionen.
Ihre Freude an einem Sonnenuntergang oder ihr manchmal unglaublicher Ärger über ihren Bruder, die Trauer über den Tod des Vaters – nichts als chemische Reaktionen im Hirn, ein Feuerwerk der Synapsen. In Computersimulationen leicht nachzubilden und nur aufgrund der zahllosen Möglichkeiten nicht zuverlässig vorhersagbar. Selbst dass nun auch sie an Seibel-Thyreoditis erkrankt war, folgte einer Logik: Immerhin stammte die Hälfte ihrer Gene von ihrem Vater. Nur – wenn sie vererbbar war, weshalb trat die Krankheit dann nicht häufiger auf?
Jennifer löste frustriert ihren Blick vom Bildschirm. Am anderen Schreibtisch sah sie Thorge über einem Papierstapel brüten. Seufzend wandte sie sich wieder ihrem Artikel zu, doch sie konnte sich einfach nicht mehr konzentrieren. Stattdessen schossen ihr jede Menge Fragen durch den Kopf.
Warum überlebten manche Krebspatienten, andere nicht? Wieso war die Wissenschaft nach über dreißig Jahren Forschung einem Aids-Heilmittel noch immer keinen Schritt näher gekommen? Warum traten Deformationen und Erbkrankheiten in manchen Gebieten und Landstrichen gehäuft auf – aber nicht dort, wo Gefahrenquellen wie Atomendlager oder eine erhöhte UV-Strahlung es vermuten ließen?
Wieso war ausgerechnet sie zum Tode verdammt, obwohl sie noch so jung war und unendlich viel vorhatte? Wieso war das Leben nur so verdammt ungerecht? Und: Konnte man nicht doch irgendetwas gegen dieses Todesurteil unternehmen?
Als Thorge plötzlich ein frustriertes Stöhnen von sich gab und eine Pause vorschlug, zögerte Jennifer keine Sekunde.
Auf dem Weg zur Mensa redeten sie erst über belanglose Dinge, doch schnell kam das Gespräch wieder auf ihre Arbeit zurück. Thorge hatte genau wie sie festgestellt, dass es kaum aktuelle Meldungen zum Thema Zellwachstum gab. Das konnte ein gutes Zeichen sein – oder auch nicht. Manche Themen lagen einfach in der Luft; mehrere Institute und Firmen arbeiteten dann zeitgleich daran, hielten sich aber bedeckt. Am Ende ging es nicht unbedingt darum, wer das beste Ergebnis vorzuweisen hatte. Mindestens genauso wichtig war, wer zuerst damit an die Öffentlichkeit ging.
»Ich glaube, Veränderungen auf dem mikrozellulären Level sind derzeit das heiße Topic«, sagte Jennifer, während sie ihren Teller von sich schob. Sie hatte kaum etwas gegessen. »Wir haben nichts zu befürchten. Es scheint, als wären alle mit etwas anderem beschäftigt. Ist dir das auch aufgefallen? In so vielen Veröffentlichungen wird über die Auswirkungen der Umweltprobleme auf Lebewesen diskutiert. Zu überlegen, wie man diese verhindern oder beheben kann, indem man das Zellwachstum manipuliert, ist dann der nächste Schritt. Wir sind ihnen weit voraus.«
Thorge schüttelte den Kopf. »Nein, die sind alle dran!«, widersprach er. »Alle arbeiten am selben Thema, da bin ich mir sicher. Nur schreibt keiner darüber, um sich nicht in die Karten gucken zu lassen.«
Jennifer zuckte mit den Schultern. »Wir haben keine Möglichkeit, es herauszufinden, also müssen wir abwarten«, sagte sie und kaum, dass die Worte ihren Mund verlassen hatten, zuckte sie zusammen. Ihr war klar, dass sie des Rätsels Lösung nicht mehr mitbekommen würde. »Sag mal«, wechselte sie schnell das Thema, »du wirst also wirklich Vater? Ich finde, das ist heute Morgen ziemlich untergegangen.«
Thorge grinste verlegen. »Ich wollte es auch noch eine Weile für mich behalten. Marie war erst letzte Woche beim Frauenarzt, sie will bis zum vierten Monat warten, bevor wir es irgendjemand sagen – sogar unseren Eltern.«
»Okay. Da bin ich aber geschmeichelt!« Jennifer grinste. »Du musst dir keine Sorgen machen, ich kann meinen Mund halten. Aber jedenfalls noch mal: herzlichen Glückwunsch! Ich finde Kinder ganz toll!«
Thorge lächelte jetzt auch und wirkte für den Augenblick etwas entspannter. »Ich glaube, ich auch. Ich meine, wir haben es nicht darauf angelegt, aber wir haben auch nichts dagegen unternommen. Trotzdem bin ich jetzt super unsicher. Aber das gehört vielleicht einfach dazu.« Nach einer kurzen Pause setzte er hinzu: »Und was mich auch total stresst, sind Maries Stimmungsschwankungen. Schon klar, alles nur Hormone, aber trotzdem – lachen, weinen, schreien, saure Gurken, kotzen, Schokolade, und das alles vor zehn Uhr morgens … das ist ganz schön anstrengend.«
»Für sie bestimmt auch«, sagte Jennifer, dachte dabei aber an sich. Beide Ärzte, die sie konsultiert hatte, hatten ihr erklärt, dass ihre Schilddrüse – das schmetterlingsförmige Organ vorn im Hals, das entscheidend für den Hormonhaushalt zuständig war – nicht einfach den Dienst quittieren würde. Oh nein, das wäre viel zu einfach und zudem recht gut behandelbar. In ihrem Fall konnte niemand abschätzen, was ihr bevorstand. Lebhaft standen ihr Clemens körperliche Probleme vor Augen; insbesondere seine intensiven und scheinbar unerklärlichen emotionalen Umschwünge in den letzten Monaten waren schrecklich gewesen.
Für einen kurzen Moment überlegte Jennifer, ob sie Thorge von ihrer Diagnose erzählen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Er hatte gerade wahrlich genug eigene Sorgen.
Um zwei saßen sie wieder an ihren Arbeitsplätzen und suchten weiter. Eine knappe Stunde später stieß Jennifer auf einen Artikel, in dem es um den Einsatz genmanipulierter Pflanzen in Brasilien ging. Namentlich nicht genannte Mitarbeiter einer ebenfalls ungenannten Firma behaupteten, ihr Arbeitgeber würde auf gerodeten Flächen eine spezielle Erdbeersorte anbauen, die besonders schnell wuchs und extragroße Früchte hervorbrachte. Die Erdbeeren waren zum Export in die USA bestimmt, ohne dabei über die entsprechenden Genehmigungen zu verfügen. Dies sei möglich, so ein Mitarbeiter, weil man die Zellmanipulation nicht nachweisen könne.
Jennifer hielt das für Unsinn. Wenn eine Veränderung des Erbgutes tatsächlich der Grund für das überraschend zügige Gedeihen der Pflanzen war, dann enthielten alle Zellen der Lebewesen diese DNA, sodass der Beweis biochemisch betrachtet sogar sehr einfach sein musste. Trotzdem fertigte sie einen Ausdruck für Koch an.
Thorge hatte in der Zwischenzeit mit dem Ordnen und der Zusammenfassung des Materials begonnen, während Jennifer nun einige Artikel las, über die sie im Laufe des Tages gestolpert war. Ein Bericht bezog sich auf eine Erhebung eines südamerikanischen Instituts, von dem Jennifer noch nie gehört hatte und zu dessen Datenbank sie auch keinerlei Anmeldeinformationen auf der RISK-Liste fand. Da es sich um eine Studie über Immunerkrankungen handelte, kopierte Jennifer den Link in eine E-Mail an ihre private Adresse, um Jonas später zu bitten, ihr Zugriff zu verschaffen. Wozu hatte man schließlich einen Computerspezialisten zum Bruder?
»Sag mal, kannst du auch Datenbanken knacken?«, fragte Jennifer, als sie am Abend endlich zu Hause war. Der Tag bei RISK war lange und intensiv gewesen und sie hatte sich auf dem Nachhauseweg darauf gefreut, einen gemütlichen Freitagabend auf der Couch zu verbringen.
Jonas schob seine Brille die Nase hoch und schaute sie fragend an. »Wie?«
»Ich habe einen Artikel gefunden, der vielleicht was mit meiner Erkrankung zu tun haben könnte, die Datenbank ist aber kennwortgeschützt.«
»Könnt ihr da nicht offiziell anfragen?«
»Wahrscheinlich schon. Aber Koch hatte heute keinen guten Tag und Thorge ist schwanger. Ich dachte, es geht vielleicht schneller, wenn ich dich frage, anstatt den offiziellen Weg zu gehen. Aber wenn es zu schwierig für dich ist –«
»Quatsch«, sagte Jonas beleidigt. »Gib mir den Link, das geht schon irgendwie.«
Jennifer grinste zufrieden. Es funktionierte erstaunlicherweise immer wieder, an Jonas Kompetenz zu kratzen. »Ich hab ihn dir per Mail geschickt.«
Jennifer trat neben Jonas Schreibtisch. Nachdem er auf den Link geklickt hatte, erschien ein Anmeldefenster, das einen Benutzernamen und ein Passwort abfragte.
»Hm«, machte Jonas. »Wenn die viele Nutzer haben, kann das durchaus ein paar Stunden dauern.« Er startete ein weiteres Programm und kopierte die Internetadresse in dessen Eingabefenster.
»Was ist das denn?«, fragte Jennifer neugierig.
»Eine Brute-Force-Attacke«, erklärte Jonas und Jennifer konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Wie praktisch, dass ihr Bruder seine Position als Globalisierungsgegner auch dahingehend interpretierte, dass es okay war, Filme, Apps und Musik kostenlos herunterzuladen.
»Das Programm fängt sozusagen bei ›A‹ und ›1‹ an und probiert dann jede rechnerisch mögliche Kombination für Benutzername und Passwort aus. Es ist relativ einfach. Wenn man nur ausreichend Zeit mitbringt, kann man auf diese Weise jede Verschlüsselung knacken.«
»Super, sag einfach Bescheid, wenn es so weit ist«, sagte Jennifer und strich sich das Haar aus dem Gesicht. »Können wir in der Zwischenzeit vielleicht einen Film gucken? Oder geht das nicht gleichzeitig?«
Jonas lachte auf. »Doch, klar. Die Filme streamen sowieso von der externen Multimediafestplatte.«
»Na dann«, sagte Jennifer und ließ sich auf Jonas Sofa fallen. Sie schob seine dreckigen Klamotten zur Seite, damit er es sich neben ihr bequem machen konnte. »Wie wär’s mit was richtig schön Kitschigem?«
Auf der anderen Seite der Welt, ein wenig außerhalb Rio de Janeiros, wurde in einem Saal mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit vierzig Meter unterhalb eines Gebäudekomplexes von einem Computer der Versuch registriert, Zugriff auf eine Datenbank im GlobalENJ-Serverpark zu erhalten. Das passierte ständig, wenn die Robots und Webspiders der Suchmaschinen das World Wide Web durchforsteten. Sie probierten automatisch die gängigsten Zugriffsmöglichkeiten aus und zogen dann unverrichteter Dinge weiter.
In diesem Fall handelte es sich jedoch erkennbar um einen Brute-Force-Angriff, denn die Eingaben wurden immer weiter fortgesetzt. Nach zehn Fehlversuchen sperrte der Server die anfragende IP-Adresse intern für alle weiteren Eingaben. Ungewöhnlich an der Sache war jedoch, dass der Zugriff nicht über eine kommerzielle T1-Internetleitung erfolgte, sondern über eine DSL-Telefonleitung, wie sie normalerweise nur von Privathaushalten genutzt wurde. Wie bei jeder Unregelmäßigkeit erfolgte daher automatisch ein Reverse Lookup des Eigners der IP-Adresse, der innerhalb weniger Sekunden von einem anderen Rechner erfolgreich beantwortet wurde. Der Name des Anschlussinhabers wurde augenblicklich abgespeichert und mit einer Vorgangsnummer gekoppelt.
Auch wenn bislang kein menschliches Auge diese Informationen erblickt hatte, lag bereits ein Verstoß gegen die strengen Datenschutzregeln der Europäischen Union vor. Denn obwohl es sich bei allen an dem Vorgang beteiligten Computern um Geräte im Besitz von Tochterfirmen von GlobalENJ handelte, war ein freizügiger Datenaustausch zwischen ihnen selbstverständlich untersagt. Doch das war für GlobalENJ nicht mehr als ein unwichtiges Detail.
Young-Sun Bak fuhr langsam durch die Friedbergstraße und musterte voller Verachtung die jungen Frauen am Straßenrand. Sie trugen hochhackige Schuhe, kurze Röcke, die fast nichts verbargen, und äußerst knappe Oberteile. Aus der Nähe betrachtet bildete die grelle Schminke auf ihrem Gesicht eine dicke Schicht.
Er bog rechts ab, dann noch einmal rechts und schließlich ein drittes Mal, sodass er erneut die Friedbergstraße entlangfuhr. Sein Wagen war ein silbernes Mittelklassemodell, bewusst unauffällig. Dennoch folgten die Augen der Prostituierten ihm gierig.
Eine von ihnen, die vor der Hausnummer 49, faszinierte ihn. Ihr langes blondes Haar, ihr schmal gebauter Körper und ihr elegant geschnittenes Gesicht mit den vollen roten Lippen hatten eine faszinierende Wirkung auf ihn. Entschlossen schüttelte er dann aber den Kopf, trat auf das Gaspedal und fuhr nach Hause.
Insgeheim wusste er, dass er irgendwann halten und sie in seinen Wagen bitten würde, aber heute noch nicht.
Kapitel 3
Da unter der Woche vieles liegen geblieben war, musste Jennifer noch einmal ins Büro. Sie packte gerade ihre Tasche, als es an der Tür klopfte und Jonas seinen Kopf in ihr Zimmer steckte.
»Guten Morgen, Schwesterherz«, begrüßte er sie gut gelaunt. »Ich hatte gestern ganz vergessen, es dir zu erzählen, aber ich spiele heute Abend im Schwulencafé in Markus Gemeinde. Jemand hat kurzfristig abgesagt und er hat mich gebeten einzuspringen. Hast du vielleicht Lust zu kommen? Um acht geht’s los.«
Jennifer überlegte kurz. »Klar, ich komme. Ist echt klasse, dass du wieder mal einen Auftritt hast. Schade, dass Mama nicht dabei sein kann. Die würde dich bestimmt auch gern sehen.«
Jonas schnitt eine Grimasse. »Nee, das glaube ich nicht«, sagte er.
»Aber sie war doch immer so stolz auf dein musikalisches Talent.«
»Schon … «, sagte er gedehnt. »Aber ich spiele ja jetzt nicht mehr Es ist ein Ros entsprungen oder Für Elise, sondern ziemlich linkes Zeug, wie du weißt.«
In Jonas Songs ging es um Themen, die ihn seit seinem vierzehnten Lebensjahr beschäftigten. Warum war er so, wie er war?
Musste und wollte er so sein? Wenn ja, zu welchen Schwulen gehörte er – zu den unauffällig Normalen oder zu den schrillen Paradiesvögeln? Über das Schwulsein hinaus drehten sich seine Lieder aber auch um weitaus allgemeinere Themen wie die Ungerechtigkeiten der Welt. Die Texte hatten Jennifer immer gefallen, weil sie tief in seine Seele blicken ließen.
»Ach, ich weiß nicht. Schließlich hat sie dich zu einem selbstständigen Denker erzogen. Und sie hat doch immer betont, wie wichtig es ist, eine eigene Meinung zu entwickeln. Solange du deine Texte also auf Nachfrage mit den entsprechenden statistischen Daten belegen kannst, wäre das für sie bestimmt kein Problem.«
Jonas grinste. »Ha! Na gut, kann sein. Schick ihr doch ein Video vom Handy, wenn du willst. Wir haben WLAN im Kirchencafé, dann musst du keinen Traffic zahlen. Ach, da fällt mir ein – deine Datenbank hat sich schlafen gelegt. Der Server ist offline, im Moment geht da gar nichts. Vielleicht haben die vielen Anfragen ihn einfach gekillt.«
Jennifer zuckte mit den Schultern. »Kein Problem. Aber danke fürs Probieren!«
»Klar. Gerne. Also, wir sehen uns später!«
Jennifer hatte registriert, dass Markus ein Schild am Eingang aufgehängt hatte: JONAS MEYER, GITARRE stand darauf, als wäre ihr Bruder nicht nur ein schneller Ersatz, sondern der echte Gast. Erwartungsvoll nahm Jennifer in der ersten Reihe Platz. Das Konzert war gut besucht, aber Jonas hatte ihr einen Stuhl reserviert.
Mit fünf Minuten Verspätung begann Jonas zu spielen, erst zwei seiner Songs, einen über die Armut in der Dritten Welt, den er nach einer Reportage über Rodungen in Südamerika geschrieben hatte, den anderen über soziale Ungerechtigkeit am Beispiel einer alleinerziehenden jungen Mutter. Dann kamen zwei bekannte Stücke – If I Could Turn Back Time von Cher und Born This Way von Lady GaGa – gefolgt von seinem dritten eigenen Stück, seinem besten und eingängigsten, wie Jennifer fand: Ich bin nicht wie du. In dem Song berichtete er von seinen persönlichen Sorgen und Gedanken. Das Publikum war Feuer und Flamme.
Jennifer kannte den Song. Jonas hatte ihn schon vor einigen Jahren geschrieben. Sie konnte sogar den Text auswendig. Es ging darum, dass Jonas aufgrund seines Schwulseins in gewisser Weise gezwungen war, sein Leben selbst zu definieren und in die Hand zu nehmen. Ihre Gedanken schweiften ab: Auch sie war seit einigen Tagen nicht mehr wie die anderen. Auch sie war gezwungen, konsequente Entscheidungen zu treffen und ihre Ziele zu verfolgen. Aber worin bestanden ihre Ziele? Sie war doch bloß eine ganz normale Zweiundzwanzigjährige. Vor zwei Wochen hätte sie hilflos vor sich hingemurmelt, wenn jemand nach ihren Zukunftsvisionen gefragt hätte. Erst mal das Studium fertig machen. Vielleicht – aber das hätte sie nie laut gesagt – wollte sie später Kinder haben. Aber nur mit dem richtigen Mann. Ihre Eltern waren so verschieden gewesen und hatten einander nicht immer gutgetan. Aber jetzt? Wie sollte sie ihre ganzen unausgesprochenen Lebenserwartungen in sechs Monate pressen?
Um sie herum brandete Beifall auf. Einige Zuschauer sprangen auf, klatschten, pfiffen, forderten eine Zugabe. Auch Jennifer applaudierte begeistert. Verlegen saß Jonas auf der kleinen Bühne und lief knallrot an. Ihr Bruder war bestimmt kein schüchterner Typ, aber sie war sicher, dass er dem Beifall mehr misstraute, als ihn zu genießen. In ihrer Familie musste man Leistung bringen, um geliebt zu werden, und Singer-Songwriter stand nicht auf der Liste anerkannter Berufswünsche.
Jonas begann dann aber doch zu lächeln und spielte zwei Zugaben. Danach sprachen die Zuschauer noch eine Stunde lang über Jonas Songs, eine mögliche Karriere als Musiker und die Kraft der Veränderung durch einprägsame Lieder mit intelligenten Texten.
Jennifer fand es interessant, ihren Bruder von seinen Sorgen und Erfolgen, seinen Ängsten und Träumen berichten zu hören. Ja, sie kannte ihn wie keine andere, aber ihre gemeinsame Vergangenheit verstellte manchmal auch den Blick auf die Gegenwart. Es gefiel ihr, wie verwundbar er sich zwischendurch zeigte. Vielleicht sollte sie das auch mal probieren. Würde sie dann eher eine klare Vorstellung davon entwickeln, was sie mit den nächsten Wochen und Monaten anfangen sollte? Oder war es in ihrer Situation zwingend notwendig, sich mehr als bisher zusammenzunehmen, weil sonst gar nichts mehr ging?
Um ungestört Wirksamkeitsstudien durchführen zu können, hatte die Firma MedVida im Ebbegebirge ein kleines, aber exzellent ausgestattetes Klinikum errichtet. Dieses war mit der Übernahme an einen neuen Betreiber gefallen: das brasilianische Konglomerat GlobalENJ.