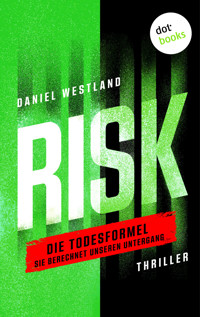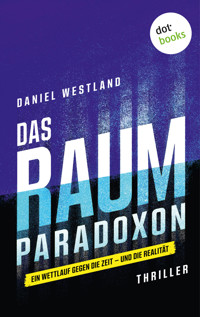
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist eine physikalische Anomalie – und eine potenzielle Waffe … Gefesselt und verschleppt – Sara erwacht in einem eiskalten Labor und hat nur ein Ziel: ihre Mutter zu retten, die mit ihr zusammen in Gefangenschaft geriet. Als Objekt rätselhafter Experimente ist Sara eine Schachfigur im Machtkampf zwischen Wissenschaftlern und Geheimagenten, die ihre parapsychologischen Fähigkeiten zur Kriegsführung einsetzen wollen. In einem Wettlauf gegen Raum und Zeit wird Sara bewusst, dass nicht nur ihre Familie, sondern das Gewebe der Realität auf dem Spiel steht … Ein packender Wissenschaftsthriller für Fans von Andreas Brandhorst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Gefesselt und verschleppt – Sara erwacht in einem eiskalten Labor und hat nur ein Ziel: ihre Mutter zu retten, die mit ihr zusammen in Gefangenschaft geriet. Als Objekt rätselhafter Experimente ist Sara eine Schachfigur im Machtkampf zwischen Wissenschaftlern und Geheimagenten, die ihre parapsychologischen Fähigkeiten zur Kriegsführung einsetzen wollen. In einem Wettlauf gegen Raum und Zeit wird Sara bewusst, dass nicht nur ihre Familie, sondern das Gewebe der Realität auf dem Spiel steht …
Über den Autor:
Daniel Westland schreibt Sachbücher und Thriller. Er war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und ist überzeugt, dass zwei Dinge die Welt besser machen: Wissen und Träumen! Er lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat drei Kinder.
Die Website des Autors: danielwestland.de
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor »RISK – Die Todesformel«, »REVERSE« und »Das Raum-Paradoxon«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2025
Dieses Buch erschien bereits 2014 unter dem Titel »Repeat« bei script5
Copyright © der Originalausgabe 2014 script5, Bindlach. script5 ist ein Imprint der Loewe Verlag GmbH, Bindlach.
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/sergio 34, Rita Soni
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-504-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Daniel Westland
Das Raum-Paradoxon
Thriller
dotbooks.
Widmung
Für die, die ich liebe. Mit aller Kraft.
Zitat
»Es gibt Glücksmomente, (…) die sind so kostbar, dass man sie zu Recht nur selten erlebt, vielleicht sogar nur ein einziges Mal im Leben.«
aus: 100 Stunden, Jean-C. Rufin
TEIL I5. Mai
Kapitel 1SARA
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 11:34 UHR MEZ
Ich habe es an seinen Augen gesehen. Den einen fand ich nett, aber der andere hatte einen Blick wie ein Pitbull, gnadenlos. Ich hätte die Tür zuschlagen und die Polizei rufen sollen, aber sie waren freundlich und hatten Laborkittel an und zeigten eingeschweißte Ausweise.
Nur ein paar Fragen wollten sie stellen.
Mama war auch da, deswegen habe ich nicht auf mein Gefühl gehört, sondern mich halb zur Seite gedreht und über die Schulter gerufen: »Mama? Hier sind zwei … «
Caro sagte mir immer, ich wäre zu nett. Ich wollte von allen gemocht werden. Das müsste ich aufgeben, um ich selbst zu sein. »Sogar Timo wusste manchmal nicht, woran er bei dir war.« Super, so was hört man von der besten Freundin natürlich gern.
Aber sie hatte recht, ich wollte gemocht werden, sogar von einem Fremden mit brutalem Blick, der jetzt einfach in unsere Wohnung stürmte. Er schubste mich, ich prallte gegen die Garderobe und versuchte automatisch, mich an den Jacken aufrecht zu halten, hörte aber nur Stoff reißen und fiel. Der Zweite kam direkt hinter ihm her und ich konnte hören, wie die Tür ins Schloss gedrückt wurde. Ich war erfüllt von Panik. Reiner, nackter Angst. Zwei Männer drangen gewaltsam in unsere Wohnung ein, weil ich mich hatte überrumpeln lassen wie ein dummes Schulmädchen.
Als Mama die Geräusche aus dem Flur hörte, rief sie: »Sara, was ist denn?«
Ich war noch im Fallen, da lief der mit dem Pitbull-Blick schon an mir vorbei. Ich begriff nicht, was er vorhatte, aber seine Zielstrebigkeit machte mir klar, dass die beiden nicht ohne Plan vorgingen. Wir waren keine zufälligen Opfer von Kleinkriminellen geworden ‒ die Sache war persönlich. Wie persönlich, das würde ich erst später begreifen.
Der andere ‒ der, der eigentlich ganz nett aussah ‒ beugte sich zu mir herunter. Ich hatte den Eindruck, dass in seinem Blick sogar ein wenig Bedauern lag, während er hastig die Hand aus der Kitteltasche zog und mir einen Lappen aufs Gesicht drückte. Ich nahm einen eigenartigen Geruch wahr, dann nichts mehr.
Als ich wieder zu mir kam, saßen Mama und ich auf dem Sofa. Meine Arme waren eigentümlich nach hinten verbogen und die Schultern taten mir weh. Ich wollte die rechte Hand heben, um mir die Augen zu reiben, aber es ging nicht.
Ich war gefesselt.
Bevor ich darüber nachdenken konnte, dass es vielleicht klüger gewesen wäre, mich noch einige Zeit schlafend zu stellen, hatte ich schon die Augen aufgeschlagen. Mir gegenüber saßen die beiden Männer. Sie hatten offenbar gerade miteinander gesprochen, jetzt aber wandten sie sich mir zu.
Ich kniff die Augen zusammen, öffnete sie wieder, schaute zu Boden. Meine Füße wurden an den Knöcheln mit braunem Klebeband zusammengehalten.
Mama saß rechts von mir, sie hatte die Augen noch geschlossen. Unwillkürlich versuchte ich, meine Hände zu befreien, und als das nicht gelang, wechselte ich zu den Füßen, aber es brachte nichts. Und was hätte es mir auch genutzt, mich zu befreien ‒ mit diesen beiden Typen direkt vor meiner Nase.
Ich sah die beiden an und sie sahen mich an, aber keiner sagte was. Mir schossen alle möglichen Fragen durch den Kopf: »Was soll der Scheiß?«, und: »Wer seid ihr eigentlich?«, und: »Was zum Teufel wollt ihr?«, aber aus irgendeinem Grund war ich klug genug, die Klappe zu halten. Mama wäre richtig stolz auf mich gewesen, wenn sie es mitbekommen hätte. Sie fand, ich redete zu viel.
Jetzt jedenfalls starrten die beiden mich an und ich starrte zurück, und sosehr ich mich auch dafür hätte ohrfeigen können, den einen fand ich immer noch ganz süß. Den anderen fand ich immer noch gruselig. Und zumindest mit dieser Einschätzung hatte ich ja offensichtlich auch recht.
Keiner sagte ein Wort, keiner rührte sich. Was in meinem Fall kein Wunder war, aber diese beiden Männer benahmen sich echt seltsam. Natürlich war es sowieso nicht normal, irgendwo zu klingeln und dann einfach reinzustürmen und die Bewohner mit Klebeband zu fesseln. Aber ohne, dass ich hätte sagen können warum, schien es mir so, als wäre da eine Spannung zwischen den beiden. Als passten die beiden nicht zusammen, aber nicht so, dass aus dem Widerspruch etwas Interessantes entsteht, wie bei Vanilleeis und heißen Himbeeren. Das hatte ich mir als Kind immer gewünscht und viel zu selten bekommen. Das letzte Mal, als meine Eltern mir sagten, dass sie sich trennten. In der Eisdiele. Krank, oder? Seitdem schmeckt mir die Kombi nicht mehr.
Die beiden jedenfalls gehörten irgendwie wirklich nicht zusammen. Sie starrten mich an, ich starrte zurück. Der, der so harmlos guckte, hatte blonde Haare, ein bisschen zu lang, aber gleichzeitig genau richtig, und blaue Augen hinter einer Brille mit schwarzem Rahmen. Er wirkte jung und unsicher im Vergleich zu dem anderen, trotzdem aber auf eine ruhige Art selbstbewusst.
Irgendwie kam er mir bekannt vor, als wären wir uns schon mal über den Weg gelaufen. Zugleich war ich mir sicher, ihn noch nie gesehen zu haben, denn das hätte ich bestimmt nicht vergessen.
Sein Kinn war kantig, seine Wangen schmal, die Ohren vielleicht einen Hauch zu prominent. Die Schultern wirkten nicht besonders breit, die Arme nicht sonderlich muskulös. Viel mehr konnte man wegen des Kittels nicht sehen.
Ganz anders der Mann neben ihm. Er trug schwarze Stiefel, eine Jeans, war kleiner, aber deutlich grobschlächtiger gebaut als sein Partner. Seine Schultern waren kräftig und seine tiefbraunen Hände, die ruhig auf den Oberschenkeln lagen, richtige Pranken. Die Haare waren kurz geschnitten, die Lippen angespannt aufeinandergepresst, die dunklen Augen lagen tief. Der Blick war stechend, drohend, unangenehm.
Was wollten diese Männer von uns?
Kapitel 2LENNARD
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 11:47 UHR MEZ
Dr. Lennard Keller hasste seinen Kollegen Mike Bishop. Nicht wirklich natürlich, aber in diesem Moment inbrünstig und mit großer Leidenschaft.
»Wenn wir freundlich fragen, kann einfach zu viel schiefgehen«, hatte Mike gesagt. Und in seinem unnachahmlichen Ami-Akzent hinzugefügt: »Nette Jungs bringenʼs nicht.«
Damit mochte er recht haben, aber jetzt verabscheute Lennard ihn dafür. Weil er die Angst in Sara Weidenbachs Augen sehen konnte.
Am liebsten wäre er aufgestanden und hätte ihr die schulterlangen, dunkelbraunen Haare, die ihr ins Gesicht hingen, hinter die Ohren geschoben. Er wusste, dass es nicht passieren würde, aber er hoffte dennoch auf ein Lächeln. Obwohl er das nun wahrlich nicht verdient hatte.
Lennard wünschte, ihm wäre ein besserer Weg eingefallen, an die Informationen zu kommen.
Sara sah ihn an. Er wusste alles über sie und ihre Mutter. Sara war 21 Jahre alt, studierte Theaterwissenschaften, stand ab und zu mit einer Laiengruppe auf der Bühne und jobbte seit einem halben Jahr in einem Coffeeshop in Schwabing. Sie war Mitglied in einer Tier- und einer Umweltschutzorganisation, Vegetarierin, besaß eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr, fuhr aber meistens Fahrrad. Das der Mutter ‒ Heike Weidenbach ‒ war im letzten Jahr gestohlen worden. Die Hausratversicherung hatte den Schaden anstandslos erstattet und eine Woche nach Eingang der Überweisung hatte sie in einem Fachmarkt ein neues Rad gekauft.
Heike Weidenbach führte halbtags das Büro einer Psychotherapeutin in der Lindwurmstraße, sah für ihr Alter erstaunlich frisch aus und las alle zwei Wochen für eine Stunde in einem Kinderkrankenhaus vor.
Sie mussten eine Katze haben, denn sie kauften regelmäßig Katzenfutter und ein- bis zweimal im Jahr wurden Besuche beim Tierarzt abgerechnet. Neben der Toilette hatte Lennard auch ein beigefarbenes Katzenklo stehen sehen, aber die Katze selbst war nicht da. Oder hatte sich versteckt.
Sara hatte ganz offensichtlich das Bewusstsein wiedererlangt, sagte aber nichts, sondern schaute nur vorwurfsvoll. Auf eine eigenartige Weise machte das die Sache nur noch schlimmer ‒ sie sah ihn mit abschätziger Verachtung an, so als müsste auch ihm klar sein, was für ein Mistkerl er war.
Nach einiger Zeit, die Lennard unerträglich lang vorkam, rührte sich auch die Mutter, Heike. Sie brauchte etwas länger als ihre Tochter, um die Situation zu begreifen, dann aber reagierte sie weit weniger cool als Sara, sondern fing an, mit schriller Stimme um Hilfe zu rufen.
Kapitel 3SARA
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 11:53 UHR MEZ
So habe ich Mama noch nie erlebt, komplett hysterisch. Okay, sie hat sich immer schon schnell aufgeregt, sie war stets besorgter als die Mütter meiner Freundinnen. Ich musste anrufen, wenn ich da war, anrufen, wenn ich losfuhr, anrufen, wenn ich mich verspätete. Mein Leben ein Unfall, der sich nur noch nicht ereignet hatte. Vielleicht war sie so, weil sie die Verantwortung für mich fast alleine trug. Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich noch klein war, in der Grundschule, und wir haben ein paar Jahre ganz in der Nähe von Papa gewohnt. Aber als ich aufs Gymnasium kam, sind Mama und ich hierher gezogen, und seitdem war Papa immer weniger für den Alltag zuständig gewesen und immer mehr für tolle Wochenenden und aufregende Ferien.
Dass Mama jetzt ausrastete, konnte ich natürlich total verstehen. Aber trotzdem war es voll schrill. Nun warf sie sich auch noch auf dem Sofa hin und her und versuchte, ihre Hände freizubekommen. Dabei knallte sie ein paarmal gegen mich, bis ich fast vom Sofa kippte.
»Das reicht! Schluss jetzt, sonst gibts den Knebel zu schmecken!«, sagte der Pitbull schließlich mit amerikanischem Akzent. Ganz ruhig und gar nicht so laut, aber in seinem Ton lag etwas, das Mama tatsächlich verstummen ließ.
Merkwürdig, wie still es plötzlich war. Die Luft im Raum war gespannt und niemand schien so richtig zu wissen, wie es weitergehen sollte.
»Es tut mir leid«, sagte da der mit den blonden Haaren und beugte sich ein wenig vor. Er stützte seine Ellenbogen auf die Knie und legte die Handflächen aneinander. »Wir wollten Ihnen keine Angst … «
»Ey!«, unterbrach ihn der andere. »Wir sind hier nicht in der Gesprächstherapie.«
Der Blonde verstummte und presste die Lippen aufeinander.
Offenbar lief es zwischen den beiden nicht ganz glatt. Allerdings war ich nicht sicher, ob das einen Vorteil für uns darstellte oder eine Gefahr.
Der Ami holte tief Luft, warf seinem Kollegen einen letzten strengen Blick zu und stellte uns dann eine höchst eigenartige Frage: »Glauben Sie an übernatürliche Kräfte?«
Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich eine Regalwand voller Einmachgläser vor mir, in denen menschliche Einzelteile schwammen, Gehirne, Organe, Augen, Finger. Wie in einem Horrorfilm. Da wirkten die durchgeknallten Schlachter auf den ersten Blick auch immer besonders nett.
Und auf einmal, nach dieser freundlich vorgetragenen Frage, hatte ich panische Angst.
Aber dann wurde es gar nicht schrecklich, sondern eher komisch. Sie begannen, uns mit höchst merkwürdigen Fragen zu bombardieren.
»Sind Ihnen in den letzten drei Wochen ungewöhnliche Ereignisse aufgefallen?« Dabei schaute der Blonde auf einen Zettel, den er aus der Brusttasche seines Kittels zog, und nannte drei Daten.
Wir sahen einander entgeistert an und schüttelten die Köpfe.
»Treiben Sie regelmäßig Sport? Wenn ja, wie oft und welche Sportarten?«
»Essen Sie vitaminreich?«
»Auf einer Skala von eins ‒ ungern ‒ bis zehn ‒ sehr gern wie gern schauen Sie Fernsehspielfilme?«
»Wurden Sie in den letzten drei Jahren operiert?«
»Essen Sie häufig ‒ vier Mal die Woche oder öfter ‒ Fertiggerichte?«
»Bitte nennen Sie die Primzahlen bis hundert, so schnell es Ihnen möglich ist.«
»Konsumieren Sie regelmäßig ‒ mehr als drei Mal die Woche ‒ Alkohol, und wenn ja, in welcher Menge?«
»Ich nenne Ihnen jetzt fünf Begriffe, von denen einer nicht in das Muster passt ‒ bitte wiederholen Sie diesen.«
»Wie viele Telefonnummern können Sie auswendig wählen?«
»Können Sie eine Zahl erkennen? Wenn ja, welche?« Er hob ein Blatt, auf dem eine Drei aus bunten Punkten auf einer Fläche aus andersfarbigen bunten Punkten zu sehen war.
»Bitte nennen Sie das heutige Datum und den amtierenden Bundespräsidenten, sowie die früheren Bundespräsidenten in umgekehrter Reihenfolge, so weit Sie sich erinnern können.«
»Schlafen Sie auf dem Rücken oder auf dem Bauch?«
»Mit offenem oder geschlossenem Fenster?«
»Leiden Sie an unregelmäßigem Stuhlgang?«
Ich kam mir vor wie in einer kranken Kuppelshow. Aber die Frage nach dem Stuhlgang brachte mich auf eine Idee.
»Ich muss ganz dringend auf die Toilette«, sagte ich.
Kapitel 4LENNARD
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 12:40 UHR MEZ
Sie hatten alles bis ins Detail geplant, mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen, einen Konter für jedes Problem ausgetüftelt. Aber keiner von ihnen hatte damit gerechnet.
»Ich muss ganz dringend auf die Toilette«, sagte Sara ebenso freundlich wie bestimmt.
Lennard warf Mike einen Blick zu. Was jetzt?
Der schloss für einen Moment entnervt die Augen. Vermutlich wünschte er sich, in Guantanamo zu sein. Dann sagte er gereizt: »Okay. Aber du gehst mit.«
Lennard nickte, stand auf und streckte Sara die Hand hin, um ihr hochzuhelfen. Woraufhin sie abschätzig die Augenbrauen hochzog und sagte: »Ich bin gefesselt, schon vergessen?«
Mike stöhnte und Lennard errötete. »Ich, äh, Moment«, murmelte er und steckte die Hände suchend in die Kitteltaschen, als könnte sich darin wie durch Zauberei ein Taschenmesser befinden.
Mike sprang auf und trat neben ihn. Er packte Sara am Oberarm und zog sie mühelos in den Stand. »Wir sind hier doch nicht auf dem Abschlussball«, blaffte er Lennard an und ließ Sara los.
»Und jetzt? Soll ich aufs Klo hüpfen, oder was?«, fragte die.
Mike gab ein missmutiges Grunzgeräusch von sich, beugte sich vor und riss mit einem Ruck das Klebeband durch. Trotz des Kittels konnte man dabei seine Rückenmuskulatur arbeiten sehen. »So«, sagte er dann und setzte sich wieder.
Lennard hielt Sara die Tür zum Flur auf. Ihre Arme waren immer noch hinter ihrem Rücken fixiert. Sie drehte sich zur Seite, als wollte sie ihn auf keinen Fall berühren. Ihr Haar streifte seine Brille, seine Wange, dann war sie an ihm vorbei.
Sie ging vor bis zur Badezimmertür, wartete. Lennard zog die Wohnzimmertür hinter sich zu. Dann öffnete er die Tür zum Bad. Sie ging hinein und sah ihn herausfordernd an. »Und nun?«, fragte sie und wackelte mit den Schultern, dann drehte sie sich um und hielt ihm ihre Hände hin.
Kapitel 5SARA
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 12:42 UHR MEZ
Es hatte geklappt. Mir war ganz schlecht vor Aufregung, aber trotzdem war ich sicher, das Richtige zu tun. Diese Typen waren irgendwie krank im Kopf und keiner wusste, was für Perversionen die sich noch ausdenken würden, wenn sie mit ihrer Version von »Was bin ich?« fertig waren.
Also lieber Hilfe holen, als bei Mama bleiben.
Ich streckte dem Blonden meine Hände hin. Der andere hätte mir bestimmt einfach die Jeans runtergerissen und ungerührt neben mir gestanden, jedenfalls stellte ich mir das so vor. Aber der hier … der nicht. Sein Pech.
Ich hielt ihm meine gefesselten Hände hin und er begann, vorsichtig das Klebeband abzuziehen. Es war eine merkwürdige Situation, gleichzeitig intim und distanziert. Jedenfalls rieb ich mir die Handgelenke, als er fertig war, drehte mich dann um und sah ihn an. Er trat einen Schritt vor und überprüfte den Sicherheitsgriff des Badezimmerfensters. Abgeschlossen.
Dann sah er mich fragend an. Ich lachte auf, legte ihm die flache Hand auf die Brust und schob ihn zur Tür hinaus. Das ließ er Gott sei Dank geschehen. Ich drückte die Tür zu und schloss ab.
Dann stellte ich das Wasser an, holte den Fensterschlüssel aus dem Medizinschränkchen, riss das Fenster auf und kletterte hinaus auf das flache Garagendach direkt davor. Hier saß ich im Sommer manchmal mit Caro und chillte, bis der Hausmeister uns verjagte.
Ich rannte los, scharf nach rechts, damit ich nicht durchs Wohnzimmerfenster zu sehen war. Ich erreichte die Dachkante und blieb abrupt stehen. Keine drei Meter, vermutlich nur zwei fünfzig bis nach unten, aber trotzdem. Ich schaute zurück. Niemand zu sehen.
Vorsichtig setzte ich mich auf die Kante, dann holte ich tief Luft, wollte mich abstoßen ‒ und traute mich nicht.
Wieder ein Blick zurück. Vielleicht sollte ich einfach wieder ins Bad klettern, die Spülung betätigen und meiner Mutter beistehen?
Der Gedanke an meine Mutter gab mir Mut. Gegenüber unserem Mehrfamilienhaus, ausgerechnet vor dem Handyshop, stand eine Telefonzelle. Da konnte ich notfalls auch mit gebrochenem Knöchel hinhüpfen.
Ich kniff die Augen zu und sprang.
Zum Glück war die Landung weit weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt hatte, auch wenn ich umknickte und mir das Knie stieß. Ich rappelte mich hektisch auf, warf noch einen Blick zurück zu unserem Badezimmerfenster und lief dann los.
Kurz war ich in Versuchung, zu uns nach Hause zurückzukehren, an der Tür zu klingeln und zu hoffen, dass alles nur ein schlechter Traum gewesen war. Aber ein Blick auf die roten Striemen an meinen Handgelenken belehrte mich eines Besseren. Also humpelte ich so schnell ich konnte über die Straße, grub dabei schon in der Hosentasche nach Münzen und fluchte, als ich keine fand. Kurz dachte ich darüber nach, zur nächsten Polizeistation zu laufen, die nur drei Straßen weiter war. Aber mit dem umgeknickten Knöchel würde das viel zu lange dauern. Also nahm ich den Hörer ab, stieß ein kurzes Stoßgebet zwischen den Zähnen hervor und wählte 110 ‒ tatsächlich, es klingelte! Zwei Mal, drei Mal, vier Mal. Nervös behielt ich unsere Haustür schräg gegenüber im Auge. Hoffentlich hatten die zwei Typen mein Verschwinden noch nicht bemerkt!
Als ich schon entnervt den Hörer auf die Gabel knallen wollte, um doch direkt zur Wache zu hinken, meldete sich endlich eine gelangweilte Stimme. »Polizei, Ihr Name bitte?«
Ich nannte meinen Namen, dann: »Zwei Männer sind bei uns … eingebrochen. Sie haben meine Mutter entführt. Also, gefesselt. Ich konnte entkommen!«
»Ihre Anschrift bitte!«
Zwei Mal verhaspelte ich mich, als ich die Adresse nannte, unter der Mama und ich seit mehr als zehn Jahren wohnten. Doch schließlich hatte der Polizist am anderen Ende der Leitung alles richtig notiert und ich schloss mit einem erleichterten Seufzen die Augen.
Kapitel 6LENNARD
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 13:17 UHR MEZ
Auf einmal stand Mike neben ihm. »Was machst du denn hier draußen? Ist sie etwa allein da drin?«, fragte er und drückte im gleichen Moment auch schon die Klinke. Aber die Tür war abgeschlossen.
»Im Ernst?«, fragte er Lennard und schüttelte traurig den Kopf. Lennard stand noch wie gelähmt, als Mike schon einen Blick auf das Türschloss mit dem kleinen roten Feld geworfen, einen Schlüsselbund von der Kommode gerissen, den Kopf eines Schlüssels seitlich in den Schlitz gepresst und das Schloss von außen geöffnet hatte. Jetzt ließ er den Schlüsselbund zu Boden fallen und stieß zugleich die Badezimmertür auf.
Das Fenster stand offen, das Wasser lief, Sara war verschwunden.
Vorsichtig, als könnte Sara gleich hinter der Tür hervorspringen und sich auf ihn stürzen, folgte Lennard seinem Kollegen Schritt für Schritt in den Raum hinein. Mike blieb in der Mitte stehen, drehte sich einmal langsam im Kreis, ballte die Fäuste. »Idiot!«, zischte er genervt in Lennards Richtung, was gar nicht nötig gewesen wäre. Er fühlte sich auch so schon dumm genug.
Mike Bishop fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, dann sagte er: »Wir müssen hier weg. Bestimmt kommen gleich die Bullen.«
Im Wohnzimmer riss Mike ein Stück Packband von der Rolle ab und klebte es der überraschten Heike Weidenbach über den Mund. Dann hob er warnend die Hand, einen Zeigefinger hochgestreckt. »Ruhe!«
Lennard konnte sehen, wie die Angst in Heikes Augen zunahm, sie atmete hektisch durch die Nase, immer schneller, und dann verdrehten sich auch schon ihre Augen und sie sackte ohnmächtig zur Seite.
»Scheiße«, stöhnte Mike. Er ging vor dem Sofa in die Knie, schlang seinen rechten Arm um die Hüfte der Frau und zog sie sich auf die Schulter wie einen Sack Mehl. »Mach mal die Türen auf«, befahl er Lennard.
Der steckte vorsichtig den Kopf ins Treppenhaus, aber die Luft war rein. Tür weit auf, Mike durchlassen, Tür zu. Treppe runter. Haustür einen Spaltbreit auf, wenig los, ganz auf, Mike durchlassen, Auto aufschließen, Tür auf, die Mutter auf den Rücksitz. Er warf Mike den Schlüssel zu und ließ sich selbst auf den Beifahrersitz fallen.
Mit quietschenden Reifen jagten sie davon.
Was für ein verdammter Mist. Aber immerhin bestand trotz allem noch eine 50-Prozent-Chance, dass sie ihre Forschungen erfolgreich abschließen konnten.
Lennard sah zum Fenster hinaus. Oh Gott, was dachte er denn da, fragte er sich entsetzt, wie dachte er denn da. Was war aus ihm geworden?
Kapitel 7SARA
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 13:24 UHR MEZ
Ich hatte gerade unsere Adresse genannt, da ging die Haustür auf. Einer der Männer ‒ der Brillenträger ‒ trat heraus und sah sich um. Ich krampfte die Hand mit dem Hörer vor meine Brust und versuchte, mich in der Zelle unsichtbar zu machen.
»Hallo? Hallo?«, hallte die Stimme dumpf aus dem Hörer. »Sind Sie noch da?«
Der Mann drehte sich um und sagte etwas, woraufhin die Tür sich weiter öffnete und der Muskelprotz heraustrat. Er trug Mama über die Schulter geworfen, sie rührte sich nicht. Was hatten sie mit ihr gemacht? Und was hatten sie jetzt mit ihr vor?
Der, der Mama trug, schleppte sie über den Bürgersteig in Richtung eines weißen Autos, während der Blonde einen Schlüssel aus der Tasche zog und die Hintertür des Wagens öffnete. Unsanft ließen sie Mama auf die Rückbank fallen, dann sagte der Ami etwas zu seinem Kumpanen und streckte ihm die Hand hin.
Der Brillenträger reichte ihm den Schlüssel und stieg nach hinten zu Mama. Der andere schaute noch einmal die Straße auf und ab und ich hielt erschrocken die Luft an, als er in meine Richtung blickte. Doch nach einem kurzen Stirnrunzeln ging er um das Auto herum und setzte sich ans Steuer. Der Motor heulte auf und der Wagen schoss von seinem Parkplatz herunter. Ein von der Seite kommender Laster konnte gerade noch bremsen.
Ich ließ den Hörer los und sprang auf die Straße. Selbst wenn sie mich entdeckten, bei dem Verkehr würden sie nicht umkehren können. Ich wollte mir wenigstens das Nummernschild merken, aber der Laster war im Weg, und dann war der weiße Pkw schon zu weit weg.
»Scheiße«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und stürmte zurück zur Telefonzelle. Hoffentlich war der Bulle noch dran! Ich rief in den Hörer: »Passen Sie auf, jetzt haben sie sie wirklich entführt! Gerade sind sie in einem weißen Lieferwagen davongefahren. Mit meiner Mutter!«
Vom anderen Ende der Leitung hörte ich ein unwilliges Schnauben. »Kennzeichen?«
»Tut mir leid. Das konnte ich nicht erkennen.«
Der Polizeibeamte holte tief Luft, als wollte er Anlauf nehmen. »Jetzt hör mal, Mädchen«, polterte er dann los, »verarschen kann ich mich selbst. Schön, wenn du am helllichten Tag nichts Besseres zu tun hast, als dir Telefonstreiche auszudenken, aber ich hab hier einen ganzen Schreibtisch mit echten Fällen. Und jetzt schleich dich und lass mich meine Arbeit machen, sonst schick ich dir wirklich noch ne Streife vorbei! Dann lernst du hoffentlich, dass wir bei so was keinen Spaß verstehen!« Und mit diesen Worten knallte er schwungvoll den Hörer auf die Gabel.
Unsere Wohnungstür stand weit offen und der Korb mit Tüchern und Schals war von der Kommode auf den Boden gekippt. Frau Schröder, unsere Katze, die mir normalerweise sofort um die Beine schlich, wenn ich nach Hause kam, war nirgends zu sehen. Ich stieg über das bunte Chaos und ließ mich aufs Sofa fallen. Mit den Fingern der linken Hand umfasste ich den kleinen Mondstein, den ich als Glücksbringer immer in der Hosentasche trage. Wenn der jetzt nichts half, konnte ich ihn eigentlich auch gleich wegschmeißen.
Wo waren Mama und ich da hineingeraten? Die Fragen der beiden Männer hatten eindeutig gezeigt, dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgten. Sie konnten nicht einfach bloß total durchgeknallt sein, dazu waren sie zu planvoll und kontrolliert vorgegangen.
Und jetzt? Zögernd kam Frau Schröder angeschlichen und sprang auf meinen Schoß. Mechanisch streichelte ich die Katze. »Dir haben die beiden sicher auch einen ganz schönen Schrecken eingejagt, was?«, murmelte ich. Die hatten Mama mitgenommen, was sollte ich jetzt nur machen?
»Ach klar, natürlich!« Frau Schröder fetzte entrüstet unter das Sofa, als ich wie elektrisiert aufsprang. Eilig nahm ich das Telefon aus der Ladestation und suchte Mamas Handynummer.
Es klingelte. Ich spitzte die Ohren, aber in der Wohnung selbst blieb es still. Vielleicht hatte ich Glück und Mama hatte …
Mit einem Klicken ging die Mailbox ran. Ich legte auf und versuchte es gleich noch einmal. Es klingelte erneut und nach dem zweiten Mal ging tatsächlich jemand ran.
»Sara?«, fragte eine Stimme. Aber es war nicht Mamas Stimme, sondern die des Mannes mit der Brille.
»Ja«, sagte ich, selbst nicht ganz sicher, ob ich erkannt werden wollte.
»Sara, wir … « Es klang, als zögerte er, dann beendete er den Satz hörbar entschlossener: »Wir wollen mit Ihnen reden.«
Was? Vielleicht waren die beiden doch aus der Klapse entlaufen und hielten sich für Außerirdische auf dem Weg nach Hause.
»Ja?«, sagte ich und diesmal klang es noch unsicherer.
»Moment mal«, sagte er. Dann hörte ich ein Rascheln und gedämpftes Grummeln ‒ anscheinend musste er sich erst mit dem anderen Typen besprechen. Ich glaubte, die Worte »Einsatz« und »nicht anders« zu vernehmen.
Dann war er auf einmal wieder klar zu verstehen: »Wir haben Ihre Mutter.«
»Das weiß ich.«
»Oh. Ja. Okay.« Pause. »Es war nicht klug von Ihnen, zu fliehen«, sagte er dann und es schien, als versuchte er, einen drohenden Unterton in seine Stimme zu legen. Aber irgendwie klappte das nicht. Er klang eher, als ob er mit seinem großen Bruder angab, obwohl alle wussten, dass er Einzelkind war.
»Und jetzt?«, fragte ich. »Was wollen Sie überhaupt?«
»Mit Ihnen reden. Das sagte ich doch schon.«
»Äh, Augenblick mal ‒ Sie haben uns überfallen und gefesselt und dann haben Sie uns lauter idiotische Fragen gestellt. Miteinander reden ist, wenn man fragt, ob jemand oft in die Bar kommt, oder notfalls auch, ob man sich nicht schon mal irgendwo gesehen hat.« Langsam wurde ich sauer.
»Ja, äh … «
Ich schnaubte. So allmählich ging mir sein Gestottere wirklich auf die Nerven. Die waren bei uns eingebrochen und hatten Mama entführt! Warum spielte er sich auf, als wäre er das Opfer? Doch bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich ein Quietschen, dann ein Rascheln, anschließend die Stimme des anderen Mannes. Der mit dem fiesen Blick. »Jetzt hör mal gut zu«, sagte er, »wenn du deine Mutter je Wiedersehen willst, dann wirst du exakt das tun, was ich dir sage!«
»Okay«, entgegnete ich. Was blieb mir anderes übrig.
Kapitel 8LENNARD
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 13:59 UHR MEZ
Sie hielten an der Theresienwiese. Mike erwies sich immer mehr als echter Rambo. »Du bleibst hier und bewachst die Mutter«, befahl er und deutete mit dem Daumen auf Heike Weidenbach, die neben Lennard auf dem Rücksitz saß. Sie war gefesselt und mittlerweile auch nach allen Regeln der Kunst geknebelt. »Und wehe, du verbockst noch mal was«, blaffte Mike. »Wenn du nicht so ein Waschlappen wärst … «
»Moment mal, Moment mal«, wehrte sich Lennard. »Was heißt hier verbocken. Ich wollte anrufen und fragen, wie zivilisierte Menschen das nun mal tun, aber du hast ja darauf bestanden, dass wir … «
»Sag mal, hast du sie eigentlich noch alle?«, unterbrach ihn Mike und warf mit hochgezogenen Augenbrauen einen Blick auf die Gefangene. »Willst du ihr vielleicht auch noch deinen Personalausweis fotokopieren, damit sie dich leichter verklagen kann?« Er seufzte und schüttelte den Kopf. Dann sagte er: »Du bleibst jetzt einfach hier und hältst zur Abwechslung mal zehn Minuten die Klappe. Ach ja, und wenn die nachher immer noch da ist, wäre das natürlich von Vorteil. Für dich.«
»Okay, okay, ist ja gut ‒ wir wollen doch beide dasselbe«, wehrte Lennard ab.
»Und zwar schnellstmöglich«, entgegnete Mike. Dann grinste er, aber auf Lennard wirkte sein Gesicht nicht fröhlich, sondern eher wie das eines Raubtieres, das seine Zähne bleckte.
Mike stieg aus und knallte die Tür hinter sich zu, während Lennard den Blick geradeaus gerichtet hielt. Heike Weidenbach neben ihm saß reglos da, er konnte sie angestrengt durch die Nase atmen hören.
Vorhin, als ihr Handy geklingelt hatte, hatte er es ihr aus der Hosentasche ziehen müssen, das war ihm richtig peinlich gewesen. Er hatte sich mehrfach bei ihr entschuldigt, Mike hatte geflucht, er solle schneller machen, aber es war nicht einfach gewesen und noch dazu hatte die Frau ihn die ganze Zeit angestarrt, als wäre er ein widerwärtiges Monster. Aber dann hatte Sara zum Glück noch ein zweites Mal angerufen.
Er fragte sich, warum sie das getan hatte. Und ob sie jetzt wirklich ohne Polizei zu dem Treffpunkt kommen würde, den Mike genannt hatte.
Andererseits: Wenn jemand seine Mutter entführt hätte, würde er auch alles tun, um sie da herauszuholen.
Gedankenverloren schaute er durch die Windschutzscheibe. Tatsächlich, da kamen sie auch schon. Zwischen einigen Inlineskatern und Fahrradfahrern hindurch marschierten Mike und Sara Weidenbach direkt auf den Wagen zu.
Lennard blieb beinahe der Atem weg, als er sie kommen sah. War das nur die Anspannung oder warum hakten sich seine Gedanken immer wieder an der jungen Frau fest? Auch Heike Weidenbach neben ihm hatte nun ihre Tochter entdeckt und begann, sich mit neuer Kraft gegen ihre Fesseln zu stemmen.
Hoffentlich kam bei der ganzen Sache etwas raus. Dann wäre es für die Zivilisten zwar unangenehm gewesen, hätte sich aber wenigstens gelohnt.
Kapitel 9SARA
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 14:02 UHR MEZ
Mama starrte mich wütend an, was ich absolut verstehen konnte. Wenn ich eine bessere Idee gehabt hätte, dann wäre ich garantiert nicht zu diesen beiden Halbirren in den Wagen gestiegen. Aber ich konnte Mama schließlich schlecht allein lassen. Weglaufen, um schnell mal Hilfe zu holen, klar. Doch sie so richtig im Stich lassen ‒ niemals. Im Grunde war es ja sogar meine Schuld, dass sie Mama entführt hatten. Wenn ich nicht abgehauen wäre … Und außerdem war ziemlich klar, dass ich ohnehin mit drinhing. Also konnte ich die Sache genauso gut offen angehen.
Vor dem Einsteigen fesselte mir der Brutalo wieder die Hände. Irgendwie wurde ich den Eindruck nicht los, dass er es genoss, mir das Klebeband richtig fest um die Handgelenke zu wickeln. Idiot. Der andere saß hinten neben Mama. Der Möchtegern-Rambo öffnete die Tür, drückte mich zu den beiden auf den Rücksitz, setzte sich hinters Steuer. »Kindersicherung«, sagte er über die Schulter. »Die Tür geht also nur von außen auf, alles klar?«
»Ja«, sagte ich genervt. »Ist doch egal, ich bin schließlich freiwillig hier ‒ meinen Sie, da werf ich mich gleich bei voller Fahrt auf die Straße? Überfahren lassen kann ich mich auch einfacher.«
Ohne Antwort ließ er den Motor an, gab Gas und schoss aus seiner Parklücke. Hinter uns hupte jemand, sicher zu Recht.
Erst jetzt fiel mir auf, dass ich gar nicht angeschnallt war. Eine Minute lang schwiegen alle, dann fragte ich über Mama hinweg den mit der Brille: »So, würden Sie mir jetzt bitte mal erklären, was los ist?«
Ich muss mich echt sauer angehört haben, denn er zuckte sichtbar zurück, zwinkerte, nahm seine Brille ab und begann, sie mit dem Zipfel seines T-Shirts zu putzen.
»Ich, also … wir, ich meine … «, begann er und setzte seine Brille wieder auf.
»Ruhe dahinten!«, befahl unser Steuermann. »Wir reden später darüber.«
Ich zog ein Bein hoch und kickte missmutig gegen die Rückenlehne seines Sitzes. Nicht so heftig, dass er deswegen aussteigen würde, ich wollte nur, dass klar war, wie wenig mir passte, wie er sich aufführte.
Er reagierte nicht. Schweigend fuhren wir weiter. Nach einer Weile schaltete er das Radio ein. Bayern 3. Draußen strahlte die Sonne. Hätten die beiden uns nicht entführt und gefesselt, hätten wir auch ein paar Freunde unterwegs zum Badesee sein können.
Nach knapp dreißig wortlosen Minuten erreichten wir die Autobahn. Ich warf Mama einen besorgten Blick zu, aber als ich bemerkte, dass sie noch viel größere Angst zu haben schien als ich, bemühte ich mich um ein Lächeln. Sie stieß den Atem durch die Nase aus.
»Können Sie meiner Mutter das Klebeband vom Mund abmachen?«, fragte ich den Mann neben uns leise. Er warf einen Blick auf Mama, dann einen nach vorn zum Fahrer, der ganz offensichtlich das Sagen hatte. Er schüttelte den Kopf und schaute dabei mindestens halb so ängstlich, wie ich mich fühlte. Nur: Wir waren die Opfer, er der Täter. Wenn er schon Angst vor diesem Kerl hatte ‒ dann musste ich mir ja wohl erst recht Sorgen machen.
Mit Vollgas ging es über die linke Spur. Ab und zu hupte unser Fahrer jemanden beiseite, der es wagte, langsamer als Lichtgeschwindigkeit zu fahren, doch sonst war wenig los. Wir näherten uns dem Flughafen, bogen aber kurz vor der Abzweigung auf eine unbeschilderte Ausfahrt mit mehreren großen Verbotstafeln und Warnschildern: DURCHFAHRT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN und ACHTUNG, MILITÄRISCHES SPERRGEBIET.
Zwar fuhren wir jetzt langsamer, aber der Zustand der Straße war auch schlechter, sodass wir kräftig durchgerüttelt wurden. Einmal stieß ich mir nach einer besonders tiefen Bodenwelle den Kopf am Türrahmen und wünschte nun doch, ich wäre angeschnallt. Allerdings würde es wohl keinen der beiden kümmern, wenn ich mich über die mangelnde Fahrgastsicherheit beschwerte.
Schließlich kam ein viereckiger, mindestens dreistöckiger fensterloser Bau in Sicht. Er war in einem merkwürdig undefinierbaren Graubraun gestrichen. An einer Seite befanden sich zwei große Tore, davor eine lange Asphaltbahn. An deren Ende stand ein kleiner Turm, dessen Obergeschoss mit Spiegelglas verkleidet war.
In einem der großen Tore waren nebeneinander zwei Doppeltüren eingelassen, die in dem Kasten winzig anmuteten, bei näherem Hinsehen aber so groß wie das Tor einer Doppelgarage waren.
Keine Menschenseele war zu sehen, überall hingen Kameras. An einer Wand war ein Kreis mit einem Vogel darin aufgemalt, der die Schwingen spreizte. Sollte das vielleicht der Bundesadler sein?
Waren diese Typen etwa vom Geheimdienst? Falls ja, dann stellte sich erst recht die Frage, was sie von uns wollten.
Eine der Doppeltüren öffnete sich. Wir bretterten mit Vollgas hinein, dann bremste der Wagen abrupt ab. Ich prallte gegen die Lehne des Vordersitzes.
Ungläubig blickte ich zum Fenster hinaus. Wir standen unter der Tragfläche eines Personenflugzeuges.
Kapitel 10LENNARD
MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 15:48 UHR MEZ
Den Straßenzug, in dem sein Bruder Jan wohnte, hatte Lennard wieder nicht entdeckt, aber wenigstens konnte er jetzt durch das Fenster die Gipfel der Alpen sehen. Langsam breitete sich Erleichterung in ihm aus. Die beiden Gefangenen steckten in zwei der insgesamt fünf Einzelzellen an Bord des hochmodernen Jets.
Allerdings kam jetzt Mike zu ihm herübergeschlendert. An der Anspannung der Kiefermuskeln konnte Lennard erahnen, dass die Lockerheit seines Kollegen nur gespielt war.
»Und?«, fragte Mike. »Besser?«
»Ja, wieso?«, erkundigte sich Lennard.
»Du warst vorhin ganz schön neben der Spur. Ich hatte das Gefühl, wenn es nach dir geht, dann erklären wir den beiden erst mal, worum es geht, und dann fahren wir zu einer Suppenküche für Obdachlose und tragen uns alle gemeinsam als ehrenamtliche Helfer ein.«
Lennard schüttelte irritiert den Kopf. »Nein«, sagte er. »Ich bin nach wie vor dabei. Es ist nur … ich bin eben Wissenschaftler, kein Soldat. Du bist für so was ausgebildet. Für mich ist das alles neu.«