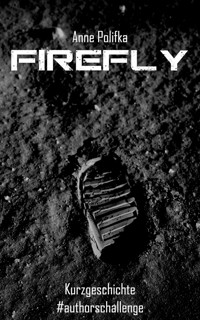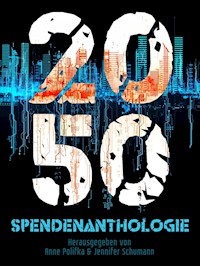5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie sind so alt wie die Zeit selbst. In allen Epochen, in allen Schichten der Gesellschaft sind sie ein fester Bestandteil des Lebens. Ob gemeinsam oder allein, ausgeführt in einer öffentlichen Zeremonie oder im stillen Kämmerlein: Rituale. 20 fantastische, liebevoll illustrierte Geschichten und Gedichte zum Spendenzweck gegen Alterseinsamkeit. Die Spendeneinnahmen kommen „Freunde alter Menschen e. V.“ zugute. Autoren: S.A .Wallner, Kornelia Schmidt, H. K. Ysardsson, Chrystal Tanuki, Lilly von Rothensteyn, Andrea Bannert, Arthur Krone, Maria Linwood, Christian Heß, Lea Denkel, Katrin Holzapfel, Roland R. Maxwell, Christoph Holtsträter, Philip Bartetzko, Sabine Brandl, Sebastian Steffens, Gerd Meyer- Anaya, Luna McMullen, Nina Heyer, Sophia Rosenberger, Karla Schulz, Anne Polifka & Jennifer Schumann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rituale
S.A .Wallner, Kornelia Schmidt, H. K. Ysardsson, Chrystal Tanuki, Lilly von Rothensteyn, Andrea Bannert, Arthur Krone, Maria Linwood, Christian Heß, Lea Denkel, Katrin Holzapfel, Roland R. Maxwell, Christoph Holtsträter, Philip Bartetzko, Sabine Brandl, Sebastian Steffens, Gerd Meyer- Anaya, Luna McMullen, Nina Heyer, Sophia Rosenberger, Karla Schulz, Anne Polifka & Jennifer Schumann
Impressum
Spendenanthologie
Hersg.: Jennifer Schumann & Anne Polifka
Anne Polifka
c/o autorenglück.de
Franz- Mehring- Str. 15
01237 Dresden
https://anthologie4.wixsite.com/
Buchbeschreibung:
Sie sind so alt wie die Zeit selbst. In allen Epochen, in allen Schichten der Gesellschaft sind sie ein fester Bestandteil des Lebens.
Ob gemeinsam oder allein, ausgeführt in einer öffentlichen Zeremonie oder im stillen Kämmerlein: Rituale.
20 fantastische, liebevoll illustrierte Geschichten und Gedichte zum Spendenzweck gegen Alterseinsamkeit.
1. Auflage
18. 11. 2022
© S.A .Wallner, Kornelia Schmidt, H. K. Ysardsson, Chrystal Tanuki, Lilly von Rothensteyn, Andrea Bannert, Arthur Krone, Maria Linwood, Christian Heß, Lea Denkel, Katrin Holzapfel, Roland R. Maxwell, Christoph Holtsträter, Philip Bartetzko, Sabine Brandl, Sebastian Steffens, Gerd Meyer- Anaya, Luna McMullen, Nina Heyer, Sophia Rosenberger, Karla Schulz, Anne Polifka & Jennifer Schumann
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vorwort
Ritualerei
Die Beruhigung der Seele
Der Nebelwald
Das Herz des Ozeans
Dämonen im Blut
Die fehlende Anrufung
Heilung
Nachtwandler
Nur ein Job
Ein Wunsch so dunkel und kalt
Nur bis Mitternacht
Schwarzer Sand
Dunkle Tore
Sequenz A.N.E
Totes Eichhörnchen
Akrotiri
Erntefest
Böse Obsession
Der ewige Architekt
Regenprasseln
Schutzkreis
Drachenkönig
Der Aufzug
2050
Unterstützer
Vorwort
Vor einem Jahr erschien mit »2050« unsere erste Spendenanthologie zugunsten von »Zeichen gegen Mobbing e. V.«. Schon da stand für uns fest, dass es eine weitere Anthologie geben wird, und hier ist sie nun und unterstützt den Verein »Freunde alter Menschen e. V.«.
Auch diesmal haben wir nicht nur eine hohe Beteiligung und damit auch spannende Geschichten, sondern auch von anderer Seite Hilfe erhalten. Viele Lektoren unterstützten uns ehrenamtlich.
Am Ende wird jeder einzelne vorgestellt. Zudem steuerte kritzelsusa auch diesmal liebevoll gestaltete Illustrationen zu jeder Geschichte bei.
Wir danken allen Beteiligten für die wunderbare und engagierte Zusammen. Nun bleibt uns nur noch, Ihnen viel Spaß beim Lesen zu wünschen.
Wir würden uns sehr über eine Bewertung freuen, denn diese animiert noch mehr Menschen dazu, diese Anthologie zu kaufen und somit den Kampf gegen die Alterseinsamkeit zu unterstützen.
Ein abschließendes Dankeschön für Ihr Vertrauen und die Unterstützung dieses Projekts.
Liebe Grüße
Jennifer und Anne
Ritualerei
Gerd Meyer-Anaya
Von der wiege bis zum grab
rituale nicht zu knapp
diese halten uns auf trab
ohne sie gäbs keinen halt
sicherlich auch mehr gewalt
auf dem weg von jung nach alt
babyshower später taufen
neues taufkleid dazu kaufen
gutes essen recht viel saufen
ob kita schule abitur
ständig ist man in der spur
rituale regeln nur
auch in der studentenzeit
rituale weit und breit
zwischen zwang und heiterkeit
diese gelten auch bei feten
ebenso wie bei dem daten
sollte man sich nie verspäten
danach vor dem traualtar
macht ein ritual es klar
und man wird zum ehepaar
streit wird oft zum ritual
häufig ist der grund banal
im schlimmsten fall kommts zum skandal
kommts zur scheidung rituale
wer bekommt die silberschale
damit man mit dieser prahle
man steht dann beim ritterspruch
gleich ob segen oder fluch
denn zerschnitten ist das tuch
hat man fünfzig jahr durchlitten
dann verlangen es die sitten
und es hilft hier auch kein bitten
dass man diese zahl jetzt feiert
auch wenn man herum geeiert
später man gemeinsam reihert
selbst am arbeitsplatz gibt’s riten
mancher würd sie gern verbieten
oder ein büro sich mieten
betriebsauflug ein jubelfest
geben manchem schnell den rest
weil keiner sie zufrieden lässt
selbst in unserm todesfalle
sitzen weinend leider alle
auch noch in der leichenhalle
ritual das sehr gefragt
denn nur gutes wird gesagt
und der abschied sehr beklagt
wie gesagt das ritual
häufg ein erkennungsmal
öfter noch ganz trivial
manchmal spritzig manchmal schal
hin und wieder auch brutal
und des öfteren ne qual
ob die hölle ob der himmel
rein kommt man erst nach gebimmel
denn auch dort herrscht ritenfimmel
ob beim teufel ob bei gott
erst nach hü erfolgt das hott
so auch dort der gleiche trott
Die Beruhigung der Seele
Sebastian Steffens
»Amun – set – Re – ta – sal – rah!« John fuhr mit der Hand über die alten Zeichen auf der Wand und murmelte leise die Silben, für die sie standen. Dann wischte er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Mit 50 Jahren und einem Bauchansatz machte er sich zwar noch ganz gut im Hörsaal, aber nicht im Feldeinsatz. Schon gar nicht in der ägyptischen Hitze. Und besonders vor seiner Tochter Kathy wollte er nicht wie ein alter Sack wirken. Er sah sich lieber als eine Art Indiana Jones. »Ich glaub’, ich muss wieder mehr trainieren«, murmelte er.
»Das steht da sicher nicht.« Kathy grinste.
John machte einen Schritt zur Seite, damit das spärliche Licht aus dem Zugangsschacht die Kegel der Akkuscheinwerfer beim Ausleuchten der Wand besser ergänzen konnte. »Äh, nein. Der Rest ist schwer zu entziffern. Aber ich glaube, das heißt so viel wie ›Störe die Ruhe und Du wirst dienen!‹« John überlegte, zog ein kleines Büchlein aus der Seitentasche seiner Tropenhose und blätterte darin. »Vielleicht auch … ›Sklave sein‹ statt dienen. Ist nicht ganz klar.« Er zog die Stirn in Falten und kniff die Augen zusammen.
Grabräuber hatte es im Tal der Könige schon solange gegeben, wie Gräber. Also seit 3000 Jahren mehr oder weniger. Aber dieses Grab hier, die Nummer KVWW 17, war unberührt. Und es war großartig. Nach zwei Jahren der Recherche in den vergessenen Regalen von Museen und Archiven und zwei Monaten der Suche vor Ort hatten sie diesen Raum ausgegraben.
Auf den Wänden waren im Licht der Scheinwerfer reiche Verzierungen, Hieroglyphen und Bilder von Re, dessen Tochter Maat und ihrem Gegenspieler Apophis sowie von Isis und Anubis zu erkennen. Auch der Verweis auf Cherti, den Fährmann des Todes, fehlte nicht. Die erdigen Farben sahen noch so frisch aus, als wären die Bilder gerade eben erst von einem sorgfältigen Maler – oder sollte man sagen Schreiber? – auf die Wände gebracht worden.
Ungewöhnlich unter den abgebildeten Göttern und Dämonen waren Benu und Ba. »Wiederauferstehung und freie Seele«, murmelte John.
Kathy schüttelte den Kopf, als ob sie die Irritation durch das Geräusch vertrieben wollte, und folgte dem Blick ihres Vaters. »Wahnsinn eigentlich.«
»Wahnsinn?« John musste lachen. »Bitte etwas mehr Respekt, junge Dame«, sagte er ironisch.
»Ich mein’ ja nur. Dreitausend Jahre lang haben die ihren Priestern alles geglaubt, unglaublichen Aufwand in all die Tempel und Pyramiden gesteckt und für uns ist es nur noch Wissenschaft und Kunst. Da kann man für schon demütig werden, wenn man bedenkt, dass alle aktuellen Religionen erst seit viel weniger Jahren existieren. Vielleicht werden die später auch mal von Wissenschaftlern enträtselt.«
Stimmt, dachte John und war stolz auf sie. »Nicht, dass Du mir noch weise wirst mit dem Alter«, grinste er.
Kathy grinste zurück.
John überlegte. »Aber warum eigentlich Grabräuber? Hier ist doch nichts, was man rauben könnte.«
Kathy wiegte den Kopf hin und her. »Vielleicht liegen Grabbeigaben ja nicht einfach in einer Vorkammer rum.«
»Wieso Vorkammer?« John war irritiert. Hier ist doch Schluss. Er zeigte auf die Wand.
»Jetzt schau halt endlich auf den Bildschirm.«
»Ach, der Technikschnickschnack«, winkte John ab. »Wer braucht das schon?«
»Wenn du jetzt nicht schaust, werde ich ernsthaft sauer.«
John seufzte. »Also schön, was hat uns dein Dings denn mitzuteilen?«
»Schau selbst.«
John blickte auf den Monitor und bekam große Augen. Die Konturen eines Zugangsschachts und des Raumes, in dem sie standen, waren klar zu erkennen. Auch die Wand mit den Hieroglyphen. Und ein Hohlraum dahinter! »Mein Gott, das ist nur eine Scheinwand!«
»So ist es«, sagte Kathy sichtlich zufrieden. »Die Wand ist Fake. Ein wenig Technikschnickschnack schadet wohl doch nicht? Ich denke, was wir da sehen, ist die Hauptkammer! Und das da …« – sie deutete auf eine T-förmige Struktur in der Kammer hinter der Wand – »… ist vielleicht, was die Sprüche beschützen sollen.«
John steckte sein kleines Büchlein weg und zog aus derselben Tasche ein Handy, drückte zwei Tasten und sprach hinein: »Dreizehnter Tag der Expedition. Wir stehen in der Vorkammer von Grab KVWW-17. Das Tiefensonar zeigt eine weitere Kammer hinter einer Scheinwand. Wir öffnen jetzt vorsichtig einen Sicht- Zugang …«
»Ach, jetzt ist es ein Tiefensonar und kein Technikschnickschnack mehr?«
John zuckte mit den Schultern. »Es musste sich seinen Namen erst verdienen.«
»Wollen wir?« Kathy wippte auf ihren Füßen auf und ab.
»Okay, los. Aber vorsichtig!«
Kathy nahm einen kleinen Handpickel vom Gürtel und bearbeitete damit vorsichtig die Wand. Die Schläge klangen dumpf, Lehm bröckelte ab und rieselte zu Boden. Plötzlich fühlte sie, wie das Material nachgab. Der Pickel durchstieß die dünne Wand. Ein paar Brocken Mörtel lösten sich ringsum, das Loch wurde größer. Ein Luftzug kam aus dem Loch. Heraus. Das war ungewöhnlich. John hielt sich ein Tuch vor die Nase, gab Kathy ein zweites und machte ihr ein Zeichen es ihm nach zu tun. »Schimmelpilze vielleicht«, sagte er gedämpft durchs Tuch.
»Hmm«, brummte Kathy in ihr Tuch. Dann war es, als würde dieser Laut von den Wänden aufgenommen, zurückgeworfen und dabei verstärkt: HmmmMMMMM. Ein dumpfes Grollen. Dann ein Rumpeln. »Was zum …?« Kathy trat einen Schritt zurück und schaute sich um. Ein lauter dumpfer Schlag war zu hören. Der Sand am Boden der Kammer wurde aufgewirbelt.
Hinter John und Kathy erstarb im Zugangsschacht das Tageslicht. Nun blieb nur noch das Licht der Akkuscheinwerfer. Es tauchte das Gesicht ihres Vaters in bleiches Licht. Oder war die Farbe aus seinem Gesicht gar nicht wegen der künstlichen Beleuchtung verschwunden?
»Oh Scheiße.« John setzt sich mit zittrigen Knien auf den Boden.
»Was war das denn?« Kathy war sichtlich besorgt. Sie kaute auf ihrer Unterlippe.
»Eine Falle. Wir sind eingeschlossen.« John schüttelte halb ungläubig, halb die alte Technik bewundernd den Kopf.
»Und jetzt?« Kathy schien sich zu ärgern, dass ihr Vater weniger Anzeichen von aufsteigender Panik zeigte, als sie selbst fühlte.
»Abwarten, bis uns jemand ausgräbt. Oder willst du’s damit versuchen?« John zeigte auf den Handpickel, den Kathy noch in der Hand hielt.
Kathy kam ihr Werkzeug mit einmal lächerlich klein vor.
Sie seufzte und setzte sich neben ihren Vater auf den Boden.
»Na schön. Wie lange wird es dauern, bis uns jemand findet?«, wollte sie wissen. John zuckte mit den Schultern. »Heute Abend vielleicht.«
Kathy lächelte erleichtert.
»Oder halt in dreitausend Jahren«, fuhr John seufzend fort.
Kathy schaute ihn böse an. Sie schwiegen eine Weile.
Es raschelte wieder. Das kam von hinter der Wand. John zuckte zusammen. »Was …?«
Ein Kratzen war zu hören.
Kathy stand auf. »Vielleicht ist da ein Tierbau – etwas, das wir vergrößern können, um hinaus zu kommen. Oder wenigstens frische Luft.« Sie leuchtete mit der Taschenlampe durch das Loch – mitten in ein schrumpeliges Gesicht! Kathys Herz setzte einen Schlag aus. Sie taumelte zurück.
»Was hast Du denn?«, wollte John wissen. Aber Kathy schüttelte nur stumm den Kopf und wich von der Wand zurück.
Das Rascheln wurde lauter. Jetzt wieder dieses Kratzen. Eine Hand griff durch das Loch. Sie sah aus, als würde sie nur aus Haut bestehen, die zu Leder geworden war. Eine zweite Hand erschien und beide rissen mit erstaunlicher Leichtigkeit die Wand um das Loch herum ein.
Kathy schrie. Sie ließ den Pickel fallen und bemerkte es nicht einmal.
John schrie noch lauter.
Langsam arbeitete sich eine Gestalt durch das Loch – offenbar keine lebende Gestalt. Auch keine Mumie. Eher ein Art Ledermann. Auf dünnen Knochen festgeklebtes dunkles, altes Leder. Die Erscheinung fing an zu sprechen: »Ar... Ath... Mo... Ker... He... Sa... Amen... Thep.«
John konnte mühsam folgen. Das war Altägyptisch aus dem ersten Reich, nicht Johns Spezialgebiet. Dass Kathy, weiter an die Wand gepresst, immer noch gellend kreischte, war auch nicht hilfreich. John zwang sich dazu, die Worte konzentriert laut nachzusprechen.
Das brachte Kathy dazu, das Schreien zu beenden. Sie blickte die Erscheinung nur noch ungläubig an.
Dann übersetzte John: »Du – gestört – Ruhe von – Amenthep.« Er versuchte, in derselben Sprache zu antworten: »Sa – Lun – Te – Amenthep? Du – Amenthep?« Der Ledermann bewegte langsam und knarzend den Kopf von links nach rechts. Schütteln konnte man es nicht nennen. Aber es hatte wohl die gleiche Bedeutung. »Ka She Po.«
»Priester«, übersetzte John.
»Amen Thep Ank.«
»Amenthep – dort«.
Die Lederhand wies durch das Loch in die Hauptkammer. Kathy nutzte diese Ablenkung, sprang vor, schnappte sich den kleinen Pickel wieder vom Boden und hielt ihn abwehrend in Richtung Gestalt. Die drehte nur den Kopf in Kathys Richtung und rührte sich nicht. Wieder knarzte es dabei, als ob man einen alten Ledergürtel verdreht. Kathy stellten sich die Nackenhaare auf.
John war inzwischen jenseits jeder Angst. Er nahm den Scheinwerfer und leuchtete die Kammer hinter dem Loch aus. Für das Gold und den Streitwagen, die sich darin befanden, hatte er kein Auge.
Denn in der Mitte standen ein prächtiger Sarkophag und an dessen Fußende ein leeres steinernes Bett. Und der Deckel des Sarkophags bewegte sich langsam scharrend zur Seite.
Hinter John fing die seltsame Ledergestalt wieder an, zu sprechen: »Sa Kul Ta Amen Thep Tehh! Ser Lu Ser Mi Fah! Li Ba Stal Ta!«
John fuhr herum und leuchtete mit dem Scheinwerfer in seiner Hand in das augenlose Gesicht aus Leder. Dann übersetzte er: »Rache Amenthep furchtbar. An Dir – und mir – schnell! Ritual der … Beruhigung von Seele«.
»Beruhigung klingt gut«, meinte Kathy.
Auch John fand das eine gute Idee. Er nickte. »Ja, Ritual. Los! Ka!«
Der Lederpriester sah von John zu Kathy. »Gja Vo Har Tse Ko »
»Ich dafür brauche Leber. Leber?« John wurde nun doch panisch und überlegte, ob er das vielleicht falsch übersetzt hatte. Er deutete auf seinen Bauch. »Leber?«
Der Priester nickte langsam. »Ka Mno Gel?«
»Wer von Euch?«
»Nimm deine eigene, verflucht!«, mischte sich Kathy ein und machte mit erhobenem Pickel einen Schritt auf den Schrumpelpriester zu.
John übersetzte und hätte schwören können, dass das langsame Kopfschütteln des Priesters diesmal traurig war. »Ka Go Ne La.«
»Meine – lange – fort« übersetzte John.
»Li Ba – Amen Thep Stal!«
»Wir machen Ritual. Dann Amenthep besänftigt, insistiert er«, meinte John.
»Fuck.« Kathy war sauer. »Kommt nicht in Frage.«
Der Ledermann seufzte. Es klang wie Blätter im Wind. »So Kje Tal Ta Tol«
»Dann – schrecklicher Tod – alle.« John zögerte. »Alle?«, hakte er dann nach. »Wie, alle?«
»Lu, sha.« Der Priester zeigte auf John, dann auf Kathy und eine Übersetzung war unnötig … »Mi.« Er legte sich selbst die Hand auf die Brust. »Ta Tol. Ene Nok. Kes Chu.« Er zeigte auf den blockierten Gang.
»Alle da draußen«, übersetzte John wieder. »Die Welt.« Der Priester seufzte wieder mit einem rasselnden Ton, der jedem Kettenraucher alle Ehre gemacht hätte. Wieder war das Scharren des Sargdeckels zu hören.
»Du bist doch offenbar schon tot – oder so ähnlich«, warf Kathy ein. »Was interessiert dich das?«
John übersetzte das und auch die Antwort: »Ich Wächter.«
Wieder rasselte es aus dem Brustkorb des Priesters.
John blickte mit großen Augen auf seine Tochter. »Die Warnung sollte gar nicht die Toten beschützen …«, fing er an.
Kathy beendete den Satz: »… sondern die Lebenden! Oh Mist!«
Das unverkennbare Scharren von Stein auf Stein ertönte wieder und es hatte etwas Endgültiges.
John und Kathy blickten nun auf den Monitor des Laptops. Der Ledermann seltsamerweise auch. Dort war der inzwischen verdrehte Sarkophagdeckel deutlich zu erkennen.
John fasst einen Entschluss. Der Schmerz wäre nur kurz. Für Kathy musste er es tun! Für sie und für den Rest der Welt. Einen Dämon freigelassen zu haben, wäre außerdem schlecht für seine wissenschaftliche Reputation. »Hätte ich das geahnt, hätte ich weniger über fehlendes Training nachgedacht und lieber mehr getrunken.« Er wandte sich wieder dem Priester zu. »Nimm meine Leber!« John zeigte nochmal auf seinen Bauch.
»Dad!«, schrie Kathy auf.
Der Priester nickte wortlos, zog ein Messer hinter seinem Rücken – oder aus seinem Rücken – hervor und mit einer schnellen offenbar geübten Bewegung, die John keine Zeit für eine letzte Angstattacke ließ, schnitt er ihm den Bauch auf, griff hinein, umfasste die Leber und schnitt sie sauber heraus. John sackte zusammen. Er sah noch, dass der Priester das bluttriefende Organ nach oben hielt und anfing, eine Formel zu murmeln. Im Hintergrund schrie Kathy wieder, diesmal hasserfüllt. Sie sprang mit dem Pickel auf den Ledermann zu. Aber John hörte und sah sie schon nicht mehr richtig. Es wurde dunkel um ihn.
Dann wieder heller. Er öffnete die Augen und blickte an sich herab. Keine Wunde. Was zum …? Dann schaute er wieder hoch. Licht fiel wieder durch den Zugangsschacht, alle technischen Geräte und auch Kathy waren verschwunden. Ebenso der Staub. Der Boden glänzte geradezu! Vor John stand ein Mann in altägyptischer Kleidung, in der Hand hatte er einen verzierten Stab, der mit einem geschnitzten Widderkopf als Knauf abschloss. War das die junge Version des Ledermanns? Er sah ihm jedenfalls merkwürdig ähnlich … John verstand jetzt die Worte des Priesters problemlos, so als wäre Altägyptisch seine Muttersprache und er hätte es nicht jahrelang mühsam lernen müssen. »Willkommen Sklave. Du dienst nun auf ewig Amenthep im Schattenreich«, sagte der Mann emotionslos.
John schrie.
⁂
»Cut!«
Josh Carter entspannte sich. »Oh Mann, wurde auch Zeit! Method Acting ist so anstrengend. Ich war echt in John drin.«
»Ja, riecht man aber auch«, sagte Kathy, alias Amanda Green, von hinter der Kamera.
Der Priester grinste und stupste Josh kameradschaftlich mit dem Stab in den Bauch. Josh wandte sich ihm zu. »Lu, Sha, Mi, was? Fast hätte ich lachen müssen. Wo kam das denn her?«
Paul Sturbes, alias Priester, alias Ledermann, grinste. »Improvisiert. Wer kann sich denn das ganze Kauderwelsch merken?«
Der Regisseur klatschte in die Hände. »Das war alles ok so. Endlich! Freunde, das war die letzte Szene. Heute Abend machen wir unser Abschluss-Ritual und legen was auf den Grill!«
Amanda grinste Josh an. »Für Dich vielleicht eine Leber?«.
»Ich beruhige meine Seele lieber mit einem guten Tropfen!« Josh lächelte zurück. Wenn der Film ein Erfolg ist, wird sie vielleicht doch noch die nächste Lara Croft, dachte er.
Sebastian Steffens, geb. 1969 in Lübeck, Studium der Physik, promoviert in Astrophysik. Lebt mit seiner Frau in Varel in Friesland und arbeitet als freiberuflicher Berater für IT-Sicherheit. Schreibt lieber SciFi oder historische Geschichten, als über die Gegenwart.
Der Nebelwald
Luna McMullen
Die tiefhängenden Wolken schluckten das letzte Tageslicht, während Taruk durch die moosbedeckten Hügelbauten hindurchschritt. Sein Heimatdorf lag an einem großen See, dessen Wasser sich im Herbst ähnlich den Blättern der Bäume leuchtend rot verfärbte. Die Ältesten nannten dies den Blutboten und es läutete die Zeit der großen Feste ein. Dieses Jahr allerdings war für Taruk ein besonderes, denn er war nun alt genug, um zum ersten Mal selbst an einem der Feste teilzunehmen. Bevor es jedoch so weit war, musste er erst die Prüfung überstehen.
Der durchdringende Duft der Sumpfblumen stieg ihm in die Nase, doch sein Kopf war zu beschäftigt, um es wirklich zu merken.
Mit zusammengekniffenen Lippen schritt er weiter durch die Reihen der Häuser. Seine Knie zitterten leicht, aber unter keinen Umständen er wollte sich seine Verunsicherung anmerken lassen.
Taruk folgte dem Pfad und erreichte schließlich den Rand des Sees. Seichte Nebelschwaden zogen an ihm vorüber und sammelten sich über dem rötlich glänzenden Gewässer.
Sein Ziel befand sich, auf Pfählen gebaut, direkt über der Wasseroberfläche. Ein dünner Faden Rauch erhob sich, wie von den Geistern gezogen, in Richtung Himmel. Wächterin Vesta stand mit einem Speer bewaffnet am Zugang zum Steg und sah ihn schon aus der Ferne kommen.
»Wer rief dich, Taruk?« Er sah Vesta irritiert an.
»Die Ältesten!« Nun sah die Frau ihn mit hochgezogenen Brauen an.
»Taruk! Wer rief dich?« Die Art, wie sie die Frage wiederholte, ließ ihn erst stutzen, dann begriff er seinen Fehler. Er räusperte sich.
»Die Götter riefen mich.«
»Dann darfst du passieren.« Sie trat zur Seite, doch Taruk rührte sich nicht vom Fleck.
»Nun mach nicht so ein verdrießliches Gesicht, die drei Ältesten werden dich schon nicht auffressen.«
»Du hast leicht reden, Vesta.« Eine tiefe Falte erschien auf seiner Stirn.
»Stell dir vor, ich war auch einmal in deinem Alter und musste die Prüfung durchlaufen.« Sie zwinkerte ihm zu. »Nun geh schon.«
Mit pochendem Herzen betrat Taruk den Steg und lief auf den Planken bis zur Hütte. Er wollte eben klopfen, da öffnete sich die Tür von selbst. Dichter Rauch und der süße Geruch nach glimmender Moorbaumrinde drangen heraus und verursachten ein heftiges Kratzen in seinem Hals.
»Tritt ein, Taruk!« Die ruhige Stimme kam aus dem dunklen Inneren und mit einem letzten tiefen Atemzug ging er hinein.
Es dauerte einige Momente, bis sich seine Augen an das dämmrige Licht gewöhnten.
Die einzige Lichtquelle bildete ein Feuer, das in der Mitte des Raumes brannte. Die drei Ältesten saßen in einem Halbkreis um die steinerne Feuerschale und blickten den Jungen erwartungsvoll an. Ihre Augen leuchteten, angestrahlt von den Flammen, gespenstisch.
Taruk schluckte, doch seine Kehle blieb trocken und ließ seine Stimme krächzen, als er die Worte sprach, die sein Vater ihm beigebracht hatte: »Ehrwürdige Älteste, ich bin Taruk, Sohn des Aalon, und werde mich dem Nebelwald stellen.«
In Wahrheit wollte er sich dieser Prüfung keineswegs unterziehen. Er fühlte sich noch nicht bereit. Doch es blieb ihm nichts anderes übrig. Jeder Mann und jede Frau, die an die Götter glaubten, musste diese Prüfung absolvieren und wenn jemand das Alter des Wandels erreicht hatte, war es soweit. Nur so würde er zum vollen Mitglied des Stammes werden und durfte an den Festen und Entscheidungen des Dorfes teilhaben.
»Wir haben die Götter befragt und sie haben dich als würdig erachtet.« Damit waren die rituellen Worte gesprochen und es gab kein Zurück mehr. »Nimm Platz, Taruk.« Die Älteste deutete auf einen hölzernen Schemel nahe dem Feuer.
Er setzte sich zögerlich und die Frau drückte ihm einen Becher in die klammen Hände. Die Flüssigkeit darin war im Dunkel der Kate kaum zu erkennen, doch sie war eindeutig warm und roch nach Schuppengras und Minze. Vorsichtig trank er einen Schluck, um seinen Hals zu befeuchten. Ein Teil seiner Anspannung verflog augenblicklich. Taruk nahm einen weiteren Schluck und genoss, wie sich die Wärme in ihm ausbreitete.
Dann zog der bärtige Älteste neben ihm seine Aufmerksamkeit auf sich. Seine Stimme war rau und kalt.
»Als Anwärter wirst du dich morgen bei Sonnenaufgang zum Rand des Nebelwaldes begeben. Deine Familie darf dich bis zur markierten Stelle begleiten. Du betrittst den Wald ausschließlich bewaffnet mit der Klinge der Götter.« Kaum sprach der Mann dies aus, zog die Älteste einen kleinen Dolch in einer ledernen Hülle aus der Tasche ihres Mantels. Taruk bemerkte ein sanftes grünes Glitzern am Knauf, während sie ihm die Waffe entgegenstreckte. Bedächtig nahm er die Gabe entgegen.
»Deine Aufgabe ist es, bis zum Steinkreis vorzudringen.« Der dritte Älteste, dessen Narbe am Kinn schimmerte, blickte über das Feuer zu ihm herüber und ein Stich der Furcht durchzuckte Taruks Körper. Erneut schluckte er leer, bevor er antwortete.
»Ich habe verstanden.«
Drei Augenpaare sahen ihn weiterhin unverwandt an und Taruk wusste nichts Besseres zu tun, als einen weiteren Schluck aus seinem Becher zu nehmen.
Schweigen füllte die Hütte zusammen mit dem leisen Knistern des Feuers.
⁂
Als er endlich am Haus seiner Eltern ankam, stieg er durch den runden Einlass und setzte sich ans Feuer. Taruks Mutter reichte ihm einen Becher Tee, den er in einem Zug leerte, während sein Vater ausgelassen über einen großen Hasen plauderte, der sich in einer seiner Fallen verfangen hatte. Taruks Schwester starrte wie hypnotisiert auf den Dolch.
Er wusste, dass seine Eltern nichts über die Prüfung erzählen würden, also sparte er sich die Fragen. Nach einer Weile zog er sich ohne ein Wort in die Schlafnische zurück.
Kühle Luft pfiff durch einen Spalt im Moosdach und vertrieb allmählich die dröhnenden Kopfschmerzen, die er dem stickigen Rauch in der Hütte der Ältesten verdankte. Ein unangenehmer Knoten bildete sich in seinem Magen mit jedem Moment, den er der Prüfung näher kam. Taruk versuchte, seinen Körper zu beruhigen, und atmete einige Male tief ein. Er wollte die Götter um Rat bitten, doch die rechten Worte kamen ihm nicht in den Sinn.
Da es viel zu dunkel war, um irgendetwas zu erkennen, zog er die Waffe der Götter zum ersten Mal aus der Halterung. Vorsichtig fuhr er mit dem Finger über die flache Seite der Klinge nach oben. An der Spitze angekommen fuhr ein stechender Schmerz durch seinen Daumen. Die Klinge war so scharf, dass er sich trotz der nur leichten Berührung geschnitten hatte. Seufzend wischte er das Blut ab und schob die Klinge zurück. Er blickte noch eine Weile in die Dunkelheit, sicher, keinen Schlaf zu finden, denn die quälenden Gedanken um die Prüfung erfüllten seinen Körper und Geist.
⁂
Als Taruk erwachte, hing die Finsternis noch immer undurchdringlich in der Behausung. Er hörte das leise Atmen seiner Schwester neben sich. Wie lang war es wohl noch bis Sonnenaufgang? Sogleich beschleunigte sich sein Herzschlag wieder und der Kloß in seinem Inneren kehrte zurück. Mit zitternden Beinen kletterte er aus dem Lager und schob den Stoff vor dem Eingang zur Seite.
Erstes Dämmerlicht erhellte den Himmel im Osten. Er sah kurz zurück zu der Nische, in der seine Eltern schliefen. Sollte er sie wecken oder noch warten? Kopfschüttelnd trat er nach draußen. Jetzt war es genauso gut wie zum Sonnenaufgang, um die Prüfung anzutreten. Das Dorf war noch wie ausgestorben, so sah wenigstens keiner, wie Taruk mit jedem Schritt mehr zu schlottern begann. Auch nicht Borek. Niemand hatte ihm etwas über die Gefahren erzählen wollen, die den Anwärter im Wald erwarteten. Niemand durfte etwas erzählen. Die Ungewissheit nagte an seinem Verstand und nährte gleichzeitig seine Angst.
Taruk betrat die Wiese vor dem Nebelwald, während dicke, feuchte Schwaden langsam über den Pfad waberten. Er erkannte die Markierung erst, als er unmittelbar davor stand, doch Vesta hörte offenbar, wie seine Schuhe durch das Gras raschelten, und schien keineswegs überrascht.
»Wer rief dich, Taruk?«
»Die Götter riefen mich.« Diesmal wusste er die richtige Antwort.
»Dann darfst du passieren.« Seine Augen fixierten den schmalen Weg und den Wald, der mit jedem Schritt näher rückte.
Dann umfing ihn die Dunkelheit zwischen den Bäumen. Sein Herz hämmerte fast so heftig gegen seine Rippen, wie der Kriegsgott vor einer Schlacht seine Trommeln schlug.
Taruk zwang sich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, während das Blut in seinen Ohren rauschte. Der Schrei einer Eule ließ ihn zusammenzucken und beinahe stolperte er über eine Wurzel. Sein Atem wurde unregelmäßiger und sandte kleine Dunstwolken in die kühle Luft.
Irgendwo knackte ein Ast und Taruk wirbelte mit aufgerissenen Augen herum. Das Geräusch ertönte erneut und er griff nach seinem Dolch. Ein tiefes Knarzen brachte ihn fast aus dem Gleichgewicht.
Angestrengt blickte er in die Dunkelheit und suchte verzweifelt nach irgendeiner Bewegung in den Schatten. Wieder ein Knacken nahe vor ihm. Taruk stieß die Waffe einige Male blindlings ins Nichts, bis sich sein Fuß in einer Ranke verfing. Er strauchelte und stieß hart mit dem Knie gegen einen Stein. Keuchend vor Schmerz schwang er den Dolch abermals durch die Luft. Beinahe wäre ihm seine einzige Waffe aus den feuchten Händen geglitten. Panisch befreite er seinen Fuß von der Pflanze und zog sich auf die Beine.
Er rannte los, ohne sich umzusehen. Langsam drang etwas Licht durch die dichten Baumwipfel, gerade so viel, dass er den Pfad vor sich als dunkle Schneise erkannte.
An einer Weggabelung kam er rutschend zum Stehen und blickte sich schwer atmend um.
Wieder knackte es in der Nähe und diesmal sah Taruk, wer ihn verfolgte. Eiskalt floss ihm der Schweiß über den Rücken und die Haare an seinen Armen stellten sich auf. Er konnte den Blick nicht von dem Wesen abwenden. Dies konnte nicht wirklich passieren! Das war nicht echt! Baumhüter gab es nur in den Geschichten, die Eltern ihren Kindern erzählten, um sie vom Wald fernzuhalten. Doch hier war er und kam mit jedem von Taruks Herzschlägen näher. Der knorrige, stammartige Körper des Wesens schob sich mit Hilfe seiner Wurzeln langsam über den Boden.
Einer Peitsche gleich schlugen seine Äste nach dem Jungen. Ehe dieser es ganz begreifen konnte, umwickelten die Zweige seine Handgelenke. Wurzeln wanden sich um seinen Brustkorb und drückten die Luft aus seinen Lungen. Taruk trat verzweifelt um sich. Der Baumhüter kam immer näher, so nahe, bis seine unheimlichen Gesichtszüge zu erkennen waren.
Leere Augenhöhlen starrten Taruk an und ein langer Schlitz darunter glich dem zahnlosen Mund eines Greises.
Der Junge rang weiter um Luft und ruderte vergeblich mit den Armen, doch der übernatürlichen Kraft des Wesens hatte er nichts entgegenzusetzen. Ein Sonnenstrahl fiel durch das Blätterdach und brachte den Kristall am Dolch, den Taruk weiterhin fest umklammert hielt, zum Leuchten. Der Stein reflektierte das Licht und warf einen grünlichen Schimmer auf den Baumhüter. Ein ohrenbetäubendes Krächzen erfüllte die Stille des Waldes. Der Schrei dröhnte schmerzhaft in Taruks Kopf. Die Schlinge um sein Handgelenk lockerte sich. Er befreite seine Hand und stieß in blinder Panik die Klinge in Richtung des Wesens.
⁂
»Taruk, wach auf!« Er schoss so schnell nach oben, dass er beinahe mit seiner Mutter zusammenprallte. Schweiß lief ihm über die Stirn. War er nicht eben noch draußen gewesen? Wo war der Baumhüter hin? Konnte das alles wirklich nur ein Traum gewesen sein? Kopfschüttelnd fiel er zurück auf das Lager.
»Du musst aufstehen! Bei Sonnenaufgang müssen wir am Nebelwald sein. Komm!« Die sanfte Stimme seiner Mutter holte ihn aus seinen Gedanken raus. Das konnte nicht wahr sein!
Die Prüfung lag immer noch vor ihm. Noch einmal wollte – konnte – er das nicht durchleben. Verunsichert kroch der Junge aus der Schlafnische und trank einen Schluck Wasser. Seine Eltern waren zum Abmarsch bereit und auch seine Schwester saß erwartungsvoll auf einem Schemel.
»Mach dir keine Sorgen, du schaffst das!« Sein Vater legte ihm die Hand auf die Schulter. Offenbar trug Taruk seine Zweifel und die Angst ungeschönt im Gesicht.
Seine Beine fühlten sich wie Sumpfmoos an und er stolperte zweimal fast über seine eigenen Füße, während er den Weg zum Nebelwald erneut beschritt. Die meisten Dorfbewohner schliefen noch. Nur Borek saß mit einem fiesen Grinsen vor seiner Hütte und flickte ein Netz. Die Anwesenheit von Taruks Eltern ersparte ihm aber immerhin einen Kommentar des Schwachkopfs.
Als er die Wiese vor dem Nebelwald betrat, erhob sich eine Gruppe Krähen krächzend aus den nahen Bäumen und flog tief über ihn hinweg. Dann kamen die Markierung und Vesta in Sicht.
»Guten Morgen, Taruk. Ab hier musst du nun allein weiter!«
»Aber … musst du mich nicht nach den Göttern fragen?« Die Wächterin schenkte ihm ein Lächeln.
»Diese Frage hast du bereits beantwortet.« Taruk starrte die Frau mit offenem Mund an. Sein Herz schlug nicht, es hämmerte wild gegen seine Brust.
Zu gern hätte er sie gefragt, ob er nicht doch schon hier gewesen war, doch wie lächerlich hätte das geklungen?
Mit sanfter Gewalt schob sein Vater ihn weiter, bis seine Beine von allein zu laufen begannen.
Der Wald verschwamm vor seinen Augen und ohne es zu merken, stand er plötzlich zwischen den Bäumen. Zaghaft setzte er einen Fuß vor den anderen. Würde gleich der Baumhüter erneut auftauchen? Oder gar etwas noch Schlimmeres?
Ein Knacken ließ den Jungen so heftig zusammen- zucken, dass er sich an einem Baumstamm festhalten musste.
Sein Blick raste panisch zwischen den Stämmen hindurch. Verfolgt von den Bildern seines Traumes rannte er, ohne zu überlegen, los. Die Weggabelung tauchte vor ihm auf. Welchen Weg sollte er wählen? Hektisch sah er sich wieder um. Alles war ruhig, bis auf einen Vogel, der sich schimpfend aus seinem Nest erhob. Taruk wählte instinktiv den linken Pfad. Er preschte weiter, selbst als ein niedriger Ast ihm ins Gesicht schlug.
Schwer atmend kam er auf einer Lichtung zum Stehen.
Der Steinkreis lag friedlich vor ihm. Einige der Monolithen waren größer als das Hügelhaus seiner Eltern. Die teilweise mit Flechten bewachsenen Felsen glitzerten leicht in der Morgensonne und verströmten eine seltsame Ruhe. Zögernd trat Taruk näher und berührte den ersten Stein. Die raue Oberfläche war warm unter seinen Fingern und er fühlte ein leichtes Kribbeln.
»Guten Morgen, Taruk!«
Der Bursche wirbelte erschrocken herum und sah den bärtigen Ältesten zwischen den Steinen auftauchen. »Was hast du gesehen?«
Verwirrt und noch immer außer Atem blieb der Junge dem Mann eine Antwort schuldig.
»In deinem Traum – gegen was hast du gekämpft?«
»Ich … also, gegen einen Baumhüter!« Die Worte klangen zu verrückt in seinen Ohren und doch war es die Wahrheit.
»Einen Baumhüter? Erzähle uns genau, was passiert ist.« Die beiden anderen Ältesten erschienen nun ebenfalls zwischen den Steinen und versammelten sich um eine flache Stele in der Mitte des Kreises. Langsam trat auch Taruk näher und schilderte seinen Traum und den Kampf.
Dabei beobachtete er die drei Gesichter genau, doch niemand schien das Ringen gegen eine Sagengestalt für ungewöhnlich zu befinden. Irritiert kam Taruk zum Schluss der Geschichte. Bangend sah er die drei an.
»Du hast deine Prüfung bestanden und kannst nun als zukünftiger Wächter deine Ausbildung beginnen.«
»Was?« Taruk hatten mit viel gerechnet, aber nicht, dass er die Prüfung bereits absolviert hatte. »Ich … also …«
»Du zweifelst am Willen der Götter?«
»Nein! Ich verstehe es nur nicht!«
»Diese Prüfung dient dazu, deinen Mut zu testen und deine Bestimmung zu finden. Die Vision zeigte dir deine schlimmste Angst und du hast sie mit Hilfe der Götter besiegt.« Die Älteste sah ihn mit einem Lächeln an.
»Aber …?« Taruk wusste nicht, was er sagen sollte.
»Du stehst immerhin hier. Du hast dich dem Wald entgegengestellt, trotz der Ungewissheit, ob der Baumhüter zurückkehren würde.«
Der zukünftige Wächter starrte weiterhin ungläubig zu den Ältesten herüber.
»Er sieht nicht überzeugt aus«, scherzte der Mann mit der Narbe am Kinn. »Zieh deinen Dolch!«
Beinahe hätte Taruk vergessen, dass er die Waffe an seinem Gürtel trug. Langsam umfasste er den Griff und zog die Klinge. Um ein Haar hätte er den Dolch fallen gelassen, denn braunes klebriges Harz haftete überall am Werkzeug der Götter und glitzerte im Licht der Sonne.
Luna McMullen, geboren 1992, begeistert sich schon seit ihrer Kindheit fürs Lesen und gibt diese Liebe auch an ihre beiden Söhne weiter. Dabei ist sie immer offen für neue Genres, doch vor allem Fantasy und historische Romane stehen in den heimatlichen Regalen. Als studierte Anthropologin stehen in ihren Werken vor allem ein vielschichtiger Plot, ein detaillierter Weltenbau und Logik im Vordergrund. Seit Anfang 2021 arbeitet sie an ihrem High-Fantasy Debüt.
Instagram: @luna9.2mcmullen
Das Herz des Ozeans
Kornelia Schmid
In Querea ruht das Herz des Ozeans tief in felsigem Grund. Heute träumt Koyi von ihm. Hinter seiner Stirn sprudelt die Stimme, immer lauter.
Koyi schüttelt den Kopf, doch der Laut klebt an seinen Schuppen. Keine seiner Bewegungen kann ihn abstreifen, egal wie sehr er es versucht. Also folgt er dem Ruf, entlang der Lichterkette der grünen Schnecken durch den Düsterschein der Stadt. In ihrem Zentrum liegt ein Tempel aus Korallensäulen und Perlmutttreppen.
»Komm«, schreit das Herz hinter dem Torbogen.
Koyi sieht sich um. Die Priester sind nicht hier. In seinen Träumen ist er allein. Immer allein. Langsam blinzelt er. In den Wogen im Inneren des Gebäudes pulsiert roter Schein und färbt die Wände in derselben Schwere, die auf Koyis Schuppen haftet. Das Wasser kocht. Wolken aus dunklem Dampf winden sich durch die Wellen. Koyi windet sich mit ihnen. Denn inmitten einer klaffenden Wunde im Boden quillt heiß das Blut des Herzens. Glühende Tropfen stoßen wie Finger durch den Tempel. Ihre Berührung raubt dem Boden das Leben und lässt nur starre graue Masse zurück.
Keine Pflanze wird dort Halt finden, kein Krebs darüber krabbeln. In seinem Schmerz tötet das Herz des Ozeans den Tempel. Bald auch die Stadt. Querea ist verflucht, schon seit vielen Zyklen zum Untergang verurteilt. Das sagen die Priester.
»Komm«, schreit das Herz und Koyi streckt die Hände aus. Dampfwolken stoßen ihn zurück, doch er beißt die Zähne zusammen und drängt sich mit kraftvollen Flossenschlägen durch Strudel aus Finsternis, bis die Glut des Blutes sein Sichtfeld ausfüllt. Dann taucht er seinen Kopf ins Herz. Vertrautes Elend brennt auf seinen Schuppen und umfängt ihn bald endlos wie das Meer.
⁂
Koyi reißt die Augen auf. Das Pochen in seiner Brust bebt durch seinen Körper. Die Schreie kleben noch immer auf ihm und Glut brennt durch seine Adern. Der rote Schein des blutenden Herzens liegt wie eine Membran über seinem Blick und gibt nur langsam die Sicht auf das Zimmer frei, in dem Koyi seit vielen Zyklen seinen Schlaf finden darf. Manchmal ist er friedlich.
Über ihm schwingen filigrane Bögen und Spiralen aus grünen und gelben Muschelplättchen. Eine Qualle hinter einem Netz spendet mattblaues Licht.
Jari legt eine Hand auf seine Schuppen, wie sie es immer tut, wenn er träumt. Sie weiß davon, niemand sonst. Ihre Stimme gleitet sanft durch die Wogen. Er spürt die Wirbel des Schalls auf seinem Gesicht. »Du solltest in den Tempel schwimmen. Vielleicht können die Priester deine Seele heilen.«
Koyi schwimmt niemals in den Tempel. Seine Seele gehört nur ihm. Glaubt er.
Jari betrachtet ihn mit lichtgelben Augen und wartet auf eine Antwort, die er ihr nicht geben kann.
Schließlich nickt sie und legt den Kopf auf seine Brust. Koyi streichelt die Flossen ihres Rückens und wartet auf die Schreie von draußen. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis ein Priester zwischen den Säulen erscheint.
»Meine Königin.« Seine Stimme fließt ihnen entgegen und trägt kühle Wellen herbei. »Meine Königin, kommt schnell. Es ist das Herz.«
Jari richtet sich auf und Koyi lässt sie los. Er ballt die Hand zur Faust, um den letzten Hauch ihrer Körperwärme festzuhalten. In ihrem Schrecken vergisst sie, sich noch einmal umzusehen. Koyi fühlt die Schläge ihrer Flossen im Wasser um ihn herum.
⁂
Jari hat Quereas Untergang bewirkt, als sie das Kind verschont hat. Damals, vor unzähligen Zyklen, als das Herz zum ersten Mal geblutet hat. Als Jari frisch gekrönt in den Tempel gekommen ist, eine Tränenwolke im Wasser um ihren Kopf.
In ihrer Erinnerung schimmern die Bodenplatten und umschließen die Steinspalte, in der das Herz des Ozeans ruht. Heute liegt Glut auf dem Stein und verrät die frische Wunde im Körper des Meeres.
Neben der Spalte wartet das Kind und blickt in die Tiefe. Seine hellen Schuppen reflektieren den roten Schein. Sie wirken dünn auf seiner Brust – an der Stelle, auf die ein Priester den Knochenspeer drückt.
Als Jari vor den Jungen tritt, hebt der Junge den Kopf und blickt sie an. In seinen Augen leuchtet die Stimme des Herzens. Jari schluckt.
Der Priester gibt ihr die rituelle Waffe. Sie schließt die Finger darum, doch der glatte Schaft droht davonzugleiten.
Ihre Mutter konnte ihn halten, Jari kann es nicht. Er passt nicht in die Form ihrer Hand.
»Ein Fluch wurde aus dem Herzen geboren.« Der Priester zeigt auf den Jungen. »Er muss dem Herz die geraubte Kraft zurückgeben, damit sich die Wunde schließt.«
Ihre Mutter ist gestorben. Jari kann nicht noch mehr Blut den Haien opfern. Nicht in diesem Moment. Egal, wie sehr das Herz des Ozeans danach schreit. Tut es das überhaupt? Sie lauscht auf das Pochen tief unter ihr, doch es bleibt leise. Das verfluchte Kind wendet das Gesicht ab und weint. Manchmal hört Jari seine Stimme, wenn sie im Tempel ist. Sie hat den Speer mit in ihren Palast genommen und im Sand vergraben. Sie kann ihn nicht zerbrechen. Das steht auch einer Königin nicht zu.
⁂
Jetzt verharrt Jari vor dem Torbogen. Sie sieht tosende Schwärze, durchmischt mit Schmerzenslicht. Grauer Stein hat die Perlmuttplatten gefressen und Hitze die Algenranken zerstört. Die Wunde ist nun schon so lange offen. Ihre Glutfinger zucken höher als zuvor. Bald werden sie nach der Stadt greifen. Jari sinkt in den Sand und legt die Hände auf den Boden. Drei Priester verharren vor ihr, sehen sie an, erwarten eine Entscheidung. Aber Jari weiß nicht, wie sie ihre Stadt retten soll.
Das Wasser um sie herum ist wärmer als sonst und winzige Steinflocken treiben in den Wellen. Sie schmecken nach Schwärze.
»Das verfluchte Kind hat dem Herzen seine Kraft geraubt. Solange es lebt, kann die Wunde nicht heilen«, sagt ein Priester. »Du hast die Heilung des Herzens damals verhindert, Jari.«
»Er war nur ein Junge.« Und sie nur ein Mädchen, kaum eine Herrscherin. Der Schmerz des Herzens ist die Strafe dafür, dass der Speer nicht in ihre Hand gepasst hat. Als sie die Priester anschaut, erkennt sie diese Gewissheit in ihren Blicken.
»Inzwischen ist er kein Junge mehr. Ist sein Leben deshalb weniger wert?« Koyi kommt näher.
Jari ist erstaunt, dass er sich einmischt. Das tut er nie. Er will kein König sein, egal, wie oft sie ihn darum bittet.
»Sein Leben ist unermesslich kostbar«, antwortet ein Priester. »Doch er hat es nur geliehen – nie zuvor wurde ein Kind im Tempel geboren. Seine Seele gehört dem Herzen, nicht ihm.«
Jaris wühlende Hände finden etwas Hartes. Ihre Finger tasten über den Schaft des Knochenspeers. Sie will ihn nicht herausziehen, aber sie tut es. Jari dreht die rituelle Waffe in der Hand. Sie ist sperrig und schwer, doch sie rutscht nicht davon. Dann richtet sich Jari langsam auf und blickt die Priester der Reihe nach an.
Damals hat sie das Kind nicht getötet, doch sie hat dafür gesorgt, dass es die Stadt verlässt. Dass es weit weg schwimmt und fern aller bekannten Siedlungen ihres Reichs inmitten blauer Ödnis einen Platz findet, an dem es die Priester nicht erreichen. Jari packt den Speer fest.
Koyi sieht ihr in die Augen. »Ich könnte ihn finden«, sagte er leise. »Wenn das dein Wunsch ist, breche ich auf und suche ihn.«
Jari ist eine Königin. Sie hat den Wunsch, ihr Volk zu beschützen. Vor der Todesfahlheit, mit der das Herz des Ozeans Querea überschüttet.
Also nickt sie. Koyi drückt ihre Hände. Sie will ihm die Waffe geben, doch er nimmt sie nicht.
Nein, das würde er nicht tun. Das Ritual ist für sie bestimmt.
Ohne ein Wort schwimmt er hinaus, blickt sich nur noch einmal zu ihr um. Jari hält seinen dunklen Blick in Gedanken fest. Die Priester folgen ihm. In diesem Moment wirkt er wie ein König.
⁂
Jari hat Koyi kennengelernt, als sie immer weiter nach oben geschwommen ist. Damals weiß sie nicht, warum die Stimme ihrer Mutter so lange nach ihrem Tod immer noch in ihrem Kopf wirbelt. Warum sie sie hört, in jedem Flossenschlag. Damals verlässt Jari Querea und umhüllt sich mit Einsamkeit.
In der Vergangenheit umgibt Blau sie, so weit sie sehen kann. Licht sickert über ihrem Kopf durch die Wellen und blitzt in den Bläschen, die ihre Bewegungen verursachen. Ein Schwarm silberner Fische zuckt an ihr vorbei. Jari schließt die Augen. Als sie sie wieder öffnet, sieht sie ihn treiben. Er gleitet reglos dahin, als wäre er tot.
Jari schwimmt zu ihm hin, nimmt seine Hand und zieht ihn aus der Strömung. Sofort reißt er seine Finger weg und taumelt durch die Wellen. Dann trifft sie sein Blick.
Seine Augen sind rot wie Seesterne, seine Schuppen hell wie Schaum. Einen Moment lang glaubt sie, seine Flossen würden bluten, doch das Muster ist natürlich. Jari kennt ihn nicht. Bestimmt kennt er sie. Denn sie ist seine Königin. Vielleicht schwimmt er deswegen so schnell und lässt sie zurück in blauer Leere. Ihre Lippen zittern. Jari presst die Hand auf den Mund. Später erreicht sie den Meeresgrund. Vor sich erkennt sie die Türme ihrer Hauptstadt.
Ihre Silhouetten liegen blass hinter den Wasserschichten. Bunte Lichtpunkte verraten die Anwesenheit ihres Volks.
Eine Weile verharrt sie im Sand, spürt, wie die feinen Körnchen von Wellen über ihre Arme gespült werden, und lauscht auf das Lied des Ozeans. Weit unter ihr im Boden pocht der Schlag seines Herzens.
Dann sieht sie ihn wieder. Er ist ihr gefolgt und beobachtet sie aus der Ferne. Jari bewegt sich nicht. Und irgendwann wendet er sich ab und schwimmt davon – weg von Querea. Die Konturen seiner Gestalt vergehen in Dunkelheit und Jari bleibt nur die Erinnerung an seinen Schatten.
Es wird viele Zyklen dauern, bis er ihre Hand erneut berührt. Dann wird er sie direkt ansehen und sie mit seinen roten Augen wärmen.
»Kannst du die Stille spüren?«, wird er fragen, obwohl es im Meer keine Stille gibt. Doch sie wird wissen, was er meint, und lächeln. Und als sie nickt, lächelt er ebenfalls. Bald darauf lernte sie seinen Pulsschlag fühlen.
⁂
Jari kann ihn niemals verstehen. Er weiß das. Doch ihre Hand liegt über seiner Seele, während er träumt.
Deshalb muss er zurück. Koyi schwimmt tiefer in die Höhle hinein. Ein Schwarm blauer Fische zieht an ihm vorbei. Die Wellen haben Muster in den Boden gezeichnet. Ein Krebs läuft über Muschelschalen. Koyi blickt ihm hinterher und entdeckt die Knochen. Der Sand hat sie weiß geschmirgelt.
»Der Junge ist tot«, sagt Koyi zu den Priestern.
»Bist du sicher?«
Koyi nickt und deutet auf das Gerippe. »Dort hat er sich das Leben genommen.«
Draußen tosen Wellen gegen den Fels. Die Priester beobachten Koyi. Ihre Augen sind weit aufgerissen, ihre Mienen reglos. Hören sie den Schmerz des Herzens so wie er?
»Das Ritual ist wirkungslos ohne sein Opfer«, sagt ein Priester.
Koyi antwortet nichts darauf. Nachdem sich die Priester abgewandt haben, bleibt er noch eine Weile allein in der Höhle. Hier spürt er die Stille.
Jari wartet zwischen den Säulen ihres Palasts auf seine Rückkehr. Die Schreie des Herzens werden lauter. Durch seinen Schmerz bebt der Grund und die Wellen schäumen wild durch Querea. Sie tragen Hitze mit sich. Schwer mischt sie sich in Jaris Atem.
Heute hat sie ihre Quallen freigelassen. Denn auch die Fische sind verschwunden und die Krebse laufen in Scharen über den Boden. Sie fliehen vor der grauen Verwüstung.
Der Tempel ist nicht mehr wiederzuerkennen. Qualm durchbricht sein Dach und färbt das Wasser schwarz. Finsternis treibt über der Stadt und nimmt kein Ende. Der Geschmack der Dunkelheit schwimmt auch im Palast.
Hässliche schwarze Tupfen liegen auf Jaris Schuppen. Egal, wie oft sie sie wegwischt, sie kehren immer zurück.
Jari betrachtet das Meer über Querea und hofft auf Koyis silberhelle Gestalt. Als sie ihn sieht, kribbelt ihre Brust. Er schwimmt voran, die Priester hinter ihm. Niemand sonst. Jari legt die Hände auf die Brüstung einer Mauer.
Neben ihr lehnt der Knochenspeer und zittert in den Fluten.
Koyis rote Augen funkeln. Seine Berührung ist sanft wie eine Luftblase.
»Er ist tot.« Koyi sieht sie nicht an. Seine Worte dringen nur langsam in Jaris Verstand, denn sie sind schwer wie Stein und ihre Kanten schneiden.
»Aber warum blutet das Herz dann noch?«, fragt sie. Koyi wendet sich ab. Seine Finger gleiten zwischen ihren davon.
Jari schluckt. Sie kann dem Herzen die Magie des verfluchten Jungen nicht zurückgeben. Was bleibt ihr dann noch? Sie muss Querea beschützen. Seine Kalktürme, die sich weiß in die Höhe kräuseln. Seine Säulen, an denen Muscheln wachsen und Seesterne kleben. Seine Bewohner. Die Fische zwischen den Korallen. Und ihr Volk, das sie hoffnungsvoll seine Königin heißt.
»Ich gehe selbst«, flüstert Jari. Inmitten der Meereswogen kann Koyi ihre Stimme nicht gehört haben.
Trotzdem schlingt er seine Arme um sie. Er hält sie fest und lässt sie nicht los. Lässt sie nicht in den Tempel zum Herzen.
Jari schließt die Augen und drückt die Stirn an seine Schuppen. Sie sind warm.
Doch seit das Herz blutet, ist alles hier warm. Wärme erinnert sie an den Fluch über Querea.
Lediglich sein Pulsschlag beruhigt sie, denn er ist genau wie damals und fließt gleichmäßig durch ihre Seele, bis er ihren Körper ausfüllt, genauso wie seinen.