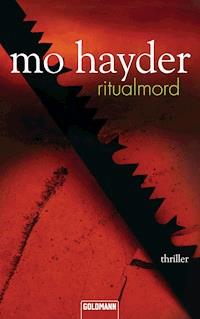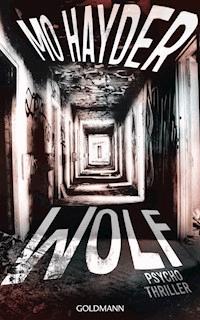Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Mo HayderCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbHNeumarkter Str. 28, 81673 München.ISBN : 978-3-641-02894-7V003
www.goldmann-verlag.dewww.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1 – 13. Mai
Kapitel 2 – 13. Mai
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6 – 25. November
Kapitel 7
Kapitel 8 – 13. Mai
Kapitel 9
Kapitel 10 – 25. November
Kapitel 11
Kapitel 12 – 14. Mai
Kapitel 13 – 7. Mai
Kapitel 14 – 14. Mai
Kapitel 15 – 14. Mai
Kapitel 16 – 14. Mai
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19 – 15. Mai
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24 – 10. Mai
Kapitel 25 – 16. Mai
Kapitel 26 – 16. Mai
Kapitel 27 – 16. Mai
Kapitel 28 – 16. Mai
Kapitel 29 – 16. Mai
Kapitel 30 – 16. Mai
Kapitel 31 – 17. Mai
Kapitel 32 – 17. Mai
Kapitel 33 – 17. Mai
Kapitel 34 – 10. Mai
Kapitel 35 – 17. Mai
Kapitel 36 – 17. Mai
Kapitel 37
Kapitel 38 – 17. Mai
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41 – 18. Mai
Kapitel 42 – 11. Mai
Kapitel 43
Kapitel 44 – 18. Mai
Kapitel 45 – 18. Mai
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49 – 18. Mai
Kapitel 50
Kapitel 51 – 18. Mai
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55 – 18. Mai
Kapitel 56
Kapitel 57 – 18. Mai
Danksagung
Copyright
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Ritual« bei Bantam Press, a division of Transworld Publishers, London
Für »Adam«
Irgendwo mitten in der Abgelegenheit der Kalahariwüste in Südafrika, versteckt im trockenen, ockergelben Veld, liegt ein kleiner, schilfbedeckter Teich am Grunde eines Kraters. Von seiner Stille abgesehen ist er unauffällig – ein beiläufiger Betrachter würde ihn nicht weiter beachten und keinen weiteren Gedanken an ihn verschwenden. Es sei denn, er wollte darin schwimmen. Oder wenigstens einen Zeh hineintauchen. Dann würde er feststellen, dass da etwas nicht stimmt. Dass etwas anders ist.
Als Erstes würde er feststellen, dass das Wasser kalt ist. Eiskalt, genau gesagt. Von einer Kälte, die nicht auf diesen Planeten gehört. Von einer Kälte, die aus Hunderten und Aberhunderten von Jahren der Stille kommt, aus den ältesten Tiefen des Universums. Und zweitens würde er feststellen, dass er fast ohne jedes Leben ist; nur ein paar farblose kleine Fische schwimmen darin. Und zuletzt, wenn er wirklich dumm genug wäre, darin zu schwimmen, würde er das tödliche Geheimnis entdecken: Dieser Teich hat keine Uferböschung und keinen Grund – er führt in einer senkrechten, kalten Linie ins Herz der Erde. Vielleicht würde er es dann hören, das unaufhörliche Raunen in den uralten Ahnensprachen der Kalaharivölker: Dies ist der Weg zur Hölle.
Dies ist Bushman’s Hole. Dies ist Boesmansgat.
1
13. Mai
Kurz nach der Mittagspause an einem Dienstag im Mai, drei Meter unter Wasser im Floating Harbour von Bristol, schloss Polizeitaucherin Sergeant »Flea« Marley ihre behandschuhten Finger um eine menschliche Hand. Es traf sie ein wenig unvorbereitet, sie so leicht zu finden, und sie strampelte unwillkürlich und wirbelte Schlick und Maschinenöl vom Boden auf; ihr Körpergewicht verlagerte sich, der Auftrieb nahm zu, und sie begann zu steigen. Sie musste sich nach unten neigen und die linke Hand unter die Pontontanks schieben; dann ließ sie ein bisschen Luft aus dem Anzug, bis sie so weit stabilisiert war, dass sie wieder auf den Grund hinuntersinken und sich ein bisschen Zeit nehmen konnte, um den Gegenstand zu befühlen.
Es war stockdunkel da unten, als steckte sie mit dem Gesicht im Schlamm, und unmöglich, irgendetwas zu sehen. Wie fast immer beim Tauchen in Fluss und Hafen musste sie sich ganz auf ihren Tastsinn verlassen, Geduld haben und abwarten, bis dieses Ding durch Abtasten seine Form verriet und ein Bild in ihrem Kopf entstehen ließ. Sie zählte die Finger, um sich zu vergewissern, dass es etwas Menschliches war, und stellte dann fest, welcher Finger welcher war. Zuerst der Ringfinger – er war von ihr weggekrümmt, sodass sie jetzt wusste, wie die Hand lag: mit der Handfläche nach oben. Ihre Gedanken überschlugen sich, als sie sich vorzustellen versuchte, wie der Körper liegen könnte – wahrscheinlich auf der Seite. Probehalber zog sie leicht an der Hand. Statt von einem Gewicht gehalten zu werden, ließ sie sich mühelos lösen und schwebte aus dem Schlick herauf. Wo ein Handgelenk hätte sein müssen, fühlte sie nur freiliegende Knochen und Knorpel.
»Sarge?« PC Rich Dundas’ Stimme kam aus ihrem Ohrhörer. In der erdrückenden Dunkelheit klang sie so nah, dass sie erschrak. Er stand oben auf dem Kai und verfolgte ihre Aktion zusammen mit dem Leinenführer, der ihre Sicherungsleine abspulte und die Kommunikationsanzeigen im Auge behielt. »Wie kommen Sie voran? Sie sind genau über dem Hotspot. Sehen Sie was?«
Der Zeuge hatte von einer Hand gesprochen, nur von einer Hand, nicht von einer Leiche, und das hatte alle im Team beunruhigt. Keiner von ihnen hatte je erlebt, dass eine Leiche auf dem Rücken trieb; die Verwesung sorgte dafür, dass sie mit dem Gesicht nach unten schwamm und Arme und Beine im Wasser nach unten hingen. Das Letzte, was man sehen würde, wäre eine Hand. Aber jetzt hatte sich das Bild geändert: An der schwächsten Stelle, am Gelenk, war diese Hand abgetrennt worden. Es handelte sich nur um eine Hand, nicht um eine Leiche. Es war also kein Leichnam gewesen, der da gegen alle Gesetze der Physik auf dem Rücken im Wasser trieb. Trotzdem stimmte an dieser Zeugenaussage etwas nicht. Sie drehte die Hand um und verfestigte das geistige Bild von ihrer Lage, ergänzte es durch kleine Details, die sie für ihre eigene Zeugenaussage brauchen würde. Sie war nicht vergraben gewesen. Sie konnte nicht einmal sagen, dass sie im Schlick versunken war. Sie hatte obendrauf gelegen.
»Sarge? Hören Sie mich?«
»Ja«, sagte sie, »ich höre Sie.«
Sie hob die Hand auf, umfasste sie behutsam und ließ sich auf den Schlick im Hafen sinken.
»Sarge?«
»Ja, Dundas. Ja, ich bin da.«
»Haben Sie was?«
Sie schluckte, drehte die Hand um, sodass die Finger quer über ihren eigenen lagen. Sie sollte Dundas melden, dass sie etwas gefunden hatte. Aber sie tat es nicht. »Nein«, sagte sie stattdessen. »Nichts. Noch nichts.«
»Was ist denn da los?«
»Nichts. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Ich sage Bescheid, wenn ich was habe.«
»Okay.«
Sie wühlte einen Arm in den schmutzigen Schlamm auf dem Grund und zwang sich, klar zu denken. Als Erstes zog sie die Führungsleine sanft herunter und tastete nach der nächsten Dreimetermarke. Oben würde es so aussehen, als spulte sie sich ganz natürlich ab; es würde aussehen, als schwämme sie über dem Grund entlang. Als sie die Marke erreicht hatte, klemmte sie die Leine zwischen die Knie, um die Spannung zu halten, und legte sich in den Schlick, wie sie es ihrem Team beibrachte, wenn es darum ging, bei einer CO2-Überdosis zu ruhen: das Gesicht nach unten, damit die Maske sich nicht heben konnte, und die Knie leicht in den Schlamm gebohrt. Die Hand hielt sie dicht an ihre Stirn, als betete sie. Der Sprechfunk in ihrem Helm war still; sie hörte nur ein statisches Rauschen. Jetzt, nachdem sie das Zielobjekt gefunden hatte, konnte sie sich Zeit lassen. Sie stöpselte das Mikro an ihrer Maske ab, schloss für eine Sekunde die Augen und kontrollierte ihre Balance. Sie konzentrierte sich auf einen roten Fleck vor ihrem geistigen Auge, beobachtete ihn und wartete darauf, dass er zu tanzen anfing. Aber er tat es nicht. Blieb starr. Sie hielt sich sehr, sehr ruhig und wartete wie immer darauf, dass etwas zu ihr kam.
»Mum?«, flüsterte sie und verabscheute den hoffnungsvollen, zischenden Klang ihrer Stimme im Helm. »Mum?«
Sie wartete. Nichts. Wie immer. Sie konzentrierte sich angestrengt und drückte dabei die Knochen der Hand leicht zusammen, bis dieses fremde Stück Fleisch sich halb vertraut anfühlte.
»Mum?«
Etwas drang in ihre Augen. Es brannte. Sie öffnete sie, aber da war nichts – nur das übliche stickige Schwarz der Maske, das verschwommene bräunliche Licht auf dem Schlick, der vor der Sichtscheibe schwebte, und das alles umhüllende Geräusch ihres eigenen Atems. Sie kämpfte mit den Tränen, und am liebsten hätte sie es laut gesagt: Mum, bitte hilf. Ich habe dich letzte Nacht gesehen. Ich habe dich gesehen. Und ich weiß, du willst mir etwas sagen – ich kann dich nur nicht richtig hören. Bitte sag mir, was es ist.
»Mum?«, flüsterte sie und schämte sich: »Mummy?«
Ihre eigene Stimme kam zurück, und das Echo hallte in ihrem Kopf, aber jetzt klang es nicht wie Mummy, sondern wie Idiot, du Idiot. Schwer atmend legte sie den Kopf zurück und wehrte sich gegen die aufsteigenden Tränen. Was erwartete sie? Warum kam sie zum Weinen immer hierher, unter Wasser? Es gab keinen schlechteren Ort dafür – zum Weinen unter einer Maske, die sie nicht abnehmen konnte wie ein Sporttaucher. Vielleicht war es naheliegend, dass sie sich Mum an einem solchen Ort näher fühlte, aber da musste mehr dahinterstecken. So weit sie zurückdenken konnte, war das Wasser immer eine Umgebung gewesen, in der sie sich konzentrieren konnte. Wo eine Art Friede heraufschwebte – als könnte sie hier unten Kanäle öffnen, die oben verschlossen blieben.
Sie wartete ein paar Minuten, bis die Tränen irgendwohin verschwunden waren, wo sie ihr nichts anhaben konnten, und sie sicher war, dass sie sich nicht lächerlich machen würde, wenn sie wieder auftauchte. Sie seufzte und hob die abgetrennte Hand hoch. Sie musste sie so dicht an die Maske halten, dass sie die Plexiglassichtscheibe fast berührte; sonst konnte man nichts erkennen. Als sie die Hand aus dieser Nähe betrachtete, begriff sie, was ihr außerdem Sorgen machte.
Sie stöpselte das Mikrokabel wieder ein. »Dundas? Sind Sie da?«
»Was gibt’s?«
Sie drehte die Hand weniger als einen Zentimeter vor der Sichtscheibe hin und her und betrachtete die graue Haut und das abgerissene Ende. Ein alter Mann hatte sie gesehen, nur eine Sekunde lang. Er war mit seiner kleinen Enkelin unterwegs gewesen, die ihre neuen pinkfarbenen Gummistiefel im Regen hatte ausprobieren wollen. Sie hatten sich zusammen unter den Schirm geduckt und zugeschaut, wie die Tropfen auf das Wasser prasselten, als er sie entdeckt hatte. Und hier war sie – exakt an der Stelle, die er dem Team genannt hatte, versteckt unter dem Ponton. Ausgeschlossen, dass er sie bei diesen Sichtverhältnissen hier unten hatte erkennen können. Vom Ponton aus war es nicht möglich, zwei Handbreit in die Tiefe zu sehen.
»Flea?«
»Ja, ich dachte nur gerade... Hat einer von euch da oben jemals was anderes erlebt als null Sichtweite hier unten?«
Eine Pause trat ein; Dundas befragte das Team auf dem Kai. Dann meldete er sich wieder. »Negativ, Sarge. Niemand.«
»Definitiv null Sichtweite zu jeder Zeit?«
»Ich würde sagen, das ist höchstwahrscheinlich so, Sarge. Warum?«
Sie legte die Hand wieder auf den Grund des Hafens. Sie würde mit einem Asservatenbeutel zurückkommen – es kam nicht in Frage, dass sie damit an die Oberfläche schwamm und forensisches Beweismaterial verlor -, aber jetzt hielt sie sich an der Führungsleine fest und versuchte nachzudenken, herauszufinden, wie der Zeuge die Hand hatte sehen können. Doch sie konnte keinen richtigen Gedanken fassen. Hatte wahrscheinlich etwas mit dem zu tun, was sie letzte Nacht gemacht hatte. Entweder das, oder sie wurde älter. Nächsten Monat neunundzwanzig. Hey, Mum, was sagst du dazu? Ich bin fast neunundzwanzig. Hättest du nie gedacht, dass ich so weit komme, stimmt’s?
»Sarge?«
Langsam ließ sie die Leine nach und stemmte sich dabei gegen den Zug des Assistenten, um den Anschein zu erwecken, als kröche sie am Kaisockel entlang zurück. Sie schob das Mikrokabel zurecht, damit die Verbindung störungsfrei blieb.
»Ja, sorry«, sagte sie. »War mit meinen Gedanken woanders. Alles okay, Rich. Ich habe das Zielobjekt. Komme jetzt hoch.«
Sie stand in der eisigen Kälte auf dem Kai, die Maske in der Hand. Ihr Atem hing weiß in der Luft, und sie zitterte, als Dundas sie mit dem Schlauch abspritzte. Sie war noch einmal mit einem Asservatenbeutel unten gewesen und hatte die Hand geborgen. Der Tauchgang war zu Ende und dies der Teil, den sie hasste: der Schock, wenn sie aus dem Wasser kam, der Schock, wenn sie wieder von Lärm und Licht und Leuten umgeben war – und die Luft, die sich anfühlte wie ein Schlag ins Gesicht. Sie klapperte mit den Zähnen. Und der Hafen sah trostlos aus, obwohl jetzt Frühling war. Der Regen hatte aufgehört, und jetzt leuchtete die kraftlose Nachmittagssonne auf Fensterscheiben, auf die stachligen Kräne im Great Western Dock gegenüber und die öligen Regenbogen auf dem Wasser. Sie hatten einen Teil der Veranda aus behandeltem Kiefernholz hinter einem Hafenrestaurant – dem Moat – abgesperrt, und ihr Team in den gelb fluoreszierenden Jacken bewegte sich zwischen den Tischen umher und sortierte die Ausrüstung: Tauchflaschen, Kommunikationssystem, Rettungsfloß, body board – alles lag ausgebreitet zwischen den Regenpfützen auf der Veranda.
»Er war Ihrer Meinung.« Dundas drehte den Wasserschlauch ab und deutete mit dem Kopf auf das Panoramafenster des Restaurants mit dem verschwommenen, stumpfen Spiegelbild des kriminaltechnischen Leiters, der auf die Hand hinunterschaute, die zu seinen Füßen in dem offenen Asservatenbeutel lag. »Er glaubt, Sie haben recht.«
»Ich weiß.« Seufzend nahm Flea die Maske ab und zog die zwei Paar Schutzhandschuhe aus, die alle Polizeitaucher trugen. »Aber wenn man ihn so ansieht, würde man nie darauf kommen, hm?«
Es war nicht der erste Körperteil, den sie aus dem Schlick rings um Bristol zog, und es würde auch nicht der letzte sein; abgesehen davon, was sie über die Traurigkeit und Einsamkeit des Todes sagte, war an einer abgetrennten Hand zumeist nichts weiter Bemerkenswertes. Es würde eine Erklärung dafür geben, irgendetwas Deprimierendes, Profanes – wahrscheinlich ein Selbstmord. Die Presse beobachtete den Polizeieinsatz oft mit ihren Teleobjektiven von der anderen Hafenseite aus, aber heute sah man niemanden auf dem Redcliffekai. Es war selbst ihnen zu alltäglich. Nur sie, Dundas und der Cheftechniker wussten, dass diese Hand keineswegs alltäglich war, und wenn die Journalisten hörten, was sie versäumt hatten, würden sie sich überschlagen, um ein Interview zu bekommen.
Sie war nicht verwest. Im Gegenteil, sie war völlig unversehrt, von der Verletzung durch die Abtrennung einmal abgesehen. So verdammt frisch, dass sofort sämtliche Alarmglocken geschrillt hatten. Sie hatte den CSM darauf hingewiesen und gefragt, wie um alles in der Welt sie von ihrem Besitzer hatte getrennt werden können, wenn es allem Anschein nach unmöglich war, dass sie sich einfach so vom Körper lösen konnte – nicht ohne eine sehr spezielle Verletzung. Und wenn er sie fragte: Was man da an den Knochen sah, waren keine Fischbisse, sondern Klingenspuren. Und er hatte gesagt, dazu könne er sich vor der Obduktion unmöglich äußern, aber sie sei ziemlich clever. Viel zu clever, um ihr Leben unter Wasser zu verbringen.
»Hat jemand mit dem Hafenmeister gesprochen?«, fragte Flea jetzt, während ihr Assistent ihr half, das Geschirr mit dem Sauerstoffgerät abzulegen. »Ihn gefragt, welche Strömungen hier heute durchgegangen sind?«
»Ja.« Dundas bückte sich und rollte den Schlauch zusammen. Sie schaute auf seinen Kopf hinunter, auf die leuchtend rote Mütze, die er immer trug – ansonsten, sagte er, könne er mit der Wärme, die sein kahler Schädel abstrahlte, ein ganzes Stadion heizen. Sie wusste, unter seiner fluoreszierenden Allwetterjacke verbarg sich ein großer, kräftiger Körper. Manchmal war es schwer, als einzige Frau dabei zu sein und Entscheidungen für neun Männer zu treffen, von denen die Hälfte älter war als sie, aber an Dundas zweifelte sie nie. Er war bei allem auf ihrer Seite. Als genialer Techniker pflegte er einen väterlichen Umgang mit den Kollegen und mit dem Gerät, und manchmal hatte er ein unglaublich dreckiges Mundwerk. Aber jetzt konzentrierte er sich, und wenn er das tat, war er so gut, dass sie ihn am liebsten geküsst hätte.
»Es gab heute eine Strömung, aber erst nach der Sichtung«, sagte er.
»Von der Regulierungsschleuse?«
»Genau. Heute Nachmittag um vierzehn Uhr für zwanzig Minuten geöffnet. Der Hafenmeister hat den Bagger zum Abladen aus dem Feeder Canal herunterkommen lassen.«
»Und der Anruf kam wann?«
»Um dreizehn fünfundfünfzig. Gerade als sie die Schleuse öffneten. Sonst hätte der Hafenmeister gewartet. Ja, ich bin sicher, er hätte gewartet, wenn ich mir vorstelle, wie sehr sie uns hier unten lieben. Wie sie sich jederzeit ein Bein für uns ausreißen.«
Flea hakte die Finger unter den Rand der Neoprenhaube, rollte sie am Hals herauf und behutsam über Gesicht und Kopf, damit sie nicht allzu oft hängen blieb. Wenn sie ihre Hauben inspizierte, waren sie anscheinend immer voller Haare, ausgerissen mitsamt den Wurzeln. Manchmal fragte sie sich, warum sie nicht schon längst so kahl wie Dundas war. Sie ließ die Haube fallen, fuhr sich über die Nase und schaute seitwärts über das Wasser, hinauf zur Perrot’s Bridge. Das Sonnenlicht strahlte golden auf dem doppelten Horn, und dahinter erstreckte sich die Wasserfläche von St. Augustin’s Reach, wo der Fluss Frome aus der Erde kam und in den Hafen mündete.
»Ich weiß nicht«, brummte sie. »Klingt komisch, finde ich.«
»Was haben Sie gesagt?«
Sie zuckte die Achseln, warf einen Blick auf das graue Stück Mensch zwischen den Füßen der beiden Männer und überlegte, wie der Zeuge die Hand hatte sehen können. Aber sie kam nicht weiter. In ihrem Kopf ging es auf und ab wie auf einer Achterbahn – die sie mitreißen wollte. Sie griff nach einem Stuhl, ließ sich darauf sinken und legte die Hand an die Stirn. Sie wusste, dass das Blut aus ihrem Gesicht gewichen war.
»Alles in Ordnung, Flea, altes Mädel? Mein Gott, Sie sehen aber nicht toll aus.«
Sie lachte und fuhr sich mit den Fingern übers Gesicht. »Na ja, ich fühle mich auch nicht so toll.«
Dundas ging vor ihr in die Hocke. »Was ist los?«
Sie schüttelte den Kopf und starrte auf ihre Beine in dem schwarzen Neoprenanzug, auf die Pfützen, die sich um ihre Taucherstiefel sammelten. Sie hatte mehr Tauchstunden absolviert als jeder andere in ihrem Team, und sie sollte hier die Verantwortung tragen; deshalb war es falsch, ganz falsch, was sie letzte Nacht getan hatte.
»Ach, nichts«, sagte sie und bemühte sich um einen unbekümmerten Ton. »Das Übliche – ich kann einfach nicht schlafen.«
»Immer noch so beschissen?«
Sie lächelte ihn an und spürte, wie sich das Licht in den Regentropfen in ihren Augen fing. Als Teamchefin war sie zugleich Ausbilderin, und das bedeutete, dass sie manchmal am unteren Ende der Befehlskette ins Wasser stieg und anderen Gelegenheit gab, die Tauchaufsicht zu übernehmen. Im Grunde ihres Herzens gefiel ihr das nicht; wirklich glücklich war sie damit nur an Tagen wie heute, wenn sie Dundas als Tauchaufsicht einteilte. Er hatte einen Sohn, Jonah – einen erwachsenen Sohn, der ihm und seiner Exfrau Geld stahl, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, und der seinen Vater trotzdem mit den gleichen Schuldgefühlen plagte, die Flea ihrem Bruder Thom gegenüber empfand, und zwar immer. Sie und Dundas hatten viel gemeinsam.
»Ja«, sagte sie schließlich. »Es ist immer noch beschissen. Noch nach all der Zeit.«
»Zwei Jahre.« Er schob eine Hand unter ihren Arm und half ihr beim Aufstehen. »Das ist keine lange Zeit. Aber ich kann Ihnen sagen, was helfen würde.«
»Was?«
»Wenn Sie zur Abwechslung mal was essen würden. Blöde Idee, ich weiß schon, aber vielleicht könnten sie dann besser schlafen.«
Sie lächelte matt und legte ihm eine Hand auf die Schulter, damit er sie hochziehen konnte. »Sie haben recht. Ich sollte was essen. Ist was im Wagen?«
2
13. Mai
Das »Station« war das Polizeibootshaus gewesen, bevor es verkauft und renoviert worden war, und deshalb glaubte der neue Eigentümer, es sei nicht recht, wenn er sich jetzt nicht seinerseits gefällig zeigen und der Polizei erlauben würde, es in der Stunde der Not zu benutzen. Er hatte ihnen einen Raum hinter dem Restaurant zugeteilt, neben der Küche, und dort war es wärmer als im Van. Früher war es der Spindraum der Polizei gewesen, jetzt zog sich hier das Personal um. Ihre Straßenkleider hingen an Haken, und Outdoorstiefel und Taschen lagen unter der Bank, die ringsum an der Wand entlangführte.
Während Dundas loszog, um in der Küche zu stöbern, nahm Flea ihre schwarze Sporttasche und fing an, sich auszuziehen. Sie schälte den Taucheranzug und die zur Ausstattung gehörende Thermounterjacke bis zur Hüfte herunter. Die Thermojacke behielt sie an, rollte den Neoprenanzug bis zu den Knöcheln herunter und schleuderte die Taucherstiefel von den Füßen. Sie hielt inne und starrte auf ihre Füße hinunter, weil sie allein war und es sich erlauben konnte. Sie streckte die Zehen, inspizierte die kleinen Lücken zwischen den Zehen und rieb die Häutchen dort, bis sie rot wurden. Schwimmhäute. Schwimmhäute an ihren Füßen wie bei einem Frosch. »Froschmädchen« sollten sie sie nennen. Sie fasste das Häutchen zwischen der großen und der zweiten Zehe und bohrte die Fingernägel hinein. Der Schmerz schoss durch ihren Körper und ließ ihr Gehirn weiß aufglühen, aber sie ließ nicht locker, schloss die Augen und konzentrierte sich auf die Glut in ihren Adern. Der Personalbetreuer hatte ihr in ihrer halbjährlichen Sitzung gesagt, sie müsse jemandem ihre Füße zeigen und darüber sprechen, wie dieses Problem sich entwickelt habe – und können Sie mir rasch auf die Sprünge helfen? Wann ist diese Haut erschienen? War das um die Zeit des Unfalls herum?
Aber sie hatte sie niemandem gezeigt. Nicht dem Betreuer, nicht dem Arzt. Irgendwann würde sie sich vermutlich operieren lassen müssen. Aber damit wollte sie warten, bis sie Schmerzen bekäme oder in ihren Bewegungen eingeschränkt wäre, oder bis sonst etwas einträte, das sie am Tauchen hindern könnte.
Sie hörte ein Geräusch hinter sich, und hastig wühlte sie ihre Socken aus der Sporttasche und zog sie an. Dundas kam mit einem Ciabatta in einer geblümten Papierserviette. Er hob eine Braue, als er sie im BH und mit heruntergerollter Thermojacke dasitzen sah, die Hände schützend um die Füße geschlungen.
»Äh – wollen Sie sich nicht was anziehen? Der stellvertretende Ermittlungsleiter kommt her, um die Sache abzuschlie-ßen. Habe ihm gesagt, wo er uns findet.«
Sie zog ein T-Shirt an, griff zum Handtuch und fing an, sich energisch die Haare zu frottieren. »Wo ist denn der Chef?«
»Der hat ein Meeting wegen Operation Atrium. Interessiert ihn nicht, wenn wir hier mit einer Hand am Hafen herumkaspern. Er findet nicht, dass die Abteilung für Schwerstkriminalität sich mit uns abgeben soll. Er war schon vor zwanzig Minuten weg.«
»Freut mich. Ich mag ihn nicht.« Sie dachte an die Besprechung, die kurz vorher stattgefunden hatte. Der diensthabende Ermittlungsleiter war ganz okay gewesen, aber sie hatte nie seinen Gesichtsausdruck vergessen, als er sie bei einer Tauchbesprechung drei Jahre zuvor zum ersten Mal gesehen hatte. Genau wie all die anderen Chefs wirkte er irgendwie deprimiert, wartete auf jemanden, der ein bisschen Autorität besäße, ihm Fragen nach dem Wasser beantwortete, und statt beruhigt zu werden, fand er Flea – neunundzwanzig, spindeldürr, mit einer dichten Mähne und diesen blauen Kinderaugen, die so weit auseinanderlagen, dass sie den Ausdruck vermittelte, als könnte sie nicht einmal ein Bankkonto eröffnen, geschweige denn, vier Meter unter Wasser eine Leiche aus dem Schlamm ziehen. Aber so ging es ihr meist mit den höheren Chargen. Anfangs war es eine Herausforderung gewesen. Jetzt machte es sie nur noch sauer.
»Und?« Sie ließ das Handtuch fallen. »Wer ist denn sein Stellvertreter? Jemand aus Kingswood?«
»Jemand Neues. Keiner, den ich kenne.«
»Wie heißt er?«
»Kann mich nicht erinnern. Einer von der Sorte, die sich anhört wie ein abgerissener alter irischer Säufer. Alte Schule – Bier und Essen vom Takeaway. Zu hoher Blutdruck. Der Typ, der jedes Jahr jemand Jüngeren mit falschem Ausweis an seiner Stelle zum Piep-Test schickt.«
Lächelnd spähte sie an ihrem Arm herunter und spannte den Bizeps. »Sprechen Sie das Piep-Wort nicht aus. In zwei Wochen ist die jährliche Gesundheitsprüfung.«
»Rauf nach Napier Miles House, Sarge? Dann sollten Sie anfangen zu essen.« Er schob ihr das Ciabatta hinüber. »Proteindrinks. Eis. McDonald’s. Sehen Sie sich doch an. Untergewicht ist das, was früher Übergewicht war. Wussten Sie das nicht?«
Sie nahm das Sandwich und fing an zu essen. Dundas beobachtete sie. Komisch, wie er den Beschützer spielte, während sie doch seine Chefin war. Dundas verschwendete nie seine Zeit damit, seinem Sohn Vorträge zu halten. Die hob er sich für Flea auf. Sie kaute und dachte dabei, er wäre jemand, dem sie es erzählen könnte, was wirklich los und in der vergangenen Nacht passiert war.
Sie versuchte, ihre Worte zu sortieren und in eine Reihe zu bringen, als hinter ihnen die Tür aufging und eine Stimme sagte: »Sind Sie die Taucher? Die die Hand heraufgeholt haben?«
Ein Mann im grauen Anzug, Mitte dreißig, mittelgroß, stand in der Tür und hielt einen Becher Automatenkaffee in der Hand. Er hatte ein entschlossenes Gesicht und dichtes, dunkles, kurz geschnittenes Haar. »Wo ist sie denn?« Er legte eine Hand an den Türrahmen, beugte sich herein und sah sich im Umkleideraum um. »Auf dem Kai ist niemand außer Ihrem Team.«
Keiner der beiden sagte etwas.
»Hallo?«
Flea kam ruckartig zu sich. Sie schluckte ihren Bissen hinunter und wischte sich hastig mit dem Handrücken die Krümel vom Mund. »Ja. Sorry. Sie sind...?«
»Detective Inspector Jack Caffery, stellvertretender Ermittlungsleiter. Und wer sind Sie?«
»Das ist Flea«, sagte Dundas. »Sergeant Flea Marley.«
Caffery warf ihm einen sonderbaren Blick zu. Dann musterte er sie, und ihr war sofort klar, dass er hinter seiner Miene etwas verbarg. Sie glaubte zu wissen, was es war. Männer arbeiteten nicht gern mit einsfünfundsechzig großen Mädchen in Taucherstiefeln zusammen. Vielleicht hatte sie aber auch nur Krümel auf dem T-Shirt.
»Flea?«, fragte er. »Der Floh?«
»Das ist ein Spitzname.« Sie stand auf und streckte ihm die Hand entgegen. »Ich heiße Phoebe Marley. Unit Sergeant Phoebe Marley.«
Er starrte auf ihre Hand wie auf ein Ding von einem anderen Planeten. Dann schien ihm wieder einzufallen, wo er war, und drückte sie fest, um sie aber gleich wieder loszulassen. Im selben Augenblick wich Flea zurück und flüchtete aus seinem Dunstkreis. Sie setzte sich und strich sich verlegen vorn über das T-Shirt. Wieder war sie aus dem Gleichgewicht geraten, und auch das machte sie sauer. Sie war nicht sehr gut im Umgang mit Männern. Zumindest nicht mit dieser Art von Männern. Sie erinnerten sie an Dinge, die sie hinter sich gelassen hatte.
»Und?«, fragte er. »Flea. Wo ist diese Hand, die Sie aus dem Wasser geholt haben?«
»Der Coroner hat sie wegbringen lassen«, sagte Dundas. »Hat Ihnen das niemand gesagt?«
»Nein.«
»Na, hat er aber. Der Cheftechniker hat jemanden damit nach Southmeads geschickt. Aber vor morgen ist das nicht erledigt.«
»Sie scheinen hier viele Hände aus dem Wasser zu ziehen!«
»Yep«, sagte Dundas. »Haben eine ganze Sammlung oben in Southmeads. Füße, Hände, ein oder zwei Beine.«
»Und woher kommen sie?«
»Selbstmorde hauptsächlich. Unten im Avon in neun von zehn Fällen. Der Fluss hat eine Gezeitenströmung, wie Sie sie noch nie gesehen haben – da wird alles heftig hin und her gespült und prallt mit Bäumen und Treibgut zusammen. Alle möglichen Teile tauchen da auf, links, rechts und überall.«
Caffery ließ seine Hand aus dem Jackettärmel hervorschießen und sah auf die Uhr. »Na, okay. Dann bin ich hier fertig.«
Er hatte die Tür geöffnet und war schon halb draußen, als er plötzlich innehielt. Mit dem Rücken zu ihnen, die Hand auf der Türklinke, schaute er hinaus in den Küchengang, und vielleicht spürte er, dass die beiden ihn schweigend beobachteten.
Es dauerte zwei, drei Herzschläge, bevor er sich umdrehte.
»Was?« Sein Blick ging zwischen Dundas und Flea hin und her. »Es ist ein Selbstmord. Wie verfahren Sie normalerweise bei einem Selbstmord?«
»Wenn wir keinen Hotspot haben? Keinen Zeugen?«
»Ja?«
»Na ja, äh, wir warten, bis er schwimmt.« Flea benutzte das Wort »schwimmen« behutsam. Im Team sagten sie es so oft, dass sie gelassen damit umgingen und manchmal vergaßen, was es bedeutete: dass eine Leiche so voll von Verwesungsgasen war, dass sie an die Oberfläche trieb. »Wir warten, bis er schwimmt, und fischen ihn dann von der Oberfläche. Bei diesem Wetter dürfte das zwei Wochen dauern.«
»Dachte ich mir. So machen sie es in London auch.« Er wollte sich wieder zum Gehen wenden, aber diesmal hatte er offenbar den Blick gesehen, den Dundas Flea zuwarf, denn er blieb stehen. Er schloss die Tür und kam näher. »Okay«, sagte er langsam. »Sie wollen mir irgendetwas erklären. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, was.«
Flea holte tief Luft. Sie drehte sich um, stützte die Knie auf die Ellbogen und schaute ihm in die Augen. »Hat der Cheftechniker es Ihnen nicht erzählt? Hat er Ihnen nicht gesagt, dass wir nicht von einem Selbstmord ausgehen?«
»Sie haben soeben erklärt, Sie haben hier draußen eine Million Selbstmorde.«
»Ja. Im Avon. Wenn es im Avon gewesen wäre, würden wir es verstehen. Aber das war es nicht. Es war im Hafen.«
Sie stand auf und blieb stehen; mit einer Hand hielt sie den Stuhl fest, als könnte er sie schützen. Sie ließ es sich nicht anmerken, aber ihr war sehr bewusst, dass er groß war und irgendwie schlank und muskulös unter dem Anzug. Sie wusste, wenn sie näher heranginge, würde sie ihn womöglich anstarren, denn ein paar Dinge waren ihr bereits aufgefallen – zum Beispiel die Stelle über seinem Kragen, wo der nachmittägliche Bartschatten begann. »Wir sind keine Pathologen«, fuhr sie fort. »Wir sollten Ihnen gar nichts sagen. Aber etwas stimmt da nicht.« Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und warf Dundas einen Seitenblick zu. »Ich meine – erstens hat die Hand weniger als einen Tag im Wasser gelegen. Eine Leiche löst sich in rauem Gewässer erst auf, wenn sie sehr lange geschwommen ist. Die Hand hier ist viel zu frisch.«
Caffery legte den Kopf schräg und zog die Brauen hoch.
»Ja. Und wenn Tiere sie abgebissen hätten – Fische oder vielleicht Hafenratten -, dann wäre sie von Bissspuren übersät. Ist sie aber nicht. Die einzige Verletzung«, sie hob die Hand und umschloss ihr Handgelenk mit Daumen und Zeigefinger, »ist hier. Da, wo sie vom Arm abgetrennt wurde. Der Cheftechniker sieht die Sache genauso.«
Caffery stand vor ihr und betrachtete ihr Haar und ihre dünnen Arme in der Thermojacke. Sie konnte das nicht ausstehen. Sie hatte immer das Gefühl, dass ihre Haut nicht richtig saß, wenn sie auf dem Trockenen war, wo andere Leute raffinierte Dinge mit ihren Beziehungen anstellten – und deshalb würde sie sich unter Wasser immer wohler fühlen. Mum, dachte sie, Mum, du würdest wissen, wie das hier geht. Du würdest normal aussehen, nicht miesepetrig wie ich.
»Und?« Er musterte sie nachdenklich. »Was könnte eine solche Verletzung hervorgerufen haben?«
»Ein Bootsunfall vielleicht. Aber das passiert weiter drau-ßen, in der Mündung. Dann gibt es Leute, die von der Clifton Bridge springen. Selbstmörderbrücke nennen wir sie. Wenn jemand hier in der Gegend ins Wasser springt, tut er es in neun von zehn Fällen da. Sie können dann flussauf- und -abwärts treiben, und manchmal – manchmal, wenn die Tide stimmt – geraten sie ziemlich weit stromaufwärts.« Sie zuckte die Achseln. »Ich nehme an, theoretisch, wenn einer von der Brücke springt und draußen auf dem Fluss von einem Boot zerfetzt wird, dann könnte eine einzelne Hand vielleicht knapp an den Sperrwerken vorbeikommen und im Hafen landen. Oder durch den Cut herauftreiben.« Sie strich sich das Haar hinter die Ohren. »Aber nein. Das ist unmöglich.«
»Unmöglich«, bestätigte Dundas. »Die Chance ist eine Million zu eins. Und selbst wenn sie aus dem Frome River käme oder weiter stromauf aus dem Avon, herunter durch die Netham-Schleuse und in den Feeder Canal...«
»... dann hätte das nur passieren können, wenn es im Hafen eine Strömung gäbe, was normalerweise der Fall ist, wenn die Schleusentore offen sind.«
»Was aber in den letzten zwei Tagen nur einmal geschehen ist. Und zwar nachdem der Fund gemeldet wurde. Wir haben es überprüft.«
»Sie wollen also sagen, sie wurde hier ins Wasser geworfen?«
»Wir wollen gar nichts sagen. Ist nicht unser Job.«
»Aber sie wurde hineingeworfen?«
Sie wechselten einen Blick. »Ist nicht unser Job«, sagten sie wie aus einem Munde.
Cafferys Blick ging von Flea zu Dundas und wieder zurück. »Okay«, sagte er. »Sie wurde hineingeworfen.« Er sah wieder auf die Uhr. »Okay – in welcher Schicht arbeiten Sie beide heute? Was muss ich tun, damit Sie im Wasser bleiben?«
»Oh, darum würde ich mir an Ihrer Stelle keine Sorgen machen.« Dundas nahm lächelnd seine Allwetterjacke vom Haken und zog sie an. »Wir haben uns beim Hafenmeister noch nicht abgemeldet. Und überhaupt, an Überstunden sind wir immer interessiert? Nicht wahr, Sarge?«
3
25. November
Von der Nadel wegkommen ist das Einzige, was er je wollte. Für jeden, der verfolgt hat, wie er hundert Prozent seiner Zeit und Energie darauf verwendet, Stoff zu beschaffen, klingt es verrückt zu hören, dass er sich in Wirklichkeit mehr als alles andere wünscht, irgendeinen Weg aus all dem rauszufinden und clean zu werden. Es ist November, und er steht mit dem Bag Man – es ist der, den sie »BM« nennen – im Schatten des Hochhausblocks, drüben bei den Müllcontainern, wo die meisten Deals abgehen. Ein rauer Herbstwind peitscht auf Müll und Plastiktüten ein. BM trägt ein graues Kapuzenshirt; auf der Brusttasche steht »Malcolm X«, obwohl er weiß ist, und Mossy ist wütend, weil BM ihm eben gesagt hat, dass er keinen Kredit mehr hat.
»Was?«, sagt Mossy, denn er und BM kennen sich schon tierisch lange, und es gibt überhaupt keinen Grund, so plötzlich dichtzumachen. »Fuck, was redest du da?«
»Sorry«, sagt BM und sieht ihm in die Augen. »Das geht alles zu weit. Kann dir diesmal nicht helfen, Mann, nicht mehr. Ende der Fahnenstange.« Er packt Mossy am Arm und zieht ihn zu sich heran. »Wird Zeit, dass du in eine Beratung gehst.«
»Beratung? Was soll das heißen, Beratung?
»Mach mir keinen Druck, Alter. Ich hab dir einen Tipp gegeben. Hör auf, mir Druck zu machen.«
Aber Mossy versucht es trotzdem, noch ein bisschen jedenfalls; er versucht BM zu überreden, ihm was zu geben, wenigstens eine Kleinigkeit. Aber BM ist entschlossen und bleibt stur, und am Ende kann Mossy sich nur verdrücken. Halb denkt er daran, BM umzubringen, und halb an das, was er über eine Beratung gesagt hat. Zu seiner eigenen Überraschung findet er sich am Nachmittag im Westen der City wieder, unterwegs zu einer Beratungsstunde in einer gruseligen kleinen Klinik mit einer alten Frau am Empfang, die wirklich total furchterregend ist. Eines Tages wird diese Aktion allein, das bloße Betreten dieser Klinik, für Mossy Grund genug sein, BM die Schuld an allem zu geben.
Die Sitzung ist gespenstisch. Alle hocken irgendwie im Zimmer verteilt herum, und keiner schaut dem anderen in die Augen. Einer hat eine Zweiliterflasche Mineralwasser, an der er nuckelt, als könnte sie ihm das Leben retten. Mossy sitzt da, die Ellbogen auf die Knie gestützt, und tut, als interessierte er sich für sie, während sie mit monotoner Stimme jammern, das Leben sei nicht fair. Das ist ihm aufgefallen bei Leuten, die auf Heroin sind: Sie sind immer voller Selbstmitleid. Er hofft, dass er nicht auch so klingt. Aber die ganze Zeit schaut er sie an und fragt sich eigentlich nur, ob einer von ihnen ein bisschen Stoff dabeihat und welcher von denen wohl mitleidig genug sein könnte, um ihm was abzugeben. Also nudelt er jetzt seine Geschichte ab: wie er von seinem Onkel misshandelt wurde, wie er mit dreizehn das Wichsen lernte, und das ganze Zeug über Entzug und die Zwangstests, die er machen musste, über die Prostitution, und dass sie echt früh angefangen hat, als er noch nicht mal fünfzehn war. Und er schwafelt weiter, obwohl er merkt, dass der Gruppenleiter, ein durchtrainierter Typ, der seit Jahren clean ist und der Gesellschaft etwas schuldet, ihn anstarrt, ihm in die Augen starrt, und Mossy glaubt, er findet da Sympathie, und vielleicht ist er der Einzige hier, der wirklich einen guten Grund hat, so drauf zu sein. Aber dann, als er fertig ist, fragt der Gruppenleiter: »Mossy? Mossy? Woher hast du diesen Namen?«
Er zuckt die Achseln. »Keine Ahnung. Haben die Kumpels sich ausgedacht. Weil ich bloß Haut und Knochen bin, wie das Model da. Kate Moss.«
Es ist eine Weile still, und niemand außer dem Gruppenleiter sieht ihn an.
»Meinst du nicht, das könnte anstößig wirken?«, fragt er, und Mossy weiß sofort, dass der Unterton der falsche ist, eine Art Warnung. Also wird es Zeit auszusteigen, und er brummelt, er wolle niemanden beleidigen, und wartet auf einen Themawechsel. Dann steht er auf, so leise er kann, schiebt den Plastikstuhl an die Wand und geht. Er verlässt die Klinik, zündet sich eine Selbstgedrehte an und sucht sich weiter unten an der Straße eine Stelle, wo er den Eingang der Klinik sehen kann und jeden, der da herauskommt. Er wartet und spürt, wie die Krämpfe langsam durch ihn hindurchgehen, von vorn nach hinten. Die sind die schlimmsten von allen Qualen, diese Krämpfe. Sie kommen als Erstes und gehen als Letztes. Er setzt sich hin, schlingt die Arme um den Bauch und fragt sich, ob es hier irgendwo ein Scheißhaus gibt. Es ist ein warmer Tag, und das hilft, und wenn er vor sich hin summt, lenkt ihn das ab.
Nach einer Weile geht die Tür auf. Er spürt, dass der Gruppenleiter ihn anstarrt, aber er lässt sich nicht einschüchtern und wartet, während die anderen herauskommen. Wie eine Hyäne sucht er sich den aus, der am weichsten aussieht und am Rand der Herde mitzockelt, den, der auf eine Story hereinfallen wird. Man kann sie erkennen; es hat was mit der Hoffnung in ihren Augen zu tun – als glaubten sie wirklich, dass Leute gerettet werden können. Mossy wartet, bis sie vorbeigehen, und dann latscht er neben ihnen her, die Hände in den Taschen, den Kopf ein bisschen gesenkt, sodass er ihn seitwärtsdrehen und murmeln kann: »Kannst du mir kurz aushelfen? Hmm? Hast du was dabei, nur ein bisschen? Ich geb’s dir zurück. Das versprech ich dir.« Aber sie brummen irgendwas und gehen mit gesenktem Kopf über die Straße, als wollten sie nicht mit ihm gesehen werden, und sie lassen ihn stehen. Das Schwitzen geht los und das Jucken, und als er zu seinem Platz zurückgeht, fühlt er, wie die Knochen seiner Kniegelenke sich aneinander wundscheuern. Liegt das daran, dass er zu dünn ist, oder ist es noch was anderes? Ist es, weil seine Haut irgendwas Verrücktes macht?
Als sie weg sind, versucht er, eine Passantin um Geld anzuschnorren, aber sie ignoriert ihn, den Blick in die Ferne gerichtet, und nach einer Weile beschließt er, zum Hafen runterzugehen – mal sehen, ob da was läuft. Vielleicht ist einer von denen aus Barton Hill da und hat gute Laune. Wenn nicht, muss er sich was anderes überlegen.
Er ist eben aufgestanden und losgeschlendert, als es passiert. Gerade noch ist er mit seinen üblen Gedanken allein, und im nächsten Moment läuft da neben ihm so ein kleiner, dürrer Schwarzer mit total dicht am Schädel anliegenden Haaren und einem dünnen Schnurrbart. Er trägt Jeans, die vorne maschinell vorgebleicht sind, und eine olivgrüne Kappajacke; die Kapuze hat er sich irgendwie um den Kopf drapiert, und Mossy erkennt ihn aus der Beratungssitzung wieder – er hat in der Ecke gesessen. Aber was Mossy vor allem auffällt, ist sein Gang: Er geht wie geölt. Als wäre er nicht hier auf den trockenen Straßen von Bristol geboren, sondern an einem besseren Ort. Als wäre er daran gewöhnt, Tag für Tag durch den Busch zu laufen.
»Suchst du was?«, fragt er. »Suchst du was?«
Mossy bleibt stehen. »Ja, aber ich bin pleite.«
Und das Irre ist, statt Mossy die Kopfnuss zu verpassen, mit der er rechnet, schaut ihm der dürre Typ in die Augen und sagt: »Mach dir keine Sorgen wegen Geld. Keine Sorge. Ich kenne jemanden, der dir helfen kann.«
Und so fängt natürlich alles an.
4
13. Mai
Die Spätnachmittagssonne war hinter den Wolken hervorgekommen, rot und ein bisschen geschwollen, aber im Restaurant Station brannten schon die Tischlampen. Der Laden füllte sich allmählich; Leute kamen herein, zogen ihre Jacken aus, bestellten etwas zu trinken. Es war zu kühl, um draußen zu sitzen, und die Veranda war menschenleer; also ging Caffery hinaus, um seine Telefonate zu erledigen. Der Superintendent musste ein bisschen bearbeitet werden, damit er ernst nahm, was die Taucher und der Cheftechniker sagten, und dem Fall eine Prioritätsstufe zuwies, bevor die Obduktion stattfand – denn die Hand würde obduziert werden, ganz allein. Dann mussten die beiden Detective Sergeants drüben in Kingswood ein bisschen auf Trab gebracht werden; sie waren ihm zugewiesen worden, damit sie einen Raubüberfall bearbeiteten, und jetzt würde er ihnen noch ein kleines Extra dazugeben: Besuch bei Notfallambulanzen und Leichenschauhaus. Irgendwelche männlichen Leichen, denen die rechte Hand fehlte?
Nachdem er ein paar Leute in Bristol auf die Palme gebracht hatte, steckte er das Telefon ein und ging über die Terrasse, bis er um die Polizeiabschirmung herum auf die Terrasse des Nachbarrestaurants schauen konnte, wo die Tauchercrew sich bereitmachte. The Moat hieß das Lokal. Das gefiel ihm – »Burggraben«, als wäre es etwas Mittelalterliches und nicht nur ein aufgemotztes Bootshaus mit ein paar nachgemachten ausgestopften Tieren an den Wänden. Jemand hatte den Geschäftsführer überredet, an diesem Abend nicht zu öffnen, und das Team hatte seine ganze Ausrüstung auf die Veranda gekippt. Das Zeug lag jetzt in den Pfützen herum. Dazwischen stakste, mit einer Tauchermaske hantierend, ein paar Worte mit dem Assistenten wechselnd und ihr Gurtwerk checkend, Sergeant Marley.
Er stützte die Ellbogen auf die Balustrade, drehte sich eine Zigarette – er hatte es sich immer noch nicht abgewöhnen können, auch wenn die Regierung ihm jedes Mal, wenn er den Fernseher einschaltete, in den Ohren lag – und zündete sie an, und dabei beobachtete er sie aufmerksam. »Flea« – ein blöder Spitzname, aber irgendwie verstand er, warum sie ihn hatte. Selbst in ihrem Polizeitaucheranzug ging so etwas wie kinetische Energie von ihr aus, und etwas in ihrem Gesicht ließ ahnen, dass ihre Gedanken nie lange stillstanden. Es ärgerte ihn, dass er das alles an ihr bemerkte. Es ärgerte ihn, dass er, als er in den Umkleideraum gekommen war und sie dagesessen hatte, den Taucheranzug heruntergerollt, mit ihren nackten, dünnen braunen Armen und ihrem widerspenstigen blonden Strubbelhaar, das drahtig aussah, als hätte sie es in Meerwasser gewaschen, am liebsten wieder gegangen wäre, weil er plötzlich nichts anderes fühlen konnte als seinen eigenen Körper: den Kontakt mit seinen Kleidern, das Kratzen der Hose auf seinen Schenkeln, das Scheuern des Hosenbunds an seinem Bauch und die Stellen, die das Hemd am Hals berührten. Er musste sich bremsen. Das war etwas für jemand anderen. Für einen anderen Menschen an einem anderen Ort, vor langer Zeit.
»’tschuldigung?«
Er sah sich um. Eine kleine Frau stand hinter ihm. Ihr leuchtend rotes Haar war mit lauter bunten Bändern überall auf dem Kopf zu kleinen Büscheln zusammengebunden. Eine Kellnerin aus dem Station, nach ihrer Schürze zu urteilen.
»Ja?«
»Äh -« Sie wischte sich die Nase ab und warf einen Blick über die Schulter zum Restaurant, um sich zu vergewissern, dass sie nicht beobachtet wurde. »Darf ich fragen, was hier los ist?«
»Sie dürfen.«
Sie verschränkte fröstelnd die Arme, obwohl es nicht allzu kalt hier draußen war, nicht so kalt, dass es einen frösteln konnte. »Na, dann... Haben sie was gefunden?«
Etwas an ihrer Stimme veranlasste ihn, sich umzudrehen und ein bisschen genauer hinzuschauen. Sie war klein und dünn, und unter der Schürze trug sie eine schwarze Combathose und ein T-Shirt mit der Aufschrift »Ich liebe dich mehr, wenn du so bist wie ich.«
»Ja«, sagte er, »haben sie.«
»Unter dem Ponton?«
»Ja.«
Sie zog einen Stuhl vom Tisch zurück, setzte sich und legte die Hände auf den Tisch. Caffery beobachtete sie. Sie trug zwei Ringe im Nasenflügel; die Piercings waren entzündet, und Caffery vermutete, dass sie daran herumfingerte, wenn sie nervös war. »Alles in Ordnung?«, fragte er. Er drückte seine Kippe aus, zog einen Stuhl heraus und setzte sich ihr gegenüber mit dem Rücken zum Moat. »Haben Sie was auf dem Herzen?«
»Sie würden’s nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle«, sagte sie. »Ich meine, ich seh’s an Ihrem Gesicht, dass Sie mir nicht glauben würden.«
»Versuchen Sie es.«
Sie verzog den Mund und betrachtete ihn nachdenklich. Sie hatte sehr helle Augen mit anämischen Wimpern. Ein paar Pickel rings um die Nase waren mit Make-up zugekleistert. »Ich meine, sogar ich weiß, dass es irre klingt.«
»Aber Sie möchten es mir erzählen. Oder?«
Sie schwieg. Dann hob sie, wie er es vermutet hatte, die Hand und begann, mit einem Ring an ihrer Nase herumzuspielen; sie drehte und drehte ihn, bis er befürchtete, es werde gleich anfangen zu bluten. Man hörte nur das Plätschern des Wassers am Kai und das Klirren des Gurtwerks und Taucherflaschen, mit denen die Taucher hantierten. Nach einer ganzen Weile ließ sie die Hand sinken und deutete mit dem Kinn zu dem Ponton vor dem Moat hinüber.
»Ich hab da etwas gesehen. Ziemlich spät abends. Stand da drüben vor dem Moat. Genau da, wo die Taucher jetzt sind.«
»Etwas?«
»Okay. Jemanden. Man würde wohl sagen, jemanden, obwohl ich nicht ganz sicher bin.« Wieder fröstelte sie. »Ich meine, es war wirklich dunkel. Nicht wie jetzt. Spät. Richtig spät. Wir hatten schon geschlossen, aber jemand hatte die Damentoilette vollgekotzt, und was glauben Sie, wer so was sauber machen darf? Ich ging mit dem Eimer durch das Restaurant und wollte zum Besenschrank, und ich kam da drinnen am Fenster vorbei...« Sie deutete auf das Station, wo ein paar Gäste die Polizeiabsperrung entdeckt hatten und die Hälse reckten, um zu sehen, was da vor sich ging. Die Sonne berührte fast den Horizont, und er sah sein und ihr Spiegelbild über den Leuten als Silhouetten vor dem lodernden Rot. »Und als ich an dem Tisch da vorbeikomme, bleibe ich aus irgendeinem Grund stehen. Und da sehe ich ihn.«
Caffery hörte die Beklemmung in ihrer Stimme.
»Er war nackt – das habe ich sofort gesehen.«
»Er?«
»Mein Freund glaubt, es war einer von den Zigeunerjungs. Manchmal verlaufen die sich hier ans Ufer des Cut. Man kann sie von der Straße aus sehen; sie campieren hinter den Lagerschuppen und hängen ihre Wäsche raus. Mein Freund meinte, es war ein Junge, weil er so winzig wirkte. Nur ungefähr so.« Sie streckte die Hand aus und hielt sie etwa einen Meter hoch über den Boden. »Und er war schwarz. Richtig kohlrabenschwarz, wissen Sie, deshalb glaub ich’s nicht. Ich glaub nicht, dass er ein Zigeuner war.«
»Wie alt? Fünf, sechs?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist es ja. Genau das hab ich meinem Freund gesagt. Er war nicht jung. Überhaupt nicht. Ich meine, er war klein wie ein Kind, aber er war kein Kind. Ich hab sein Gesicht gesehen. Nur kurz, aber lange genug, um festzustellen, dass er kein Kind war. Es war ein Mann«, sagte sie. »Ein total unheimlicher Mann. Das war so verdammt irre – deshalb weiß ich, dass Sie mir nicht glauben werden. Das und …«
»Das und...?«
»Und was er getan hat.«
»Was hat er denn getan?«
»Ach...« Sie fummelte wieder an dem Ring herum. Drehte den Kopf hin und her und wich seinem Blick aus. »Ach, Sie wissen schon...«
»Nein.«
»Das Übliche – wissen Sie -, was Männer so tun. Hatte sein Ding... Sie wissen schon.« Sie krümmte die Hand auf dem Tisch. »Hatte es so draußen.« Sie lachte verlegen. »Aber er war nicht – wissen Sie, nicht irgend so’n alter Wichser. Ich meine, das muss ein Trick gewesen sein, denn dieses Ding... er muss es umgeschnallt haben, denn es war... lächerlich. Lächerlich groß.« Jetzt sah sie ihn an, wütend fast, als habe er gesagt, er glaube ihr nicht. »Das ist kein Witz, ja? Und er wollte ganz offensichtlich, dass jeder, der im Moat war, es anschaute. Als ob er sie schocken wollte.«
»Und war noch jemand da? Brannte noch Licht?«
»Nein. Es war so gegen zwei Uhr morgens. Später erinnerte ich mich noch mal daran, und ich dachte, vielleicht hat er sich selbst im Spiegel betrachtet. Wissen Sie – im Fenster. Wenn drinnen das Licht aus war, musste er sich da sehen können.«
»Vielleicht.«
Caffery ließ die Szene in seinem Kopf abspielen: das Restaurant leer, als einzige Beleuchtung das bunte Licht der Leuchtreklamen und der Coors-Schriftzug über der Bar, draußen die Lichter vom Redcliffe Quay und die Reflexe im Wasser, ein dunkler Streifen zwischen dem Fluss und dem Restaurant. Er stellte sich die verschwommenen Umrisse des Mädchens im Fenster vor, als sie mit ihrem Eimer durch das Lokal ging. Er sah ihr Gesicht, bleich und schockiert, wie sie nach leisen Geräuschen lauschte; ihre Augen wanderten hin und her und spähten in die dunkle Nacht hinaus. Er sah eine kindliche Silhouette vor dem orangegelben Himmel, die sich nackt in einem Panoramafenster betrachtete. Ein Priapus.
»Was glauben Sie, woher er kam?«
»Oh, aus dem Wasser.« Es schien sie zu überraschen, dass er sich das nicht denken konnte. »Ja, da kam er her. Aus dem Wasser.«
»Sie meinen, aus einem Boot?«
»Nein. Er kam aus dem Wasser. War geschwommen.«
»Zum Ponton?«
»Ich hab ihn nicht herschwimmen sehen, aber ich wusste, dass er von da kam, weil er nass war – er tropfte. Und da ging er dann auch wieder hin. Zurück ins Wasser da drüben. Da, wo das rote Ding jetzt ist. Richtig flink war er, wie so ein Aal.«
Caffery drehte sich um. Sie deutete auf die rote Markierungsboje im Wasser. Sergeant Marley – Flea – musste jetzt darunter sein, denn das Tauchteam stand auf dem Ponton und spähte hinunter ins Wasser. Eine Führungsleine schlängelte sich aus dem Wasser zum Leinenführer hinauf, und Dundas sprach mit leiser Stimme in das Funkgerät. Es war schwer, sich vorzustellen, dass da unten jemand sein sollte: Der Wasserspiegel war glatt und konturlos, und der rote Himmel spiegelte sich darin. Jemand hatte eine »Totenbahre« gebracht, einen starren, orangegelben Polyurethanblock, der jetzt erwartungsvoll auf dem Steg lag, um bei Bedarf ins Wasser geworfen zu werden. Eine gespenstische Stille hing über der Szene im schwindenden Licht – als lauschten sie alle auf das Wasser und warteten darauf, dass etwas heraufgeschossen käme. Vielleicht ein Mensch, der aussah wie ein Mann, aber so klein wie ein Kind war. Ein Mensch, der sich bewegte wie ein Aal.
Caffery drehte sich zu dem rothaarigen Mädchen um. Ihre Augen waren jetzt feucht, als erlebte sie die Angst noch einmal, als erinnerte sie sich, wie etwas Dunkles, Nasses lautlos ins Wasser glitt.
»Ich weiß.« Sie bemerkte seinen Gesichtsausdruck. »Ich weiß. Es war das Unheimlichste, das ich je erlebt hab. Ich hab’s eine Weile beobachtet, wie es sich an der Mauer entlangbewegte, und dann...«
»Und dann?«
»Dann ging es unter. Tauchte unter, ohne das Wasser zu kräuseln. Und ich hab’s nie wieder gesehen.«
Flea und ihre Einheit waren nicht nur Taucher. Neben dem üblichen Unterstützungsdienst bei Unruhen und der Vollstreckung von Haftbefehlen waren sie speziell ausgebildet für Durchsuchungen in beengten Räumen und die Beseitigung von chemischem und biologischem Risikomaterial. Eine Folge ihrer Erfahrung im Umgang mit Schutzkleidung verschiedener Art bestand darin, dass Fleas Team, wann immer ein verwesender Leichnam gefunden wurde – im Wasser oder an Land -, hinzugezogen wurde, um ihn zu bergen. Sie waren so gut im Umgang mit zersetzten Leichen, dass man sie im Dezember 2004 nach Thailand schickte, um bei der Identifizierung der Tsunamiopfer mitzuhelfen: In zehn Tagen hatte das Team fast zweihundert Tote geborgen.
Die Leute konnten nicht glauben, dass sie damit zurechtkam. Zumal nach dem Tsunami, fanden sie. Hatte sie keine Albträume? Nein, eigentlich nicht, sagte Flea. Und außerdem bekommen wir psychologische Betreuung. Dann fragten sie, ob sie so etwas denn tun müsse und nicht ihr Talent vergeude, wenn sie verrottete Leichen aus Abflussrohren zog. Sie brauchte doch sicher nur ein Wort mit ihrem Vorgesetzten zu reden und die Versetzung zur Kriminalpolizei zu beantragen, dann könnte sie in Zivil arbeiten. Wäre das nicht besser?
Darauf gab sie keine Antwort. Sie wussten ja nicht, dass sie diese Arbeit nicht aufgeben konnte, dass sie seit dem Unfall ihrer Eltern nur noch dann richtig denken konnte, wenn sie einen Toten seiner Familie zurückgab, weil ihr klar war, dass vielleicht irgendwo ein Vater oder eine Mutter, ein Sohn oder eine Tochter auf dem Weg zur Genesung einen Schritt weiterkommen würde. Und das Tauchen – vor allem war es das Tauchen. Ohne das Tauchen – wie sie es ihr Leben lang mit ihrer Familie getan hatte – würde sie morgens niemals aufstehen. Nur unter Wasser konnte sie wirklich sie selbst sein.
Heute allerdings nicht, an diesem Abend fühlte sie sich selbst unter Wasser unbehaglich. Das Wasser im Hafen hatte sich ein bisschen beruhigt, und im Licht ihrer Lampe sah sie schemenhafte visuelle Anhaltspunkte. Versunkene Formen lösten sich aus dem Schlick, Orientierungsmarken, die sie erkannte: ein versunkener Heizungstank, der vor einem Monat von einem Schiff gekippt worden war, ein Auto, etwa zehn Meter weit links von ihr – ein Peugeot, dessen Windschutzscheibe mit dem Steuersticker im Halbdunkel noch sichtbar war, wenn man nah genug herankam. Ein Versicherungsbetrug, der Wagen war in der Nähe des Ostrich Inn ins Wasser geschoben worden, bevor der Schlipp gesperrt worden war. Hatte fast sechs Monate dort gelegen, bis der Arm des Baggers eines Morgens im Februar dröhnend dagegengeschlagen war. Sie hatte den Wagen durchsucht und Bergungsdrähte angeschlagen, um dem Hafenmeister einen Gefallen zu tun, und der wartete jetzt darauf, dass der Kran repariert wurde, damit das Wrack gehoben werden konnte.
Aber obwohl alles ganz vertraut und unkompliziert schien – wie hundert andere Suchaktionen ohne konkretes Ziel, die sie schon hinter sich hatte -, konnte sie nichts gegen die gespenstische Beklommenheit tun, die sich auf sie herabsenkte, während sie arbeitete. Manche Leute behaupteten, der Hafen sei seltsam: Sie redeten von unheimlichen Durchgängen, die vom Grund in eine noch tiefere Unterwelt hinabführten – wie etwa der uralte, zugemauerte Graben, der unter Castle Green verschwand und eine Viertelmeile weiter an einer dunklen, geheimen Schnittstelle drei Meter unter Wasser in den Frome mündete. Doch sie hatte hier schon Hunderte Tauchgänge absolviert und wusste, dass es nicht das war, was sie nervös machte. Auch der stellvertretende Ermittlungsleiter war es nicht, obwohl es ihr auf die Nerven ging, wie er sie anschaute, als wäre sie ein Kind – wie er ihre ganze professionelle Staffage durchdrang und sie daran erinnerte, dass das Leben furchterregend war und sie sich seit dem Unfall albern jung fühlte. Auch das genügte nicht, um ihr dieses Gefühl zu vermitteln. Nein. Im Grunde ihres Herzens wusste sie, woher das Gänsehautgefühl kam: von dem, was sie letzte Nacht in Dads Arbeitszimmer getan hatte.
Sie versuchte, nicht daran zu denken, während sie jetzt hier in dem suppigen Wasser arbeitete. Sie hatten sich entschieden, ein diagonales Suchfeld anzulegen, und eine Ankerleine zu beiden Seiten des Hafens festgemacht, weil er an dieser Stelle schmal genug war. Dann hatten sie eine diagonale Leine zwischen den beiden gespannt, an der sie sich jetzt entlangzog, während sie mit der freien Hand hin und her fuhr. Seit fast vierzig Minuten arbeitete sie jetzt in diesem Raster, eigentlich zu lange. Nicht dass es ihr etwas ausmachte, aber oben war es jetzt dunkel, das sah sie an der Farbe des Wassers, und Dundas hätte sie inzwischen herausziehen müssen. Sie wollte die ihm übertragene Autorität nicht untergraben, aber sie hatte jetzt keine Lust mehr, hin und her zu schwimmen, das Grundgewicht an der Hafenmauer entlang einen Meter weiterzuschieben, dann umzudrehen und rechts neben der Leine zurückzurudern, langsam und dicht am Boden, und mit der Hand in einem Bogen von einem Meter Durchmesser durch den Schlick zu fahren.
»Defensiv taktil« nannte man diese Art der Suche: taktil, weil man nur mit dem Tastsinn arbeitete, und defensiv, weil man jeden Augenblick damit rechnen musste, mit etwas Gefährlichem in Berührung zu kommen – mit zerbrochenem Glas oder Angelschnüren. Manchmal war das, was man suchte, das Letzte, was man zu finden erwartete. Ein Fuß. Oder Haare. Einmal hatte der erste Kontakt mit einer Leiche an der Nase stattgefunden: Sie war mit beiden Fingern in die Nasenlöcher gefahren. »Das wäre Ihnen nie gelungen, wenn Sie es drauf angelegt hätten«, hatte Dundas gemeint. Ein andermal hatte sie schwitzend und fluchend ein Stück Industrierohrummantelung an die Oberfläche gezerrt, von dem sie hundertprozentig überzeugt gewesen war, dass es das Bein eines dreißigjährigen Fitnesstrainers sei, der eine Woche zuvor mit einem Sprung von der Clifton Bridge Selbstmord begangen hatte. Alles stand auf dem Kopf, wenn man neutral tariert war und nur eine Handbreit weit sehen konnte. Als sie unter dem Ponton auf die Führungsleine stieß, nur zwei Meter weit vom Fundort der Hand entfernt, war sie seltsam erleichtert.
Langsam, weil sie allmählich müde wurde, wuchtete sie das Gewicht aus dem Schlamm, bewegte es einen Meter weiter und ließ es wieder fallen. Sie hatte es gesichert und prüfte gerade, ob die Leine straff genug für den Rückweg war, als etwas passierte, das ihr eine Gänsehaut über den ganzen Körper jagte. Es war verrückt. Sie sah nichts, und nachher hätte sie nicht einmal sagen können, dass sie etwas fühlte, aber plötzlich war sie aus unerklärlichen Gründen sicher, dass sich jemand bei ihr im Wasser befand.
Sie drehte sich um, zog das Messer aus der Knöchelscheide und presste sich mit dem Rücken an die Wand. Schwer atmend umklammerte sie die Ankerleine und balancierte sich mit kurzen Bewegungen der Füße aus. Sie hielt das Messer vor sich und machte sich darauf gefasst, dass sich etwas auf sie stürzte.
»Rich?«, sagte sie mit zittriger Stimme ins Mikro.
»Ja?«
»Haben Sie hier sonst noch jemanden im Wasser gesehen?«
»Äh – nein. Ich glaube nicht. Warum?«
»Ich weiß nicht.« Mit einer rudernden Handbewegung hielt sie sich aufrecht und verhinderte, dass das Wasser ihren Rücken an der Wand drehte. Die Luft in ihrem Anzug drängte nach oben und sammelte sich an ihrem Hals; der Druck machte sie benommen. »Ich glaube, ich habe einen Geist gesehen.«
»Was ist los?«
»Nichts. Nichts.« Ihr dröhnte der Kopf. Die Markierungsboje war dazu gedacht, das Gewicht eines Menschen zu tragen, und sie könnte sich innerhalb einer Sekunde hinaufziehen, wenn irgendetwas sie angreifen sollte. Aber ihre Ausbildung hinderte sie daran aufzutauchen. Also wartete sie schwer atmend; ihr Blick wanderte suchend durch die Dunkelheit, während sie das Messer abwehrbereit im Bogen hin und her schwenkte. Der Hafen von Bristol, beruhigte sie sich. Nur der Hafen von Bristol. Und eigentlich hatte sie überhaupt nichts gesehen. Langsam verstrichen die Minuten. Die Nadel an ihrer SPG-Anzeige bewegte sich in winzigen Schritten, und als nichts passierte und Puls und Atmung sich allmählich wieder normalisierten, schob sie das Messer sehr langsam zurück in die Scheide an ihrer Wade. Die vergangene Nacht und Dads Arbeitszimmer – das war es, was ihr zusetzte. Es war nicht komisch. Ganz und gar nicht. Sie nahm sich zusammen und ließ sich vornübersinken, damit die Luft in ihre Beine zurückkehrte. So verstrichen ein paar Augenblicke. Feiner Sand wirbelte um sie herum.
»Dundas?«, fragte sie. »Sind Sie da?«
»Alles okay, Sarge?«
»Nein. Nein, nicht okay.« Ich habe Halluzinationen, Rich. Paranoia. Die volle Dröhnung. »Sie habe mich jetzt vierzig Minuten unten gelassen«, sagte sie schließlich. »Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie mich rausholen. Meinen Sie nicht?«
5
13.Mai