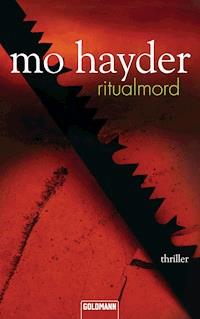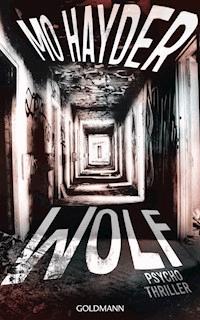
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Inspektor-Caffery-Thriller
- Sprache: Deutsch
Ein einsames Haus am Waldrand. Es war ihr
Zufluchtsort. Jetzt ist es die Hölle.
„Es hört sich an, als würden sie gerade meine Tochter oder meine Frau bedrohen. Ich weiß nicht, was passiert. Jetzt ist es still.“ Vor vierzehn Jahren wurde ein junges Liebespaar brutal ermordet. Der Hauptverdächtige gestand das Verbrechen und wurde verurteilt. Aber die Erinnerung an die Morde ist noch nicht verblasst. Als Oliver Anchor-Ferrers mit seiner Familie in das einsam gelegene Ferienhaus in der Nähe des damaligen Tatorts zurückkehrt, macht er eine schockierende Entdeckung: Ist der Täter von einst etwa wieder auf freiem Fuß? Noch kann er nicht ahnen, dass das schon bald nicht mehr seine größte Sorge sein wird. Der Albtraum kehrt mit voller Macht zurück, nur diesmal ist er die Hauptfigur ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
»Es hört sich an, als würden sie gerade meine Tochter oder meine Frau bedrohen. Ich weiß nicht, was passiert. Jetzt ist es still.«
Vor fünfzehn Jahren wurde ein junges Liebespaar brutal ermordet. Der Hauptverdächtige gestand das Verbrechen und wurde verurteilt. Aber die Erinnerung an die Morde ist noch nicht verblasst. Als Oliver Anchor-Ferrers mit seiner Familie in das einsam gelegene Ferienhaus in der Nähe des damaligen Tatorts zurückkehrt, macht er eine schockierende Entdeckung: Ist der Täter von einst etwa wieder auf freiem Fuß? Noch kann er nicht ahnen, dass das schon bald nicht seine größte Sorge sein wird. Der Albtraum kehrt mit voller Macht zurück, nur diesmal ist er die Hauptfigur …
Weitere Informationen zu Mo Hayder sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Mo Hayder
Wolf
PSYCHOTHRILLER
Ins Deutsche übertragenvon Rainer Schmidt
TEIL EINS
Holunderblüten pflücken am Abend, in der Nähe von Litton, Somerset
Amy ist fünf Jahre alt, und in diesen fünf Jahren hat sie nie gesehen, dass Mummy sich so benommen hätte. Mummy steht vor ihr auf der Wiese, und sie steht komisch da, als wäre sie von einer Eiskanone gefroren worden, wie sie der Mann bei den Unglaublichen die meiste Zeit in der Hand hält: auf einem Bein, den einen Arm vorgestreckt, als ob sie gerannt wäre und den Befehl bekommen hätte, plötzlich still wie eine Statue zu stehen. Ihr Mund ist offen, und ihr Gesicht ist weiß. Es würde richtig komisch aussehen, wenn ihre Augen nicht weit aufgerissen und unheimlich wären, wie wenn etwas Schreckliches im Fernsehen gezeigt wurde. Hinter ihr zieht eine Reihe von fluffigen weißen Wolken über den Himmel – wie bei den Simpsons –, aber der Himmel ist ein bisschen dunkler, weil es fast Nacht ist.
»Amy?« Nach einer Weile setzt Mum den Fuß auf den Boden und hört auf zu balancieren. Sie macht ein komisches Tänzchen zur Seite, wie eine Marionette, die gleich hinfallen wird, und als sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hat, verändert sich ihr Gesicht. »AMY?«
Sie fängt an zu rennen, und beim Rennen schreit sie: »Brian!?! Brian, ich hab sie gefunden! Brian? Komm HER! Ich hab sie gefunden. Hier drüben unter den Bäumen.«
Bevor Amy etwas sagen kann, hat Mum sie an sich gerissen. Sie ruft immer noch laut nach Dad: »Brian, Brian, Brian«, und sie drückt Amy an sich, wie sie es an dem Tag getan hat, als Amy auf die Straße hinauslaufen wollte und beinahe von einem Bus zermatscht worden wäre, was das Schrecklichste war, sagt Mum, was sie je erlebt hat, aber Amy fand, es war nicht halb so schrecklich wie der Puzzler bei den Numberjacks im Fernsehen.
»Wo bist du gewesen?« Mum stellt sie mit einem Bums wieder auf den Boden, hockt sich vor ihr hin, reibt sich über Arme und Beine, zieht sich das blaue Kleid glatt und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Starrt sie ganz besorgt an. »Amy? Amy, ist alles in Ordnung? Geht es dir gut, Schatz?«
»Ja, Mummy. Warum?«
»Warum?« Mum schüttelt den Kopf, wie sie es macht, wenn Dad etwas wirklich Dummes sagt. »Warum? O Baby, Baby, Baby. Mein Baby.« Sie schließt die Augen, legt den Kopf an Amys Brust und drückt sie. Sie drückt richtig fest, und Amy fühlt, wie in ihr alles zusammengequetscht wird, aber sie möchte sich nicht loswinden, weil Mum dann vielleicht traurig ist.
»Amy!« Dad kommt den Weg heruntergerannt. Die Wiese ist sehr groß und sehr grün, und es geht bergab. Die Leute aus den Autos, die hier parken, sind ausgestiegen und stehen jetzt alle da und starren sie an. »AMY?« Dad hat die Dose nicht mehr, in die sie ihre Blüten getan haben. Stattdessen hält er sein Telefon in der Hand. Er hat seinen schönen Pulli ausgezogen, und sein Hemd ist unter den Armen eklig nass. Mum sagt, da wird er undicht, wenn er zu lange rennt; also muss er jetzt lange gerannt sein. Sein Gesicht sieht aus wie Mums, blass und verstört, und Amy würde am liebsten ein bisschen lachen, denn sie sehen wirklich beide komisch aus, wie weiße Halloween-Masken. Aber es ist schwer zu sagen, ob Dad jetzt wütend oder traurig ist.
»Wo warst du? Wo hast du gesteckt?« Er schreit richtig. »Wie oft hab ich dir gesagt, du sollst immer da bleiben, wo wir dich sehen können?« Er dreht sich um und schreit zu den Leuten bei den Autos hinüber: »Wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden.« Dann sieht er wieder Amy an. Er ist wütend, ganz klar – man sieht es daran, wie schmal seine Augen blinzeln. »Du warst ewig verschwunden, und du hast deine Mutter zum Weinen gebracht. Das war das letzte Mal, dass wir Holunderblüten gepflückt haben. Das letzte Mal.«
»Brian, beruhige dich. Es geht ihr gut, das ist die Hauptsache.«
»Sicher?« Er legt Mum eine Hand auf die Schulter und schiebt sie zur Seite, damit er sich bücken und Amy ins Gesicht sehen kann. Sein Blick wandert auf und ab und hin und her, über jeden Zollbreit. »Ist alles in Ordnung? Amy? Wo bist du gewesen? Hast du mit jemandem gesprochen?«
Sie beißt sich auf die Lippe. Ihr Kopf ist scheußlich heiß, und sie hat ein paar Tränen in den Augen, die unter den Lidern herausfallen und über ihre Wangen fließen.
»Amy?« Dad packt sie beim Arm und schüttelt sie. »Hast du mit jemandem gesprochen?«
»Nur mit dem Mann. Sonst mit keinem.«
Dad wird ganz komisch. Seine Hände sind auf einmal nicht mehr nett, sondern bohren sich wie Vogelklauen in Amys Arme. »Mit dem Mann?«
»Ja.«
Mums Lippen fangen an zu zittern. Das schwarze Schminkzeug an ihren Augen ist flüssig geworden und rinnt über ihr Gesicht. »Ich habe dir doch gesagt, wir sollten um diese Tageszeit nicht hier draußen sein, Brian, weil sie jetzt alle herauskommen – sie alle. Und wir sind nicht weit entfernt vom Donkey Pitch. Du erinnerst dich? Der Donkey Pitch?«
»Mit welchem Mann?«, fragt Dad. »Amy, erzähl es mir so erwachsen, wie du kannst, denn es ist ernst. Was ist das für ein Mann?«
Sie dreht sich zum Wald um und hebt die Hand, um hinzuzeigen. Aber dann sieht sie, dass er weg ist – der Mann, der Hunde gernhat. Er ist weggegangen. Und das Hündchen muss er mitgenommen haben, denn es ist auch weg.
»Er war wirklich drollig.«
»Drollig?«, sagt Mum. »Drollig?«
»Das Hündchen hieß Bear.«
»Das Hündchen?«
»Ach, mein Gott noch mal!« Dad reibt sich heftig die Stirn. »Da ist immer ein Hündchen. Immer ein verschissenes Hündchen.«
»Brian, bitte.«
»Das ist der älteste Trick der Welt: Mein Hündchen ist krank – komm mit in den Wald, und ich zeig’s dir. Wir gehen mit ihr zur Polizei. Sie muss untersucht werden.«
Amy runzelt die Stirn. Der Mann im Wald hat nicht gesagt, sein Hündchen wäre krank, und er hat sie auch nicht gebeten, mit in den Wald zu kommen, um es sich anzusehen. Sie war es, die das Hündchen gefunden hat – bevor sie dem Mann begegnet ist.
»Ich will nicht untersucht werden, Mum. Ich will das nicht.«
»Siehst du, Brian, jetzt hast du ihr Angst gemacht. Also, Amy …« Mum setzt sich ins Gras und klopft auf ihr Bein. »Komm her, Süße, und setz dich.«
Amy setzt sich auf Mums Schoß. Sie wischt sich mit der Hand über die Nase und zieht den restlichen Rotz hoch, was aber eklig ist. Sie wünscht, Dad wäre nicht wütend – sie versteht auch nicht, warum er es ist, denn der Mann war nicht schlimm. Er sah ein bisschen komisch aus, mit einem großen, haarigen Bart, wie ein Kobold oder wie ein umgekehrter Weihnachtsmann, denn der Bart war schwarz und nicht weiß, aber er hat sehr, sehr nett mit ihr gesprochen und ihr ein Versprechen gegeben, ein richtiges Versprechen mit Ehrenwort, und alle Welt weiß, dass das ein richtiges Versprechen ist. Und das andere ist, er hat sie Krokus genannt, und das hat ihr am besten gefallen – als er gesagt hat, sie sei so hübsch wie ein Krokus. Weil, Krokusse sind wirklich hübsch, und sie sind manchmal lila und manchmal gelb und manchmal beides. Miss Redhill in der Schule sagt, der Krokus ist die zweite Blume des Frühlings, und er kommt, wenn die Schneeglöckchen gestorben und in die Erde zurückgegangen sind.
»Amy«, fragt Mum. »Dieser Mann … war er nett zu dir?«
»Ja. Und er war nett zu dem kleinen Hund.«
»War es sein Hund?«
»Nein.«
»Wessen dann?«
»Das weiß ich nicht.« Sie schiebt den Finger in die Nase und bohrt nachdenklich darin herum. Sie denkt sich, dass das kleine Hündchen vielleicht in Wirklichkeit gar kein Hundebaby war, sondern ein erwachsener Hund. Ein großer Hund kann ja klein sein, wenn er noch ein Welpe ist, und ein alter Hund kann auch kleiner sein als ein Welpe, obwohl er viel älter ist. Ob er groß oder klein ist, das hängt alles von der »Rasse« ab (so nennt man das). »Er ist erst gekommen, als ich den Hund schon gefunden hatte. Das hab ich doch eben gesagt, oder?«
Dad richtet sich auf. »Dann komm. Zeig mir, wo du den kleinen Hund gefunden hast.«
Mum lässt Amy von ihrem Schoß rutschen. Sie hält ihre Hand, als sie unter die Bäume gehen. Es ist ein bisschen unheimlich im Wald, weil es jetzt dunkel ist. Aber sie kann Dads weißes Hemd sehen, und Mum macht im Gehen mit ihrer Hand, was sie öfter macht: Sie drückt Amys Daumen, um ihr zu sagen, dass alles okay ist. Amy drückt zurück.
Amy führt Mum und Dad zu der Stelle, wo sie den kleinen Hund gefunden hat. Es wird jetzt wirklich Nacht, und die Bäume sind still und dunkel. Kein Hündchen. Der Mann hat ihr versprochen, das Hündchen irgendwo hinzubringen, wo es in Sicherheit ist.
»Ich war hier«, sagt sie. »Und ich hab die Blüten in die … Da ist sie!« Sie hat die Tupperware-Dose gefunden. Sie geht hin, hebt sie auf und zeigt Mum und Dad die ganzen Blüten. Es sind die besten Blüten, ganz ohne Würmer – nicht wie die, die Dad gefunden hat.
»Ich hab hier nur die Blüten gepflückt, und ich wollte sie holen, aber da kam der kleine Hund und hatte eine kranke Pfote.«
»Eine kranke Pfote?« Dad sieht Mum an und zieht die Brauen hoch.
»Ja, blutig und so. Und sein Nerrchen und sein Frauchen waren nicht da, und der Mann wusste auch nicht, welchem Erwachsenen das Hündchen gehörte. Und ich hab gesagt, oh, armes Hündchen, und ich wollte es zu dir bringen, Daddy, weil, wenn es kein Nerrchen hat, muss es ja …«
»Kein Herrchen«, sagt Mum.
»Kein Herrchen«, wiederholt Amy. »Wenn es kein Herrchen hat, dann braucht es ja eins, und ich dachte, es könnte bei uns zu Hause wohnen, unter dem Herd – weil, da ist es schön warm, und von mir aus kann es mein Taschengeld haben, Mum, damit es Milch kriegt.«
Mum wischt sich über die Augen und lacht ein bisschen. Das ist schön. Sie hat die ganze Zeit nicht gelacht, seit das alles passiert ist.
»Amy …« Sie umarmt sie, aber viel sanfter diesmal. »Er hat dich nicht angefasst, Amy, oder? Er wollte nicht, dass du etwas tust, das dir nicht gefällt?«
Amy lutscht ein Weilchen an den Fingern. Sie schmecken nach Gras und Blütenstielen. Sie wünscht, sie hätte den kleinen Hund behalten können.
»Amy? Wollte er, dass du etwas tust, das dir nicht gefällt?«
»Nein. Er hat nichts gemacht. Er war nur nett zu mir, und er will dem kleinen Hund helfen. Ehrlich, Mum. Ehrlich.«
Dad atmet lange aus. Es hört sich an wie ein Ballon, der ein Loch hat. Er schüttelt den Kopf, steckt das Telefon ein, steht auf und geht ein bisschen herum. Er wendet Amy und Mum den Rücken zu und ruft in den Wald hinein.
»Hallo? Hallo – möchtest du rauskommen und mit mir plaudern? Vielleicht über kleine Hunde, du Dreckschwein?«
Es ist lange, lange still. Dann kommt er zurück, und es ist erstaunlich, aber Mum schimpft nicht, weil er so ein unanständiges Wort benutzt hat.
»Komm, wir gehen – du gehörst schon seit Stunden ins Bett.«
Mum nimmt Amy an der Hand, und sie folgen Dad zum Lieferwagen – zu Dads weißem Lieferwagen, in dem er wegen der Arbeit herumfährt. Mit dem Daumennagel versucht Amy, das grüne Zeug abzukratzen, das überall innen an ihren Händen klebt. Die Blüten hier sollen sehr dick sein, und deshalb sind sie heute hergekommen. Man kann richtig, richtig leckere Getränke daraus machen, wenn man genug Zucker reintut, aber da muss ein Erwachsener dabei sein, wegen der Hitze. Es wird sehr heiß. Heiß genug, dass einem der Finger abfallen kann, wenn man ihn in den Topf hält. Mit Blut und allem.
Amys Teddy, Buttons, sitzt auf dem Vordersitz. Amy klettert hinter Mum hinein, greift nach Buttons und hält ihn ans Gesicht, um seine Flauschigkeit zu fühlen. Als Dad mit seinem Schlüssel den Motor startet, verschiebt Amy ihren Sicherheitsgurt so, dass sie auf dem Sitz knien, die Nase ans Fenster drücken und in den Wald zurückschauen kann. Mum lässt sie.
Dad fährt den Wagen von der Wiese und auf die Straße. Es ist holprig, und Amy wird durchgerüttelt, aber sie beobachtet weiter die Bäume und fragt sich, ob der umgekehrte Weihnachtsmann wohl den Besitzer des kleinen Hündchens finden wird.
Dann fährt der Wagen weiter die Straße entlang, und sie kann die Bäume nicht mehr sehen, sondern nur noch die Straße und die anderen Autos und die Häuser, die vorbeisausen. Sie setzt sich hin und zieht den Gurt bequem zurecht. Buttons setzt sie auf ihren Schoß. Er schaut sie an. Seine Nase muss repariert werden, und er hat eine kranke Pfote, genau wie der kleine Hund.
»Mummy«, sagt sie, als sie da ankommen, wo ihre Straße zu Ende ist und wo jemand ein Moshi-Monster auf das Straßenschild gesprüht hat. »Mummy, welches Wort kriegt man, wenn man den ›Hah‹-Buchstaben, wo Miss Redhill immer auf ihre Hand haucht, wenn man den nimmt …«
»Ein H, meinst du?«, fragt Mum.
»Ja, wenn man ein ›H‹ nimmt und dann das ›Esel-E‹ und das ›Lollipop-L‹ und das ›Puste-F‹, mit dem man die Kerzen auf der Geburtstagstorte auspustet, und das ›Tee-T‹ – was kriegt man dann für ein Wort?«
»H-E-L-F-T?«, fragt Mum. »Das heißt ›helft‹. Warum?«
»Helft?«
»Ja.«
»Und ›Uhu-U‹ und ›Nein-nein-N‹ und ›Schlangenzisch-Ssss‹?«
»U-N-S? Das heißt ›uns‹. ›Helft uns‹.« Mum schaut Amy an und lächelt verwirrt. »Helft uns? Wieso? Warum fragst du das?«
Amy nagt an der Unterlippe. Etwas hat am Halsband des kleinen Hundes gehangen. Ein winziges Stück Pappe, auf dem was geschrieben stand, mit blauem Stift. Es war überall eingerissen, und die Buchstaben waren ganz verwischt und zu großen blauen Klecksen verlaufen, sodass man sie nicht mehr richtig erkennen konnte. Nur diese Buchstaben jetzt.
Helft uns.
»Amy? Warum fragst du?«
Amy schaut Dads Ohr an. Wenn sie noch einmal von dem kleinen Hund anfängt, wird er sie wahrscheinlich anschreien. Also schüttelt sie den Kopf.
»Nur so«, sagt sie, als sie vor dem Haus halten. Sie wünscht, sie hätte einen kleinen Hund. Und andere Eltern. Eltern, die nicht wütend werden, wenn sie ihnen Sachen erzählt, die wahr sind. »Nur so.«
Ein paar Stunden vorher: Der Schweinemann
Der Schweinemann. So bezeichnet Oliver Anchor-Ferrers sich selbst. Als Gestalt aus den Seiten eines viktorianischen Bestiariums. Vor neun Wochen haben die Ärzte in der Mayo-Klinik in London ihm Mittel zur Blutverdünnung gegeben. Sie haben sein Perikard mit Rippen-Retraktoren aus Edelstahl geöffnet, multiple Kanülen an seinen Körper angeschlossen und sein Blut zu mechanischen Membranoxygenatoren umgeleitet, die die Aufgabe des Herzens übernahmen und Gewebe und Organe mit Sauerstoff versorgten. Sein Herz haben die Mediziner durch die Injektion einer Paralyse induzierenden kardioplegischen Lösung angehalten. Auf dem Operationstisch war Oliver fast eine Stunde lang tot. Nachdem sie die Herzklappen, die ihm von Geburt an gehört hatten, entfernt und durch die Klappen eines eigens gezüchteten Schweins ersetzt hatten, schlossen die Chirurgen die Aorta und befestigten das Brustbein mit Stahldraht. Seinem Aussehen zum Trotz – er erscheint wie ein völlig normaler Mann in den Sechzigern – wird Oliver Anchor-Ferrers durch ein Stück fremdes Fleisch am Leben gehalten, das in seinem Herzen zuckt. Er ist halb Mensch, halb Schwein.
Ein Herzklappenaustausch ist ein ziemlich alltägliches Verfahren, eine Operation, die seit Jahren gebräuchlich ist – nach seiner Rechnung müssen etliche Tausend Schweinemenschen auf diesem Planeten herumlaufen –, aber Oliver findet das nicht beruhigend. Seit er auf der Station aufgewacht ist, lauscht er auf seinen Puls und fragt sich, wie er mit seinem Gehirn verbunden ist und ob die mechanischen, uralten Überlebensteile seines Kleinhirns das Fremde schon als fremd erkannt haben. Seit der OP liegt er nachts im Bett und lauscht dem Dröhnen und Vibrieren in seiner Brust. Er fragt sich, welchen Einfluss er darauf hat. Er fragt sich, wer die Entscheidung über dieses Leben trifft – er oder das Schwein.
Schlag weiter, flüstert er manchmal, Schweineherz, schlag weiter …
Oliver ist vierundsechzig und besitzt mehrere Millionen Pfund. England ist sein Heimatland – er hat hier zwei Anwesen. Sein Hauptwohnsitz, ein Regency-Reihenendhaus, steht in Knightsbridge. Aber hier, in seinem zweiten Haus, einer weitläufigen viktorianischen Villa hoch auf einer Anhöhe in den Mendip Hills in Somerset, fühlt er sich am meisten zu Hause. Sein Lieblingssessel, abgenutzt und alt und der Form seines Körpers angepasst, steht an seinem gewohnten Platz in der Kaminecke der Küche. Er freut sich seit einer gefühlten Ewigkeit auf diesen Sessel. Fast zwei Monate hat es gedauert, bis die Londoner Ärzte ihm grünes Licht gegeben haben hierherzukommen.
Er streckt die Beine aus, lässt sich zurücksinken und schaut sich zufrieden um. Ein Feuer ist nicht vorbereitet, nicht jetzt im Sommer; im Kamin steht ein Korb mit Trockenblumen, um ihn auszufüllen. Aber sämtliche vertrauten Merkmale eines Familienaufenthalts sind da. Sie haben London im Morgengrauen verlassen und sind am späten Vormittag angekommen. Es ist ein typischer erster Tag, den sie in liebenswertem Chaos verbracht haben. Überall verstreut stehen Lebensmittel und alle möglichen anderen Dinge herum, die Matilda aus London mitbringt: zahllose Plastiktüten aus dem Waitrose-Supermarkt, in Papier gewickelte Pakete aus dem Deli, Kartons mit Frühstücksflocken und Fruchtsäften. Die einzige, unwillkommene Neuerung ist das blassrosafarbene Medikamententablett auf der Fensterbank.
Matilda kommt eilig aus der Stiefelkammer – farbenfroh und duftend. Sie trägt ihre blau-rosa Gartenschürze, die Kiran ihr vor Jahren geschenkt hat. Sie bindet sich eine mit Punkten bedruckte Werkzeugtasche um die Taille, und Oliver sieht, dass sie sich das Londoner Make-up aus dem Gesicht gewischt hat, wie sie es gewohnt ist. Ohne briefkastenroten Lippenstift und Grundierung ist ihre bloße Haut pfirsichfarben, und ihre Lippen sind von einem natürlichen zarten Rosa wie das Innere einer Feige. Matilda ist sechzig und inzwischen grauhaarig, aber ihre Haut ist klar wie ein wolkenloser Himmel, und wenn Oliver sie ansieht, vollführt das Licht immer noch einen seltsamen Tanz, wie es das immer getan hat, seit ihrer ersten Begegnung vor all den Jahren.
»Schatz.« Sie bleibt stehen und lächelt Oliver an. In diesem Lächeln liegt alles: Liebe und Mitleid und die gemeinsame Verzweiflung darüber, dass es so weit kommen musste: zu einer Herzoperation und zu Medikamenten in nummerierten Fächern. »Schatz hast du etwas dagegen, wenn ich …?«
Sie will in den Garten. Es ist noch keine halbe Stunde her, dass sie angekommen sind, und schon will sie nach draußen. In den achtundzwanzig Jahren, seit sie dieses Haus besitzen, hat sie ihr ganzes Herz in diese Blumen, Sträucher und Rabatten gegossen. Er lächelt. »Das musst du sogar, mein Liebling. Ja, ich glaube, ich höre, wie die Pflanzen nach dir rufen.«
»Kommst du auch wirklich zurecht?«
»Natürlich, natürlich. Mir geht es bestens.«
Matilda ist mit dem Werkzeuggürtel fertig und beugt sich über ihn. Sie schiebt eine Hand unter sein Hemd und drückt die kühle Handfläche auf die Narbe an seiner Brust.
»Wie fühlt es sich an?«
»Es ist brav.«
»Grunzt nicht? Quiekt nicht, kreischt nicht? Der Arzt hat gesagt, ich muss die Ohren offen halten und besonders auf das Quieken achten.«
Er legt seine Finger auf ihre und drückt ihre Hand fester an seine Brust, damit sie das Klopfen darin fühlen kann.
»Gut.« Sie nimmt sich einen Moment Zeit mit dem Zuknöpfen und streicht sein Hemd glatt, bis sie zufrieden ist. Sie drückt ihm einen Kuss auf den Kopf. »Schwester Matilda ist ein ziemlicher Drache, also mach dich auf was gefasst. Trink deinen Tee und nimm in drei Stunden deine Tabletten. Und der Kuchen ist in zwanzig Minuten fertig. Dann bin ich wieder da.«
Sie geht hinaus und wühlt in ihrem Gürtel nach der Rosenschere. Er betrachtet ihren geraden Rücken und ihr fein geschnittenes Profil. Wer sie so sähe, würde nicht ahnen, wie zart sie innerlich ist. Genau wie niemand bei seinem Anblick auf den Gedanken kommen würde, dass er von Schweineteilen am Leben erhalten wird.
»Alles in Ordnung?«
Er blickt auf. Lucia sitzt auf der Fensterbank und hat den Küchentisch dicht an sich herangezogen. Überall liegen Zeitschriften, Zeichnungen und Gedichte ausgebreitet. Die Sonne flutet hinter ihr herein und erfasst die Strähnen in ihrem schwarzen Stachelhaar. Ihre Haut ist weiß, und ihre Augen sind so stark mit Schminke umringt, dass sie wie verwaschene Löcher in ihrem Schädel aussehen. Sie mustert ihn auf ihre herausfordernde Art, mit festem, dunklem Blick. Er und Matilda nennen das den »Lucia-Blick«. Lucia ist fast dreißig, aber sie benimmt sich immer noch wie ein mürrischer Teenager.
»Ja. Warum?«
»Nur so …« Sie atmet gelangweilt geräuschvoll aus. Zuckt die Achseln. »Ich dachte gerade, ich sollte mal fragen. Aus Höflichkeit.«
Sie wendet sich wieder ihrer Arbeit zu, und Oliver sieht ihr zu, wie sie kritzelt und sich am Kopf kratzt, während sie über ihren Büchern brütet und alle paar Augenblicke mechanisch nach einer der schwarzen Trauben greift, die in der Schale vor ihr liegen. Bear, die Border-Terrier-Hündin, liegt unter dem Tisch, halb auf ihren Füßen, und schläft. Bear sieht überhaupt nicht aus wie ein Bär, eher wie ein kleiner Teddy mit ungleichmäßig angesetzten Ohren, die unterschiedlich getrimmt werden müssen, damit sie parallel sitzen. Sie ist klein, aber sie kann rennen wie der Wind und muss am ersten Tag des Aufenthalts hier an der Leine gehalten werden. Sie hat die Gewohnheit, durchzubrennen und in den Wald zu laufen, und deshalb trägt sie ihr Halsband. Die Leine liegt unter Lucias Stuhlbein, und Bears Kopf ruht auf Lucias Stiefeln – Doc-Martens-Stiefeln, die mit pastellfarbenen Trollgesichtern bedruckt sind. Alberne Kinder-Cartoons, überall auf ihren Füßen.
Oliver nimmt seine Teetasse und trinkt langsam. Die vertraute, muffige Karowolldecke, die er so sehr liebt, liegt auf seinen Knien, es duftet nach Matildas Kuchen aus dem Ofen, und er trinkt Tee aus dem angeschlagenen Becher, den sie manchmal beim Gärtnern benutzt. Er ist mit einem kitschigen Foto von Kiran und Lucia bedruckt; sie haben die Arme um den alten Golden Retriever gelegt, den sie als Kinder hatten. Noch vor einem Jahr hätte er aus diesem Becher nicht getrunken, weil ihm so viel Sentimentalität peinlich gewesen wäre.
»Oliver.«
Matilda steht in der Tür, die Rosenschere noch in der Hand. Aber ihr Blick ist nicht mehr ruhig, sondern wachsam und beunruhigt. Sofort fängt die Schweineherzklappe an zu flattern.
»Ja?«, sagt er vorsichtig.
Lucia an ihrem Tisch hebt den Kopf und starrt ihre Mutter neugierig an. »Mum?«
»Oliver«, sagt Matilda ruhig und ignoriert ihre Tochter. »Hast du einen Augenblick Zeit? Um kurz was zu besprechen?«
»Was denn?«, fragt Lucia.
Matilda sieht ihre Tochter nicht an. Stattdessen gibt sie Oliver mit einer vielsagenden Kopfbewegung zu verstehen, dass sie ihn unter vier Augen sprechen muss. Mühsam kommt er auf die Beine, und er ignoriert den Schwindelanfall, den diese plötzliche Bewegung mit sich bringt. Er umklammert den Gehstock und durchquert das Zimmer, so schnell er kann. Die ganze Zeit fühlt er Lucias Blick auf sich. Als er bei der Speisekammer angekommen ist, legt Matilda einen Finger an den Mund, fasst ihn beim Handgelenk und zieht ihn aus der Küche.
»Es tut mir leid«, flüstert sie. »Ich tu dir das nicht gern an, aber du musst es sehen. Sonst glaube ich, ich werde verrückt. Es tut mir so leid.«
Sie winkt ihm lautlos, ihr zu folgen, und geht durch die Hintertür hinaus. Er geht hinterher und spürt bewusst, wie die Luft pfeifend in seiner Lunge ein und aus geht. Schlag weiter. Schweineherz.
Draußen hat die Sonne fast ihren mittäglichen Höhepunkt erreicht und strahlt auf die Anhöhe herunter. Matilda schiebt eine Hand unter seinen Ellenbogen und führt ihn weg vom Haus. Sie gehen langsam. Trotz der Lage auf dem Hügel, nach allen vier Seiten vom Himmel umgeben, erscheint einem der Garten wie eine Ansammlung von Zimmern, nicht wie ein offener Bereich. Ein Weg führt aus dem ummauerten Garten zu einem Walnusshain, durch eine Hecke in einen kunstvoll angelegten Knotengarten und dann durch eine Pforte zu drei absteigenden Terrassen mit zerbröckelnden, verschnörkelten Balustradentreppen. Man kann in jeder vorstellbaren Reihenfolge durch die verschiedenen Bereiche spazieren, über eine Wiese mit kniehohem Gras, die in den Sommermonaten von Blumen übersät ist, bis zu den moosbedeckten Mauern des Küchengartens, wo riesige Rhabarberpflanzen wie Springbrunnen aus dem Boden schießen. Der reinste Irrgarten, ein Irrgarten und ein Denkmal für Matildas Liebe und ihre Energie.
Ab und zu fällt der Blick auf eine schwarze Stelle, die aussieht wie ein dunkler Schimmelfleck oder eine mit Pathogenen gesprenkelte Petrischale. Das sind die Stellen, an denen Lucia versucht hat, Matildas Farbenschema zu sabotieren, wann immer sie zurückkommt, um bei ihnen zu wohnen. Sie schleicht sich in den Garten und pflanzt heimlich schwarze Tulpen und blutrot-violette Nieswurz. Das ist ihre Art, einen Besitzanspruch auf das Anwesen zu stellen und dafür zu sorgen, dass sie ihren Stempel hinterlässt. Matilda macht es wütend, und sowie Lucia das Haus wieder verlässt und ihr Leben anscheinend wenigstens vorübergehend wieder in den Griff bekommt, nutzt Matilda die Gelegenheit, um die anstößigen Eindringlinge wieder auszureißen.
Am Fuße der Treppe fällt das Gelände weiter ab und reicht bis zu einer Reihe kleiner, halb versunkener Gehölze, die von Weitem aussehen wie eine holprige Kette, die sich über die Landschaft spannt. Beim ersten dieser Gehölze lässt Matilda seinen Arm los und läuft voraus. Er folgt ihr in kurzem Abstand und stützt sich auf seinen Stock. Nach ungefähr zwanzig Metern bleibt sie auf einer kleinen Lichtung stehen. Eine Harke lehnt an einem Baum, und daneben liegt ein umgekippter Korb, als sei Matilda beim Laubsammeln gestört worden.
»Da.« Sie dreht sich zu ihm um. Ihr graues Haar ist aus dem Gesicht zurückgebunden, und ihre Lippen sind nicht mehr rosig, sondern weiß. Die Zahnwurzeln am Rand des Zahnfleischs sind sichtbar. »Da. Siehst du, was ich meine? Oder werde ich verrückt?«
Ihr Blick geht zurück zu den Silberbuchen hinter ihr. Er sieht, was da ist, und für einen Augenblick muss er sich an einen Baum lehnen, um sich zu stützen. Jeder Muskel beginnt zu zittern.
Das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein.
Spuk
Matilda Anchor-Ferrers glaubt, dass es im Haus spukt. Nicht im konventionellen Sinn, nicht der Geist eines lange Verstorbenen. Was hier spukt, ist die gemeinsame Erinnerung an ein Ereignis, das sich vor fünfzehn Jahren ereignet hat, als Kiran sechzehn und Lucia gerade fünfzehn war. In Matildas Augen war es eine Wasserscheide in ihrem Leben, ein Ereignis, das alles irreparabel veränderte. Es geschah an einem Sommertag, kaum anders als dieser. Und in einem Wald, der genau so war wie dieser.
Lucia vor allem hat sich davon nicht erholt. Sie war am meisten davon betroffen. Bis zum heutigen Tag trägt sie die dunkle Energie dieses Ereignisses in sich, und deshalb hat Matilda sie nicht gebeten, mit herauszukommen. Sie muss beschützt werden vor der Unfassbarkeit dessen, was da in den Bäumen ist.
»War das so, als du es gefunden hast?« Oliver steht auf der Lichtung und stützt sich mit einer Hand gegen den Stamm eines Holunderbaums. Der plötzliche Gang und der Schock haben Furchen in sein Gesicht gegraben. »Ja?«
»Ja. Ich wollte das Laub zusammenharken, und ich …« Sie spricht nicht weiter. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. »Ich konnte nicht glauben, was ich sehe.«
»Das ist Zufall. Reiner Zufall.«
»Zufall?«, wiederholt sie. »Was soll das für ein Zufall sein, Oliver?«
»Ein Tier hat etwas gerissen – es hat sich einfach so ergeben, dass es …« Er wedelt mit unbestimmter Handbewegung zum Gebüsch hinüber und bemüht sich, barsch und souverän zu klingen, aber er sieht aus, als wollte er sich jeden Augenblick übergeben. »Dass es am Ende so aussieht.«
»Was für ein Tier wäre denn groß genug, hoch genug, um so etwas …«
»Mum?«
Matilda verstummt. Hinter Ollie steht schüchtern Lucia mit schwarzem T-Shirt und weißer Haut am Rand des Gehölzes. Es ist heiß da draußen, aber sie trägt Ollies alte Barbour-Jacke, als wäre ihr kalt. Sie ertrinkt darin; die Jacke reicht ihr bis an die Knie.
»Dad?«
Oliver löst sich schwankend vom Baumstamm und dreht sich unbeholfen um. »Lucia.« Mit mühsamen Schritten geht er über den Weg auf sie zu und deutet mit seinem Stock auf sie. »Hab dich nicht gesehen. Lass uns zum Haus zurückgehen.«
»Was ist hier los?«
»Nichts.« Oliver streckt eine Hand aus, um ihr die Sicht zu verdecken und sie zurückzutreiben. »Gar nichts. Geh zurück, und mach mit deinem Kram weiter.«
»Stimmt doch gar nicht.« Sie will an ihm vorbeigehen und reckt den Hals, um zu sehen, was da auf der Lichtung ist. »Ich kenne dich, Dad. Du lügst.«
Matilda kommt herüber und will ihr die Sicht versperren. »Lucia, Schatz, geh doch ins Haus, und nimm den Kuchen aus dem Ofen. Er verbrennt sonst.«
Aber Lucia hat es schon gesehen. »Oh«, sagt sie und legt die Hand auf den Mund. »O nein.«
Matilda nimmt ihre Tochter bei den Schultern und dreht sie mit sanfter Gewalt zum Haus um. »Hör zu. Tu, was ich dir gesagt habe. Geh ins Haus, und nimm den Kuchen aus dem Ofen. Dein Dad und ich kümmern uns um alles hier draußen. Es ist nicht so, wie es aussieht. In Ordnung? Lucia? Ist das in Ordnung?«
Die Haut um Lucias Mund ist blau. Nach einer ganzen Weile nickt sie wie betäubt. Steif macht sie einen Schritt zum Haus, dann noch einen. Ihr Kopf ist gesenkt, ihre Beine sind ungelenk und nicht koordiniert. Als Matilda sie weggehen sieht, spürt sie die vertrauten Gewissensbisse … als habe sie ihre Tochter irgendwie im Stich gelassen. Vielleicht geht es jeder Mutter so mit einem Kind, das dafür prädestiniert ist, ihr Sorgen zu machen. Für Matilda ist es nicht Kiran, sondern Lucia: Sie ist anscheinend außerstande, ihren Platz im Leben zu finden. Die von ihr angefangenen und wieder aufgegebenen Laufbahnen kann man gar nicht mehr zählen: Gerade tritt sie noch mit einer Punkband auf, und im nächsten Augenblick entwirft sie Kleidung für einen Goth Store, und was ihre Männerbeziehungen angeht – na ja, die wechseln in einem Tempo, bei dem Matilda schwindlig wird. Jedes Mal, wenn ein Job oder eine Affäre zu Ende geht, kommt Lucia nach Haus gehumpelt, um ihre Wunden zu lecken. Seit zwei Monaten ist sie bei ihnen, und natürlich führt das Schicksal sie ausgerechnet jetzt hierher.
Matilda schaut zum Haus hinauf. Die dunklen Mauern sind aus dem heimischen Blauschiefer erbaut. Es hat vier Geschosse, einschließlich der mächtigen Türme, die der zweite Besitzer um 1890 hinzugefügt hat und die dem Haus seinen Namen gaben: The Turrets. Dunkel wie eine Krähe. Mein Gott, denkt sie, sie hätten das Anwesen verkaufen sollen, als das alles passierte. Aber vor fünfzehn Jahren gab es in der ganzen Gegend kein Anwesen, das sich hätte verkaufen oder auch nur verschenken lassen. Die Leute waren abergläubisch und hatten Angst. Nichts hätte sie verleiten können, hier herauszuziehen, schon gar nicht in ein so abgelegenes Haus wie The Turrets. Wie lange braucht der Rettungsdienst, um herzukommen?, fragten sie. Man braucht sich nur die Zufahrt anzusehen – die ist doch sicher mehr als eine halbe Meile lang. Und die nächste Polizeiwache ist in Compton Martin.
Lucia öffnet die Hintertür und schlägt sie wieder zu. Das Geräusch durchdringt die Stille. Weder Matilda noch Oliver sagt ein Wort. Irgendwo singt ein Vogel, und die Zweige rascheln im Wind.
Als Matilda schließlich sicher ist, dass Lucia nicht zurückkommt, dreht sie sich um und starrt die Abscheulichkeit an, die mit Pflanzenteilen und Erde vermischt und überzogen ist. Angesichts der glänzenden Patina schätzt sie, dass sie schon seit einer Weile hier ist, mehr als ein paar Stunden, schon halb vertrocknet in der Hitze. Schmeißfliegen landen darauf und bleiben sitzen. Wahrscheinlich legen sie Eier, denkt Matilda.
Oliver reibt sich die Nase. »Ich glaube, wir nehmen das zu wichtig.«
»Wirklich?«
»Wir wissen, dass er nicht zurückkommen kann.«
»Wissen wir das, Oliver? Bist du da so sicher?«
»Natürlich bin ich sicher.«
»Wissen wir denn, dass sie ihn nicht freigelassen haben? Ich meine, ich habe mich in letzter Zeit nicht darum gekümmert. Du etwa?«
Oliver brummelt verärgert etwas von anderen Dingen, die er im Kopf habe. Ihm fehle die Zeit, sich über Häftlinge zu informieren. »Er kann nicht frei sein, da bin ich sicher. Das hätte man uns gesagt. Und alle würden darüber reden.«
»Na, dann ist es gut.« Sie nimmt die Harke, die am Baum lehnt, und wendet sich zum Haus. »Dann ist es gut, und natürlich glaube ich dir. Aber die Polizei rufe ich trotzdem an.«
Wald der Einkehr
Fünfzehn Meilen weiter östlich ist das Wetter unruhiger. Kleine Wolken drängen rastlos über den Himmel. Die Sonne blitzt auf und verschwindet wieder, und vereinzelte Regenschauer ziehen sich durch den Tag. Das ländliche West Wiltshire vibriert vom Gesang der Vögel und dem neuen, beißenden Grün des Monats Mai. In einem kleinen Wäldchen auf einer ansonsten verlassenen Anhöhe sind fast hundert Leute versammelt. Eine Frau im mittleren Alter – sie trägt hohe Bleistiftabsätze, ein Minikleid und einen schwarzen Schleierhut – steht auf einer mit Bändern geschmückten Plattform wie auf einer Bühne. Es sieht aus, als kämpfe sie mit den Tränen, während sie den wartenden Journalisten eine Rede hält.
»Viele Menschen kommen hierher, nur um über ihr Leben und solche Dinge nachzudenken.« Sie breitet die Arme aus und deutet auf das Wäldchen, in dem sie stehen, auf Girlanden, Fahnen und Büfetttische. »Für sie ist es ein Ort, an dem sie wirklich gründlich über alles nachdenken können, was auf ihrer persönlichen Reise geschieht, und deshalb haben die Klinik und ich beschlossen, diesem Ort einen Namen zu geben. Wir nennen ihn den Wald der Einkehr.«
Die Zuhörer murmeln beifällig. Die Kameras klicken.
»Ja«, sagt sie. »Der Wald der Einkehr. Und ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken, Ihnen allen, die Sie geholfen haben, es zu verwirklichen. Meiner schönen Tochter hätte es alles bedeutet, zu wissen, dass andere Menschen aus ihrer tragischen Geschichte etwas gewinnen können. Es ist wunderbar, ein wenig zurückgeben zu können.«
Die Frau ist Jacqui Kitson. Vor zwei Jahren ist ihre zweiundzwanzigjährige Tochter, damals ein Promisternchen, aus der Rehaklinik verschwunden, die eine Meile weit von dieser Anhöhe entfernt liegt. Sie hat eine tödliche Mischung aus Medikamenten und Alkohol zu sich genommen, ist desorientiert kollabiert und an einer Stelle unter den Füßen der versammelten Journalisten gestorben. Ihr Leichnam wurde nach mehreren Monaten unter dem Laub entdeckt.
Jacqui Kitson hat dieses Trauma durchlebt und schließlich hinter sich gelassen. Danach hat sie fünfzehntausend Pfund an wohltätigen Spenden sammeln können, um im Namen der Klinik dieses Wäldchen zu kaufen, als Gedenkstätte für ihre Tochter und als Ort, den die Patienten der Klinik aufsuchen können, um ihre Einsamkeit und ihre Gedanken zu verarbeiten. Eine Pagode aus Weidengeflecht steht in der Mitte der Lichtung. In ihrer unteren Ebene sind Eingangsbogen herausgeschnitten, und im Innern kann man auf Bänken sitzen und über die Ebene von Wiltshire hinausblicken.
Zehn Patienten sind zu der Feierstunde gekommen. Sie tragen unterschiedliche Kleidung – Trainingsanzüge, Jeans und Truckermützen – und stehen ungeordnet um die Plattform herum. Die Klinikleitung ist auch erschienen: drei Frauen in Kostümen, die begierig darauf warten, zu den wartenden Journalisten zu sprechen. Nur ein Mann möchte sich nicht beteiligen. Ein Mann, der in einigem Abstand von der Versammlung im Schatten hoher Birken steht. Dort kann er zusehen, ohne mitzumachen.
DI Jack Caffery ist Mitte vierzig und Kriminalpolizist. Er ist aus Pflichtgefühl hier, um zu zeigen, dass die Polizei präsent ist, aber er tut sein Bestes, um nicht in das Spektakel hineingezogen zu werden. Ganz still steht er da, mit den Händen in den Taschen, und sieht zu, wie die Leute sich um Jacqui Kitson drängen. Sie lächelt, nickt und schüttelt Hände. Posiert für ein Foto mit einer der Klinikdirektorinnen. Sie heben ihre Gläser und stoßen für den Fotografen miteinander an. Aber in den Gläsern ist grüner Tee, kein Champagner, denn schließlich ist man hier, um dem Zugriff berauschender Drogen zu entkommen. Jemand bittet sie, sich in die Pagode zu setzen und fotografieren zu lassen. Sie tut es, ohne mit der Wimper zu zucken. Ihre Hände liegen sittsam auf den Knien, und sie hebt das Kinn und schaut zur Sonne.
Caffery ist ein erfahrener Polizist. Er hat Dinge gesehen, viele Dinge, und er war oft in Situationen, in denen er sich unwohl gefühlt hat. Doch noch nie hat er sich so sehr an einen anderen Ort gewünscht wie jetzt.
Bear
Die Anchor-Ferrers sind wieder im Haus. In unterdrückter Panik haben sie Türen und Fenster geschlossen. Lucia beobachtet Dad in der Diele. Er hat den Kopf gesenkt und versucht, mit einem Buttermesser das schnurlose Telefon aufzuhebeln und die Batterien zu wechseln. Er runzelt die Stirn, denn Mum hat versucht, die Polizei anzurufen, und unerklärlicherweise war die Leitung tot. Das Sonnenlicht fällt durch das große Buntglasfenster auf sein Gesicht. Juwelenhelles Grün und Rot verwandeln ihn in einen monströsen Harlekin, als wäre der Tag nicht so schon surreal genug.
Hier in der Küche ist Mum damit beschäftigt, Ordnung zu machen. Die Koffer sind ausgepackt, der Kuchen steht zum Abkühlen auf dem Drahtgitter, und ab und zu unterbricht Mum ihre Arbeit und streicht ihre Kleidung glatt, fast als ob sie Gäste erwartete.
Aber sie erwartet keine Gäste, denkt Lucia. Zumindest nicht solche, die kommen, um Kuchen zu essen.
»Lucia«, sagt Mum, »kümmere dich um Bear. Sie braucht ein bisschen Aufmerksamkeit.«
Lucia starrt ihre Mutter wie betäubt an. Sie möchte antworten, aber kein Laut kommt aus ihrem Mund. Es ist, als habe man ihr ein Betäubungsmittel gespritzt: Alle ihre Muskeln sind unbeweglich. Was da im Garten ist, sieht ganz so aus wie schon einmal. Ganz genau so und unentrinnbar. Sie weiß, wie die Szene aussehen soll – und sie kann sich denken, wer sie geschaffen hat –, aber jetzt, da sie ihr ausgesetzt war, erscheint das alles unerwartet und falsch.
»Lucia! Hast du nicht gehört?«
Mit Mühe bewegt Lucia die Augenlider. Sie versucht, den Blick auf Mums Gesicht zu konzentrieren, aber ihre Augen schauen immer wieder vorbei und hinaus zu den Sträuchern und dem Wald dahinter. Das Komische ist, die Bäume selbst schockieren sie am meisten. Ihre Normalität. Die Tatsache, dass sie sich nicht verändert oder reagiert haben, während alles andere ganz und gar falsch ist.
»Kümmere dich um Bear.« Mum wird ungeduldig. »Lucia. Bitte. Sorg dafür, dass sie aufhört zu bellen. Ich kann nicht klar denken.«
Die ganze Unruhe hat Bear unter dem Tisch nervös gemacht. Sie kläfft schrill und unzufrieden und zerrt an der Leine, sodass der Stuhl geräuschvoll über den Steinboden scharrt. Mit einem Ruck kommt Lucia zu sich. Es passiert. Es passiert wirklich.
Ihre Beine fühlen sich an wie Gummi, als sie durch die Küche geht. Schweiß dringt durch ihr T-Shirt. Bear dreht sich aufgeregt um sich selbst und verheddert sich in der Leine. Sie hätten ihr endlich einen Chip einsetzen lassen sollen, dann müsste sie hier nicht angebunden sein. Es ist schon vorgekommen, dass sie meilenweit weggelaufen ist, einmal sogar bis zum Golfplatz in Farrington. Als hätte sie immer gewusst, dass an diesem Ort etwas Übles haftet, obwohl sie zur Zeit der Morde auf dem Donkey Pitch noch gar nicht auf der Welt war.
»Schon gut, Bear.« Lucia hakt die Leine los und nimmt den Hund auf den Arm. Sie setzt sich auf die Fensterbank, drückt Bears drahtigen Körper an die Brust und bringt sie flüsternd zur Ruhe. »Es wird alles gut, ich versprech’s dir. Alles wird gut.«
Es bricht Lucia das Herz, dass Bear solche Angst hat. Sie liebt das kleine Tier mehr als alles auf der Welt, und die meiste Zeit glaubt sie, Bear ist das einzige Lebewesen, dem wirklich etwas an ihr liegt. Lucia mag oft schweigsam und düsterer Stimmung sein, aber dumm ist sie nicht, und ihr entgeht nicht viel. Sie weiß sehr wohl, dass sie nicht Mums und Dads Liebling ist – das hat sie ihr Leben lang gewusst. Und was die Dinge angeht, die vor fünfzehn Jahren passiert sind … tja, von diesen Wunden wird sie sich nie, niemals erholen.
Hugo … Hugo.
Niemals wird sie Hugo vergessen. Seit seinem Tod hat sie nichts und niemanden mehr gefahrlos lieben können außer diesem kleinen Hund.
Licht
Das große Buntglasfenster, das Oliver vor zwanzig Jahren über der Sängergalerie hat einbauen lassen, ist eine Hommage an die Familie Anchor-Ferrers. Es zeigt sie alle vier, Matilda, Oliver, Lucia und Kiran. Sie stehen auf einer kleinen Weltkugel, umgeben von Sonnenstrahlen, orange und gelb.
Oliver liebt das Licht – liebt es, ahnt Matilda, möglicherweise mehr als seine Familie. Er betet es an und betrachtet es in jeder wachen Stunde seines Lebens. Ihre Freundinnen sagen, das Licht koste wenigstens nichts, Golfspielen oder Fliegen mit einer einmotorigen Cessna oder Angeln in Peru dagegen – ja, das alles koste eine Menge Geld, und deshalb könne Matilda von Glück sagen. Trotzdem ist sie immer ein bisschen eifersüchtig auf das Licht. Sogar ihre Kinder sind nach ihm getauft – Kiran bedeutet Lichtstrahl, und Lucia klingt in den Ohren mancher Leute ein bisschen zu sehr wie Lucifer, um behaglich zu sein. Matilda war nie wirklich glücklich damit.
Das Fenster stellt die Familie wie Untertanen des Lichts und des Himmels dar. Der Himmel sieht aus wie etwas, das William Blake hätte malen können, glanzvoll und glorreich. Das Haus dahinter soll The Turrets darstellen, aber in Matildas Augen ist es eine klägliche und plumpe Abbildung. Ein Hund fehlt, und auch das ist falsch, denn im Leben der Familie hat es immer einen Hund gegeben. Und kein Garten. Nichts, das zeigen könnte, wer sie sind. Keine Blumen, die gepflückt werden, kein Kuchen, der gebacken wird.
Es ist dumm, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, denkt sie, denn nichts könnte weniger wichtig sein. Ollie steht unter dem Fenster und fummelt mit dem Telefon herum. Beunruhigenderweise hat es sich ausgerechnet diesen Augenblick ausgesucht, um kaputtzugehen. Lucia kauert auf der Fensterbank und drückt Bear an ihre Brust, und Matilda weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll. Sie hat bisher nicht mehr zustande gebracht, als hin und her zu gehen und Dinge von hier nach da zu schieben, um irgendwie Ordnung zu schaffen. Und sich zu vergewissern, dass Türen verriegelt und Fenster geschlossen sind.
»Sieh noch mal nach der Hintertür«, sagt sie zu Lucia. »Schieb auch den oberen Riegel vor.«
Lucia geht durch den kleinen Korridor, und man hört das Rattern der Riegel. Matilda erinnert sich nicht, ob die Haustür in der Diele verriegelt ist, aber als sie hingehen will, bleibt sie plötzlich stehen. Sie starrt auf den Boden, und ihr Herz schlägt leise und langsam. Da sind vier oder fünf bräunlich rote Tropfen, jeder geformt wie eine längliche Träne.
Sie kniet nieder und kratzt mit dem Daumennagel an dem größten. Schuppige Bröckchen bleiben an ihrem Daumen hängen. Sie hebt den Kopf und lässt den Blick umherwandern. Die Küche ist ein großer Anbau an der Seite des Hauses, mit einem kleinen Essbereich und einer Sitzecke am riesigen Kamin. Alles ist ihr vertraut und uralt, aber etwas stimmt nicht – nicht nur das, was da unten im Gehölz über den Ästen hängt, sondern auch etwas hier im Haus ist nicht in Ordnung. Ein Geruch? Ein leiser, ungewohnter Hauch? Und das hier? Sie zerreibt die Krümel zwischen Daumen und Zeigefinger, und sie lösen sich auf und färben die Linien ihrer Fingerkuppen. Blut? Ist das Blut? Nein, du lieber Gott, nein. Natürlich nicht, das kann nicht sein. Sie geht zur Spüle und wäscht sich die Hände. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen roten Tropfen – die alles Mögliche sein können, seien wir ehrlich, wirklich alles – und dem, was sie vorhin in den Bäumen gesehen hat. Oliver hat recht. Das da draußen gehört zu einem Tier, das von einem Raubtier gerissen worden ist. Etwas völlig Normales, und irgendeine andere Bedeutung darin zu sehen ist blanke Hysterie.
Energisch trocknet sie sich die Hände ab und beugt sich herunter und nach vorn, damit sie durch den Korridor in die große Diele schauen kann, wo Oliver immer noch mit dem Telefon hantiert. Wieso braucht er so lange? Es kann doch nicht mehr als zwei Minuten dauern, die Batterien zu wechseln.
Er hört auf mit dem Telefon, legt den Kopf zur Seite und sieht sie an. Sein Gesicht ist ganz aufgedunsen von den Medikamenten, und auf seiner Stirn ist eine einzelne blaue Ader, die Matilda noch nie aufgefallen ist. Als hätten die Ärzte ihm bei der Operation ein zusätzliches Blutgefäß verpasst.
Er hält das Telefon hoch. »Es funktioniert nicht«, sagt sein Mund lautlos, und sein Blick fragt: Was soll ich tun? Passiert das alles wirklich?
Matilda reagiert nicht. Lucia ist wieder hereingekommen, und sie darf nicht in Panik geraten. Aber innerlich schreit Matilda. Das Telefon ist hier ihre einzige Rettungsleine. Als die Ärzte endlich gestatteten, Ollie dürfe London verlassen, wollten sie wissen, ob er schnell ein Krankenhaus erreichen könne, da The Turrets doch sehr abgelegen sei. Matilda sagte, sie könne ihn nach Wells fahren oder einen Krankenwagen rufen. Ein Mobilfunknetz gibt es hier nicht, aber ein tadelloses Festnetz, mit dem es noch nie ein Problem gegeben hat. Bis jetzt.
Matilda hat ein kleines Auto, das in der verschlossenen Garage steht, aber der Schlüssel liegt in Olivers Arbeitszimmer auf der anderen Seite des Hauses. Der Land Rover, ihr Londoner Wagen, parkt unten in der Zufahrt. Mit dem geht es schneller. Sie geht in die Schmutzdiele, schiebt die Hände in die Taschen der Regenjacke, die dort hängt, und wühlt nach dem Schlüssel für den Land Rover und nach ihrem Handy. Unten, am Ende der Zufahrt, gibt es ein schwaches Mobilfunksignal. Sie kann hinunterfahren und die Polizei anrufen. Aber der Schlüssel ist nicht in der Regenjacke. Vielleicht ist er in ihrer Handtasche auf dem Stuhl in der Diele.
Sie geht wieder in die Küche und bleibt wie erstarrt stehen. Lucia auf der Fensterbank hat den Kopf gehoben, und ihr Mund steht ein wenig offen. Verblüfft starrt sie die beiden Männer an, die in der Küchentür erschienen sind. Oliver steht bei ihnen und sieht sie ratlos an. Das kaputte Telefon in seiner Hand ist vergessen. In der Diele hinter ihnen steht die Haustür offen.
Die Männer tragen dunkelgraue Anzüge und machen ernste Gesichter. Der eine ist klein und hat lange Arme, Sommersprossen und rötlich-blondes, kurz geschnittenes Haar wie ein Soldat. Er trägt eine schwarz umrandete Brille und steht ein bisschen unbeholfen da. Sein Blick schweift durch die Küche. Der andere wirkt ruhiger. Er ist groß und hat einen geraden Rücken, eine große Nase und sehr helle grüne Augen mit blonden Wimpern. Sein blondes Haar ist lockig, aber der Haaransatz ist so weit zurückgewichen, dass sein Schädel oben kahl und glänzend ist wie bei einem Mönch, sodass er aussieht wie der junge Art Garfunkel. Er hält einen Polizeiausweis in der Hand.
»Mrs Anchor-Ferrers?«, fragt er. »Detective Inspector Honey. Das ist Detective Sergeant Molina. Entschuldigen Sie, dass wir hier hereinplatzen – wir haben am Tor unten an der Zufahrt geklingelt, aber über die Sprechanlage hat sich niemand gemeldet, und deshalb mussten wir zu Fuß heraufkommen.«
»Nein«, sagt Matilda zurückhaltend. »Wir waren draußen im Garten.«
Sergeant Molina wechselt einen unbehaglichen Blick mit Detective Honey, und der räuspert sich und steckt seinen Ausweis ein. Er lächelt nicht.
»Erlauben Sie«, sagt er, »dass wir kurz mit Ihnen sprechen?«
Die Krankheit
Detective Inspector Caffery ist ein gut aussehender Mann, mittelgroß, glatt rasiert, mit kurz geschnittenem dunklen Haar. Und er ist ein leitender Officer in seiner Einheit, weshalb Journalisten oft und gern zu ihm kommen. Ihre Zuneigung erwidert er nicht. Er geht ihnen aus dem Weg, so gut er kann. Er hat immer noch nicht gelernt, ihnen zu geben, was sie haben wollen, und verabscheut ihre unaufrichtigen Spielchen. Aber heute hat die Reporterin ihn erwischt, bevor er entkommen konnte, und jetzt kann er nicht umhin, ihre Frage zu beantworten. »Wie sehen Sie und der Rest der Polizei den heutigen Tag?« Er antwortet kurz angebunden und beugt sich ein wenig vor, um in das kleine Mikrofon zu sprechen, das sie in der Hand hält. Er vermeidet es sorgfältig, ihr in die Augen zu schauen, damit sie die Lügen in den seinen nicht sehen kann.
»Mit gemischten Gefühlen. Natürlich sind wir zutiefst bestürzt über den Verlust, den die Familie erlitten hat, und darüber, dass wir die Suche nicht mit einem glücklicheren Ergebnis beenden konnten. Aber wenn ich jetzt sehe, wie Jacqui ihr Leben so positiv erneuert …« Er deutet auf die Lichtung und das versammelte Publikum. »Ich kann sagen, dass wir – also die Polizei – uns darüber freuen, dass die Familie wieder nach vorn schauen kann.«
»Glauben Sie, Jacqui hat damit abschließen können? Ich meine, die Leiche ihrer Tochter mag gefunden worden sein, aber noch immer weiß man nicht genau, was ihr zugestoßen ist.«
Caffery starrt sie an. Er kann den Ausdruck »abschließen« nicht ausstehen. Er denkt dabei an Rechtsanwälte und Kaufverträge. Sie sieht sein Zögern und drängt: »Hat sie abgeschlossen? Hat sie es geschafft?«
»Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was dieses Wort bedeutet. Vielen Dank.«
Er nickt, und statt auf ihre nächste Frage zu warten, zieht er sich wieder in den Schutz der Bäume zurück, wo er das Geschehen verfolgen kann, ohne reden zu müssen. Die Verblüffung über seine Unhöflichkeit verschlägt der Journalistin für einen Augenblick die Sprache. Er zieht sich weiter ins Gehölz zurück, was sie nicht dazu ermutigt, ihm zu folgen.
Dort im Schatten lehnt er sich an einen Baum, denn heute hat er Mühe, sich aufrecht zu halten. Caffery ist krank. Seit zwei Wochen plagen ihn Kopfschmerzen von der Sorte, die sich durch Schmerzmittel nicht lindern lässt. Er kann nicht schlafen, und wenn es ihm gelegentlich doch gelingt, träumt er davon, gefesselt zu sein oder in Schlamm oder Treibsand zu versinken. Er war noch nicht beim Arzt – er weiß nicht einmal, wer sein Hausarzt ist –, aber er weiß auch, dass er keine Diagnose bekommen wird. Die Kopfschmerzen haben keine körperliche Wurzel, da ist er sich sicher. Ihre Ursache liegt tiefer, sie ist etwas Ungreifbares, das er nicht genau benennen kann. Jacqui Kitson zuzuhören, wie sie über ihre Tochter redet, wird den Druck in seinem Kopf verschlimmern, das ist ihm klar.
Die Reporterin hat es anscheinend aufgegeben, ihn zu verfolgen. Sie hat sich an Jacqui Kitson herangemacht, die im Gegensatz zu ihm offenbar sehr bereitwillig mit ihr spricht. Sie spult dieselbe alte Geschichte ab: wie furchtbar die Monate waren, in denen ihre Tochter verschollen war, und wie qualvoll es war, nicht zu wissen, was passiert ist. Bei jedem Satz, den sie spricht, zucken Cafferys Hände in den Hosentaschen. In Wahrheit weiß er mehr über Misty Kitsons Verschwinden als irgendjemand sonst. Er ist der ermittelnde Polizist, und es gibt Dinge bei diesem Fall, die niemand je erfahren wird, und Lügenmärchen über das wahre Geschehen, das niemals ans Licht kommen wird. Aber nicht das bedrückt ihn heute, sondern etwas, das tiefer reicht. Jacquis Auftreten und ihre Worte haben etwas an sich, das in seinem Kopf wie Sandpapier scheuert. Jedes Mal, wenn sie den Mund öffnet, verstärkt sich die Anspannung.
Er löst sich von dem Baumstamm und schlurft ein paar Schritte weiter in den Wald hinein, nur um in Bewegung zu bleiben und ein bisschen Leben in seinen Körper zu bringen. Aber es hilft nichts. Er ist müde. So müde.
Minnet Kable
Oliver ist zwar Naturwissenschaftler, aber Physiker, kein Biologe, und deshalb weiß er nicht, ob er wirklich versteht, was in seinem Körper vor sich geht. Ihm fällt auf, dass seine Gedanken seit der Operation langsamer geworden sind. Manchmal ist es wie in einem Traum – als sprächen Leute aus einem anderen Zimmer mit ihm. Als der Türknauf der Haustür sich drehte, die Tür aufging und der Größere der beiden den Kopf hereinstreckte und zu ihm in die Diele spähte, hatte er Mühe zu begreifen, wie sie hergekommen waren. Wer hatte sie gerufen? Er war es sicher nicht gewesen, denn das Telefon funktionierte nicht.
Die Männer sagen, sie sind hier, weil sie in einem Mordfall ermitteln.
»Waren Sie den ganzen Vormittag hier im Haus?«
DI Honey, der große Mann mit dem Mönchsschädel und den straffen Locken, befragt Matilda, und sie antwortet mechanisch und in abwesendem Ton, als rezitiere sie ein lange vergessenes Gedicht, das ihr plötzlich wieder eingefallen ist.
»Nein, wir sind erst nach elf gekommen. Das hier ist unser Ferienhaus. Wir sind heute Morgen aus London gekommen.«
»Sie haben die Sirenen nicht gehört?«
»Nein. Aber wir hören hier oben nichts. Es ist sehr abgelegen.«
»Das Opfer wohnte hier unten im Tal.« Er hebt die Hand und zeigt nach Westen. »Da unten, nicht weit vom Ende Ihrer Zufahrt entfernt. Das Haus steht da, wo der Weg auf die Hauptstraße stößt.«
»Meinen Sie das gelbe Haus? Das mit den Kacheln und den gelben Wänden?«
»Genau.«
»Mein Gott. Oliver? Es ist das mit der Satellitenschüssel. Weißt du?«
Er nickt wie betäubt, und noch immer bemüht er sich, mit der Realität Schritt zu halten. In dem gelben Haus wohnt eine alleinstehende Frau. Wie sie heißt, weiß er nicht, aber er hat sie schon gesehen. Brünett, Mitte vierzig, ziemlich attraktiv. Hauptsächlich erinnert er sich daran, dass sie rote Jeans und Lederjacken trug wie eine Großstadtbewohnerin und mit ihrem Geländewagen beharrlich in der Straßenmitte fuhr – als sollten alle anderen ihr ausweichen, um sie vorbeizulassen.
»Der Täter ist durch das … durch das untere Fenster gekommen. Es stand offen.«
DS Molina – der Rothaarige, der Oliver an irgendjemanden erinnert, an einen Politiker oder einen Popsänger, er weiß es nicht genau – legt die Hände auf eine Stuhllehne. Er sieht aus, als wolle er eine einstudierte Rede halten. »Wir werden ein paar Verhaltensregeln mit Ihnen besprechen müssen, und der Bürgerkontaktbeauftragte wird herkommen und Sie mit ein paar grundlegenden Gebäudesicherungsmaßnahmen vertraut machen. Wenn dies ein Ferienhaus ist, wäre es sowieso nützlich, über Fensterverriegelungen und dergleichen Bescheid zu wissen.«
»Zuerst müssen Sie uns sagen, was passiert ist«, antwortet Matilda entschieden. »Und ob Sie jemanden festgenommen haben.«
»Bevor wir das Opfer zweifelsfrei identifiziert und die Angehörigen informiert haben, können wir keine Einzelheiten preisgeben.«
Oliver hat seine Stimme wiedergefunden. »Bei einer Mordermittlung würde ich mehr Personal erwarten – besonders, wenn der Täter noch auf freiem Fuß ist. Vielleicht auch einen Hubschrauber.«
»Ein Hubschrauber war unterwegs – haben Sie ihn nicht gehört?«
»Mum hat doch gesagt, wir hören hier oben nichts«, sagt Lucia, und sie schafft es, dass ihre Worte wie ein Angriff gegen ihre Eltern klingen. »Überhaupt nichts.«
»Wir befragen die Leute, ob bei ihnen eingebrochen worden ist – oder ob irgendetwas verschwunden ist. Haben Sie einen Gartenschuppen?«
»Einen Gartenschuppen? Ja. Und eine Garage.«
»Abschließbar? Und haben Sie heute nachgesehen, ob sie abgeschlossen sind? Vielleicht ist etwas verschwunden? Werkzeug. Zum Beispiel ein Teppichmesser …«
Ein Teppichmesser. Lang anhaltende, kalte Stille senkt sich auf die Familie. Das ist die endgültige Bestätigung. Jetzt wissen sie, dass sie sich nichts eingebildet haben. Das alles passiert wirklich.
Weiterschlagen, befiehlt Oliver den Schweineherzklappen. Der nächste Schlag. Und der übernächste …
»Sie sollten sich wirklich entschuldigen!« Matilda ist plötzlich knallrot im Gesicht vor Wut und Verwunderung. »Oder war es das? Eine verspätete Entschuldigung?«
Honey antwortet nicht sofort. Er ist verwirrt. Hilfesuchend sieht er seinen Sergeant und dann Lucia und Oliver an. »Verzeihung«, sagt er. »Ich weiß nicht …«
»Wo sind die Informationen vom Strafverfolgungsdienst geblieben? Der Strafverfolgungsdienst hat uns mitzuteilen, wenn es Änderungen oder Revisionen an der Verurteilung dieses Mannes gibt. Man hat uns zu informieren, wenn er aus der Haft entlassen wird.«
»Verzeihung – ›dieser Mann‹? Ich weiß nicht …«
»Weil meine Tochter als gefährdet gilt. Sie war erst fünfzehn, als es passiert ist – fünfzehn. Mein Mann und ich haben die gleichen Rechte wie ein Familienangehöriger. Wir haben ein Recht darauf, in Kenntnis gesetzt zu werden, wenn er entlassen wird, und niemand hat uns ein Wort gesagt.«
»Mrs …«
»Sehen Sie meine Tochter an.« Sie deutet zu Lucia hinüber, die mit Bear auf dem Sofa sitzt. Der kleine Hund spürt die angespannte Atmosphäre und knurrt bedrohlich. »Sehen Sie sie an, und erzählen Sie mir, sie hätte keine Warnung verdient. Und mein Mann hat eine schwere Operation hinter sich. Wir sind also nicht gerade in der besten Verfassung für so etwas. Und unterdessen ist er – ER – uns um Lichtjahre voraus, wie immer. Er hat die Telefonleitung durchgeschnitten oder sonst etwas getan – jedenfalls funktioniert das Telefon nicht. Sie kommen also ein bisschen zu spät. Man hätte uns längst informieren müssen. Das Mindeste wären zehn Tage gewesen. Aber nein. Kein Wort. Und jetzt das …«
DI Honey hebt abwehrend die Hand. »Hören Sie, es tut mir leid, Mrs Anchor-Ferrers. Ich kann hören, dass Sie verärgert sind, und ich möchte gern darauf reagieren, aber solange ich nicht weiß, worüber Sie verärgert sind, kann ich nichts tun.«
Das bringt Matilda ein wenig zur Besinnung. Sie lässt ihn nicht aus den Augen, aber sie weicht ein kleines Stück zurück und lässt ihm Raum.
»Kable«, knurrt sie erbost.
»Kable?«
»Ja, selbstverständlich! Ich meine, bitte sagen Sie mir, Sie wissen, dass Minnet Kable der Täter ist. Er ist wieder draußen, ja? Und niemand hat es uns gesagt.«
Darauf folgt eine lange, atemlose Stille. Oliver sieht, dass Lucia die Augen geschlossen hat, und er weiß, warum. Es war das erste Mal in den letzten vierzig frenetischen Minuten, dass einer von ihnen den Namen tatsächlich laut ausgesprochen hat, obwohl sie alle daran gedacht haben. Es ist, als spräche man den Namen des Teufels aus.
Minnet Kable. Minnet. Mit Betonung auf der ersten Silbe. In diesem Haushalt wird der Name sonst niemals ausgesprochen.
Minnet ist ein weißer Brite, und die Anchor-Ferrers haben keine Ahnung, warum er einen solchen Namen trägt. In den Gerichtsunterlagen gibt es keinen Hinweis auf seine Herkunft. Ollie ist nicht im multikulturellen England von heute aufgewachsen, und es ist ihm peinlich, sich selbst gegenüber zuzugeben, dass der Name irgendwie guttural klingt, wie ein aramäischer Fluch. Etwas, das ein Dämon in einem Film sagen würde. Und Kable ist ein Dämon. Vor fünfzehn Jahren hat Minnet Kable zwei Menschen ermordet. Einer davon war Lucias Exfreund Hugo Frink.
DI Honeys Blick wandert langsam zu seinem Kollegen, als habe er das alles nicht geahnt. Als erwarte er eine Antwort. Schließlich schiebt er die Hände in die Taschen und schaut zu Boden. »Ja«, sagt er schließlich, »ich muss zugeben, daran hatte ich nicht gedacht …« Er wirft DS Molina einen Blick zu. »Ich glaube nicht, dass Sie sich an Minnet Kable erinnern. Das war, bevor Sie zur Polizei gekommen sind.«
Molinas Augen sind geweitet, als reiße sein Puls sie auf. »Doch, ich erinnere mich an ihn. Ich meine – Herrgott!« Er fährt sich mit einem Finger nervös unter dem Kragen herum. »Erinnert sich nicht jeder?«
Oliver schüttelt resigniert den Kopf. Das soll nun eine moderne Polizei sein. Er hat in der Dritten Welt schon effizientere Polizeibehörden gesehen. »Sie haben ernsthaft noch nicht an Minnet Kable gedacht?«
»Nein. Obwohl ich zugeben muss, dass es naheliegend scheint.«
»Sie müssen mit hinauskommen.« Oliver spricht so beherrscht, wie er nur kann. »Es gibt da etwas, das Sie sehen müssen.«
Das Reh