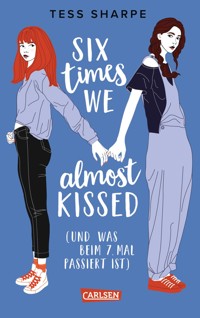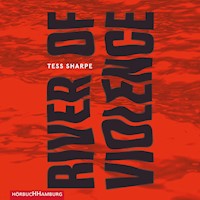
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TIDE exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: dtv bold
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
#workknifebalance Harley ist acht, als sie ihrem Vater das erste Mal dabei zusieht, wie er einen Widersacher abknallt. Der Drogenbaron hat mehr Waffen geschmuggelt, mehr Meth gekocht, mehr Männer getötet, als irgendwer anders in der Gegend. Nun, da sie erwachsen ist, arbeitet Harley für ihn, stützt sein System und wird als seine Nachfolgerin gehandelt, obwohl sie den ewigen Kreislauf aus Mord, Leid und Rache hasst und durchbrechen möchte. Gleichzeitig tritt die mächtige Springfield-Familie auf den Plan, Dukes größte Konkurrenz im Drogengeschäft, und inmitten dieses blutigen Revierkampes muss Harley sich entscheiden: Für die Familie, ihren Vater, das System – oder für ihr Leben und ihre Freiheit.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tess Sharpe
River of Violence
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Beate Schäfer
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
FÜR MEINE MUTTER, die mich in der roten Erde Wurzeln schlagen ließ.
UND FÜR MEINEN MANN, der entschieden hat, hier weiter mit mir zu wachsen.
TEIL EINSDER TRAILER IM WALD
EINS
Ich bin acht, als ich zum ersten Mal erlebe, wie mein Daddy einen Mann umbringt.
Ich soll es natürlich nicht sehen. Aber in den ersten Wochen nach Mommas Tod streune ich wild durch die Gegend, sobald mich Onkel Jake aus den Augen lässt.
Die meiste Zeit verbringe ich im Wald, spiele oben in den Hochsitzen oder probiere aus, wie weit ich auf Bäume hinaufklettern kann, wenn keiner mir hilft. Manchmal weine ich, weil Momma mir so fehlt, ich kann einfach nicht anders.
Aber wenn Daddy dabei ist, lasse ich es lieber.
Ich mag den Wald. Dort ist es still und laut zugleich. Die Waldgeräusche gehören zu meinem Leben – seit ich denken kann, haben sie mich in den Schlaf gewiegt. Wenn ich auf die großen Eichen klettere, mich mit aller Kraft hochziehe, nach starken Ästen greife und wie ein Eichhörnchen in den Baumkronen herumturne, muss ich verdammt gut aufpassen, damit ich nicht abrutsche. Dann vergesse ich, dass Momma tot ist. Und dass Daddy nur noch in einer Whiskey-Wolke durch die Gegend stürmt, seine Waffen putzt und über die Springfields flucht. Und dauernd sagt er, dass Blut fließen muss.
Momma ist vor dreieinhalb Wochen gestorben. Seitdem ist die Haut an meinen Handflächen ganz rau geworden vom vielen Klettern. Meine Knie sind voller Schorf, nachdem ich unten beim kleinen Fluss aus dem Redwoodbaum gefallen bin. Brombeeren haben meine Finger blau verfärbt und Dornen meine Arme zerkratzt. Meine Taschen beulen sich von all den Schätzen, die ich im Wald gefunden habe – lauter Sachen, die ihr gefallen hätten: Federn von Blauhähern und flache, geschmeidige Steine, die wunderbar übers Wasser springen würden, eine aufgeplatzte Eichel in der Form eines Gesichts.
Ich verstaue diese Waldgeschenke in einem Hochsitz. Onkel Jake will mich zu Mommas Grab mitnehmen, das hat er mir versprochen, obwohl Daddy gleich wieder böse geguckt hat. Ich will ihr unbedingt meine Schätze bringen, Onkel Jake hat nämlich gesagt, sie ist jetzt im Himmel und schaut uns von oben zu.
Manchmal betrachte ich den Himmel und versuche mir das vorzustellen. Und sie zu sehen.
Aber da oben sind bloß Äste und Sterne.
Daddy merkt gar nicht, wie viel ich weg bin. Er hat anderes im Sinn.
An dem Abend, um den es geht, habe ich lange in die untergehende Sonne geschaut und im Nachthimmel nach Spuren von Momma gesucht. Ich hocke immer noch oben in der Eiche am Rand unseres Gartens – die mit dem langen, starken Ast, auf dem man so gut sitzen kann. Es ist schon spät und ich sollte reingehen, aber da höre ich, wie sich die Reifen eines Pick-ups in den Schotter der unbefestigten Straße graben, die durch den Wald zu unserem Haus führt. Schnell ziehe ich die Füße hoch ins Dunkle, bevor Daddys Chevy um die Kurve kommt und die Scheinwerfer den Garten in helles Licht tauchen.
Ich presse die Fußsohlen gegen den Baumstamm, rutsche auf dem Bauch den Ast entlang nach vorne und recke den Kopf, damit ich besser sehen kann.
Kann gut sein, dass er wieder mal betrunken ist. Dann soll er mich besser nicht zu Gesicht kriegen. Ich sehe ihr nämlich so ähnlich und das macht ihn traurig. Manchmal auch wütend, aber dann versucht er, mich das nicht merken zu lassen.
Statt wie sonst vor dem Haus anzuhalten, fährt Daddy auf dem Holperweg unter dem Baum durch zur Scheune und hält direkt vor dem Tor. Der Bewegungsmelder reagiert sofort, das Scheunenlicht geht an.
Aus der Entfernung beobachte ich, wie die Scheinwerfer ausgehen und er aus dem Wagen steigt. Immerhin hat er nicht so viel getrunken, dass er taumelt, aber vielleicht hat er seine Sachen trotzdem vollgekotzt, so wie letzte Woche, das kann ich von hier aus nicht erkennen. Ich will schon vom Baum klettern, da sehe ich, dass er nicht zum Haus geht, sondern rüber zur Beifahrertür, die er mit einem Ruck aufzieht.
Ich blinzele durch die Dunkelheit. Jetzt ist er im Schatten und kaum mehr zu sehen, aber er hievt irgendwas Großes aus dem Wagen. Als er das Scheunentor öffnet, tritt er für einen Moment lang ins Licht. Ein Schein fällt auf die Schwelle und kurz kann ich Männerfüße sehen, die über den Scheunenboden gezerrt werden. Dann knallt das Tor zu.
Mein Atem geht schnell und hart, drückt meinen Bauch gegen die raue Rinde. Meine Finger krallen sich um den Ast, mein Herz hämmert, alles dreht sich. Ich wünsche mir eine Höhlung im Stamm der Eiche, will mich verstecken wie ein Specht oder ein Eichhörnchen.
Ich versuche mir einzureden, ich hätte mich getäuscht.
Aber tief drinnen weiß ich es besser.
Ein paar Minuten später – es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, mein Atem und das Grillengezirpe hallen mir in den Ohren – geht das Licht vor dem Scheunentor aus. Finsternis kriecht durch die Bäume, breitet sich überall aus.
Ich könnte jetzt runterklettern, in mein Zimmer rennen, die Tür zumachen, mir die Bettdecke über den Kopf ziehen und so tun, als hätte ich nie gesehen, wie diese Füße über den Boden geschleift sind.
Aber das tue ich nicht.
Stattdessen klettere ich vom Baum und gehe auf die Scheune zu.
Es wäre leicht, im Nachhinein zu behaupten, dass diese Entscheidung ein Fehler war, aber das ist Unsinn.
Auf irgendeine Art musste ich es ja erfahren. Was er war. Und was ich werden würde.
Das hier ist eben meine Art gewesen.
Ich schleiche also zur Rückseite der Scheune, wo lauter Astlöcher in den Zedernholzbrettern sind. Man sieht kaum etwas durch diese Dinger, aber besser geht es nicht. Ich knie mich hin, sodass ich durch das größte Loch spähen kann, das ich finde. Mein Atem geht immer noch keuchend, das Herz pocht kaninchenschnell in meiner Brust und mein Mund ist trocken.
Zuerst sehe ich Daddy gar nicht. Da ist nur der alte Traktor, der seit Ewigkeiten hier rumsteht, und der Quad, den Daddy letztes Jahr geschrottet hat. An einem Balken hängt eine kahle Glühbirne. Ich beobachte, wie sie an ihrem orangen Kabel ein wenig hin und her schwingt, und auf einmal höre ich sie – seine Stimme.
»Du sagst mir jetzt, was ich wissen will«, fordert Daddy. Ich höre ihn rumkramen, anscheinend holt er etwas aus der Werkzeugkiste.
Nach ein paar Sekunden taucht er in meinem Blickfeld auf, einen Schraubenzieher in der Hand. Lange Schatten fallen über ihn, während er sich von meinem Versteck entfernt und den Schraubenzieher dabei immer wieder in der Hand dreht. Dann verschwindet er hinter dem Traktor, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ein Stöhnen erfüllt die Luft.
Es kommt nicht von Daddy.
Sondern von dem Mann, den er hierhergebracht hat. Wer immer das ist, er stöhnt vor Schmerz.
Daddy tut ihm weh.
Dass Daddys Hände, die so groß und stark und schwielig sind und mich so gut umarmen und an den Zöpfen ziehen können, einem Menschen wehtun, ist eine seltsame Vorstellung.
»Du sagst mir, was ich wissen will«, wiederholt Daddy. »Freiwillig oder auf die harte Tour. Deine Entscheidung, Ben.«
»Fick dich«, keucht die zweite Stimme – die von Ben.
»Spuck’s aus.«
»Scheiße, ich sag dir gar nichts.« Ein feuchtes Geräusch, irgendwas zwischen Husten und Würgen. Kommt da Spucke hoch oder eher Blut?
»Wie du willst«, sagt Daddy. Verschwommene Schatten strecken sich über den Traktor, ich sehe einen Arm vorschießen, schnell und entschieden. Und dann dieses Geräusch, ein heftiges Aufstöhnen mit zusammengebissenen Zähnen, so grässlich, dass sich mir die Nackenhaare aufstellen.
»Der bleibt drin, bis du ausspuckst, was ich wissen will«, sagt Daddy und ich begreife, dass er den Schraubenzieher meint.
Schwarze Punkte tanzen vor meinen Augen. Ich muss mich mit beiden Händen auf dem Boden abstützen. Wenn ich mich nicht zusammenreiße und ganz langsam atme, kippe ich garantiert um. Meine Augäpfel fühlen sich an, als würden sie gleich rausspringen, mein Gesicht ist fest an das raue Brett gepresst. Ich will wegrennen. Aber ich muss hierbleiben und mitkriegen, was passiert.
»Sag’s mir«, wiederholt Daddy.
»Nein.«
Daddy richtet sich auf, ich kann ihn jetzt direkt sehen. Er greift in seine Hosentasche und zieht das Messer mit dem Geweihgriff heraus, das er jeden Sonntag schärft. Lässt die Klinge herausspringen – zwanzig Zentimeter tödlicher Stahl, der im Scheunenlicht aufblitzt – und prüft sie am Daumennagel. »Dann versuchen wir’s eben anders.«
Daddy kniet sich wieder hin und verschwindet aus meinem Blickfeld, aber ich sehe an dem verschwommenen Schatten seines Arms, wie er ausholt und zustößt.
Der Laut, der aus Ben kommt, ist diesmal noch schlimmer, keine zusammengebissenen Zähne, kein Versuch, den Schrei zu unterdrücken.
Ich mache die Augen nicht zu, verstecke nicht mein Gesicht, tue nichts von dem, was ich tun sollte.
Im Gegenteil, ich reiße die Augen weit auf.
Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal überhaupt so genau hinzusehen.
»Sag’s mir«, verlangt Daddy, als Bens Schrei zu einem Wimmern abebbt.
»Geht nicht«, keucht Ben. »Der macht mich kalt.«
»Ihr Springfields, ihr habt echt nicht viel Grips erwischt, was?«, spottet Daddy. »Was meinst du wohl, was ich mache, wenn du mir nicht sagst, wo er ist?«
»Bitte. Ich tue alles – Geld, Huren, Drogen, was immer du willst, Duke, ich …« Ein Aufbrüllen, aber ich kann nicht sehen, was Daddy ihm antut.
Ich presse die Lippen zusammen, um die aufsteigende Übelkeit wegzudrücken, und höre wieder Daddys Stimme: »Sag’s mir.« Er scheint nur noch diese beiden Wörter zu kennen.
»Angggghh«, lallt Ben und ringt um Luft. »Bitte. Bitte.«
»Sag’s mir.«
»Geht nicht. Carl ist mein Bruder.«
Bens linker Fuß zuckt, wie wenn er sich losreißen wollte. Ich sehe überhaupt nur seine Füße, der Rest ist hinter dem Traktor versteckt, und starre unentwegt seine Stiefel an. Daddy hat die gleichen. Momma hat sie ihm letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Ich hab ihr beim Einpacken geholfen.
»Sag mir, wo Springfield ist«, beharrt Daddy. »Oder ich schnapp mir Caroline. Was hältst du davon? Ist dir dein Bruder das wert? Hat ziemlich scharf ausgesehen, deine Frau, als ich sie neulich mal zu Gesicht gekriegt hab. Kann sein, ich lass mir Zeit.«
Ich bin zu jung, um zu begreifen, was er damit meint. Später, als ich es dann begreife, bin ich entsetzt. Und rede mir ein, er hätte nur geblufft. Ich will nicht glauben, dass er zu dieser Sorte Mann gehört. Aber vielleicht tut er das doch, die Möglichkeit steht greifbar vor mir.
»Nein«, sagt Ben schwach. »Nicht Caroline. Bitte.«
»Dann sag’s mir«, fordert Daddy. »Wenn du’s tust, lass ich sie in Ruhe und deine Jungs auch. Sie sind in Sicherheit vor mir und meinen Leuten. Ich will bloß Springfield.«
»Scheiße, Scheiße … Carl ist in Manton. Exit 34 am alten Highway. Das Haus hinten am Hell’s Pass. Aber lass verdammt noch mal die Finger von meiner Familie, du Scheißkerl!«
Daddy hebt sich von den Knien und rückt jetzt wieder in mein Blickfeld. »Danke.«
Er bewegt sich blitzschnell, so vertraut ist ihm der Griff. Seine Hände – und die Waffe – scheinen zu verschwimmen.
So laut, so furchtbar laut – der Schuss rammt sich regelrecht in meine Ohren, und dann ist da ein irgendwie matschiges Geräusch, bei dem es mir den Magen umdreht.
Ich will mir den Mund zuhalten, aber dafür ist es zu spät. Ich übergebe mich, Kotze läuft über mein Shirt, spritzt auf meine Haut. Die Gallegeruch lässt mich noch mehr würgen, und als ich versuche aufzustehen, versagen mir die Beine.
Ich muss ins Haus, bevor er mitkriegt, was ich gesehen habe. Aber meine Beine sind wie aus Gummi, und als ich mir die verklebten Haare aus dem Gesicht schiebe, spüre ich getrocknetes Salz auf meinen Wangen.
Ich will meine Momma so sehr hier haben, dass es wehtut und immer weiter wehtun wird, und allein schon der Gedanke an sie macht mich tapsig und dumm. Als ich mich aufrichte, trete ich gegen einen Stein, der mit einem lauten Knall gegen die Scheunenwand prallt.
Ich erstarre.
»Wer ist da?« Daddys Stimme dröhnt durch die Holzbretter. Seine Schritte bewegen sich rasch über den Boden, dann höre ich das Quietschen des Tors, als er es öffnet und nach draußen schaut.
Oh nein. Mein Magen verkrampft sich wieder. Am liebsten würde ich gleich weiterkotzen.
»Harley, wenn du das bist, hast du genau drei Sekunden, um Bescheid zu sagen. Sonst schieße ich. Eins …«, sagt Daddy.
Meine Gedanken rasen, fieberhaft versuche ich, alles zu begreifen.
Daddy hat ihn umgebracht. Und zwar so, als wäre das ganz leicht und hätte nichts weiter zu bedeuten.
Als täte er das nicht zum ersten Mal.
»Zwei.«
Was macht er mit der Leiche? Vergräbt er sie? Wo? Im Wald?
»Dr…«
»Ich bin’s!«, schreie ich. Mein Jeans sind verdreckt, mein Shirt ist feucht und voll Kotze. Meine Beine zittern, aber ich stürme trotzdem los, renne bis vor die Scheune.
Er steht am Eingang, Licht strömt heraus, mit einem Arm hält er das Tor immer noch offen.
Hinter ihm in der Scheune ist eine dunkle Blutlache, die schnell größer wird, und daneben das, was übrig ist von Bens Kopf. Sein Gesicht ist zur Seite gedreht, die Augen stehen weit offen, schauen mich an. Er wirkt durcheinander. Als hätte er gedacht, Daddy lässt ihn laufen.
Ich schlucke schwer.
Von Nahem ist es noch viel schlimmer.
Daddy betrachtet mich, die Neunmillimeter immer noch gezückt. Dann schaut er über seine Schulter auf Ben und die wachsende Blutlache. Er macht einen Schritt zur Seite, damit ich Bens Gesicht nicht mehr sehen kann. »Schätzchen«, setzt er an. »Wie lange …« Er bricht ab. »Liebling«, versucht er noch mal. »Ich …«
Ich starre weiter auf das Blut. Auch wenn ich Daddy schon beim Ausweiden von Jagdwild geholfen habe, so viel Blut habe ich noch nie gesehen. Es ist dunkel und dickflüssig wie Farbe. Aber es riecht ganz anders, scharf wie Kupfer, wie Leben, das im Boden versickert.
»Harley-Girl«, sagt Daddy mit der gleichen sanften Stimme, mit der er mir vor dem Einschlafen Geschichten vorliest.
Gleich muss ich wieder brechen. Doch ich beiße die Zähne zusammen und schaffe es diesmal, die aufsteigende Gallensäure runterzuschlucken. Ein wilder Kampf in meiner Kehle, der mir den Schweiß ins Gesicht treibt. Ich schwanke, und dann sind da auf einmal Daddys Hände, sie packen mich um die Taille. Mein Körper wird schlaff, ich wehre mich nicht.
Ich habe zu viel Angst vor dem, was dieser neue – nein, dieser alte, aber bisher verborgene Daddy tun würde, wenn ich es versuche.
Er trägt mich zum Haus und die Treppe hoch, ohne ein Wort zu sagen. Er setzt mich auf mein Bett und zieht mir die Stiefel aus; ich zittere vor mich hin und lasse ihn machen. Er tauscht mein vollgekotztes Shirt gegen eins von den Schlafhemden, dann drückt er vorsichtig meine Schulter und ich sinke auf das Bett. Ich sehe Bens leere Augen vor mir und schrecke vor Daddys Berührung zurück, zum ersten Mal in meinem Leben, aber er merkt es nicht. Ich erwarte eigentlich, dass er gleich geht, nachdem er mich zugedeckt hat, aber stattdessen bleibt er lange neben meinem Bett sitzen.
Erst als er aufsteht – Stunden später, kommt mir vor –, habe ich den Mut, es auszusprechen. Daddys Umriss zeichnet sich gegen das Licht im Flur ab, er will die Tür gerade zumachen, da platzt es aus mir heraus: »Er hat dir doch gesagt, was du wissen wolltest. Du musstest das nicht tun.«
Ich höre ihn seufzen, kann aber sein Gesicht nicht sehen, weil es im Schatten liegt. Er lehnt sich an den Türrahmen, drückt die Schulter dagegen. »Leben gegen Leben«, sagt er. »Anders geht’s nicht, Harley-Girl.«
Leben gegen Leben. Bens Leben gegen das von Momma.
»Du lässt Springfield also laufen?«, frage ich.
Daddy streicht sich durchs Haar. »Das kann ich nicht machen«, sagt er.
»Aber …«
»Er hat uns deine Momma genommen«, erinnert mich Daddy sanft.
Als ob ich das vergessen könnte.
»Aber du hast gesagt, du lässt seine Familie in Ruhe.«
Daddy richtet sich auf. Er wirkt riesig, wie ein Schatten. Sein Gesicht kann ich immer noch nicht sehen, aber was er sagt, höre ich nur zu gut. Drei Wörter, hart wie Schotter: »Das war gelogen.«
ZWEI
6. Juni, 7.00 Uhr
Jeden Morgen mache ich meine Runde. Ich nehme ein Gewehr mit, schließlich kann es jederzeit Probleme geben, mit Tieren oder mit Menschen. Alle paar Tage ändere ich die Route. Die kompletten zweihundertfünfzig Hektar kann ich sowieso nicht abdecken. Manchmal tue ich nichts weiter, als am nördlichen Zaun entlang zu patrouillieren, das Segeltuch klatscht mir dabei wie ein unablässiger Herzschlag gegen die Beine. Dukes Jacke ist viel zu groß für mich, aber ich trage sie trotzdem, die Ärmel dreimal umgeschlagen, um die Hände frei zu haben.
An diesem Morgen wandere ich tief in den Wald hinein, mit Busy an meiner Seite. Sie springt schwanzwedelnd vor mir her, ihre gedrungene Nase dicht am Waldboden, wo sie nach Spuren von Rotwild und Pumas sucht.
Ich gehe hinter ihr her, das Knacken von Zweigen und das Knistern der Kiefernnadeln unter meinen Stiefeln mischt sich mit dem heiseren Krächzen erwachender Elstern. Die Luft ist klar und frisch, das Gelände steigt steil an, mein Tritt ist fest und sicher. Jeder einzelne Schritt bringt mich näher, immer bergauf, und meine Sohlen graben sich in die rote Erde.
Was das Land angeht, die dichten Wälder und die Berge aus Vulkangestein, bin ich durch und durch Dukes Tochter. Ich kenne die Gegend so gut wie kein anderer außer Duke, weiß um ihre Gefahren und Geheimnisse. Manches von diesem Wissen werde ich mit ins Grab nehmen – und es spielt keine Rolle, ob bis dahin noch vierzig Jahre vergehen oder vierzig Minuten.
»He!«, rufe ich und schnippe mit den Fingern, wenn Busy zu weit wegläuft, woraufhin sie jedes Mal so abrupt haltmacht, dass sie kurz ins Rutschen gerät. Dann läuft sie den Abhang runter und kommt zurück zu mir. Ihre Augen leuchten im Licht des frühen Morgens, und wenn ich sie hinter den Ohren kraule, legt sie ihren kantigen Kopf genüsslich in den Nacken.
»Braves Mädchen«, sage ich. »Weiter.«
Oben angekommen sind meine Stiefel voller Staub und Busy hängt die Zunge aus dem Maul. Als die Steigung abflacht, rast sie begeistert einem Eichhörnchen hinterher und ich lasse ihr den Spaß.
Der Stamm der alten Eiche ist mächtig und hat starke Äste auf den unterschiedlichsten Höhen, was sie zu einem perfekten Kletterbaum macht. Aber ich bin nicht zum Klettern hier.
Ich nähere mich ihr langsam und bedächtig, so wie ich mich an einen Bock anpirschen würde, den ich erlegen will. Das mag albern sein, aber ich kann nicht anders.
Manche Dinge sind heilig.
Weit oben auf dem Stamm, schon vor über hundert Jahren eingeritzt, stehen Namen – verwachsen zwar, aber noch lesbar: Franklin + Mary Ellen. Joshua + Abigail. David + Sarah.
Ich fahre mit dem Finger an den Namen entlang nach unten. Es sind über dreißig: die großen Liebespaare des McKenna-Clans, von der Goldrausch-Ära bis heute.
Es gab eine Zeit, da habe auch ich davon geträumt, meinen Namen hier einzuritzen. Aber inzwischen bemühe ich mich, nicht mehr an Will zu denken. Wenn ich es doch tue, führt es mich nur auf Abwege und ich lande jedes Mal bei einem Wir, das es gar nicht gibt. Nicht mehr.
Ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren.
Heute ist der Tag. Die Zeit läuft ab.
Ich zeichne das letzte Namenspaar nach, das in die Baumrinde geritzt ist – so weit unten, dass ich in die Knie gehen muss, um es zu erreichen. Duke + Jeannie.
Ich presse die Handfläche auf Mommas Namen, schließe die Augen und drücke die Stirn gegen die raue Rinde. Ich atme den Harzgeruch ein, der von den nahen Kiefern herüberweht. Busy raschelt auf der Suche nach dem Eichhörnchen im Gebüsch.
Ich denke an Momma, an das, woran ich mich noch erinnern kann. Bunte Kleider und Cowboystiefel, klobiger Silberschmuck, mit Türkisen besetzt, und der schwache Duft von Lilien, der sie immer umgeben hat. Wie sehr sie den Wald geliebt hat und die kleinen Erinnerungsstücke, die sie so gerne aufgesammelt hat: ein krummer Zweig, wie ein Fragezeichen geformt, ein Büschel Moos auf einem herzförmigen Stein. Ihr Lächeln und wie sie ihre Arme um mich geschlungen und mich hochgehoben hat.
Früher habe ich mir manchmal ausgemalt, wie es wohl gewesen wäre, wenn sie weitergelebt hätte. Aber je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das. Mein Leben ist mein Leben. Mein Schicksal steht fest seit dem Tag ihres Todes. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um zu handeln.
»Es tut mir leid«, sage ich zu den beiden Namen. Meine Entschuldigung gilt dem Versprechen, das sie einander gegeben haben. Und es gilt ihr, die für dieses Versprechen mit dem Leben bezahlt hat. Und ein bisschen gilt es auch Duke, weil der sie zu sehr geliebt hat, um sie loszulassen, und diese Unfähigkeit verstehe ich besser als vieles andere.
Die McKennas lieben stark und schnell. Und nur ein einziges Mal.
Ich räuspere mich und stehe auf, denn es bringt nichts, darüber Tränen zu vergießen.
Heute ist der Tag.
Anders geht’s nicht, Harley-Girl.
DREI
Ich bin acht, als meine Mutter vor meinen Augen stirbt.
Schon seit dem Frühstück ist sie angespannt. Wir haben unsere Pancakes noch nicht aufgegessen, da geht sie mit dem Telefon rüber ins Wohnzimmer. Allein gelassen mit dem Sirup, bringe ich es fertig, meinen Zopf reinzutunken.
Während ich versuche, das klebrige Zeug irgendwie loszuwerden, wird nebenan Mommas Stimme lauter: »Nein, Will, hör zu – ich komm gleich rüber. Keine Sorge. Vierzig Minuten. Okay? Ich bin bald da. Hab keine Angst, Liebling. Lass Carl nicht rein. Und pass auf, dass deine Mom die Tür nicht wieder aufschließt. Ich bin gleich da, versprochen.«
Meine Haare haben einen klebrigen Fleck auf meinem Pyjama hinterlassen, an dem ich herumreibe, als Momma zurückkommt.
»Harley«, seufzt sie und wischt meine Haarspitzen mit einem feuchten Küchentuch ab. »Zieh dich schnell an. Wir fahren in die Stadt.«
»Aber heute ist nicht Mittwoch.« Mittwochs fährt Onkel Jake mit uns zum Einkaufen in den Supermarkt und ich darf zwischen den beiden vorne auf der Sitzbank sitzen. Momma singt mit bei den Liedern, die im Radio laufen – Songs von Sängerinnen, in denen es um das harte Leben in den Kohlerevieren und um gebrochene Herzen geht, und Sängern, deren tiefe Stimmen mich an Daddy erinnern.
»Weiß ich doch, Schatz. Tu einfach, was ich sage.«
Als ich wieder runterkomme, wie immer in Jeans und Stiefeln, wartet sie schon an der Eingangstür. Sie schnappt sich den pink-schwarzen Cowboyhut, den mir Onkel Jack auf dem Rummel gekauft hat, und setzt ihn mir auf den Kopf. Nachdem wir in den Chevy eingestiegen sind, legt sie mir ihre Hand auf die Schulter und nimmt sie den ganzen Weg in die Stadt über nicht weg.
Sie stellt das Radio nicht an und macht alle Fenster zu, obwohl schon bald Sommer ist.
»Wohin fahren wir?«, frage ich, als sie beim Supermarkt nicht anhält.
»Eine Freundin besuchen.«
Sie biegt in eine Straße ein, die ich nicht kenne. Alles hier wirkt verdreckt, das Gras vor den Häusern ist fleckig und in den Einfahrten stehen verrostete Autos, aufgebockt und ohne Räder. Nach einer Weile gibt es nur noch ab und zu Häuser, mit viel Platz von einem zum nächsten, und die Straße ist bloß noch eine unbefestigte Piste. Trotzdem fährt Momma weiter, bis ganz zum Ende.
Sie hält nicht direkt vor dem runtergekommenen Farmhaus. Stattdessen wendet sie den Pick-up und parkt ihn auf der anderen Straßenseite. Dann beugt sie sich zu mir und öffnet das Handschuhfach. Ihre langen Haare fallen ihr über die Schulter und streifen meinen Arm. Sie sind seidig und riechen nach Blumen.
Ich reiße die Augen auf, als ich die halbautomatische Pistole in ihrer Hand sehe und beobachte, wie sie das Magazin einrasten lässt.
»Momma …«
Sie lächelt mich beruhigend an und streicht mir mit der freien Hand übers Haar. »Alles in Ordnung, Baby«, sagt sie. »Du musst was für mich tun, ja? Egal was passiert, du bleibst hier im Wagen. Gleich kommt ein netter Junge aus dem Haus, er heißt Will und ist zehn Jahre alt. Er wird sich zu dir setzen. Du lässt ihn rein und dann schließt ihr die Türen ab. Lasst keinen ins Auto außer mir. Alles klar?«
Ich nicke unsicher. Obwohl sie lächelt, sieht sie irgendwie seltsam aus und ihre Augen glänzen feucht.
»Wiederhol das noch mal«, fordert sie behutsam.
Ich tue, was sie will, und muss mich anstrengen, damit meine Stimme nicht zittert.
Momma küsst mich auf die Stirn und sieht mich eine ganze Weile lang an. »Braves Mädchen«, sagt sie. »Ich hab dich lieb. Bin gleich wieder da.«
Ich sehe zu, wie sie mit energischen Schritten die Straße überquert, auf das Haus zugeht und darin verschwindet. Meine Finger krallen sich ins Armaturenbrett, das Kinn stütze ich zwischen die Hände. Ich rutsche so weit vor, bis meine Knie unter dem Handschuhfach klemmen, und meine Nase klebt fast an der Windschutzscheibe. Es ist stickig hier drin. Ich tippe gegen das Duftbäumchen, das am Rückspiegel hängt, und sehe zu, wie es sich dreht. Ich würde gern ein Fenster aufmachen, halte mich aber an das, was Momma mir aufgetragen hat.
Erst als sich vor dem Haus auf einmal etwas bewegt, schaue ich wieder hin. Ein Junge mit schwarzen Haaren stürmt heraus, seine knochigen Beine enden in dünnen Knöcheln und nackten Füßen. Er rast über den Hof auf mich zu. Staub steigt hinter ihm auf und ich ziehe am Griff und stoße die Tür auf, während er auf den Wagen zu rennt.
»Will?«
Keuchend nickt er. Ich strecke die Hand aus, und obwohl er sie nicht braucht, packt er sie und klettert hoch in die Fahrerkabine.
»Was ist hier los?«, frage ich ihn, als er die Tür zuzieht und mit der Handfläche auf die Verriegelung schlägt.
»Ist die andere auch richtig zu?«
Ich nicke.
»Hast du die Schlüssel?«
Ich halte ihm den Schlüsselbund hin, den mir Momma in die Hand gedrückt hat, bevor sie ausgestiegen ist.
»Gut«, sagt Will.
»Was ist hier los? Wo ist meine Momma?«
»Bei meiner Mutter«, antwortet Will. »Wir sollen warten, bis Carl weg ist.«
»Wer ist das?«
»Der Freund von meiner Mutter«, sagt Will, aber so, als hätte er etwas Widerliches im Mund. Sein rechtes Auge ist angeschwollen und über seinen linken Arm zieht sich eine Reihe von verschorften, kreisförmigen Wunden. »Mach dir keine Sorgen. Deine Mama schafft’s, dass er geht. Hat sie schon öfter gemacht. Wird alles gut.«
Nur einen Augenblick später passiert es.
Eine Art Tosen, entsetzlich laut und anders als alles, was ich jemals gehört habe, ein Splittern, ein Krachen, ein Brausen, alles auf einmal. Ich schreie auf und presse die Hände gegen meine Ohren. Und auf einmal ist das Haus weg. Da ist nur noch Feuer und schwarzer Rauch; Bruchstücke von Holz stieben in die Luft und prasseln wie ein Hagelsturm auf das Wagendach.
Wills Lippen bewegen sich, aber ich kann nicht hören, was er sagt. Er beugt sich zu mir, entreißt mir den Schlüssel und rammt ihn in die Zündung.
Auf einmal begreife ich. Einen Moment lang war alles wie eingefroren, jetzt rast es wieder. Feuer. Rauch. Holz, das auf die Motorhaube und das Dach des Chevys knallt – Teile vom Haus.
Momma!
Ich rufe nach ihr und schnappe den Türgriff, zerre daran, will die Tür aufreißen, aber sie ist abgeschlossen. Will packt meinen Arm, kämpft mit einer Hand gegen mich an. Er zerrt mich zu sich und startet gleichzeitig den Motor, streckt die Beine und tritt das Gaspedal durch. Der Wagen macht einen Satz, weg von dem herumfliegenden Holz, den Schindeln und Putzbrocken, die den Pick-up erschüttern und jetzt sogar die Windschutzscheibe bersten lassen. Mit einer Hand steuert Will, mit der anderen drückt er mich an sich, hält mich umklammert, lässt mich nicht los.
Wir schlingern von der Explosion weg, Trümmer rutschen von der Motorhaube, wir fahren zu schnell. Dann gibt es einen dumpfen Schlag und die Ladefläche des Pick-ups rutscht in einen Graben, auch die Fahrerkabine kippt ein Stück zur Seite und wir stehen still. Aber weit genug weg von dem Haus, um in Sicherheit zu sein. Will umklammert mich immer noch und jetzt halte auch ich ihn, genauso fest wie er mich. Gemeinsam starren wir durch die Heckscheibe.
Und sehen zu, wie alles verbrennt, was von unseren Müttern noch übrig ist.
VIER
6. Juni, 8.30 Uhr
Gleich nachdem Busy und ich von unserer Runde zurück sind, packe ich alles, was ich brauche, in meinen Pick-up und wir machen uns auf den Weg. Sie springt in die Fahrerkabine und wir holpern auf dem gewundenen Fahrweg zu den Eisentoren am Eingang des McKenna-Anwesens. Hinter uns stieben Staubwolken auf – der Boden ist um diese Jahreszeit so trocken, dass uns ein einziger Funken ruinieren kann. Busy streckt den Kopf aus dem Fenster und Hundesabber fliegt durch die Luft.
Nachdem ich unten am Eingang den Code ins Keypad getippt habe, gleiten die Eisentore auf. Ich suche im Radio nach einem Sender, bei dem die Musik deutlicher ist als das Rauschen, während Busy in den Wind bellt. Schließlich lande ich bei einem Song von Merle Haggard, dem Lokalmatador hier im Dirty Five Thirty. Der Song handelt von seiner Momma und wie die sich ins Zeug gelegt hat. Das nehme ich als ein gutes Omen.
Wir wohnen vierzig Meilen entfernt von der nächsten und zugleich größten Stadt in der Gegend. Vom Trinity County her treiben Rauchwolken herüber – die Waldbrände kommen näher. Aber wir hier im North County müssen sowieso immer durchs Feuer.
Unser Fleckchen Erde hätte sich eigentlich in Wildnis zurückverwandeln müssen, wie viele andere Orte aus der Zeit des Goldrauschs, aber irgendwie hat es überlebt. Es gibt hier immer noch Leute, die ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie Gold aus den Flüssen holen, auch wenn die altmodischen Blechpfannen inzwischen durch Goldwaschrinnen und illegale Schwimmbagger ersetzt worden sind. Und es gibt immer noch Familien, denen das Land, das sie bewirtschaften, schon seit Generationen gehört. Die Gegend floriert nicht gerade, aber wir tun, was wir können, und kommen zurecht.
Busy und ich fahren den Berg runter und durch einen Wald, der so dicht und groß ist, dass er kein Ende zu nehmen scheint, vorbei an roten Sandsteinklippen und schroffen Schieferfelsen, die von Touristen mit Begeisterung als Kletterfelsen benutzt werden. Die Straße windet sich durch den Wald, mal steigt sie und mal fällt sie wieder ab, und ich lasse den Pick-up geschmeidig um die Kurven gleiten.
Als wir nach Salt Creek kommen, nehme ich die Abfahrt Richtung Vollmer’s Pass. Oben auf dem Hügel stehen das Gerichtsgebäude und ein kleines Krankenhaus, dazu die besseren Wohnhäuser des Ortes – die, die in Schuss gehalten werden. Aber ein kurzes Stück weiter die Straße entlang verschwinden die ordentlich gestutzten Hecken und die geschmackvollen Rosengärten, stattdessen gibt es nur noch Trailerparks und schäbige Motels, in denen schmutzige Kinder herumstromern und wo die Schwimmbecken alle zugeschüttet sind.
Ich muss heute Geld eintreiben. Wenn ich es ausfallen lasse, wirkt das verdächtig.
Für die meisten Leute hier, die ordentlichen jedenfalls, ist Duke schlicht ein Geschäftsmann, der viele Jahre lang zusammen mit seinem Schwager eine Spedition betrieben hat. Er besitzt eine Reihe von Motels, ein paar Bars und Diners, ein bisschen Land hier und da – man könnte ihn inzwischen fast für sauber halten.
Aber wer ein bisschen tiefer schaut bis in die Wälder hier in der Gegend, wo schnell Blut fließt und ganz eigene Gesetze gelten, der erkennt sofort, wer Duke McKenna wirklich ist.
Duke hat lange versucht, mich zumindest aus den Drogengeschäften rauszuhalten. Das geht auf Onkel Jake zurück – es war so ziemlich das Einzige, worauf die beiden sich jemals geeinigt haben. Als ich sechzehn wurde und meinen Schulabschluss in der Tasche hatte, hat mir Duke also nicht beigebracht, wie man Crystal Meth kocht oder dealt, sondern mir eine Liste von Namen in die Hand gedrückt – alles Leute, die ihm Geld schulden, und einmal im Monat müssen die Raten eingetrieben werden.
Die Liste ist ziemlich lang. Hauptsächlich sind Frauen mit kleinen Geschäften drauf, die bei der Bank keinen Kredit kriegen und deshalb zu Duke kommen. Eine Sechzehnjährige loszuschicken, die vielleicht nicht ernst genommen wird, war ein Risiko, aber der Name McKenna steht hier in der Gegend für unbeschränkte Macht und bis jetzt hatte ich nie Probleme.
Ich fange beim Eintreiben immer in der Talbot Bakery an. Sie liegt ganz hinten in einer von diesen schmuddeligen Ladenzeilen, die man in den Siebzigern angelegt hat, um das Wirtschaftsleben der Stadt anzukurbeln.
Busy lasse ich im Wagen, Mrs Talbot kann sie nicht leiden. Als ich die Glastür öffne, klingeln Glöckchen und der Geruch von frischem Brot und Schokolade umfängt mich. Das lässt mich an Kindertage denken, an die Zeit, als ich unserer Haushälterin Miss Lissa immer in der Küche geholfen habe.
Mrs Talbot ist dabei, Brownies in eine Vitrine zu räumen. Jetzt schaut sie auf.
»Hey, Harley«, sagt sie. Ihre Haare sind unter einem grünen Kopftuch verborgen, nur ein paar einzelne Locken sind entwischt und ringeln sich um ihr Gesicht. Unter den Augen hat sie dunkle Ringe. Das kommt wohl von den Sorgen, die man eben hat, wenn eins der Kinder bei der Armee ist und das andere in einer Stadt festsitzt, in der es praktisch nichts von Interesse gibt.
Duke hat es schlau angestellt, als er vor vielen Jahren diese Liste fürs Geldeintreiben zusammengestellt hat. Er hat Frauen ausgesucht, die Mütter sind. Frauen, die mich nicht hassen und keinen Ärger machen würden, sondern Mitgefühl hätten, weil sie ihre eigenen Kinder in mir sähen.
Dabei bin ich ganz anders. Meine Kindheit drehte sich nicht um Fahrräder und Schwimmpartys, sondern um Waffen, Vollmantelgeschosse und das verkrustete Blut anderer Männer unter Dukes Fingernägeln.
»Hi«, sage ich. »Wie geht’s Jason?«
»Gut. Vielleicht kriegt er Weihnachten frei.« Mrs Talbot legt den letzten Brownie in die Vitrine und schiebt die Glastür zu.
»Und Brooke?«, frage ich harmlos. Es hat Mrs Talbot noch nie gepasst, dass ich mit ihrer Tochter befreundet bin. Aber jetzt, wo wir erwachsen sind, kann sie nicht viel dagegen tun.
Wobei sie früher, als wir Teenager waren, auch nicht groß was dagegen ausrichten konnte.
»Sie hat jetzt einen Job in Burney.« Mrs Talbot geht zur Registrierkasse, tippt auf ein paar Tasten und öffnet sie. »Die zahlen ihr sogar das Benzin. Hier im Laden fehlt sie mir zwar, aber es ist eine gute Chance.« Sie holt einen Umschlag aus der Kasse und gibt ihn mir.
Ich nehme ihn, zähle das Geld aber nicht nach. Nach all den Jahren werde ich sie nicht beleidigen. Nachdenklich betrachte ich den Umschlag, spüre sein Gewicht in der Hand.
Wahrscheinlich hat sie die ganze Kasse leergeräumt, um ihn zu füllen.
Ich schiebe die Schuldgefühle beiseite. Das hier ist eben mein Job.
»Danke«, sage ich stattdessen. »Soll ich die Brotlieferung fürs Blackberry’s mitnehmen? Ich fahr da sowieso hin.«
Die Anspannung in ihrem Gesicht lässt nach. »Das wäre nett von dir.« Sie greift nach drei großen Papiertüten, die mit Brötchen und Brotlaiben gefüllt auf der Ladentheke stehen, und schiebt sie in meine Richtung.
»Alles okay, Harley?«, fragt sie. »Du kommst mir so blass vor.«
»Mir geht’s gut«, lüge ich, während ich den Umschlag in die Hosentasche schiebe. Am liebsten würde ich ihr das Geld wieder zurückgeben.
Ich wäre gern die Art von Mensch, die so etwas tut. Aber ich bin es nicht.
Ich schnappe mir die Tüten und wende mich zur Tür. »Wenn Sie keinen Ersatz für Brooke finden, könnte vielleicht eine Ruby einspringen«, sage ich über die Schulter. »Eine ist neu dort, sie heißt Sam, hat drei Kinder und ist wirklich sehr nett. In ein paar Wochen ist sie ihren Gips los. Melden Sie sich also, wenn Sie hier im Laden Hilfe brauchen.«
»Danke, Harley.« Mrs Talbots Lächeln ist derart unbestimmt, dass mir gleich klar ist, was sie von meinem Vorschlag hält – nicht sonderlich viel. Die Leute hüten sich, mir das ins Gesicht zu sagen, aber die meisten hier können sich mit den Frauen aus dem Ruby absolut nicht anfreunden. Das ist Schwachsinn und hat vielleicht sogar weniger mit den Rubys selbst zu tun, sondern mehr mit Mo, der Frau, die den Laden mit mir zusammen führt. Nichts pisst die weißen Frauen hier in der Gegend mehr an als eine Indianerin, die etwas zu sagen hat.
Mo nimmt ganz unterschiedliche Frauen im Ruby auf, was die anderen erst recht aufregt. In deren Augen gibt es nämlich bloß eine Sorte von Gewaltopfern, die Schutz verdienen – nämlich Frauen, die es in ihren Augen wert sind. Das Opfer soll also möglichst eine Weiße sein und darf im Leben nie einen Fehler gemacht haben, und der Kerl, der sie drangsaliert, muss das sein, was man sich unter einem wilden Tier vorstellt. Und um Gottes willen kein Mann, den sie mögen und respektieren, keiner, der mit ihnen in die Kirche oder zur Arbeit geht. Das ist ihnen unbehaglich, dann gucken sie lieber weg. Also ist die Frau allein und ohne Hilfe.
Und genau da kommen Mo und das Ruby ins Spiel.
Mo ist da, egal was passiert. Sie kämpft für diese Frauen, bedingungslos.
Als ich das Brot in die Doppelkabine des Pick-ups lade, schnüffelt Busy neugierig, aber ich schnippe nur mit den Fingern, da legt sie sich wieder hin und schmollt.
»Ungezogenes Biest«, sage ich zu ihr, fahre vom Parkplatz der Bäckerei und biege nach links ab.
Das Blackberry Diner liegt in der South Street, auf der anderen Seite der Bahngleise. Hinter der Tür wachen Bären aus grobem Holz, auf jedem Tisch steht ein Glas Brombeermarmelade und dann ist da noch die lange Theke, an der die Stammgäste Hof halten – lauter Opas mit Veteranenkappen und Bifokalbrillen. Sie trinken literweise schwarzen Kaffee und tun gerne mal so, als ob sie den Namen der Bedienung vergessen hätten. Die Blackberry-Kette – insgesamt fünf Läden verteilt auf drei Counties – hat mein Großvater in den Fünfzigerjahren gegründet. Wahrscheinlich ging es dabei um Geldwäsche, schließlich hat Granddaddy McKenna praktisch nur krumme Geschäfte gemacht. Aber heutzutage bringen sie selbst ordentlich Geld ein, besonders der Hauptladen hier.
»Hallo, Schätzchen!«, zirpt eine helle Stimme, als ich mich durch die Doppeltüren schiebe. »Komm, ich nehm dir das ab.« Zwei von den Brottüten wandern zu Amanda, die das Diner führt. Sie ist groß und hübsch, ihre Haut ist gebräunt und die langen schwarzen Haare trägt sie in einem Knoten. Amanda lächelt immer – ein echtes Plus in der Gastronomie. Duke hat sie vor knapp zehn Jahren als Bedienung eingestellt und sie hat sich hochgearbeitet. Für das Salt Creek Diner hat er ihr alle Freiheiten gelassen und mit ein paar guten Ideen hat sie es geschafft, die Autofahrer in den Laden zu holen, die unterwegs nach Oregon sind. Die Touristen kaufen ihre hausgemachte Brombeermarmelade gleich kistenweise, bloß weil sie ein hübsches Etikett draufpappt und Bauernkarostoff über den Deckel tut.
»Ich dachte, ich nehm Mrs Talbot das Brotausfahren ab«, erkläre ich und folge Amanda hinter die Theke und durch die Küchentür. Hitze und Lärm schlagen mir entgegen, Geschepper dröhnt mir in den Ohren, Köche brüllen Anweisungen und jonglieren mit Zutaten. Der Spüler rennt uns entgegen, nimmt uns die Tüten ab und verschwindet nach hinten, um alles im Brotwärmer zu verstauen.
»Wie geht’s dir?«, fragt Amanda, nachdem wir die Küche verlassen haben, wo wir nur im Weg stehen würden. »Willst du einen Kaffee?«
»Gerne«, sage ich und weiche einem Abräumer mit einem vollen Transportwagen aus. »War viel los bis jetzt?«
»Eine ganze Ladung Touristen vom Freeway.« Amanda greift nach einer Kanne frischem Kaffee und einem To-go-Becher. »Macht einen ganz schön fertig, so ein Rummel gleich in der Früh.«
Ich verziehe mitfühlend das Gesicht und sie hält mir den Kaffeebecher hin.
»Mit extra viel Zucker, so wie du’s magst.«
»Danke. Wie geht’s Jeremy?« Ich nehme einen Schluck. »Ist er noch beim Wildwasser-Rafting?«
»Am Montag kommt er zurück«, sagt Amanda. »Kaum zu glauben, dass er jetzt fast dreizehn ist. Ist schon so lange her, dass …« Sie verstummt und ihr Blick verdunkelt sich, als die Erinnerung in ihr aufsteigt.
»Er war so süß als kleines Kind«, sage ich, um das Gespräch wieder ins Leichte zu wenden. »Weißt du noch, wie er im Ruby immer hinter Busy hergerannt ist? Er wollte auf ihr reiten, wie auf einem Pferd.«
Sie lacht. »Irgendwo muss ich noch das Video haben.«
»Heb’s auf, dann kannst du ihn erpressen, wenn er mit Mädchen ausgeht.«
Ihr Blick wird zärtlich. »Gute Idee.«
Ich werfe einen Blick auf die brombeerförmige Uhr an der Wand. »Ich muss los«, sage ich. »Ich hab Busy im Wagen. Danke für den Kaffee.«
»Grüß Mo und die anderen im Ruby von mir«, sagt Amanda.
»Mach ich.«
»Und pass auf dich auf, Liebling«, höre ich sie noch rufen, bevor sich die Tür hinter mir schließt.
Das werde ich tun.
Das muss ich unbedingt.
FÜNF
Ich bin zwölf, als ich zum ersten Mal auf einen Menschen ziele.
Onkel Jake und ich waren in der Stadt. Gerade als wir zurück nach Hause wollen, klingelt sein Handy.
Bevor er drangeht, runzelt er die Stirn, starrt erst das Display an und dann mich, aber am Ende nimmt er den Anruf doch entgegen.
»Hey, Mo. Passt gerade nicht so …« Er unterbricht sich, lauscht, seine dunklen Augenbrauen ziehen sich zusammen. »Okay«, sagt er. »Duke geht also nicht dran? Schick mir die Adresse, ich kümmer mich drum.«
Er beendet den Anruf und seine blauen Augen mustern mich besorgt.
»Wir müssen jemand abholen«, erklärt er in einem Tonfall, bei dem sich die feinen Härchen in meinem Nacken aufstellen. »Versprichst du mir, dass du alles machst, was ich dir sage? Egal was passiert?«
Ich nicke. »Retten wir eine Ruby?«
Onkel Jake lächelt sanft, wie um mir zu versichern, dass alles in Ordnung ist, doch ich weiß genau, was kommt. »Ja«, antwortet er leise.
Das Haus, vor dem er anhält, ist eines der besseren in Salt Creek. Grüner, gepflegter Rasen, in der Auffahrt ein blitzneues Auto.
Drinnen weint ein Kind, es scheint vollkommen außer sich zu sein. Das Gebrüll zu hören, während ich mit Onkel Jake aus dem Pick-up steige, macht mich fertig.
»Bleib dicht bei mir«, sagt er und packt mich am Arm. Gemeinsam nähern wir uns der Veranda vor dem Haus. Erst klopft er, doch als keiner reagiert, öffnet er einfach die Tür. »Amanda«, ruft er den Gang runter. »Hier ist Jake Hawes. Mo aus dem Ruby sagt, du brauchst Hilfe.«
Schlagartig verstummt das Weinen. Nur noch ein Schluckauf ist zu hören, als hätte das Kind gelernt, still zu sein, wenn ein Mann spricht.
Wir werfen einen Blick in die Küche, wo die Spülmaschine sperrangelweit offen steht. Dann steuert Jake weiter den Gang entlang und mein Herz beginnt wie wild zu hämmern.
Und da ist sie, im Schlafzimmer, und wirft Sachen in einen Koffer. Ihr Kind – ein kleiner Junge mit dunklen Haaren, etwa drei Jahre alt – sitzt auf der Bettkante. Auf seiner Stirn prangt ein großer, tiefroter Fleck.
Als sie aufsieht, entdecke ich eine ganz ähnliche Verletzung in ihrem Gesicht, nur hat sich der Bluterguss bei ihr schon blau verfärbt. »Jake«, sagt sie und ihr ganzer Körper entspannt sich. »Du bist da.«
»Klar«, sagt er und betritt das Zimmer. »Wann ist er weg?«
»Vor einer halben Stunde. Er war furchtbar wütend, ich hatte sein Essen vergessen und dann hat Jeremy auch noch so geweint, da hat er …« Sie atmet tief ein, die Finger krampfen sich um das Shirt, das sie hält. »Ich hab Mo angerufen«, sagt sie.
»Das hast du gut gemacht«, sagt Jake. »Lass uns deine Sachen zusammensuchen, dann fahr ich dich rüber.«
Amanda betrachtet den Raum, mit Tränen in den Augen, aber ohne wirklich zu weinen. »Jeremys Sachen habe ich. Ich hab auch Geld, extra dafür gespart.«
»Nimm gleich alles mit, was du brauchst. Du musst nicht zurück«, sagt Jake behutsam.
Sie nickt und wiederholt: »Ich muss nicht zurück.«
Da knallt draußen eine Autotür. Ich fahre automatisch herum, reiße den Kopf in die Richtung des Geräuschs. Daddy hat mich nicht umsonst darauf trainiert, blitzschnell zu reagieren, wenn etwas Überraschendes passiert.
»Onkel Jake«, warne ich.
Bevor ich auch nur ein Wort mehr herausbringe, öffnet sich die Eingangstür mit einem so lauten Scheppern, dass die Wände zittern. Amandas Augen weiten sich vor Panik, instinktiv stellt sie sich vor ihr Kind.
»Er ist zurück«, flüstert sie.
»Harley, nimm Jeremy«, befiehlt Jake, schnappt sich den Kleinen und schubst ihn rüber zu mir. Der Junge klammert sich gleich an mich und drückt sein nasses Gesicht an meinen Hals. Auch ich halte mich an ihm fest, denn mir ist sonnenklar, was da auf uns zukommt.
Ich weiß, was Männer Frauen antun können. Der Beweis steht mir direkt vor Augen: der Bluterguss in Amandas Gesicht.
»Los mit euch.« Jake schiebt mich zur Küche, wo die Hintertür ist. Ich höre Schritte, sie bewegen sich vom Wohnraum vorne aufs Schlafzimmer zu, und eine tiefe Stimme brüllt Amandas Namen.
Jeremy umschlingt meine Taille mit den Beinen und ich setze mich in Bewegung. Ich muss ihn rausschaffen, ihn in Sicherheit bringen.
Die Hintertür liegt direkt vor mir; meine Hand schließt sich um den Türknauf.
»Was läuft hier, gottverdammt?« Die Stimme dröhnt durchs Haus, wird von den Wänden zurückgeworfen.
Jetzt ist er beim Schlafzimmer angekommen.
Ich halte inne. Ich habe Onkel Jake furchtbar lieb, aber hat er sich überhaupt schon mal mit irgendwem geprügelt? Was ist, wenn er …
Jeremys Gesicht ist immer noch an meinem Hals vergraben, seine kleinen Finger umklammern meinen Zopf.
Er muss hier raus.
Ich reiße die Tür auf, springe die Stufen runter, renne quer über den Hof zum Pick-up von Onkel Jake. Nachdem ich Jeremy in die Fahrerkabine verfrachtet habe, werfe ich einen Blick über die Schulter.
Im Haus ist es still.
Zu still.
Ich klappe das Handschuhfach auf, schnappe mir Onkel Jakes Pistole und prüfe, ob sie geladen ist. »He.« Mit einem breiten Grinsen im Gesicht wende ich mich an Jeremy. »Bin gleich wieder da. Du bleibst im Wagen. Egal was du hörst, beweg dich nicht. Wenn du schön hierbleibst, kriegst du so viele Kekse, wie du willst. Okay?«
»Okay«, antwortet er leise, mit weit aufgerissenen Augen.
Ich steige aus und vergewissere mich, dass die Fenster weit genug, aber nicht zu weit heruntergelassen sind, dann sperre ich den Wagen ab. So ist es sicherer für ihn.
Ich verdränge den Gedanken an mich selbst, eingesperrt in einem Pick-up, an Momma, die sich einem anderen schlimmen Kerl in den Weg gestellt hat, und daran, was für ein Ende das genommen hat.
Für Jeremy wird es nicht so ausgehen.
Ich renne zurück zum Haus, von hinten her und so leise es geht. Das Gewicht der Pistole in meiner Hand ist mir vertraut, trotzdem ist alles anders als sonst.
Das hier ist nicht bloß ein Zielschießen. Nicht so, wie wenn Daddy Scheiben in die Luft wirft und ich Löcher reinschieße. Es geht nicht um Eichhörnchen, Rotwild oder Bären, auch nicht um einen Puma.
Sondern um einen Mann.
Kann ich auf einen Mann schießen?
Werde ich das jetzt gleich herausfinden?
Während ich wieder in die Küche schleiche, höre ich vom Gang her Stimmen, gedämpft und angespannt. Ich halte die Pistole fest. Meine Hände schwitzen, aber ich kann sie jetzt nicht abwischen, also umklammere ich den Griff nur noch fester.
Atmen, Harley-Girl.
Ich drücke mich gegen die Wand und spähe um die Ecke.
Er steht mit dem Rücken zu mir im Gang. Ein großer, kräftiger Kerl mit einem Stiernacken und Fäusten wie Zwanzig-Kilo-Hanteln. Er hat sich vor Jake aufgebaut, der vor Amanda steht und sie abschirmt.
Mr Groß-und-Kräftig hat eine Waffe. Das weiß ich, auch wenn ich das Ding nicht sehen kann. Ich spüre es einfach. Ich kann es in Amandas Gesicht lesen. Todesangst und Resignation: Diesmal bringt er mich wirklich um.
»Wo ist mein Sohn?«, knurrt er.
»Keine gute Idee, Hunter«, gibt Jake zurück. »Wenn du uns gehen lässt, kriegst du keine Probleme. Aber wenn du Amanda was tust oder mir? Dann hast du McKenna am Hals.«
»Bullshit«, antwortet Hunter. »McKenna gibt doch keinen Scheiß auf so’n dummes Flittchen.«
»Sie ist jetzt eine Ruby«, erklärt Jake. »Du weißt, was das bedeutet.«
»Halt dich aus meiner Ehe raus. Das ist was zwischen uns.«
»Deine Wahl, Hunter«, sagt Amanda. Ihre Stimme zittert zwar, aber sie steht aufrecht da und strahlt so viel Kraft aus, dass die Luft um sie herum zu flimmern scheint wie um ein loderndes Feuer. »Du hast die Wahl. Wie soll ich das Haus verlassen? In einem Leichensack? Im Krankenwagen? Oder lässt du mich ziehen? Egal was passiert, ich bin jedenfalls weg. Ich werde nicht so weiterleben. Nicht mit Jeremy.«
»Ach komm, Süße, ich wollte doch nicht …«, fängt er an.
»Du hast ihn geschlagen«, fällt sie ihm ins Wort, bebend vor Wut.
»Deine Frau verlässt dich«, sagt Jake. »Also steck das Ding weg und nimm es wie ein Mann. Oder schieß. Aber du wirst uns nicht beide auf einmal erwischen.«
Er hebt die Hand mit der Waffe. »Versuchen kann ich’s.«
Ich setze mich in Bewegung, mit leisen, geschmeidigen Schritten. Alles, was Daddy mir eingebläut hat, ist blitzartig da und der Abstand wird immer kleiner. Jakes Augen weiten sich, als er mich sieht, aber er gibt keinen Ton von sich, verrät mich nicht.
Ich drücke Hunter den Pistolenlauf in den Rücken. Er erstarrt, dreht den Kopf, und Jake nutzt seine Ablenkung aus. Er packt die Waffe in Hunters Hand und zerrt sie zu sich her, um sie ihm zu entwinden.
Hunter heult auf und weicht zurück, sodass sich mein Lauf noch tiefer in seinen Rücken bohrt, zugleich reißt ihm Jake endgültig die Waffe aus der Hand und richtet sie auf ihn.
»Aus dem Weg, Harley«, befiehlt Jake. Ich ducke mich unter seinem Arm durch und stelle mich neben Amanda. Sie umarmt mich und streicht mir die Haare aus dem Gesicht. »Alles okay, Liebling?«, fragt sie. »Wo ist Jeremy?«
Ich nicke. »Im Auto. Ihm geht’s gut.«
Jake steckt die Waffe hinten in den Bund seiner Jeans und greift Hunter an. Der erste Schlag trifft das Kinn, der zweite bricht ihm die Nase, der dritte geht voll in den Solarplexus und lässt ihn zu Boden sinken.
Jake steht jetzt aufrecht über ihm, die eine Hand noch immer zur Faust geballt, als wäre er noch nicht fertig.
»Onkel Jake«, sage ich.
Er dreht sich zu mir, wie wenn ihm erst jetzt wieder bewusst würde, wo wir sind. Diese Wildheit in seinen Augen und diese Wut, die so wenig zu ihm passen, dass mir davon fast übel wird – all das verblasst im gleichen Augenblick. Hunters Kopf liegt jetzt auf dem Teppichboden, er spuckt das Blut aus, das ihm von der Nase in den Mund rinnt.
»Rühr sie nie wieder an«, sagt Jake mit tiefer Stimme und einem Unterton, der keinen Zweifel darüber lässt, was er Hunter sonst antun wird. »Wag dich nie wieder in ihre Nähe. Wenn doch, hetz ich McKenna auf dich. Dann bleiben von dir nur die Zähne übrig und die krieg ich höchstpersönlich klein, das versprech ich dir.«
Er macht ein paar Schritte um Hunter herum, um Amandas Koffer aus dem Schlafzimmer zu holen.
»Gehen wir«, sagt er.
Amanda ist kaum auf der Veranda, da läuft sie schon los, rennt rüber zu Jeremy, der immer noch still im Pick-up sitzt. Jake entriegelt die Türen und sie springt in den Wagen, schließt den Jungen in die Arme und drückt ihn fest an sich.
Für die Fahrt ins Ruby müssen wir uns zu viert in die Fahrerkabine quetschen, aber damit kommen wir klar. Am Eingang wartet eine dünne Frau mit einer Zigarette zwischen den Fingern auf uns, die Brille hängt an einer klobigen Perlenkette um ihren Hals – Mo. Nachdem Amanda aus dem Wagen gestiegen ist, schließt sie sie in eine rauchige Umarmung und verkündet mit ihrer Raspelstimme: »Jetzt seid ihr sicher.« Jeremy schenkt sie ein Lächeln. »Kommt, ihr zwei, ich hab schon eine Hütte für euch bereitgemacht.«
Ich will mit, doch Jake hält mich zurück. »Heute nicht«, sagt er.
Aber er bringt mich nicht nach Hause. Stattdessen fahren wir an eine Stelle beim Fluss, wo er den Pick-up abstellt. Dann sitzt er lange Zeit nur da, schaut durch die Windschutzscheibe aufs Wasser und schweigt.
»Alles okay mit dir?«, fragt er schließlich.
Ich zucke mit den Achseln. »Und mit ihr?«
»Wird schon werden. Sie braucht Zeit«, sagt Jake.
»Und ihr Mann?«
»Der bleibt weg«, antwortet Jake. Aber seine Finger krampfen sich dabei so fest ums Lenkrad, dass ich mich frage, ob er das wirklich glaubt.
»Das machen sie aber nicht immer«, sage ich. Das weiß ich ganz sicher, denn in manchen Nächten verschwindet Daddy, nachdem er einen Anruf von Mo gekriegt hat, und wenn er zurück ist, ist da dieses Glitzern in seinen Augen, das mir zeigt, dass er Blut vergossen hat.
»Die halten sich schon an die Regeln, wenn sie wissen, was gut für sie ist«, sagt Jake.
»Aber wenn sie sie doch brechen?«
Er macht eine Pause. »Na ja, dann hat das Konsequenzen.«
»Hättest du ihn umgebracht?«, bohre ich weiter.
Jake wendet den Blick ab und sagt gar nichts.
»Hast du …« Ich bringe die Frage nicht zu Ende. Das kann ich nicht, denn er guckt jetzt so wie Momma: Sein Gesichtsausdruck ist wie eine Bitte, daran bloß nicht zu rühren.
»Deine Momma hat das Ruby geliebt«, sagt Jake. »Als sie das Motel geerbt hat, hab ich mir Sorgen gemacht. Ich dachte, sie schafft das nicht. Und dann hat sie mir erzählt, was sie vorhat, dass sie es zu einem Zufluchtsort für Frauen machen will. Ich fand das verrückt und viel zu gefährlich. Aber wenn sich deine Momma mal etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte nichts und niemand sie bremsen.« Die Erinnerung entlockt ihm ein Lächeln.
»Wie ich«, sage ich.
»Wie du«, stimmt er mir zu und lächelt wieder.
Er fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Egal wie lang er jetzt schon dabei ist, er lässt sich immer noch keinen Bart wachsen. Das ist inzwischen das Einzige, was ihn noch von den anderen unterscheidet. »Was deine Momma und Mo für diese Frauen getan haben, was das Ruby für alle Frauen hier in der Gegend bedeutet … Abgesehen von dir war das Ruby ihre Art, ein Zeichen in der Welt zu setzen und ihr etwas zurückzugeben. Und eines Tages wird das Ruby deine Aufgabe sein, zusammen mit Mo.«
»Ich weiß«, sage ich.
Aber ich habe meine Zweifel, ob ich jemals bereit sein werde. Ob ich mein Herz so unempfindlich machen kann, dass es nicht bricht, wenn ich Würgemale an Hälsen und Blutergüsse um Handgelenke zu Gesicht bekomme. Oder an kleinen Brustkörben, die noch lange nicht ausgewachsen sind.
Manchmal allerdings stelle ich alles infrage, wenn ich mit Onkel Jake und Mo zusammen bin. Ich rätsele dann, ob Härte die richtige Antwort ist. Vielleicht wäre ja Entsetzen, bei jeder Frau, bei jeder Prellung, jeder Platzwunde, die angemessenere Reaktion.
Vielleicht ist ein unempfindliches Herz nicht die Lösung, sondern das Problem.
SECHS
6. Juni, 9.30 Uhr
Nach dem Besuch im Blackberry’s treibe ich noch Geld von zwei Schuldnerinnen oben auf der Anhöhe ein, dann mache ich mich auf den Weg nach unten in die Gedärme der Stadt. Entlang der Passstraße am Fuß des Hügels gibt es ein paar Motels, die alle Duke gehören. Insgesamt fünf, eins neben dem anderen. Motels von der Sorte, in der sich Leute entweder gleich für den ganzen Monat oder nur stundenweise einmieten, ein Hotspot für Drogen und Ärger aller Art.
Wenn du deine Kundschaft im Griff haben willst, konzentrierst du am besten alle in derselben Gegend.
Aber das Ruby – das letzte, am weitesten unten gelegene Motel – ist anders. Früher hat es Momma gehört, und für Frauen mit Problemen ist es der einzige sichere Ort im gesamten North County.
Momma hatte ein weiches Herz für die Verlorenen. So drücken das viele Leute gerne aus, mit einem mitleidigen kleinen Lächeln im Gesicht. Als wäre jemand, der sich um andere kümmert, nicht ganz dicht. Als wäre das, was Momma und Mo aufgebaut haben, nicht Ausdruck eines leidenschaftlichen weiblichen Beschützerinstinkts.
Das Ruby gehörte ursprünglich Mommas Eltern – vierzig Hütten, alle in Dreiecksform und rubinrot angestrichen. Sie hat das Motel nach ihrer Heirat mit Duke übernommen, doch statt normal zu vermieten, hat sie das Ruby zur kostenlosen Unterkunft für Frauen gemacht, denen es dreckig geht. Frauen auf der Flucht vor ihren Ehemännern, ihren Freunden, ihren Vätern. Frauen, die clean werden oder vom Alkohol loskommen wollen oder einfach nur mal rausmüssen. Schwangere Mädchen, die sonst nirgends hinkönnen. Ihnen allen hat Momma im Ruby ein Dach über dem Kopf und Schutz gegeben, und kein Mann hat es je gewagt, sich gegen eine Frau zu stellen, die mit einem Zwölfkaliber umgehen kann und den Namen McKenna trägt.
Mo stammt aus Montgomery Creek, einem winzigen Ort auf dem Weg nach Burney. Sie gehört zum Pit River Tribe und kam im zweiten Jahr, nachdem Momma das Motel übernommen hatte, zum Arbeiten nach Salt Creek.
Irgendwann wollte ich mal von ihr wissen, warum sie sich gerade das Ruby ausgesucht hat. Daraufhin hat sie eine Augenbraue hochgezogen und mich gefragt, ob es denn eine dramatische Backstory bräuchte, um zu tun, was richtig ist. Ich bin rot geworden, habe mich entschuldigt und ertappt gefühlt, denn tatsächlich hatte ich irgendwas in der Art gedacht.
Ich glaube an das hier, hat sie mir damals erklärt. Ich glaube an diese Frauen.
Ohne Mo wäre das Ruby nach Mommas Tod kaputtgegangen. Bis ich alt genug war, um mein Erbe anzutreten, ist das Motel erst mal an Onkel Jake gegangen. Mo hat ihn überzeugt, es auf Mommas Art weiterzuführen, statt alles zu verkaufen oder wieder in ein normales Motel umzuwandeln. Jake tat, was er konnte, und sorgte für Schutz, aber Mo ist immer das Herz des Ganzen gewesen. Ohne sie wäre das Ruby längst im Chaos versunken.
Die Rubys gehören zum McKenna-Clan. Wenn ein Mann sich mit ihnen oder ihren Kindern anlegt, bekommt er es mit mir und Mo zu tun und letzten Endes mit Duke. Wobei ich nicht garantieren kann, dass für Duke noch was zu tun bleibt.
Das Ruby gehört jetzt Mo und mir. Wir sind Partnerinnen. Einen Tag nach Antritt meines Erbes habe ich Mo fünfzig Prozent des Grundbesitzes und der Gebäude überschrieben und verfügt, dass sie alles bekommt, falls mir was passiert.
Ich werde nie so gut sein wie Momma, über die die Frauen im County hinter vorgehaltener Hand immer noch ehrfürchtig reden, und auch nicht so schlau wie Mo, aber ich tue, was ich kann. Mein Name verschafft allen hier Sicherheit. Ich sorge dafür, dass die Crystal-Userinnen clean bleiben und die Kinder alles kriegen, was sie brauchen.
Als ich vorfahre, tummeln sich Kinder in dem Pool, den ich vor ein paar Jahren habe anlegen lassen. Ich parke den Wagen, steige aus und öffne die Beifahrertür, damit Busy raus kann.
»Hundi!« Ein kleines Mädchen tapst eifrig auf Busy zu, dicht gefolgt von ihrer Mutter.
»Sitz, Busy«, sage ich leise. Busy gehorcht und wedelt mit dem Schwanz. Als Jackie die Arme um den Hundehals schlingt, leckt sie ihr das Gesicht ab. »Wie geht’s dir, Sam?«, frage ich ihre Mutter.
»Alles in Ordnung, Harley«, antwortet Sam. Ihr Arm steckt immer noch in einer Schlinge und auf den Gips haben die Kinder ihre Namen gemalt. »Die Jungs lieben den Pool.«
»Schön, dass ihr euch gut eingewöhnt.« Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie bei einer Hütte kurz jemand den Kopf aus der Tür streckt, um ihn gleich wieder zurückzuziehen und die Tür zu schließen. Ich runzle die Stirn. Dort wohnt Jessa.
»Hast du Jessa die Tage mal gesehen?«, frage ich Sam.
»Die Frau in Nummer acht?«
Ich nicke.
»Nein, schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich glaub allerdings, sie arbeitet nachts.«
»Ja, stimmt. Ich muss mal nach ihr schauen. Meld dich, falls du irgendwas brauchst, okay?«
Ich will mich schon abwenden, doch da greift sie nach meiner Hand.
»Danke, Harley«, sagt sie. »Was du gemacht hast …«
»Schon in Ordnung«, unterbreche ich sie. »Ich tu einfach, was ich kann.«
»Du hast geschafft, dass er wegbleibt, und das …« In Sams Augen sammeln sich Tränen, aber sie weint nicht. Stattdessen nimmt sie Jackie auf den Arm und drückt sie fest an sich. Jackie protestiert quiekend und zappelnd, sie will lieber auf den Boden zu Busy. »Er ist noch nie weggeblieben«, erklärt Sam.
»Diesmal kommt er nicht wieder«, verspreche ich ihr. Und wenn doch, brenne ich seinen Pick-up nieder. Vielleicht sogar mit ihm drin. Das habe ich ihm angedroht, als er vor einem Monat mit Gewalt verhindern wollte, dass ich Sam und die Kinder aus dem Haus hole. »Du musst dir keine Sorgen mehr machen.«