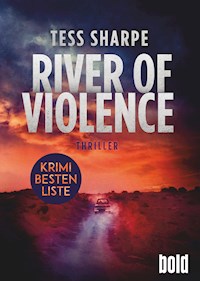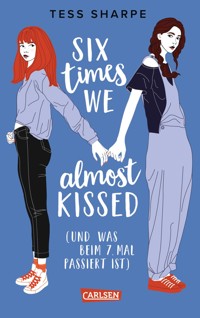
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine coole, queere Lovestory mit Twist von der Autorin von »The Girls I've Been«, mit Scharfblick, Wucht, Witz und Herz erzählt. Sechs Fun-Facts über PENNY und TATE: - Sie kennen sich schon ihr ganzes Leben - Ihre Mütter sind beste Freundinnen - Sie sind definitiv keine Freundinnen - Sie küssen sich immer wieder fast - Sie sprechen nicht darüber - Dank ihrer Mütter ziehen sie jetzt zusammen ...Als dann so ein Beinahe-Kuss zu »Ich weiß jetzt, wie dein Lipgloss schmeckt« wird, müssen Penny und Tate sich der Sache endlich stellen. Und auch ein paar anderen gut verpackten Geheimnissen. Oder? Komplexe Charaktere in einer smarten Story über Liebe und Trauer - voller Tiefe & Twists, so viel mehr als die übliche Romanze.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Ähnliche
Tess Sharpe
Six times we almost kissed (und was beim siebten Mal passiert ist)
Aus dem Englischen von Beate Schäfer
Zwei Mädchen. Sechs Momente. Ein epischer Kuss.
Sechs Fun-Facts über PENNY und TATE:
1. Sie kennen sich schon ihr ganzes Leben
2. Ihre Mütter sind beste Freundinnen
3. Sie sind definitiv keine Freundinnen
4. Sie küssen sich immer wieder fast
5. Sie sprechen nicht darüber
6. Dank ihrer Mütter ziehen sie jetzt zusammen …
Und plötzlich sind Penny und Tate gezwungen, sich dieser Sache zwischen ihnen endlich zu stellen. Und auch ein paar anderen gut verpackten Geheimnissen. Oder nicht?
Eine coole Lovestory mit Twist von der Autorin von »The Girls I’ve Been«
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Viten
1
21. Juni
Familientreffen heute Abend um sechs. Komm nicht zu spät!
Während ich die Nachricht anstarre, flitzt June an mir vorbei und bindet sich die Schürze um.
»Bist du mit allem fertig?«
»Yep«, antworte ich. »Ketchup ist auch überall nachgefüllt.«
»Stimmt was nicht mit dir?« Sie wirft mir einen Blick zu. Ich umklammere das Telefon viel zu fest und stiere immer noch auf Moms Nachricht.
Ich setze ein Lächeln auf. »Alles klar. Ich muss los. Bis später, okay?«
»Ciao, Penny.«
Ich bin kaum draußen, da kommt noch eine Nachricht: Holst du Tate vom Schwimmen ab? Anna ist hier bei mir, ihr gehts nicht so gut.
Mom hat es also ernst gemeint mit dem, was sie Familientreffen nennt. Dabei sind sie und Anna nicht mal Schwestern, auch wenn sie selbst behaupten, sie wären mehr als das. Beste Freundinnen für immer, egal was ihnen das Leben vor die Füße wirft. Verbunden auf eine Art, die tiefer geht als alle Blutsbande.
Ob Gran auch dabei ist? In meinem Kopf schwirren lauter Katastrophenszenarien, ich weiß nur nicht, welches diesmal passt. Ist Mom wieder durchgedreht? Gibt es Neuigkeiten über Annas Gesundheit? Das sind die beiden Dauerdramen, die unser Leben beherrschen … es sei denn, das soll eine Art Intervention werden, um mich auf Spur zu bringen. Aber so was brauche ich nicht. Ich habe nichts getan, auch wenn es Leute gibt, die meinen wandgroßen Kalender mit der Farbkodierung seltsam finden. Tate jedenfalls behauptet, er wäre total überzogen, aber das sagt sie über so ziemlich alles, was ich tue.
Wobei es nicht wirklich stimmt, wenn ich behaupte, ich hätte nichts getan. Es ist eine handfeste Lüge, und das, was ich getan habe, hat mir Mom ausdrücklich verboten. Aber wenn sie mir da draufkäme, hätte sie sich garantiert nicht so weit im Griff, dass sie erst ein Familientreffen ansetzt. Dann wäre sie gleich losgestürmt und hätte mich zusammengebrüllt.
Mein großes Ding kann es also nicht sein.
Braucht vielleicht Tate so was wie eine Intervention? Unmöglich. Tate macht nichts außer Bahnen schwimmen und die Augen verdrehen, wenn ich was sage. Tate ist die perfekte Tochter. Anna muss sich nie Sorgen um sie machen. Das sagt meine Mutter jedenfalls immer und klingt dabei ganz neidisch. Weil ich ihr ja so viel Ärger mache.
Obwohl es meistens auf eine Katastrophe rausläuft, wenn ich Tate länger als zehn Minuten im Auto habe, antworte ich Mom: Klar.
Sie schreibt nicht zurück. Gibt mir keine Infos mehr.
Das muss heißen, dass jemand stirbt, oder?
Nein. Verdammt. Reiß dich zusammen. Denk bloß nicht –
Es ist schon jemand gestorben.
Verdammte Scheiße.
Ob ich wohl irgendwann mal durch den Tag kommen werde ohne dass –
Werde ich nicht. Er war schließlich mein Vater.
Natürlich nicht.
Sie trägt seinen Ring um den Hals. Meine Mutter. Als sie ihn bekommen hat, hinterher, war er in zwei Teile gekappt, die mussten ihm das Ding vom Finger schneiden. Sie hat eine Hälfte quer durchs Wohnzimmer geschleudert, war total außer sich. Ich habe versucht, sie zu beruhigen, aber das ging nicht – ich konnte es jedenfalls nicht.
Anna dagegen schon. Sie hat meine Mutter fest in den Armen gehalten und mich mit Tate nach draußen geschickt. Mom wohnte zu der Zeit bei Anna und ich bei Gran. Anna hat die verlorene Hälfte gefunden und irgendwie dafür gesorgt, dass der Ring wieder zusammengesetzt wird. Jetzt, zwei Jahre später, ist Mom nie ohne ihn.
Ist was mit Anna? Mein Magen zieht sich zusammen, als ich in meinen Kombi steige und vom Parkplatz des Blackberry Diner fahre. Zurückzudenken an eine Zeit, in der Anna nicht krank war, ist fast unmöglich. Als Tate und ich noch Kinder waren, hatte sie Eierstockkrebs, aber seit ein paar Jahren ist sie krebsfrei. Aber dann ist letztes Jahr Alpha-1 bei ihr diagnostiziert worden, irgendwas Genetisches, das Lunge oder Leber angreift. Bei Anna hat es die Leber erwischt. Seitdem kommt meine Mom nicht mehr aus dem Fix-it-Modus raus.
Ich biege in die South Street ab, die vom Diner auf die andere Seite der Stadt führt.
Der Pool befindet sich in einem Siebzigerjahre-Betonbau, einem auf aggressive Art klotzigen Ding mit sonderbar abgeschrägtem Dach. Ein Überbleibsel aus der Zeit, in der es hieß, die Stadt würde wachsen, aber dann war auf einmal Schluss mit dem Holz-Boom. Drinnen ist ein Teil der Flutlichter schon abgeschaltet, das Becken schimmert im Dämmerlicht.
Tate ist noch voll dabei, die Schwimmuhr steht so, dass sie sie im Blick hat.
Ich schaue ihr einen Moment lang zu. Ich kann gar nicht anders. Wetten, niemand würde es schaffen, nicht fasziniert von der Art zu sein, wie Tate sich im Wasser bewegt. Nicht wie eine Meerjungfrau oder sonst irgendwas Mystisches – eher wie ein Hai, der durchs Wasser schießt. Als ob sie von Natur aus dort hingehört und ihr Ziel ganz genau kennt.
Sie ist allein im Becken. Im Sommer trainiert das Team nicht gemeinsam – jedenfalls schwimmen die anderen nicht mit Tate.
Sie ist sowieso immer die Letzte, die Schluss macht. Auch das weiß ich, genauso wie ich weiß, dass ich mich, wenn ich ihr beim Durchschneiden des Wassers zuschaue, danach immer ein paar Schritte lang fest auf meine Füße konzentrieren muss. Früher war sie deshalb die Letzte, weil sie einfach härter trainiert hat als alle anderen. Das tut sie immer noch, aber jetzt steckt mehr dahinter. Sie bleibt im Wasser, bis die anderen Mädchen weg sind, weil sie sich mit dem Rest des Teams nicht mehr versteht. Das ist meine Schuld, und auch wenn Tate wirkt, als wäre sie darüber hinweg, habe ich da meine Zweifel, denn ich bin es nicht, und ich kann mir kaum vorstellen, dass es bei ihr anders ist.
Sie hat mich noch nicht entdeckt, also gehe ich zu einem Stapel von Schwimmbrettern und anderem Trainingszubehör, schnappe mir eins von diesen gestreiften Teilen und werfe es ins Becken, ihren Kopf fest im Visier. Das Ding platscht direkt vor ihr ins Wasser – ich bin keine Star-Athletin, aber zielen kann ich schon – und sie schnellt mitten im Schwimmzug hoch.
Gelassen dreht sie sich in meine Richtung und nimmt nicht mal die Schwimmbrille ab, als sie mich erkennt.
»Im Ernst jetzt?«, fragt sie. Bevor ich antworten kann, hat sie das Ding schon geschnappt und pfeffert es mit einer solchen Präzision auf mich, dass ich nur knapp ausweichen kann.
Mir entfährt ein Kichern, ganz und gar unfreiwillig. Das weiß sie auch, ich sehe es an der Andeutung eines Lächelns in ihrem Gesicht, als sie zum Beckenrand schwimmt.
Sie hebt sich aus dem Wasser und ich gehe auf Abstand. Gleich wird sie sich schütteln wie ein Hund, das weiß ich, und ich will keine Tropfen abkriegen. Diese Szene haben wir als Kinder wer weiß wie oft durchgespielt. Tausende von Malen, denn wie es aussieht, kann ich nicht bei allem schlau sein. Schon gar nicht, wenn es um Tate geht.
Sie trägt zwei Wettkampfanzüge übereinander und dazu auch noch Dragshorts, die an einem Bein eingerissen sind. Während sie sich in ihr Handtuch hüllt, fragt sie: »Hat meine Mom dich geschickt?«
»Nein, meine. Guck mal auf dein Handy.«
Sie reißt Badekappe und Schwimmbrille runter, geht zu ihrer Tasche und zerrt ihren Parka heraus. Ich warte und frage mich, ob sie eine Textnachricht oder eine Voicemail bekommen hat. Dem Stirnrunzeln nach, mit dem sie auf den Screen schaut, ist es wohl eher ein Text.
Ob sie mehr Infos gekriegt hat als ich? Oder auch bloß dieses knappe »Familientreffen« – absichtlich vage und zugleich ein klares Vorzeichen, dass irgendwas richtig Schlimmes im Busch ist.
Ich versuche, die Antwort an ihrem Gesicht abzulesen, von dem ich nur das Profil sehe. Ihre Nase ist leicht nach oben gebogen und ihr französischer Zopf ganz zerzaust von der Badekappe, dem Wasser und dem Conditioner, den sie vor dem Schwimmen immer drauftut. Eigentlich muss sie jetzt erst noch duschen, um das Chlorwasser abzuspülen, aber als sie von ihrem Handy hochschaut, weiß ich, dass wir direkt nach Hause fahren.
»Lass uns gleich los«, sagt sie. Normalerweise würde ich mich beschweren, dass sie in ihrem Schwimmparka mein Auto volltropfen wird, aber jetzt nicke ich bloß.
Nachdem wir eingestiegen sind, starrt sie nur auf ihr Telefon. Dabei will ich so dringend mehr wissen. Ich muss mehr wissen, unbedingt, trotzdem fahre ich einfach weiter. Die Angst zwischen uns ist wie ein bedrohlich angespanntes Seil, an dem wir aus entgegengesetzten Richtungen zerren und das gleich reißen wird.
»Wann wird dein Pick-up repariert?«, frage ich, denn es darf jetzt um Gottes willen nichts zerreißen oder brechen. Katastrophen können wir nicht brauchen, wir haben mindestens zehn Minuten Fahrt durch die Stadt vor uns und dann noch mal zwanzig den Berg hoch bis zu mir nach Hause.
Schweigen. Ich trommele mit den Fingern aufs Lenkrad und warte, denn Tate wägt ihre Worte manchmal so wie Weinliebhaber edle Tropfen verkosten – bevor sie bereit sind für den ersten Schluck, müssen sie erst genüsslich schwenken und schnüffeln.
Und genau so läuft es. Ich bin schon auf der Ausfallstraße, als sie endlich antwortet: »Gar nicht.«
Ich schaue kurz zu ihr rüber. »Was soll das heißen?«
Sie blickt eisern geradeaus, während sie sagt: »Ich hab ihn verkauft.«
»Was?« Sie liebt diesen Pick-up. Es ist eine Schrottkarre, aber sie pflegt ihn hingebungsvoll. Wachst ihn ein, nimmt diese speziellen Mikrofasertücher und so.
»Aber erzähl das nicht meiner Mom, okay?«
»Tate.« Ich kann sie nicht anstarren, auch wenn mir danach ist. Ich möchte in ihrem Gesicht nach einer Antwort suchen, denn auch wenn sie fast nie etwas laut ausspricht, zeigt sich ab und zu etwas in ihrer Miene …
Manchmal kann sie sich nicht unter Wasser verstecken.
Sie zuckt mit den Achseln. »Die Kreditkarte war am Limit. Ohne Strom sein geht nicht. Lebensmittel und Medikamente müssen auch irgendwie bezahlt sein, und außerdem … Ich habs hingekriegt, okay?«
Mir bleibt die Spucke weg, als ich realisiere, wie schlimm es steht. Das Geld war schon immer knapp, kein Wunder bei den Arztkosten. Aber wenn es dermaßen eng ist, dass Tate hinter dem Rücken ihrer Mutter den Pick-up verkaufen muss …
»Das kriegt sie doch mit, wenn der Wagen weg ist.«
»Sie glaubt, er wäre in der Werkstatt. Mach dir keine Sorgen.«
»Ich –« Ganz ehrlich: Tate könnte genauso gut sagen, ich soll nicht atmen. Sorgen machen, das ist mein Ding, ich kann nicht anders. »Na gut. Aber falls es bei dem Treffen darum geht, dann bild dir nicht ein, dass ich auf deiner Seite wäre.«
Sie verdreht die Augen. »Da gibt es keine Seiten, Penny. Ich versuch nur, alles am Laufen zu halten. Ich dachte, du würdest das verstehen. Du hast es doch genauso gemacht, als –«
Meine Zunge schnalzt gegen die Zähne, ein Warnlaut, der in mir widerhallt, während Wut und Schmerz in meiner Brust aufblitzen. »Stopp.«
Tate scheint sich nicht mal zu schämen, sie sieht mich nur herausfordernd an. »Dann nerv nicht rum, nur weil ich es schaffen will, diese verdammten Rechnungen zu zahlen.«
»Du hättest dir Hilfe suchen können, bevor du deinen Pick-up verkaufst und Mom und Anna zwingst, mit diesem Treffen hier ein Riesending draus zu machen!«
»Darum geht es heute nicht. Wenn Mom rausbekäme, dass ich den Pick-up verkauft habe, würde sie mit mir reden und nicht irgendein Treffen einberufen.«
Ich stürze mich regelrecht auf ihre Worte. »Du weißt also, worum es geht?« Sie macht ein Geräusch – ihre Version eines Lachens, die eher ein Schnauben ist und ihre Lippen und Augen nie ganz erreicht. Ihr Lächeln tut das schon, manchmal jedenfalls. Selten. Du musst es dir verdienen.
»Herr im Himmel«, sagt sie einigermaßen angewidert und liest von ihrem Handy ab: »Hallo, Süße. Familientreffen bei Lottie heute Abend! Penny holt dich ab.« Dann fügt sie hinzu: »Willst du anhalten und die Nachricht selbst lesen, damit du sicher sein kannst, dass ich nicht lüge?«
Jetzt schweige ich. Vielleicht ist es das, was sie wollte, den Rest der Fahrt über sind wir jedenfalls still. Als ich schließlich auf das Schottersträßchen einbiege, das zu unserem Haus führt, atmet sie erleichtert aus, und ich tue, als hätte ich das nicht gehört. In der Küche brennt Licht, das sehe ich, als ich das Vorhängeschloss am Viehgatter aufsperre. Ich habe das Ding auf einem County-Flohmarkt gekauft, um das ursprüngliche Gatter zu ersetzen, das Mom in dem schlimmen Jahr umgefahren hat. Miss Frisbee muss das Preisschild mit den dreißig Dollar extra für mich drangehängt haben, weil ich ihr so leidgetan habe, da bin ich mir fast sicher.
Ich hasse es, dass Tate mich an diese Zeit erinnert hat. Ich hasse es, dass Mom beschlossen hat, in ihrer Nachricht kryptisch zu sein statt klar. Uneindeutiges kann ich nicht ausstehen. Zehn-Punkte-Pläne mit drei verschiedenen Exit-Strategien sind mir lieber.
Der Wagen steht noch nicht richtig, da springt Tate schon raus. Auch etwas, das ich hasse. Ungeduld, dein Name ist Tate.
Bis das Gatter wieder abgeschlossen ist und ich sie einhole, ist sie schon fast auf der Veranda.
»Wir brauchen eine Strategie«, zische ich. »Was machen wir, wenn die wirklich eine Intervention vorhaben?«
»Weswegen denn? Oder hast du ein Problem ausgebrütet, von dem ich nichts weiß? Falls du deinen Kleiderschrank bis oben hin mit Permanentmarkern vollgestopft hast, was ja schon immer dein Traum war, bin ich jedenfalls auf der Seite von Lottie und Mom. Kein Büromaterial mehr für dich. Dieser Riesenkalender und das Bullet Journal des Grauens sind schon schlimm genug.«
»Mein Kalender ist nützlich!«
»Das Ding verdeckt eine komplette Wand in deinem Zimmer! Wozu brauchst du überhaupt einen Kalender, wenn du ein Bullet Journal hast?«
»Nicht mal wenn ich tot bin, trennt mich irgendwer von meinem Journal.«
»Aha.«
Ich will mit dem Fuß aufstampfen. Das macht sie immer: Fußaufstampf-Gefühle in mir auslösen. Wie ein Kind, das gleich einen Wutanfall kriegt, weil der Frust einfach zu viel ist.
Aber dann schaue ich sie an und da ist es – in ihrem Blick, denn nur selten erreicht es ihre Lippen: ihr Lächeln.
»Bist du etwa nur so ein Miststück, weil du mich ablenken willst?«, frage ich.
Um ihre Augen bilden sich kaum wahrnehmbare Fältchen. Oh mein Gott! Warum tut sie mir das an?
Und warum falle ich immer wieder darauf rein?
»Wir müssen jetzt ins Haus«, sagt sie, sonst nichts.
»Warte.« Meine Hände scheinen mehr zu wissen als mein Kopf, jedenfalls packe ich sie am Handgelenk. Ihr Schwimmparka hat ein Fleecefutter, also ist ihre Haut schon wieder warm – und dann ist da dieser lange Moment, in dem Sekunden, vielleicht sogar Minuten bedeutungslos werden, während sie erst den Blick auf meine Finger an ihrem Handgelenk senkt und mich dann ansieht … und trotzdem halte ich sie weiter fest.
Es ist immer so schwer, mich von ihr zurückzuziehen.
»Aber wenn es nicht um den Pick-up geht …«, bringe ich heraus. »Dann … was, wenn es richtig schlimm ist, Tate?«
Sie windet sich aus meinem Griff, schlingt ihre Finger um meine und drückt sie sanft. Erst als sie loslässt, springt die Zeit wieder um in die Realität.
»Dann ist es schlimm«, sagt sie schlicht.
Sie geht zur Haustür. Diesmal halte ich sie nicht auf, sondern gehe einfach hinter ihr her.
3
21. Juni
T: Bist du eben über diese verdammte Wiese gejagt wie ein Reh, das vor mir wegläuft?
T: Was zur Hölle soll das, Penny?
T: Dein Laufstil ist übrigens immer noch beschissen. Ich hätte dich locker einholen können.
T: Ich dachte, nach Yreka …
T: Ich dachte …
T: Scheiße.
22.00 Uhr:
T: Reden wir da irgendwann doch noch mal drüber?
4
DAS ERSTE MAL, IM HEUSCHOBER
Vor zweieinhalb Jahren
Als wir uns zum ersten Mal beinahe küssen, habe ich ziemlich viel getrunken. Kein wirklich überzeugender Auftakt, ich weiß – das wirft kein gutes Licht auf mich und mein erstes Halbjahr in der Highschool, und auch nicht auf die Geschichte vom ersten (und definitiv nicht letzten) Mal, als ich beinahe Penelope Conner geküsst hätte. Aber machen wir einfach weiter.
Eine Welt ohne Penny hat es für mich nie gegeben. Sie ist zwei Monate älter als ich, also war sie vor mir da. Als wir klein waren, hat sie mir das dauernd unter die Nase gerieben. Und weil Lottie und Mom eben Lottie-und-Mom sind, habe ich mein ganzes Leben in Pennys Umlaufbahn verbracht, das ging gar nicht anders.
Penny kann das: Leute an sich binden. Sie ist wie ein Magnet. Wie diese verdammte Stadt – immer wenn du denkst, du hättest dich von ihr befreit, holt sie dich wieder zurück. So habe ich es bis jetzt nicht geschafft, mich auf Dauer von ihr zu befreien – genauso wenig wie von Penny.
Mit sieben habe ich beschlossen, dass sie mich nervt. Mit neun hätte ich sie gern gehasst, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Mit elf hätte ich mich mit ihr geprügelt, wenn Marion nicht dazwischengegangen wäre. Als wir zwölf waren, hatten wir endgültig die Nase voll von den penetranten Versuchen unserer Mütter, uns zu Freundinnen zu machen. Dann wurden wir dreizehn, kamen in die Highschool und gingen getrennte Wege. Ich bin jeden Morgen um fünf Uhr zum Schwimmtraining aufgestanden, sie hat ihre Leidenschaft fürs Farbkodieren entdeckt und mit dem Zeug, das sie in der Schülermitverwaltung veranstaltet hat, die Schulleitung in den Wahnsinn getrieben.
Was uns zurück zum Beginn der Highschoolzeit bringt und zu dieser Party. Und damit zu dem Moment, der für mich alles verändert hat, aber für sie eindeutig nicht. (Sie ist nicht die Einzige, die gern den Überblick behält. Nur tue ich das eben in meinem Kopf statt in Kalenderform an der Wand.)
Es ist die Party von einer aus dem Schwimmteam, die schon in der Abschlussklasse ist. Ihre Eltern sind verreist und sie kennt da so einen Typen, also gibt es jede Menge Bier und jemand hat Lichterketten an die Deckenbalken der Scheune gehängt. Es riecht nach Heu, der Geruch ist stärker als der von Marihuana, Motoröl und Schweiß.
Der Wechsel vom Schwimmclub zum Schulteam ist ein Balanceakt für mich, an den Wochenenden schwimme ich nämlich weiter für den Club, und jeder weiß, dass die Schultrainerin das nur akzeptiert, weil ich jetzt schon schneller bin als alle anderen im Team. Nicht nur die aus meiner Klassenstufe, sondern auch fast alle Älteren.
Ich bin nicht olympiareif oder so. Aber für ein College-Stipendium könnte es reichen, und das ist meine einzige Chance, diese Stadt jemals hinter mir zu lassen, also konzentriere ich mich ganz darauf. Mir ist jetzt schon klar, dass es ziemlich viel gibt, was für mich außer Reichweite ist. Manche Mädchen kriegen manche Sachen einfach nicht. Und ich gehöre definitiv zu dieser Sorte.
Ich bin also auf dieser Party. Nach zwei Bier bin ich einigermaßen beduselt, weil ich nichts gegessen habe, außerdem ist das noch das Alter, bevor alle kapiert haben, dass Sich-Volllaufen-Lassen eher langweilig ist und das Schwimmen am Morgen danach zur Hölle macht … und ich möchte furchtbar dringend zum Team passen und dazugehören. Da weiß ich noch nicht, dass auch Dazugehören für mich immer außer Reichweite sein wird.
Die Mädels sind laut, genau wie die Musik aus den Boxen, die irgendwer angeschlossen hat. Anfangs bemerke ich Penny gar nicht, vor allem weil mich mein Freund Remington immer neu mit Bier versorgt und mich dann dazu bringt, literweise Wasser hinterherzukippen – ich soll bloß nicht dehydrieren, zischt er mir zu. So ist Remi eben; er macht sich fast so viele Sorgen wie Penny.
Später schaue ich aus den Augenwinkeln immer wieder rüber zu Penny, die den ganzen Abend mit Jayden abhängt. Ich gebe mir wirklich Mühe, die beiden nicht weiter zu beachten, aber wenn ein betrunkener Kerl auf einmal in voller Lautstärke brüllt: Ich glotz jeden Busen an, den ich will, ist es unmöglich, das nicht mitzubekommen.
Jayden Thomas ist ein Arsch. Jemand, der allen Mädchen ganz ungeniert auf die Brüste starrt.
Weinend läuft Penny von ihm weg, so schnell, dass da nur ein Vorbeihuschen von braunem Haar und pastellfarbenem Chiffon zu sehen ist, dann ruft Remi meinen Namen, aber ich höre nicht hin.
Ich habe ein Problem damit, auf Leute zu hören.
Stattdessen folge ich Penny. Raus aus der Scheune und zu dem Heuschober, in dem sie sich versteckt. Drinnen gibt es kaum Licht und der Geruch erinnert mich an die Gartenarbeit mit Marion.
Als ich ankomme, hat sie sich aus Heuballen einen kleinen Sitz gebaut und dazu auch noch eine Art Fußstütze.
»Machst du als Nächstes eine richtige Burg?«, frage ich.
Mein Herz hüpft, als sie sagt: »Lass mich in Frieden, Tate«, ohne sich überhaupt nach mir umzudrehen.
»Ich will nach dir schauen.«
»Alles okay mit mir.« Sie schnieft. »Geh wieder rüber.«
Sie legt die Füße auf den Heuballen und verschränkt die Arme. Ich könnte wirklich gehen, sollte gehen … Eine andere, weniger betrunkene Version von mir hätte das wahrscheinlich getan. Aber in meinem Suff finde ich, dass sie gedemütigt und traurig wirkt, also habe ich gar keine andere Wahl, als ihre Füße zur Seite zu schieben und mich auf dem Heuballen vor ihr niederzulassen, direkt ihr gegenüber.
Ihre Wimperntusche ist nicht verschmiert, was ich als gutes Zeichen nehme – dann hat sie wohl nicht allzu viele Tränen vergossen. Und das heißt hoffentlich, sie hängt nicht so an ihm, dass er sie besudeln kann.
»Jayden ist ein Volldepp.«
»Ich liebe ihn«, gibt sie zurück, und ich kann den Mund nicht halten, sondern widerspreche, noch bevor sie den Satz ganz ausgesprochen hat.
»Tust du nicht, Penny. Das ist unmöglich.«
Sie guckt mich böse an. »Muss ich aber.«
»Wer sagt das denn?«, frage ich ungläubig. »Stammt das von ihm?«
»Nein«, meint sie und schnieft. »Das gehört zu meinem Plan.«
»Was für einem Plan?« Ich habe eine dunkle Vorahnung, denn sie hat es schon öfter zu weit getrieben mit ihren Plänen. So wie damals, als wir in der Grundschule waren und sie beschlossen hat, eine Woche lang nur von dem zu leben, was das Land ihr gibt, weil sie ein Buch wirklich verstehen wollte, das wir im Unterricht durchgenommen hatten. An das Buch kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, wie die neunjährige Penny tagelang mit einer Axt im Wald rumgerannt ist und sich nur von Brombeeren und den Fischen ernährt hat, die sie mit einem selbstgeflochtenen Netz aus Ranken fangen konnte.
»Meinem Highschool-Plan«, sagt sie.
Natürlich hat sie einen Plan. Wahrscheinlich umfasst er etliche farbcodierte Teile und sie hat sich dafür extra einen Bauplan der Schule besorgt. Und wie es aussieht, gehört auch Jayden Thomas dazu. Die Vorstellung macht mich fertig, etwas sticht in mir, ich sehe rot und kann mich nicht mehr beherrschen. Und so poltere ich, ohne nachzudenken, einfach los.
»Dein Highschool-Plan beinhaltet einen Typen, der weder vor dir noch vor anderen Frauen genug Respekt hat, um ihre Brüste nicht zu begaffen? Also ehrlich, Penny. Brüste sind wunderbar, klar. Ich mag sie auch sehr, aber ich glotz doch nicht die von irgendwem an!«
»Gott, der ist so ein Arschloch«, stöhnt sie mit den Händen vorm Gesicht. »Und dazu küsst er auch noch total schlecht. Was hab ich mir da bloß gedacht?«
Ich bin so erleichtert, dass dieser Depp ihr nicht das Herz gebrochen hat, dass ich erst kapiere, was mir da rausgerutscht ist, als ihr Kopf hochschießt und sie mich anstarrt.
»Moment mal. Was hast du da eben über Brüste gesagt?«
»Was?« Mein Herz donnert unter meinen Rippen.
»Du hast gesagt …« So intensiv, wie sie mich beäugt, wird mir auf einmal klar, dass Weglaufen wirklich was für sich hat.
Denn mit meinem halb betrunkenen Gerede über Brüste habe ich mich Penelope Conner gegenüber geoutet.
»Bist du …« Sie unterbricht sich, will mir die Möglichkeit geben, mein versehentliches Coming-out ungeschehen zu machen. Das finde ich so süß von ihr – und so großzügig –, dass ich nur mit den Achseln zucke und den Satz beende.
»Ja. Ich bin bi.«
Sie neigt den Kopf. In ihren Augen blitzt Neugier auf. »Okay, das klärt ein paar Fragen, die ich in der siebten Klasse über Mandy Adams und dich hatte.«
Ich schubse Heu auf sie. »Halt die Klappe. Mandy und ich haben nie irgendwas –«
Sie grinst, ihre Tränen sind restlos getrocknet.
»Haben wir nicht«, beharre ich.
»Hättest du aber besser mal, bevor sie weggezogen ist. Mandy war wirklich hübsch. Aber wohl mehr mein Typ als deiner.«
Und auf einmal bin ich diejenige, die starrt.
Sie hat alles auf den Kopf gestellt, einfach so. Noch vor fünf Sekunden hätte ich behauptet, ich wüsste alles, was es über Penny zu wissen gibt. Ich habe – oder hatte? – sie im Griff, von der Persönlichkeit her, meine ich.
Aber das hier … tja, das ist wirklich unerwartet.
»Penny, wie viel hast du getrunken?«
»Und du, wie viel hast du getrunken?«, schießt sie zurück. Ihr Grinsen vertieft sich, und durch die Schatten der Dachsparren sieht ihr Gesicht auf einmal fast wild aus.
Mit Penny ist es nämlich so: Oberflächlich betrachtet ist sie superkorrekt und klassensprecherinnenhaft, aber wenn du genauer hinschaust, hat sie sich eben nicht nur eine Woche lang mit einer Axt im Wald rumgetrieben, sondern auch noch jede Sekunde davon genossen.
»Du bist nicht die Einzige, die Geheimnisse hat«, flötet sie.
»Na ja, deinen großen Plan hast du ja schon verraten.«
»Jayden war nur ein Teil.« Sie wedelt die Erinnerung an ihn weg wie eine Fliege.
»Und wie viele Teile gibt es?«
»Fünfzehn.«
»Du hast einen Plan mit fünfzehn Teilen für deine Highschool-Zeit gemacht?«
»Der gehört zu meinem Fünfunddreißig-Schritte-Plan fürs Leben.«
Sie hat zu viel getrunken, viel zu viel, sonst würde sie nie so offen mit mir reden. Und ich habe auch viel zu viel getrunken, sonst würde ich nicht hier sitzen und mich an Pennys Worte klammern, als wäre sie eine Felsklippe, von der ich abgestürzt bin. Aber ich lasse nicht los, sondern halte mich fest.
»Das sind ziemlich viele Schritte.«
»Wie viele hätte dein Plan denn?«
»Mein Lebensplan besteht aus einem einzigen Schritt: Ich will weg aus dieser Stadt.«
Sie lacht. Ich sollte nicht darauf schauen, wie das Licht auf ihre Lippen fällt, tue es aber.
In diesem Heuschober kommen mir so viele schlechte Ideen. So viele neue Ideen. Dabei sind sie vielleicht gar nicht neu, sondern waren vorher nur verschwommen. Jetzt ist mein Blick wie ein beschlagener Spiegel, der auf einmal blank gewischt worden ist, und zum ersten Mal sehe ich sie wirklich klar: Penny, in ihrer ganzen Schärfe. Eher ein gebogener Dorn als ein Mädchen, etwas, das sich in dir verhaken und nicht mehr von dir lassen will.
Wie das gehen soll, weiß keine von uns.
»Du hast schon immer weggewollt.« Sie macht sich lang auf ihrem Thron aus Heu und ich bin froh, dass das Licht hier so schlecht ist, denn schon bevor ihr Top hochrutscht, laufe ich rot an. Da ist nur ein winziger Streifen Haut, kaum sichtbar, ein bisschen blasser als ihre Haut sonst, und ich begreife nicht, warum er auf einmal alles verändert. Warum er so viel mehr bedeutet als die Haut an ihrem Arm oder ihrem Hals, dieser Streifen über der Jeans, der so weich aussieht.
Dabei ist sie gar nicht weich. Daran muss ich mich extra erinnern. Sie mag weich wirken, aber sie ist das Mädchen im Wald mit der Axt. Das Mädchen, das alle Hausaufgaben schon unter der Woche macht, damit sie am Wochenende freihat, um mit ihrem Vater auf den Fluss zu gehen.
Das Mädchen, das sogar Stromschnellen mit links fährt, bei denen sich erfahrene Rafter vor Angst in die Hose machen.
Wenn ich im Wasser gut bin, ist Penny ein Genie auf dem Wasser.
Sie ist so furchtlos, dass es einem Angst machen kann – ein todesmutiger Adrenalin-Junkie, und ihr Dad treibt sie immer weiter an. Als ich das letzte Mal mit den beiden auf dem Wasser war, habe ich gedacht, ich muss jeden Moment sterben.
»Willst du denn nicht hier weg?«, frage ich, zu ehrlich und zu neugierig, um mich zurückzuhalten.
»Für mich ist die Gegend hier jedenfalls kein Käfig.« Sie dreht den Kopf zur offenen Seite des Heuschobers, wo der Horizont zu sehen ist – nichts als Kiefern und Vulkangestein, und in meinem Magen macht sich ein Gefühl breit, das ich nicht gut genug kenne, um es zu benennen. »Diese Berge … dieser Fluss … ich könnte mein Leben damit zubringen, das alles immer besser kennenzulernen, und es bliebe immer noch so viel Unbekanntes übrig.«
»Von hier weggehen muss doch einer von diesen fünfunddreißig Schritten in deinem Plan sein«, stelle ich fest.
»Ach, wirklich?« Sie zieht eine Augenbraue hoch und ich habe es wieder mal geschafft – ohne es zu wollen, habe ich sie verärgert, weil wir schon immer aneinander scheuern und schleifen wie Metallteile, die ein schlechter Mechaniker zusammengeflickt hat.
»Du willst also für immer hier bleiben?«
»Ich hasse diesen Ort jedenfalls nicht so wie du.«
»Tu ich doch gar nicht.«
»Tust du doch.«
Stille. Denn mit dem Hassen hat sie ja teilweise recht, und das mit dem Käfig stimmt hundertprozentig. Auch was sie über sich selbst gesagt hat, stimmt, sie könnte wirklich ihr Leben hier in den Wäldern verbringen, mit ihrer verdammten Axt, und würde nie aufhören, Neues zu entdecken. Das sehe ich so deutlich vor mir, wie ich sie auf einmal ganz deutlich sehe.
Ich weiß nicht, warum mir das so viel ausmacht: diese Vorstellung, dass sie einfach hier bleiben könnte.
(Oder ist es vielleicht eher die Vorstellung, sie zurückzulassen? Egal wie nervig Penny sein mag, hassen konnte ich sie nie. Und auch wenn es oft knallt zwischen uns und wir grundverschieden sind – ich weiß, wo sie herkommt. Wir haben uns wirklich ins Zeug gelegt, um die von unseren Müttern zusammengeflochtenen Fäden unseres Lebens wieder auseinanderzukriegen, aber je mehr wir es versucht haben, desto klarer ist mir geworden, dass das kaum möglich sein wird.)
Sie schnaubt. »Immerhin sagst du nicht, ich wäre zu intelligent, um hier zu versauern.«
»Du bist auch ziemlich nett zu mir« antworte ich, woraufhin sie mich verwundert anschaut. »Du verkneifst dir zu sagen, dass ich sowieso nie von hier wegkommen werde.«
Penny runzelt die Stirn. Sie hat krasse Augenbrauen – dichte dunkle Härchen auf gebräunter, sommersprossiger Haut –, und wenn die sich zusammenziehen, während sie dich anstarrt, ist das echt intensiv. »Das würde ich niemals sagen«, meint sie. »Auch wenn es bestimmt schwer wird, aber das ist ja deine Spezialität, oder?«
Sie beugt sich vor, stützt die Ellbogen auf die Oberschenkel, ihre Füße sind jetzt dicht an meinen, wir berühren uns fast. Der Lack auf ihren Zehennägeln ist grün. Vielleicht auch blau, so genau kann ich das nicht sehen. Jedenfalls will ich mir diesen Moment plötzlich unbedingt einprägen, jedes kleinste Detail im Sinn behalten.
Sie ist so nah. (Zu nah? Nicht nah genug? Ich kann mich nicht entscheiden.) Ihre Knie streifen mein Bein und mir bleibt die Luft weg, während sie mir geradewegs in die Augen schaut und sagt: »Wenn es irgendwer schafft, dann du.«
»Penny.« Ich weiß in dem Moment nichts als ihren Namen. Und sehe nichts als sie.
Ich hätte nie einen Fuß in diesen Heuschober setzen dürfen.
»Egal ob du das selbst glaubst oder nicht, ich bin mir da sicher«, sagt sie. Wenn sie das mit Trara und großer Geste verkünden würde, würde ich es vielleicht als betrunkenes Gerede abtun.
Aber es ist eine schlichte Feststellung, kein Hauch von Getue.
Da sind ihre Hände, die meine Handgelenke umfassen und drücken, während sie das sagt. Da ist ihre Aufmerksamkeit, ihre volle Konzentration auf mich, die Sicherheit in ihren Augen, und als sie nicht loslässt, geht ein Ruck durch meinen Körper – wie ein holpriges Anspringen von lauter Teilen, die bis jetzt nie in Gebrauch waren und auf einmal zitternd zum Leben erwachen.
Ich ziehe meine Hände zurück, in der Erwartung, dass sie mich dann loslässt.
Tut sie aber nicht, sondern lässt sich näher heranziehen.
(Ich weiß nicht, was ich tun soll. / Ich weiß, was ich gern täte.)
(Ich weiß nicht, wie ich das kriegen kann / ob ich es versuchen soll.)
(Ist es besser, mich nicht zu rühren?)
»Deine Wimpern sind so lang«, sagt sie, und ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Herzrasen klarkommen soll, das mich überfällt, als sie fortfährt: »Das habe ich bis jetzt nie bemerkt.«
»Sind doch bloß Wimpern.« Ist das meine Stimme? Keine Ahnung. Mein Herz schlägt viel zu schnell. Meine Haut glüht. Berührt ihre.
(Nicht nah genug, beschließe ich.)
»Aber schön.« Als müsste sie das extra beweisen, lässt sie mich los und fährt, noch bevor ich mich erholen kann, mit dem Finger über mein Gesicht, streicht unter dem Bogen meiner Augenbraue entlang bis zum Augenwinkel, eine Berührung, die mich vergessen lässt, wie blinzeln geht, wie bewegen oder überhaupt irgendwas tun geht.
»Du bist wirklich hübsch.«
Mir wird kalt, mein ganzer Körper ist unter Schock. Ich ziehe mich nicht zurück, weiß aber jetzt, dass ich das tun muss.
»Du hast zu viel getrunken.«
Jetzt grinst sie wieder. Oh Gott. Ihre Finger streichen über meine Wange – wenn sie noch ein bisschen tiefer wandern, umschließen sie mein Gesicht.
»Ein halbes Bier, und das schon vor zwei Stunden. Glaubst du wirklich, ich müsste betrunken sein, um dich hübsch zu finden?«
»Ich …«
»Das warst du nämlich schon immer.«
Jetzt umfasst sie wirklich mein Gesicht. Vor Sehnsucht, ganz in diesem Gefühl aufzugehen, kann ich nicht mal mehr schlucken.
(Sie ist so nah. Ihre Hände sind nicht weich, sie hat Schwielen vom Raften, ihre raue Haut schabt über mein Gesicht, und das ist … es ist … Es ist, als würde sich mir zum ersten Mal überhaupt jemand zärtlich zuwenden.)
Ich sage ihren Namen. Damit sie aufhört? Oder damit sie weitermacht? Nicht mal mir selbst gegenüber bin ich ehrlich genug, um zuzugeben, was von beidem ich will.
(So nah.)
Dann ruft von draußen vor dem Schober eine andere Person Pennys Namen und wir lösen uns mit einem Ruck voneinander – so schnell, dass mir schwindlig wird.
»Penny? Bist du da drin?«
Eine Sekunde später kommt Meghan reingerannt, ihre beste Freundin.
»Da bist du ja! Ich hab dich überall – ach, hallo Tate. Hast du Penny Gesellschaft geleistet?«
Ich setze ein Lächeln auf. »Ich hab bloß gewartet, dass du sie findest«, sage ich und stehe auf.
»Bist du okay?«, fragt Meghan Penny, aber die starrt nur mich an, als wäre ich eine besonders knifflige Wildwasserstelle, von der sie noch nicht weiß, wie sie durchkommt, und ich will hier weg, aber wie kann ich das, wenn sie mich anschaut, als wäre nichts auf der Welt faszinierender als ich? »Du siehst furchtbar aus. Wir müssen dich wieder in Ordnung bringen, bevor wir nach Hause fahren. Komm schon.«
»Mir gehts gut«, sagt Penny und lässt sich von Meghan wegzerren. Aber dabei dreht sie sich noch mal zurück zu mir, die Brauen wieder zu einem dunklen Strich zusammengekniffen, als wäre sie wild entschlossen, herauszufinden, was zur Hölle da eben passiert ist. Oder nicht-aber-doch-fast-passiert ist.
Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde. Oder ob es die Wahrheit ist.
Jedenfalls versucht sie später nie mehr, es herauszufinden. Vielleicht, weil ihr dafür einfach keine Zeit mehr bleibt? Denn diese Penny – die mit dem Plan in fünfunddreißig Schritten, die wegen eines Jungen geweint hat, der mies zu ihr war, und in einem Heuschober mein Gesicht gestreichelt hat?